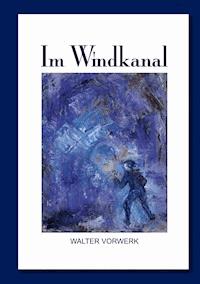
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Das Schnelllebigste ist die Zeit. Man kann sie nicht anhalten. Darin liegt die Gefahr, dass vieles vergessen wird, was wichtig erscheinen mag. Ich musste mich beeilen, dieses Buch zu schreiben, weil auch ich dieser Zeitmaschine ausgesetzt bin. Als Journalist, der in der DDR aufgewachsen ist, gehöre ich zu jener Generation im Osten, die man auch "Testgeneration" nennen kann - daher der Titel des Buches Im Windkanal. Seit der einseitigen Wendezeit beschäftigt mich der missliche Umstand, dass Leute verschiedener Couleur, die die DDR gar nicht erlebt haben, glauben, "unsere Vergangenheit bewältigen" zu können oder zu müssen. Hier schreibt ein "Ossi" gegen das Vergessen aus seiner ganz persönlichen Erlebniswelt heraus. Vielleicht hilft das Buch, nachdenklich zu werden - über sich selbst - das wäre mein Ziel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 689
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieses Buch widme ich meiner lieben Mutter (1896 – 1974),
meinen beiden Söhnen
Steffen (1966 – 1998) und Sebastian (1973),
meiner lieben Frau Sabine und all den guten Menschen,
die mich nachhaltig geprägt haben
Inhaltsverzeichnis
Zum Geleit
Schlesien 1939 – 1945
Die Mutter
Der Vater
Kindheitsepisoden
Flucht in die Ungewissheit
Oberlausitz 1945 – 1953
Das neue Leben
Fantasien unterm Dach
Die Schulzeit beginnt
… und vergib uns ihre Schuld
Himmelfahrtstag 1948
Dialog mit einem Stück Brot
Eva
Erste Schritte zur Selbstfindung
Neue Schulen 1953 – 1957
Auf dem Weg zur »Mittleren Reife«
Der neue Schritt
Erster Pressewind 1957 – 1958
Der junge Mann mit dem Lodenmantel
Der Student 1958-1962
Alma Mater Lipsiensis »Karl Marx«
Schwerin 1962-1965
Was wird aus mir
Die Heizsonne
Funkhaus Berlin 1965 -1970
Nun bin ich ein Berliner
Sänger & Darsteller 1970-1972
Die Bretter, die die DDR bedeuten
Zurück ins Funkhaus 1972-1975
Im »Jugendjournal«
Worüber man sich in Ungarn den Kopf zerbrach
Zu Gast bei Kollegen
Wo die Morgensonne den Oleviste kitzelt
Mit den »Augen des Freundes«
Kulturschatzkammer Armenien
Als Egon Krenz schockiert war
»Vergesst die tapferen Partisanen nicht!«
Ukraine 1975-1977
Leuchte, blaue Erdgasflamme …
Das Gastgeschenk
Wieder in Berlin 1978 – 1989
Diese Zeit braucht eine Wende
Vier Wochen an der Lomonossow-Universität Moskau
Zurück in die Ernüchterung
Der Nachlass
Für inneren und äußeren Frieden
Der Ruck in der DDR 1989-1991
Die Wende
Was ich noch sagen wollte …
Wir brauchen Differenzierungsvermögen im Blick auf die Realitäten
1.0. Der revolutionäre Prozess in der DDR
1.2. Die Ursachen für das Scheitern des Systems
1.3. Die derzeitige Lage
2.0. Die Medien und der revolutionäre Prozess
2.2. Die Medien während der Revolution
2.3. Die heutige Situation in der Medienlandschaft
Das Ende von zwei deutschen Staaten
»Entkommunistifizierung«
Das Haus mit dem roten »A«
Der aufrechte Gang aus der Erniedrigung
Licht ins Dunkel bringen
Engagement
Was dich nicht umhaut, macht dich stark 1992 – 1994
Wie weiter?
Neue Schritte wagen
Nicht aufgeben
1995 und danach…
Ich finde den Weg
Goldene Worte meiner Gesprächspartner
In hora ultima – Gedanken über Religion
Anhang
Zum Geleit
Ein Windkanal ist eine Testeinrichtung, in der Wind auf stehende Modelle von Flugzeugen, Bahnen oder Autos geblasen wird, um den Luftwiderstand, das aerodynamische Verhalten zu erforschen. Strömungen, Temperatur und Geschwindigkeit werden genau bestimmt … – so die Definition für ein technisches Labor. Und wie wird ein Mensch getestet? – Durch das Leben. Erst im fortschreitenden Alter ist mir bewusst geworden, wie viele Bausteine so ein Menschenleben eigentlich ausmachen. Es gibt nichts, was selbstverständlich wäre ... Ich bin kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges geboren und habe gesellschaftliche Variationen wahrgenommen, sie empfunden wie Wind, Hurrikan, Tornado, Tsunami … den Strömungen ausgesetzt. Und heute sehe ich all das so, als wäre meine Generation ein Versuchsobjekt gewesen. Wir sind getestet worden – wie ein Objekt im Windkanal. Und bei diesem Gedanken ist auch der Titel dieses Buches entstanden. Das geschah bereits Ende der 80er-Jahre, als ich die ersten Seiten verfasste. Ja, ich habe an diesem Buch sehr lange geschrieben, ab 2009 intensiver. Und das Ergebnis meiner Überlegungen? Scheitern und Erfolg stehen für die Formung eines Menschenlebens wie Yin und Yang, wie die kosmische Waage, die ein großes Geheimnis bleiben wird, oder wie das Programm, das jeder in sich trägt, ohne es zu kennen – zum Glück. Was hier an Erlebtem aufgezeichnet ist, sind enthüllte »Bauteilchen « – Episoden aus dem Leben eines Zeitzeugen. Da das Vergessen eines der typisch menschlichen Merkmale unserer rasanten Zeit ist, könnte mein Buch vielleicht dem einen oder anderen helfen, sich Gedanken zu machen – über sich selbst.
Walter Vorwerk
Berlin 2016
Schlesien 1939 – 1945
Die Mutter
Es war wie immer, wenn der Himmel seine gewaltigen Energien auf die Erde entlud. Der grelle Schein der Blitze und das ohrenbetäubende Krachen des Donners, der im crescendo und decrescendo über uns rollte, war stets etwas Unheimliches für uns Kinder. Unsere Mutter – »Muttl« sagten wir zu ihr – weckte uns in solchen Situationen. Wir wussten, was zu tun war. Schlaftrunken zogen wir unsere Sachen an, die immer geordnet neben unserem Bett lagen, und gingen die Treppe hinunter ins Wohnzimmer. Sie stand am Fenster und sah voller Entsetzen den glutroten Schein am Himmel. Es hat die Guhl-Mühle in Geibsdorf erwischt! Sie brannte lichterloh, der Blitz hatte eingeschlagen. Mutter tat das, was sie in schweren Situationen immer tat. Sie versammelte uns um den Tisch und sagte: Kommt, lasst uns beten! Sie sprach laut das Vaterunser. Dann waren wir mucksmäuschenstill und lauschten auf das Gewitter, das sich mehr und mehr verzog. Sie war keine orthodoxe Christin, ohnehin hatte sie es schwer in einem stockkatholischen, konservativen Nest, in dem die Hakenkreuzfahne neben dem Kruzifix in der Kirche stand. Mutter lebte ihre Seele, sie hörte auf ihre innere Stimme und ihre Wärme und Güte beruhigte die Gemüter. Gott hat sie offensichtlich zumeist erhört. Diesmal zog sie die Stirn in Falten: Die Guhl-Mühle – das verheißt nichts Gutes!, hörte ich sie zum Vater sagen … Der murmelte etwas in seinen Oberlippenbart, das ich nicht verstand. Von den Sorgen und Nöten der Eltern erfuhren wir Kinder erst viel später. Meine Erinnerungen sind bruchstückhaft, ich war ja auch noch zu klein, um alles zu verstehen, geschweige zu begreifen. Der Rest der Nazizeit reichte aber aus, um traumatisiert zu werden. Die wenigen Episoden waren für mich so intensiv und nachhaltig, dass ich heute davon noch tief berührt bin. Bei jeder Sirene zucke ich zusammen. Und es entstand mein Credo: Das Heiligste im Leben sind der innere und äußere Frieden und Wasser und Brot. Die Bedeutung meines Geburtsdatums hat Klang: Internationaler Frauentag. Davon war damals keine Rede. Geehrt wurde die »Deutsche Mutter« nur am Muttertag im Mai. Und vom Zweitgeborenen Johann Sebastian Bachs, Carl Philipp Emanuel, der auch an einem 8. März das Licht der Welt erblickte, hatte damals wohl keiner in der Familie je etwas gehört. Heute betrachte ich dieses Datum als ein gewisses Omen für meinen Werdegang. Als ich mich an jenem Mittwoch, dem 8. März 1939, anschickte, zur Welt zu kommen, hatte meine zweitälteste Schwester Johanna, die einmal Lehrerin werden sollte, in der Schule einen Vortrag über Heinrich I. zu halten. Es war ein so genannter »Jungmädel-Nachmittag«, die Themen wurden verteilt. Die Älteste, Elfriede, war bei Mutter zu Hause und hatte es nicht weit zur Schule, um ihrer Schwester zu sagen, dass sie nach Geibsdorf radeln müsse, die Hebamme zu holen – es sei soweit … Damals bekamen die Mütter ihre Kinder zumeist zu Hause, nur bei Komplikationen kam man in die Kreisklinik nach Lauban. Die Hebamme schnappte sich Johannas Fahrrad und strampelte nach Pfaffendorf, das heute Rudzica heißt (möglicherweise abgeleitet vom Wort »ruda«, das Erz, denn in der Nähe befinden sich Kupferminen), zwischen Görlitz/Zgorzelec und Lauban/Luban gelegen. Immerhin war meine Mutter bereits 43, als ich zur Welt kam … aber es waren ja noch fünf andere Geschwister vor mir. Meine Mutter erzählte mir einmal, dass mein Vater, als sie mit mir schwanger war, gesagt haben soll: Wenn das ein Junge wird, dann soll er ein Sänger werden! – eine programmatische Äußerung, denn von Kindheit an war mir das Singen eine Lust.
Das Häuschen mit der Nummer 33 in Pfaffendorf, einem typischen Bauerndorf, war klein und viel zu eng. Kirche, Schule, Dorfteich lagen dicht beieinander. Bald war wieder einmal ein Umzug fällig. Meine Eltern kannten diesen Trubel, sie haben vor meiner Geburt oft das Domizil wechseln müssen. Das hatte stets soziale Gründe, worauf ich noch zu sprechen komme, wenn später etwas über den Vater zu sagen ist. Das neue Zuhause war ein kleines Bauerngehöft mit Stallungen, Kleinvieh und Obstgehölzen. Meine Mutter hatte nun noch mehr, über das normale Maß hinausgehende Hausfrauenpflichten zu erfüllen. Sie war kräftig gebaut und arbeitete schwer. Das Wasser wurde mittels einer Schwengelpumpe aus einem Brunnen auf dem Hof gefördert – die vielen Wassereimer hatten ihr Gewicht. Dann waren die Hühner, Enten, Kaninchen zu versorgen. Sie kochte Sirup aus Zuckerrüben und stampfte selbst Sauerkraut ein. Im Sommer sammelte sie mit uns Pilze und Holz im Wald und spaltete mit der Axt, linkshändig, bis zum Umfallen Scheit für Scheit als Wintervorrat. Obst wurde eingeweckt oder kam als Backobst in große Blechkisten. Ich sehe sie vor meinem geistigen Auge, wie sie Taschen schleppend die Dorfstraße entlang läuft, im Lodenmantel, mit einer Pudelmütze. Zum Marx Theo, dem kleinen Lebensmittelladen, nahm sie mich ungern mit, weil ich ein Quälgeist war. Ich »natschte« solange herum, bis ich ein Bonbon oder eine Scheibe Wurst ernörgelt hatte. Die einfachste Lösung fand meine Mutter darin, mir eine Handvoll Backobst zu geben und mich ins Bett zu stecken. Die Ereignisse in der Welt gingen an ihr nicht spurlos vorüber. Sie war eine gottesfürchtige Frau und sie schloss in ihr Gebet ein, dass ihre Söhne niemals Soldat an der Front werden mögen. Vier Söhne. Dafür verliehen ihr die Nazis das Mutterkreuz in Silber. Bei mehr »männlichem Material« gab es dieses »Blech« in Gold. Aber die Mütter mit dem goldenen Kreuz hatten dann letztlich oft auch die meisten hölzernen Kreuze … Unsere Mutter war nur für uns da. Zu keiner Zeit, und ging es uns noch so schlecht, hat sie uns vernachlässigt – wir Kinder waren ihr Ein und Alles. Möge dieses Buch mit meinen Erinnerungen ein kleines Denkmal für sie sein … Meine Kindheit war bis 1945 relativ sorglos. Warum mich meine evangelische Mutter in die katholische »Spielschule« brachte, obwohl ich genügend Geschwister als Spielkameraden hatte, kann nur so erklärt werden, dass außer mir alle zur Schule gingen und ich dann doch einsam gewesen wäre. Die Mädels waren sowieso in der Ausbildung, weg von zu Hause. Nach dem Unterricht gingen die beiden größeren Jungs zum Großbauern Kühe hüten. Dafür bekamen sie gutes Essen und es fiel so mancher Happen für die Familie ab. Meine Einsamkeit vertrieb ich mir mit einer zerbrochenen Porzellanfigur. Und die hat ihre Geschichte: Die letzte Wohnung, die wir in Schlesien hatten, war ein kleines Bauerngehöft und es stand eine Scheune auf dem Gelände. Dort ließ es sich besonders gut spielen, wenn die Eltern uns das auch verboten hatten. Es könnte ein Unglück passieren bei Dreschmaschine und Rüttelwerk. Aber Verbotenes reizt ja bekanntermaßen. Hier, unter Lehm, fand ich »meinen Helden« – die erwähnte Porzellanfigur. Sie war sehr klein. Als ich mit den Fingernägeln den Lehm abkratzte, kam ein Schmied zum Vorschein. Ich erkannte es, obwohl die Figur keinen Kopf hatte, nur einen Arm und ein Bein, aber Amboss und Hammer … Meine Fantasie kannte keine Grenzen, ich ahnte, wie er ausgesehen haben könnte. Und ich nannte ihn »Homatl«. Wie dieser Name zustande kam und was er bedeuten sollte, kann ich heute nicht mehr erklären. »Homo« – Mensch – kann ich ja nicht gemeint haben, denn das lateinische Wort kannte ich damals natürlich noch nicht. Es war mein Homatl, ich hing an ihm und ich versteckte ihn, damit ihn niemand finden sollte. Er bleibt bis heute unauffindbar … Damals gab es einen Zwischenfall, der mir bis heute traumatisch in Erinnerung geblieben ist. Eines Tages holte ich meinen Bruder Hans von der Kuhweide ab. Es war Kartoffelerntezeit. Die Krautfeuer brannten und es war eine Lust, die gerösteten Kartoffeln aus dem Feuer zu angeln und frisch zu essen – das schmeckte. Der Großbauer, es war der Ortsbauernführer, hatte einen polnischen Zwangsarbeiter, mit dem Hans oft zusammen arbeitete. Der packte mich an Armen und Beinen und hielt mich über das knisternde Krautfeuer und rief dabei: Hah, Deitschland Hackefleisch machen! Ich schrie wie am Spieß und hatte höllische Angst. Ich begriff noch nicht, was in diesem Polen vor sich ging. Wir erzählten davon nur der Mutter, denn es hätte fürchterliche Folgen gehabt, wenn Vater davon erfahren hätte. Meine Schwester sagte mir später: Es traute sich damals keiner, etwas zu sagen und die Angst wuchs ständig. Meine Mutter brachte mir bei, die Leute freundlich und höflich zu grüßen, Ursache für einen Affront, als ich nämlich zur Ortsfrauenschafts-Führerin Guten Tag! gesagt hatte. Daraufhin brüllte sie meine Mutter auf offener Straße an: Sie haben gefälligst einem deutschen Jungen den ›Deutschen Gruß‹ beizubringen! – War denn »Guten Tag« nicht Deutsch? Frau Storch stolzierte wie gleichnamiger schwarz-weiß-roter Vogel durch das Dorf und – ließ sich grüßen. Erhobenen Hauptes verkündete sie, wie stolz sie darauf sei, dass ihr Sohn als Flieger für den geliebten Führer, für Volk und Vaterland auf dem Felde der Ehre gefallen sei… Meine Mutter schüttelte über so viel Fanatismus und Verblendung nur den Kopf. Als später auch diese Frau das Weite suchen musste, schnitt sie aus der roten Fahne den schwarzen Haken heraus … Ich erinnere mich noch ganz gut, dass über dem Bett meines zweitältesten Bruders ein Hitlerbild hing. Es war für mich Furcht einflößend. Das Bild von diesem zerknirschten uniformierten Mann mit dem Bärtchen unter der Nase stimmte mit der schrecklich krächzenden Stimme überein, die ich ab und zu im Radio hören musste, im Volksempfänger, den der Volksmund »Goebbels-Schnauze« nannte. Über dem Kopfende meines Bettes hing ein anderes Bild. Es waren die Jünger, denen Jesus bei Emmaus erschienen war, sie gehen zum Haus des Kleopas (1995 war ich in Israel an jener Stelle der christlichen Legende). Dabei laufen sie durch ein mit weißen Lilien durchwachsenes, golden leuchtendes Kornfeld und sie bitten Jesus: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneiget (Lukas 24, Vers 29). Vor dem Schlafen faltete ich im Beisein meiner Mutter die Hände und schaute dabei auf dieses Bild mit den freundlichen Männern und dem schönen Kornfeld. Wir beteten gemeinsam: Müde bin ich, geh zur Ruh, schließe meine Augen zu – Vater, lass die Augen Dein über meinem Bette sein. Amen. Dann strich mir meine Mutter sanft über den Kopf und entfernte sich leise aus dem Zimmer. Ich fühle heute mehr denn je, dass wir Kinder für sie immer an erster Stelle standen – bis zu ihrem letzten Atemzug. Sie liebte uns alle und behütete und beschützte uns wie eine Glucke. Sie bleibt für mich die Inkarnation eines liebenswürdigen, bescheidenen, gutmütigen, großzügigen und geduldigen Menschen. Meine Mutter war eine Frau, die immer gedient hatte. Sie wurde in einer armen Landarbeiterfamilie geboren, am 26. September 1896 in Schwendnig, Kreis Nimptsch, in Oberschlesien. Sie erzählte mir, dass ihr Großvater noch Leibeigener auf dem Gut des Barons gewesen sein soll. Die Eltern waren arme Leute, trugen aber den Familiennamen Falkenhain. Das ist kein bürgerlicher oder bäuerlicher Name. Vielleicht waren weitläufige Vorfahren meiner Mutter »Rittersleut«, die ihren Adelstitel aus Armut verkauften. Auf jeden Fall ist der Name suspekt. Meine Mutter kam in einer großen Familie zur Welt, mit einem Dutzend, vielleicht sogar einem »Teufelsdutzend«, also dreizehn Kindern. Viele überlebten nicht. Ernst Falkenhain (geb. 1869) war Wirtschaftsvogt auf einem Gut. Auch meine Großmutter, Ernestine (1872), starb früh und unser Großvater war nun auf die Stütze durch die heranwachsenden Kinder angewiesen. Aber er heiratete noch einmal. Es gab in der Familie keinen Zusammenhalt. Für die Töchter war eine Mitgift oder andere Hilfe, um mit dem Leben draußen klar zu kommen, nicht möglich. So verdingte sich meine Mutter nach der Volksschule als vierzehnjähriges Mädchen bei einem Rittergutsbesitzer in Posen als Magd, Aufwartung, Putzmädchen und Küchenhilfe. Wo sie geboren wurde, lagen in der Nähe die Orte Peterswaldau und Langenbielau, bekannt durch den Schlesischen Weberaufstand. Und ich befragte sie später oft danach. Es war ja auch die Heimat des Dichters Gerhart Hauptmann, der den schlesischen Webern mit seinem Drama 1893 ein Denkmal setzte. Weil er damit erstmalig den Weberaufstand auf die Bühne brachte, wurde das Werk zunächst verboten. Vom 4. bis 6. Juni 1844 hatte sich in Peterswaldau und Langenbielau die Wut der armen Leineweber vor allem gegen die Textilunternehmer Zwanziger und Dierig entladen. Etwa 3.000 Weber zerstörten Maschinen und Einrichtungen und setzten auch Gebäude in Brand. Die Hymne des Aufstandes war »Das Blutgericht«. Preußische Truppen schlugen den Aufstand mit aller Härte nieder. Heinrich Heine war der erste deutsche Dichter, der bereits im Jahr des Aufstandes 1844 sein Gedicht »Die schlesischen Weber« schrieb. Es stand dann später auf dem Lehrplan in der Grund-Schule und wir haben es auswendig lernen müssen. Es klingt mir heute noch in den Ohren Deutschland, wir weben dein Leichentuch, wir weben hinein den dreifachen Fluch … wir weben, wir weben … Später sah ich dann auch den ausdrucksstarken Graphikzyklus »Ein Weberaufstand« von Käthe Kollwitz (entstanden 1893/97). Meine Mutter hatte über ihre Eltern und Großeltern von diesem Ereignis erfahren. Die Lage in der Region des Eulengebirges muss schlimm gewesen sein. Die Wut der armen Weber entlud sich gegen die große Not. Die Verleger beuteten die Weber brutal aus, es gab wenig Geld für viel Schinderei am Handwebstuhl in der dunklen Kate, die Tuberkulose grassierte, die Kinder starben, es schien alles aussichtslos und hoffnungslos zu sein.
Meine Mutter war immer eine Dienende und eine Lernende. Eines Tages fand sie in Lüben Anstellung bei einer geschiedenen Dame von Geschwendt, deren Verwandtschaft aus dem »Geschlechte derer von und zum Stein« stammen soll. Meine Mutter hat keine Berufsausbildung genießen können, das war damals für Mädchen enorm schwer, vor allem, wenn sie aus armen Verhältnissen kamen. Aber sie war hell wach und lernte von den Adligen viel, auch, wie man es nicht macht – daraus empfing sie einen geschärften Gerechtigkeitssinn und ökonomisches Denken. Wie hätte sie sonst später eine achtköpfige Familie führen können. Ja, sie war der eigentliche Kopf der Familie. Erst recht, als sie mit uns Kindern in der schwersten Zeit ab 1945 alleine dastand und Unglaubliches bewältigen musste. Auf jenem Gut in Lüben lebte die Dame von Geschwendt mit ihrem Sohn Friedjof, der sich in die »Gustl« (meine Mutter hieß Auguste Pauline ...) verliebte. Die »Patronin« sah das zwar nicht so gern, aber sie war fest davon überzeugt, dass meine Mutter irgendwann einmal einem Adelsgeschlecht entsprungen sein musste, denn mit dem Namen »Falkenhain« ging es ihrer Meinung nach nicht mit rechten Dingen zu. Das war ihre Rechtfertigung der entstandenen Situation. Schließlich verlobten sich die beiden jungen Leute. Und es geschah etwas »Seifenopernartiges« – meine Mutter wurde von der Herrin adoptiert und erhielt den Mädchennamen der adligen Dame »von Biedenfeld«, denn ihr geschiedener Mann hätte der Übernahme des »von Geschwendt« nicht zugestimmt. Der Vater meiner Mutter hatte wieder geheiratet und war sicherlich ganz froh, dass eine seiner Töchter »unter der Haube« war, zumal unter solch »gehobener«. Mutters Geschwister werden all diese Vorgänge sicher mit sehr gemischten Gefühlen verfolgt haben. Das Glück der jungen Leute währte nicht lange, denn Friedjof erlag während einer Jagd einem Herzschlag. Mutter diente weiter am Hofe und lernte eines Tages in Lüben den drei Jahre älteren Bäckermeister Paul Vorwerk kennen und lieben. Damit begann für sie ein völlig neues Leben, denn Bäcker sind »Lerchen« – sie stehen frühzeitig auf und gehen am Mittag schlafen. Es ist ein Beruf, der viel Mühe und Schweiß kostet. Jedenfalls stand meiner Mutter, der künftigen Bäckersfrau, eine harte Zeit bevor.
Der Vater
Die beiden heirateten am 26. Mai 1923 in Lüben … Mein Vater Otto Hugo Paul Vorwerk wurde am 3. Oktober 1893 in Lüben geboren und stammt aus einer Beamten- und Handwerkerfamilie. Sein Großvater war Königlicher Vollzugsbeamter, der Vater aber Bäckermeister. Seine Mutter stammt aus der Familie eines Müllers – das passt zum Bäcker schon eher. Als sein Vater 1925 starb, übernahm der Sohn (mein Vater) nach der Lehre als Meister die Bäckerei. Das war ein kühnes Unternehmen in Zeiten wirtschaftlichen Tiefgangs in Deutschland und anderswo. Zuvor aber holte man ihn zum Militär, weil für den Ersten Weltkrieg Soldaten gebraucht wurden. Sehr sportlich war mein Vater nicht. Er liebte die gängige, leichte Musik jener Zeit und den Gesang, war Mitglied der Liedertafel und dann des Deutschen Sängerbundes. In seiner Schallplattensammlung befanden sich viele Aufnahmen mit Chören. Und so lief am Sonntag die Scheibe mit dem Lied »Sonntag ist’s in allen Landen« oder »Hört die alten Eichen rauschen« … Eine violette Schleife mit dem Aufdruck »10. Deutsches Sängerbundesfest Wien 1928« ist das einzige Originalzeugnis, das ich von meinem Vater besitze. Er war damals anlässlich des 100. Todestages Franz Schuberts im Block des Niederschlesischen Sängerbundes (Breslau) nach Wien mitgefahren. Nach der Wende habe ich im Gedenken an meinen Vater die Stelle in der Nähe der Karlskirche in Wien, wo damals die Sänger eine Schubert-Linde pflanzten, mit meiner Sabine oft besucht. Das Wiener Sängerfest fand zehn Jahre nach Beendigung des 1. Weltkrieges statt, zu dem mein Vater eingezogen worden war. In der Ardenne-Schlacht ging für ihn der Krieg zu Ende. Er kam mit einem Bauchschuss ins Lazarett und durfte dann nach Hause. Außerdem endete das ganze Dilemma 1918 mit der Abdankung und Flucht von Kaiser Wilhelm II. nach Holland. Die Revolution brach aus, die Linken riefen nach dem Vorbild Russlands die »Sozialistische Republik« aus, die aber am reaktionären Adel scheiterte, und das Bürgertum wollte mit den Roten nichts zu tun haben. Man besann sich der Demokratiebewegung der 1848er-Zeit, schuf die Weimarer Republik und alles steuerte auf die Weltwirtschaftskrise zu. Unser Bäckermeister Paul Vorwerk hatte beruflich schlechte Karten. Nur der Zunftbruder hatte Aussicht auf Rentabilität, dem es gelang, das Mehl in edelstes Gebäck und Kuchen zu verwandeln und der über einen breiten Kundenkreis verfügte. Vater soll sehr gute Brötchen und Brot gebacken haben, aber daran kann ein Bäcker nichts verdienen. Das Konditoreifach war nicht seine Stärke. Er war auch nicht geschäftstüchtig genug, um sich gegen die Konkurrenz zu behaupten. Das war dann schon eine Zeit, in der der »braune Spuk« begann. Die wirtschaftliche Notlage in Deutschland war für die Hitler-Partei die Gelegenheit, das Volk auf ihre Seite zu bringen. Man versprach Arbeit und eine »Neuordnung der Volksgemeinschaft«. Vater stellte auf Bitten seiner Frau ihren jüngsten Bruder als Lehrling ein. Eines Tages erschien der mit seinem Fahrrad, an dem ein Hakenkreuzwimpel flatterte. Da aber das Brot und die Brötchen in eine Arbeitergegend ausgefahren werden musste, wo man zunächst mit den Nazis nichts am Hut hatte, geriet der Bäckermeister in Jähzorn und feuerte den Lehrling. Später wandelte sich das Blatt … Unabhängig von dem Zwischenfall mit dem Hakenkreuzwimpel bewegte sich der Laden in Richtung Konkurs. Es begann für die wachsende Familie eine Zeit des »Gürtel-enger-Schnallens« bis hin zur Verarmung. Das Haus in Lüben wurde verkauft, ein gewiefter Makler haute meinen Vater übers Ohr, es wurde eine neue Bäckerei, in Volkersdorf/Heide, Kreis Lauben, gesucht. Schließlich zwangen Krankheiten zur Geschäftsaufgabe. Neuer Umzug nach Friedeberg in ein Siedlungshaus, Vater war nun arbeits- und mittellos. Er stand beim Arbeitsamt an und wurde zu Erdarbeiten im Kanalbau vermittelt. Diese Beschäftigung erwies sich als zu schwer, zumal meinem Vater die Kriegsverletzung immer noch zu schaffen machte. 1936 erwarb er über einen Makler in Gerlachsheim ein primitives kleines Einfamilienhaus. Das fünfte Kind war unterwegs. Davor wurde 1924 Elfriede geboren, 1926 kam Johanna, dann gab es zwei Fehlgeburten, 1933 kam Paul auf die Welt, 1935 Johannes, 1936 Ernst und ich war der späte Nachzügler im Jahr 1939. Die soziale Lage wurde immer schwerer, denn als einstiger selbständiger Bäckermeister bekam mein Vater keine Unterstützung und an Rücklagen war nicht zu denken. Die Armut griff um sich. Mutter hatte auch keine Geldquelle. Sie nahm schließlich Heimarbeit für das Winterhilfswerk (WHW) an. In dieser sozialen Notlage kam es zu großen Spannungen in der Familie, die darin gipfelten, dass mein Vater in seiner Verzweiflung gesagt haben soll: Wenn sich nichts ändert, nehme ich die Axt und schlage uns alle tot! Zur misslichen sozialen Situation kam nun noch die Angst vor einem cholerischen, jähzornigen Mann. Meine Mutter nahm diese Bedrohung für die Familie sehr ernst. Sie ging zur Polizei. Vater wurde aufs Amt bestellt und zur Rede gestellt. Er schilderte seine Notlage. Dann erst kam etwas in Bewegung. Natürlich halfen die Nazis nur denen, die zu ihnen standen. Und die Meisterleistung an Demagogie zeigte Wirkung: Schon allein im Namen dieser Partei – National-Sozialistische-Deutsche-Arbeiter-Partei – steckte die ganze Melodie des »Rattenfängers«, auf die die breite Masse hereinfiel. Die Volksverführer stahlen den Sozialisten und Kommunisten sogar die rote Fahne, sie setzten nur einen weißen Kreis mit schwarzem Hakenkreuz hinein. Mein Vater ging in die NSDAP und in die SA und war letztlich stolz darauf, zur »großen Bewegung« zu gehören. Ich sehe noch seine braune Uniform mit der Armbinde im Schrank hängen. Koppel und Gamaschen waren stets gewienert. Er besaß auch einen Revolver …. Man bot ihm eine Arbeit im Reichsbahn-Ausbesserungs-Werk (RAW) in der Kreisstadt Lauben an. »Reichsbahnförderarbeiter« hieß die hochtrabende Bezeichnung der Beschäftigung. Darunter war nichts anderes zu verstehen, als dass man etwas zu befördern hatte, nämlich Ersatzteile und Metallteile als Transportarbeiter für die Reparatur von Waggons und Lokomotiven. Es gab wieder einmal einen Umzug: Von Gerlachsheim nach Marklissa. Die Fahrt zur Arbeitsstätte war aber immer noch zu weit. So suchten die Eltern 1938 nach einem Ort, der näher an Lauban lag – das war Pfaffendorf, ein Angerdorf mit der »Dreieinigkeit « in der Mitte: Kirche, Gemeindeamt und Schule. Hier wurde ich am 8. März 1939 in einem kleinen Einfamilienhaus mit der Nummer 33 (die trägt es heute noch) geboren. Aber obwohl die große Schwester schon im »Reichs-Arbeits-Dienst« (RAD) diente, waren die Räume für uns viel zu klein, denn überdies wohnte da noch ein anderer Mann, sonst hätten meine Eltern das Haus nicht mieten können. Das war eine Bedingung im Vertrag. Es muss 1941 oder 1942 gewesen sein, dass meine Eltern noch einmal umzogen, auf eine leichte Anhöhe in Pfaffendorf, den Viebig, einen verlorenen Winkel am Ende des Dorfes. Das Haus mit der Nummer 52 war ein kleines Bauerngehöft. Meine Mutter hielt Kleinvieh – Kaninchen, Hühner, Enten. Gartenkräuter wurden angepflanzt. Es gab Obstbäume. Da die Marken für Einkellerungskartoffeln nicht reichten, gingen wir auf die abgeernteten Felder »stoppeln«. An Arbeit mangelte es nicht. Die Wirtschaft boomte. Die Nazis hatten für den Krieg alles mobilisiert. Vater musste nicht an die Front, schließlich war er ein wichtiger Eisenbahner und auf Grund seiner Verletzung aus dem 1. Weltkrieg nicht »kriegsverwendungsfähig«. Er glaubte fest daran, dass ihn sein schwarzes Verwundetenabzeichen mit dem Stahlhelm vor noch Schlimmerem schützen würde. Und obwohl er das Schlimme kannte, stand er fest an der Seite der »Volksgenossen«. Er – und nicht nur er – hielten den Namen der übermächtigen Partei für ein Programm. Schließlich war er jetzt Arbeiter und schließlich waren für ihn die »Volksrevolution« und die »Vorsehung des Führers« besser als das »Chaos der Weimarer Republik«. Sonntags lief er mit der Spendenbüchse des Winterhilfswerkes von Tür zu Tür, nicht ahnend, dass wir eines Tages für uns selbst an Türen klopfen würden. Er war fest davon überzeugt, den »Helden an der Front« wirklich etwas Gutes zu tun. Er glaubte fast bis zum Schluss an den »Endsieg« und an die »Wunderwaffe des Führers«. Die Rattenfänger hielten ein ganzes Volk in Trance, sie opferten es skrupellos, eine andere Art »Kamikaze«, Völkermord nach innen und nach außen … Es ist seltsam, je länger die Zeit zurück liegt, je schneller sie davon eilt, desto mehr Bruchstücke an Erinnerungen auch an meinen Vater tauchen in mir auf … Wie die Spatzen hockten wir Kinder am Fenster und ließen die Landstraße, die sich frei unserem Blick bot, nicht aus dem Auge. Jeder drängte sich um den besten Platz, von dem man als Erster laut verkünden konnte: Er kommt, er kommt! Natürlich erkannten wir Vater sofort an seinem wiegenden Fahrstil. Im Winter war auch sein gestrickter Gesichtswärmer nicht zu übersehen. Täglich fuhr er mit dem Fahrrad, das mit Gesundheitslenker und verbeulter Lampe ausgestattet war, zur Arbeit. Bis Niklausdorf, den Rest mit dem Zug. Es kamen etliche Kilometer zusammen, das hielt ihn fit. Wenn er dann die Wohnung betrat, wurde er stürmisch begrüßt. Und das nicht ohne Hintergedanken, denn jeder gierte nach dem Privileg, seine Brotbüchse aus der Tasche holen zu dürfen. Sie war nämlich meist noch halb gefüllt und diese »Hasenbrote« schmeckten natürlich viel besser als frische. Immerhin hatten sie eine Arbeitsschicht in der Werkhalle hinter sich und der Maschinenöldunst gab dem Brot offensichtlich seine eigene interessante Geschmacksnote. Mein Vater verdiente nicht viel, er hatte große Mühe, »unsere Mäuler zu stopfen«. Er selbst war ein äußerst bescheidener Mann was seine materiellen Ansprüche betraf. Er rauchte nicht und trank keinen Alkohol. Zu Hause gab es nur Kräutertee oder Malzkaffee und nur sonntags eine Tasse Kakao für uns Kinder. Vater lieferte bei meiner Mutter den gesamten Lohn ab und er begnügte sich mit ein paar Mark Taschengeld. Er murrte nie darüber und überließ den Haushalt völlig seiner Frau, die auf wunderbare und oft wundersame Weise alles zur Zufriedenheit regelte. Meine Mutter erzählte mir einmal, dass sich mein Vater maßlos über bestimmte Arbeitskollegen aufgeregt haben soll, die abfällig von ihren Frauen redeten oder irgendwelche Zoten rissen. Über den Krieg sprachen meine Eltern selten. Heute weiß ich, dass es in dieser Frage tiefe Meinungsverschiedenheiten gab. Meine Mutter hasste den Krieg. Sie war verbittert darüber, dass Menschen gezwungen wurden, sich gegenseitig umzubringen. Für sie gab es auch ohne Krieg schon genug Leid auf der Welt. Für meinen Vater war das Soldat-Sein und In-den-Krieg-Ziehen eher Ausdruck von »Zucht und Ordnung, Manneskraft und Macht«. Ich habe diese Haltung nie begriffen, zumal er ja selbst den Krieg körperlich zu spüren bekommen hatte. Den Tornister der Soldaten nannte man »den Affen«, weil er außen mit Fell bespannt war. Mit ihm hatte man dessen Träger »zum Affen« gemacht, also zum bedingungslosen Gehorsam gezwungen. Das Parteiprogramm der NSDAP rollte durchs Land, an die Westfront und an die Ostfront: »Alle Räder müssen rollen für den Sieg« stand in großen Buchstaben an den für mich riesigen schnaufenden Lokomotiven der Züge. In den Kneipen wurde gegrölt: Jeder Stoß ein Franzos, jeder Schuss ein Russ, jeder Tritt ein Brit, und aus den Lautsprechern dröhnte es: Wir werden weiter marschieren bis alles in Scherben fällt, denn heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Wir mussten schließlich bitter erleben, was diese Welle von nationalistischem Fanatismus anrichten kann. Das Kino war ein ganz wichtiges Propagandamittel. Ich kann mich noch genau erinnern: Vor dem Film »Quax, der Bruchpilot« mit Heinz Rühmann (da waren die Hakenkreuze noch am Ruder zu sehen, die später wegretuschiert wurden) oder dem Film »Schneeweißchen und Rosenrot« lief »Die Deutsche Wochenschau«. Mit Fanfarengetön entfaltete sich ein riesiger Reichsadler. Die martialische Stimme der Reporter wurde verstärkt mit Franz Liszts »Les Préludes«, wenn der unaufhaltsame Vormarsch der deutschen Panzer geschildert wurde, und Richard Wagners Signalmusik aus den Opernvorspielen war wunderbar geeignet, den tapferen Heldenmut im Kampf gegen den Feind zu untermalen. Wenn es um die Seeschlachten ging, war nicht von Schiffen die Rede, sondern von versenkten Bruttoregistertonnen. Vater war stolz auf den Klimbim von Orden, Ehrenzeichen und Fahnen, auf das klingende Spiel und den zackigen Marschtritt deutscher Stiefel. Dennoch ahne ich erst heute so richtig, was für ein innerlich zerrissener Mensch er eigentlich gewesen sein muss. Vermutlich geht vieles auf seine nationalistisch eingestellte, herrschsüchtige und dominante Mutter zurück, die den Sohn an ihrem Schürzenband geführt hatte und ihm so die Ausprägung seiner eigenen Persönlichkeit stahl. Mein Vater war jähzornig und feinfühlig, unberechenbar und fürsorglich, ein Widerspruch in Person. Er liebte uns Kinder sehr, duldete aber keine Ausrutscher, auch kindliche nicht. Er hielt uns »an der Kandare«, die nur Mutter wieder lockerte. Er war schnell bei der Hand mit Züchtigungen (»Zucht und Ordnung«), zerschmolz aber in Selbstmitleid, wenn er zu streng gegen uns gewesen war. Natürlich verbot er uns Kindern, Radio zu hören, den »Volksempfänger«, im Volksmund »Goebbels-Schnauze«, einzuschalten. Ich konnte damals einfach nicht begreifen, wie denn die Dame, die da so herzzerreißend sang, in den kleinen Kasten hineingekommen war. Völlig klar, dass man nur den Großdeutschen Rundfunk hörte, der Sender Breslau lag am nächsten. Außerdem brachte der so schöne Heimatsendungen. Das kam an, das lenkte ab von den Vorgängen weit an der Front. Ich weiß nicht, ob meine Mutter nachts heimlich BBC London gehört hat. Ich weiß aber, dass sie eine mutige und beherzte Frau war. In die NS-Frauenschaft war sie sicherlich nur in der Absicht eingetreten, Frieden zu Hause zu haben. Vielleicht hat es auch Vater von ihr verlangt … Ein besonderes Heiligtum war Vaters Telefunken-Koffer-Grammophon. Niemand außer ihm durfte damit umgehen. Wir daheim lebenden vier Brüder (die Schwestern waren beim Reichsarbeitsdienst – RAD bzw. auf der Lehrerausbildungsanstalt – LBA) nervten »Vatl« oft, das Grammophon hervorzuholen und die Schellack-Platten aufzulegen. Diese Bitte erfüllte er nur unter der Bedingung, dass wir uns mucksmäuschenstill verhielten und uns möglichst wie die Ölsardinen auf das Sofa legten. Spätestens beim »Morgenblätterwalzer« schliefen wir dann schon. Ruhm handelte er sich durch seine »Kochkünste « ein. Im Gedächtnis geblieben ist mir eine Reise, die Mutter allein zu ihrer Adoptivmutter von Geschwendt unternahm. Vater blieb bei uns und ihm war also auch die Zubereitung des Mittagessens überlassen worden. Als Mutter von ihrer Tour nach Hause kam, wurde sie mit großem Hallo empfangen und ihr versichert, dass Vater besser kochen könne als sie. Was gab es denn?, fragte sie neugierig. Mehlsuppe, war die Antwort. Na, das ist doch nichts Besonderes! – Doch, doch … er hat sie anbrennen lassen …. Ein Ereignis legte sich lähmend auf das ganze Dorf: Ein Kind hatte die gesamten Schlaftabletten seiner Eltern geschluckt. Ein kleiner weißer Sarg war der letzte Gruß. Die Begebenheit erhöhte noch die pessimistische Stimmung, die durch den Kriegsverlauf in der Luft lag. Keiner wagte laut zu sprechen, bis auf die, die stolz auf den Führer waren, egal was im fernen Stalingrad passierte. In der Zeitung las man oder erfuhr es im Einkaufsladen, dass wieder einer aus dem Dorf den »Heldentod« an der Ostfront gefunden hatte. Und dann verteilte man die ersten Soldaten zur Genesungspflege (»Reha« würden wir heute sagen) in jene Familien, die sich freiwillig dafür anboten. Und obwohl wir gerade mal so über die Runden kamen, nahmen meine Eltern einen Soldaten mit einer Oberschenkelschussverletzung auf. Er war intelligent, sehr wortkarg, warmherzig, liebte Kinder und nahm mich gern auf seinen Schoß. Das war für ihn sicherlich in mehrfacher Hinsicht schmerzlich. Wie ist es, wenn so ein Mann auf Väter von Kindern schießen muss … Er wusste, dass er wieder an die Front geschickt werden würde. Sein Gesicht hatte manchmal einen ängstlichen, vielleicht erschütterten Ausdruck, so, als wären seine Gedanken über den Krieg vielleicht voller Ahnung des Schrecklichen gewesen, das uns allen noch bevorstand … Was meine Eltern mit ihm besprachen, nachdem wir zu Bett gegangen waren, weiß ich nicht. Aber gewiss fragte mein Vater, wie groß die Kraft der Wehrmacht sei oder ob wir hier mal raus müssten … Und dieser Soldat, der vielleicht von meiner Mutter ein Vorsichtszeichen bekommen hatte, meinte dann gespielt euphorisch, dass das natürlich niemals geschehen werde, weil doch der Führer und die Wunderwaffe … Ich denke, dass er davon im Grunde seines Herzens, nach den Erfahrungen, die er an der Ostfront machen musste, keinen Pfifferling hielt. Er machte, jetzt im Nachhinein, den Eindruck, dass er die eigenen Gesetze dieses schrecklichen Krieges genau kannte. Mein Vater hat mit Sicherheit das Verbrecherische der Nazi-Ideologie nicht erkannt. Er war dem wirtschaftlichen Aufschwung des Regimes auf den Leim gegangen und stand durch die Erziehung, die er genossen hatte, schon immer zu »Zucht und Ordnung«, womit er sicherlich auch die altpreußischen soldatischen Traditionen meinte, deren Ergebnisse so schnell in Vergessenheit geraten waren. Am »Erbfeindhass« machte er keine Abstriche, denn schließlich war er ja im 1. Weltkrieg verwundet worden … Die Ursachen dafür schienen ihm weniger wichtig zu sein und das eingeimpfte Serum des Hasses auf die »Roten« wirkte auch bei ihm. »Die Bolschewistische Gefahr« mobilisierte alles – besonders die Gefühle. Es war ein Gespenst, das ihn bis in die Familie verfolgte. Erst recht, als der Krieg immer näher kam, nachts Flugzeuge in großer Höhe Richtung Berlin flogen und die Verwundetentransporte zunahmen. Es lag eine knisternde Spannung in der Luft, die meinen Vater eines Tages zu einer schrecklichen Äußerung hinreißen ließ: Wenn die Russen kommen sollten, dann bringe ich uns alle um! Meine Mutter, die den Jähzorn ihres Mannes kannte, wusste auch, dass in einem der Kommodenschubfächer ein geladener Revolver lag. Nach dieser Bemerkung meines Vaters, die bewies, dass die Prophezeiungen des Führers Niemals wird der Feind deutschen Boden betreten im Inneren meines Vaters ins Wanken geraten waren, rechnete meine Mutter mit allem. Und wie eine Glucke, die sich angesichts eines bedrohlich kreisenden Habichts schützend über ihre Kücken wirft, bemächtigte sie sich eines Tages jenes Revolvers und vergrub ihn unter dem Stachelbeerstrauch im Garten. Später lüftete sie mir gegenüber dieses Geheimnis, als ich mehr über meinen Vater wissen wollte. Aber zurück zu unserem Frontsoldaten. Gerade ihm gegenüber glaubte mein Vater, besonders patriotisch wirken zu müssen. Der aber wurde immer wortkarger. Er wandte sich mehr uns Kindern zu. Als er mit seinen anderen verwundeten Kameraden wieder an die Front verabschiedet wurde, gestaltete die NS-Frauenschaft ein Programm im Kinosaal. Meine Eltern gingen selbstverständlich hin und mein zweitältester Bruder, der schon immer zum Widerspruch neigte, wollte unter allen Umständen dabei sein. Weil ihm das natürlich untersagt wurde, lief er – in der Winternacht im Nachthemd (!) – den Eltern hinterher. Das forderte Vaters Zorn massiv heraus. Er rannte hinter ihm her, packte ihn und verprügelte ihn derart mit dem Holzlöffel, den Mutter zum Wäscheumrühren im Waschhaus benutzte, dass sich der siebenjährige Knabe nur mit großer Mühe schluchzend ins Bett schleppen konnte. Mutter war zum Glück zwischen die beiden getreten, um noch Schlimmeres zu verhindern. Ich höre meinen Bruder noch vor Schmerzen wimmern, denn sein Rücken war mit roten und blauen Striemen überzogen. An Schlaf war nicht zu denken. Als mein Vater sah, was er in seinem Jähzorn angerichtet hatte, weinte er. Seitdem kann ich das traurige Lied »Aba heidschi bumbeidschi bum bum«, das den Soldaten bei ihrer Verabschiedung vorgesungen worden war, nicht mehr hören … Diese Lied wird auch oft zu Weihnachten gesungen. Ja, zu Weihnachten, da erlebten wir einen ganz anderen Vater … Vatl kommt heute Abend nicht, er ist beim Weihnachtsmann, sagte unsere Mutter, um uns zu beschwichtigen, dass es keinen Zweck hatte, an jenen Abenden vor Weihnachten auf den Vater zu warten. Beim »Weihnachtsmann«? Das bedeutete für uns vier Bengels, besonders artig zu sein, ohne Murren ins Bett zu gehen und Ordnung zu halten. Nachts träumte ich dann vom großen weißbärtigen Mann im roten Mantel und von seinen vielen fleißigen Zwergen. Besonders oft und schön (damit er’s ja hört) sangen wir dann das Lied »Knecht Ruprecht aus dem Walde«. Später verriet uns Mutter, dass dieser »Weihnachtsmann« ein Kollege meines Vaters war. Der bastelte mit ihm Pferdchen und Wagen, weil er im Schnitzen und Drechseln Geschick hatte. Und das war nicht so teuer wie im Kaufhaus. Wir freuten uns über all die Dinge, die dann unterm Weihnachtsbaum lagen. Da waren die Geld- und Geschenksorgen schnell vergessen. Überhaupt ist der 24. Dezember – der Heilige Abend – mit vielen Kindheitserinnerungen verbunden. Mein Vater spielte dabei eine große Rolle. Ein Christbaum war immer da. Er musste möglichst bis an die Zimmerdecke der »Guten Stube« reichen. Als er dann – zumeist von meinen beiden Schwestern – akkurat und fein mit Glaskugeln, Strohsternen und Lametta geputzt war und die Wachskerzen warm erstrahlten, übertrug sich dieses Licht in unsere Herzen. Wir stellten uns der Reihe und Größe nach auf und warteten auf das Glöckchen, das aus der Weihnachtsstube ertönte. Mag alles noch so bescheiden gewesen sein, unsere Augen leuchteten und wir staunten. Es duftete so wunderbar nach Wachs, nach frischem Tannengrün, nach selbstgebackenen Pfefferkuchen, nach Äpfeln und nach dem traditionellen Weihnachtsessen, das es nur am Heiligabend gab und das bis heute in unserer Familientradition erhalten geblieben ist. Es besteht aus Sauerkraut (meine Mutter machte das immer selbst), Salzkartoffeln, gebrühten rohen Würsten und einer polnischen Gewürzsoße, die eine ganz spezielle Prozedur erfordert, denn sie ist aus Wurzelwerk, Soßenkuchen und Malzbier gemacht. Das hört sich eigenartig an, ist aber lecker, denn alle Komponenten ergänzen sich zu einem schmackhaften und herzhaften Gericht. Und mein Vater? Er bereitete uns einen harmonischen und unvergesslichen Familienabend. Wir sangen mit kindlichem Gemüt all die schönen Weihnachtslieder und er begleitete uns am Klavier. Ja, wir waren zwar nicht bemittelt, aber in der »Guten Stube« stand ein Klavier. Dem Spiel meines Vaters zuzuschauen, war ein Erlebnis für sich. Seine Hände schnellten, nachdem sie die Tasten berührt hatten, nach oben. Es sah aus wie der Flügelschlag eines Vogels und dazu erklangen unsere Stimmen. Überhaupt wurde in unserer Familie viel gesungen. Das konnten wir alle recht gut und die Mädels brachten von ihren Ausbildungsstätten Lieder mit, die mir bis heute im Gedächtnis geblieben sind: »Knecht Ruprecht aus dem Walde«, »Und in dem Schneegebirge«, »Dort nied’n in jenem Holze« … Mein Vater war eigentlich Nichtraucher – eigentlich, aus finanziellen und gesundheitlichen Gründen. Er fand das Rauchen auch unmoralisch. Aber am Heiligen Abend gab es eine Ausnahme. Er wartete schon auf die Bitten seiner Kinder, »schönen Duft« zu machen. Dann zündete er sich eine Zigarre an, rauchte sie aber nie zu Ende. Diese völlig ungewohnte Situation war und blieb ein Ritual zum Christfest und wir hatten unser Gaudi. Vater war nur 1,64 m groß. Er verfügte über eine solide Korpulenz und hatte dennoch die Fähigkeit, recht gut laufen zu können. In diesem Zusammenhang erinnere ich mich an eine Begebenheit nach Weihnachten. Wo viele Kinder im Hause sind, da gesellen sich bald noch mehr hinzu – die aus dem Dorf nämlich. Sie trafen besonders dann bei uns ein, wenn wir unsere Weihnachtsgeschenke, z.B. die Autos, Bausteine oder Pferdegespanne ins Freie brachten. Das endete meist mit einem Riesenkrawall, weil sich die Dorfjungs unseres Spielzeugs bemächtigten und einiges davon dann auch zu Bruch ging. Als sich mein Vater davon überzeugt hatte, dass wir nicht die Hauptschuldigen an der Demontage des neuen Spielzeugs waren, geriet er in den gefürchteten Zorn. Im Eifer fand er nicht immer die passenden Schimpfworte, die man vor Kindern noch vertreten konnte. Die Denkpause überbrückte er mit dem beliebten Wörtchen »und«. Und so hatte er im Dorf den Spitznamen »Der Und-Und«. Das Nachäffen dieses Wortes brachte Vater erst recht in Rage. Er rannte was das Zeug hielt den Burschen hinterher, verwalkte den, den er als Ersten griff und sorgte auf diese Weise dafür, dass vorübergehend mehr Ruhe bei unserem Spielen herrschte. Als mein Vater am 13. Februar 1945 abends zur Arbeit fuhr, ahnten wir nicht, dass wir ihn an diesem Tage zum letzten Mal gesehen hatten …
Kindheitsepisoden
Meine Kinderjahre sind kurz, viel zu kurz. Einiges habe ich schon berichtet, Bruchstücke von Erlebtem, Episoden und kindliche Befindlichkeiten. Hier noch ein paar Ergänzungen. Man erzählte mir, dass ich schon als kleiner Bub von 2 – 3 Jahren meine Tierliebe beweisen wollte. Auf einem der wenigen frühen Kinderfotos halte ich eine Henne im Arm. Auch die süßen kleinen, eigelbfarbenen Entchen, die so flauschig und kuschelig waren, hatten es mir angetan. Ich ergriff zwei davon und zeigte meine Freude darüber unserer Mutter. Die Freude währte nicht lange, denn ich hatte meine Liebe zu den Entchen etwas zu derb bekundet … Ich erinnere mich an eine Veranstaltung im Saal des Dorfkinos, auf der die »Spielschule« den Eltern ihr Können vorführen sollte. Wir sangen und spielten und alle waren aufgeregt, besonders ich, denn ich durfte beim szenisch gestalteten Lied »Häschen in der Grube« das Häschen spielen … allein, mitten in einem Kreis. Erst später konnte ich definieren, wie ich mich da gefühlt habe – wie in einem »Windkanal« … Mit meinem Bruder Ernst, drei Jahre älter als ich, teile ich viele Kindheitserlebnisse. Ich erinnere mich, dass wir eine Kuchenform mit Teig zum Bäcker fahren sollten. Es war Winter, eiskalt und es lag Schnee. Also nahmen wir den Schlitten. Ich saß mit dem Kuchenteig darauf und Ernst zog mich ins Dorf hinunter. Er machte sich einen Spaß daraus, auch ein paar Haken zu schlagen und – »plautz« – der Schlitten kippte um und mit mir der Kuchenteig in der Backform. Er ergoss sich auf den Schnee. Mit beiden Händen beförderten wir den Teig schnell wieder in die Form zurück und lieferten das Ganze beim Bäcker ab. Als dann Mutter den Kuchen abholte, wunderte sie sich, dass der so komisch geraten war. Das gab es bei ihr doch sonst nicht… Um die Schuld vom Bäcker abzuwenden, gestanden wir schließlich unser Missgeschick. Es gab Schimpfe, aber ganz sicher hat unsere Mutter heimlich in sich hineingeschmunzelt … Vier Jungs waren wir – es lässt sich denken, dass da eine Menge angestellt wurde. Im Winter bauten wir Schneehäuser, durchstreiften im Sommer die Wälder, beobachteten Tiere, ließen im Bach Schiffchen um die Wette fahren, brachen auf dem Eis ein, kamen pitschnass nach Hause und – Mutter brachte alles in Ordnung, bevor Vater nach Hause kam. Der Haselbusch des katholischen Pfarrers hatte es uns besonders angetan, wenn im Herbst die Nüsse reif wurden. Als eine der wenigen evangelisch-lutherischen Familien hatten wir es ohnehin nicht leicht. Man wurde beargwöhnt, manchmal zu Recht. Denn eines Tages überredeten mich meine Brüder, auf den Haselbusch zu klettern und Nüsse herunterzuwerfen. Sie hoben und schoben mich hoch. Aber christlich teilen, ja! Bei diesem »christlich« knackte es im Unterholz. Da stand er schon vor uns, der Herr Pfarrer, um die Frevler zu fassen. Meine Brüder gaben Fersengeld, während ich auf dem Busch saß und schließlich den Hintern versohlt bekam. Seitdem war ich skeptisch gegenüber gemeinsamen Aktionen und dem »christlichen Teilen« … Im Kindergarten, der »Spielschule«, spürte man nicht, dass diese Einrichtung katholisch war, dafür aber mehr die »Deutsche Zucht und Ordnung«. In der katholischen Kirche hing ja auch neben der Fahne des Vatikan die Hakenkreuzfahne. Alles hatte auf Anweisung und Befehl zu erfolgen und dann möglichst »zackig« ausgeführt zu werden – Zähneputzen, Beten, Essen, Schlafen, Spielen, sogar der Gang zum WC – alles in Reih und Glied … Der Tagesablauf war nahezu militärisch und man wurde für alles, was nicht in diese Ordnung passte, bestraft: Ohrfeigen, die Ohren drehen, bis sie eingerissen waren und bluteten, oder an den Haaren ziehen, die Stehtortur in einer Ecke mit straffer Haltung – Alltag für uns Vorschulkinder. In diese »Ordnung« passte einfach nicht, dass ich eines Tages Bauchschmerzen bekam und es fürchterlich in meinem Leib rumorte. Flehentlich bat ich die Betschwestern, auf die Toilette gehen zu dürfen, was man mir kategorisch verweigerte. Schließlich, weil man sah, wie ich mich quälte, gestatte man es. Das Örtchen lag aber am anderen Ende des Korridors. Bis dahin schaffte ich es nicht mehr … Für das Malheur machten die »lieben christlichen Schwestern« natürlich mich verantwortlich. Über die Haltung des Spielschulpersonals war meine Mutter empört, nachdem ich ihr die volle Wahrheit über den Vorfall »gebeichtet« hatte. Irgendwie rangierte ich später dieses Ereignis als eine Art Abschied von der Kindheit ein … Als ich vorhin über meine Mutter schrieb, wurde auch ihre Adoptivmutter erwähnt, Adele von Geschwendt. Sie war für uns die »Koselitzer Oma«, weil sie in diesen Ort gezogen war. Ich durfte eines Tages mit meiner Mutter zu ihr mitfahren. Ich erinnere mich, dass sie in einem Haus wohnte, an dessen Wand ein riesiger Birnbaum stand. Um in die Wohnung der adeligen Dame zu gelangen, musste man eine hölzerne Außentreppe erklimmen. Das war mir schon unheimlich. Im Zimmer lag die alte Dame, sie war bettlägerig und wurde von einer Gouvernante betreut. Diese Betreuung hat meiner Mutter die Haare zu Berge stehen lassen, denn es war ein Jammerbild, das sich uns bot. Schmutz überall, die Ameisen tummelten sich in der Zuckerdose, überall verdorbenes Essen und Schmutz. Ich lenkte mich ab, indem ich in einem Realienbuch blätterte und mich über die vielen abgebildeten Tiere freute. Auf meine bittende Frage, ob ich das Buch haben könne, meinte die »Oma«, dass ich es lieber hier lassen soll, denn ich käme ja mal wieder zu Besuch. Dazu kam es nicht. Und als Muttl von der Beerdigung ihrer Adoptivmutter wieder zu Hause war, fragte ich, ob sie mir das Realienbuch mitgebracht habe. Ich höre noch heute ihre Antwort: Da war nichts mehr zu finden! … Ein anderes Ereignis, das alle Gemüter bewegte, verdeutlicht die ethisch-moralische Kluft innerhalb der Familie. Eines Morgens stellte einer von uns Jungs fest, dass das Kellerfenster eingetreten war. Meine Mutter stieg die schmale Steintreppe in den Keller hinab und sah, dass eingebrochen worden war. Dank ihrer akkuraten Ordnung bei den vielen Einweckgläsern und ihrem scharfen Gedächtnis stellte sie sehr schnell fest, was fehlte. Wir fanden die Spuren: ein ausgegessenes Glas eingeweckter Kirschen und hinter dem Garten am kleinen Bach lag ein noch unberührtes Glas mit Birnenkompott. Da wir uns keinen Hund leisten konnten und wir Kinder außerdem Angst vor Hunden hatten, waren wir nachts nicht gewarnt worden, dass sich jemand auf den Hof und in den Keller geschlichen hatte. Mein Vater vermutete, dass es sich bei dem Einbrecher um einen »Spion« gehandelt haben müsse. Das Wort »Spion« machte sowieso überall die Runde, selbst auf den Streichholzschachteln war ein Lauscher an einer Ziegelwand zu sehen und darunter stand »Pst, Feind hört mit!« Alle Delikte, die man nicht aufklären konnte, wurden »Spionen« in die Schuhe geschoben. Natürlich konnten das nur »die Russen« sein, manchmal tippte man aber auch auf Engländer, auf Fallschirmjäger, die sich im Hinterland absetzen ließen. Da meine Mutter sofort erkannte, dass der Einbruchschaden unerheblich und belanglos war, bat sie unseren Vater, von einer Strafanzeige abzusehen: Siehst du denn nicht, dass es sich hier um einen Menschen handelt, der weiter nichts als Hunger hatte …! Ohne, dass sie es aussprach, konnte man ihre Gedanken vollenden – … der arme Kerl. Mein Vater blieb unerbittlich: Feinde und Vaterlandsverräter müssen verfolgt und bestraft werden! Aber der von der Polizei eingesetzte Hund entpuppte sich als unfähig, die Spur zu verfolgen, er kapitulierte bereits am Bach. Damit ließ man es schließlich bewenden, mahnte aber zu verstärkter Vorsicht vor »Spionen«, ich fragte mich allerdings, was es denn in unserem kleinen Nest auszuspionieren gegeben hätte.
Flucht in die Ungewissheit
Es war eine unruhige Nacht – das Fliegergedröhn nahm kein Ende. Grummeln in der Ferne. Der Kalender zeigte den 14. Februar 1945. Die Küchenuhr, ein Teller mit Zwiebelmuster, tickte unaufhaltsam ihre Sekunden und Minuten herunter. Wir saßen am Frühstückstisch. Radio wurde da nie eingeschaltet. Vater war auf Arbeit. Meine Brüder waren schon zur Schule, obwohl keiner wusste, ob heute überhaupt Unterricht sein würde. Der fiel immer häufiger aus, weil immer mehr Lehrer an die Front abkommandiert worden waren. Öde und kahle Klassenzimmer waren keine Seltenheit. Immer öfter kam ein Kind verweint zur Schule: Mein Vater ist …
Als Hans, mein zweitältester Bruder, zur Stube hereinstürmte, trauten wir unseren Ohren nicht: Wir müssen raus! Alle verlassen das Dorf! Mutter glaubte ihm nicht und schickte Johanna ins Dorf hinunter. Als sie außer Atem zurückkam, waren die Worte meines Bruders bestätigte Gewissheit. SS-Leute in schwarzen Ledermänteln (vermutlich Feld-Gendarmerie) fuhren mit Beiwagen-Motorrädern durch den Ort und trommelten mit dem Megaphon alle Einwohner zusammen: Achtung! Achtung! Das Dorf muss geräumt werden. Es wird Frontgebiet. Sie haben zwei Stunden Zeit! Sammelstelle war das Gehöft des Ortsbauernführers. Jeder Familie war gestattet, zwei Säcke mit Wäsche mitzunehmen. Was dann kam, lässt sich kaum beschreiben – es ist und bleibt ein traumatisches Erlebnis: Schluchzend stürzt meine Mutter in die Schlafstube, reißt die Kommodenschübe auf, rennt in fürchterlicher Verzweiflung durch die Zimmer, bleibt wieder und wieder am Wäscheschrank stehen, nimmt einige Stücke in die Hand, Tränen rinnen über ihr Gesicht, die Wäsche fällt zu Boden … es ist ein Bild der Fassungslosigkeit, der Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Ich war ihr heimlich gefolgt: Muttl, warum weinst du … Meine Schwester nimmt mich zur Seite und schickt mich fort. Sie allein war in der Lage, die Situation einigermaßen zu erfassen, denn sie hatte bereits die Flucht aus der Lehrerausbildungsanstalt im oberschlesischen Kattowitz hinter sich. Die Säcke werden vollgestopft mit Wäsche, wir Jungs eingekleidet für eine Reise mit ungewissem Ziel. Die Großen ziehen den Handwagen … durch einen Schleier aus Tränen sehen wir noch einmal den Hof … einsam und verlassen. Gewiss wundern sich die Kaninchen und Hühner über die plötzliche Freiheit, die ihnen geschenkt wird …
Die Szenen, die sich auf dem Großbauernhof des Ortsbauernführers abspielen, sind erschütternd: Mütter mit ihren Kindern, Alte, Kranke und Gebrechliche bildeten den ersten Teil des Trecks einer Pferdekarawane mit Planwagen, die sich schließlich Richtung Westen in Bewegung setzt. Die Leute hofften, zunächst bis Görlitz zu kommen. Unterwegs mussten mehr und mehr Kinder absteigen, weil die Pferde vom langen Laufen schwach wurden. Des Öfteren heulten irgendwo Sirenen, schmissen sich die Leute in die Straßengräben, die teilweise mit Wasser gefüllt waren. Hoch am Himmel sah man Flugzeuge … es roch brenzlig … der Wind trug verbranntes Papier durch die Luft … beim näheren Hinschauen sah man, dass es verkohlte Geldscheine waren, auch Briefe, irgendwelche Akten, Papiere … dann glitzerten Stanniolstreifen am Himmel auf – Funkablenkungsmittel. Ich hörte nur, wie jemand sagte: Schrecklich, sie haben Dresden bombardiert! Diese »Dresdner Boten« flogen, hochgetrieben von der Hitze der Phosphorbomben, wie eine unheimliche Wolke zu uns. Für die aus heutiger Sicht relativ kurze Strecke von Pfaffendorf über Görlitz, Schönbrunn, Radmeritz (heute Rodomierzyce), Ostritz, Zittau, Großschönau, Rennersdorf, Oberoderwitz, Ebersbach, Friedersdorf, Oppach bis nach Taubenheim (Spree) brauchten wir acht Tage. Das lange Laufen, die Ungewissheit, der Hunger und die Kälte forderten ihren Tribut. Es war ein Schreckenszug. Nachts hockten wir irgendwo in einem Keller, wenn die Sirenen zum Fliegeralarm heulten. Ich zucke heute noch zusammen und es läuft mir eiskalt über den Rücken, wenn eine Sirene ertönt. Unsere Mutter scharte uns um sich. Wie eine Glucke hütete sie unseren Schlaf und betete, dass der Allmächtige die Gefahren von uns abwenden möge … In den Oberlausitzer Bergen rastete der Treck. In Taubenheim kamen wir in ein Sammellager – das war die Schule. Gleich gegenüber, auf einer Anhöhe, steht die Kirche aus dem Jahre 1524, eine der ersten lutherischen Kirchen in Deutschland. Ihre Glocken haben offensichtlich das Schicksal anderer Glocken, für Torpedos eingeschmolzen zu werden, nicht teilen müssen. Es war für mich später immer ein besonderes Erlebnis, wenn mich der Glöckner mit auf den Kirchturm nahm. Schon allein der Weg in die Kuppel des Turmes war abenteuerlich und dann das ohrenbetäubende Dröhnen der Glocken, die der ältere Herr mit einem dicken Seil, an dem er kräftig zog, in Schwingungen versetzte. Ich selbst durfte daran nicht ziehen, das wäre zu gefährlich gewesen. Der Ort selbst wird 1186 erstmalig urkundlich erwähnt. Reizvoll sind noch heute die typischen Lausitzer Umgebindehäuser und die Sonnenuhren. Aber dafür hatten wir damals verständlicherweise keinen Blick. Die physisch und psychisch völlig erschöpften Flüchtlinge lagen auf Strohschütten und Decken. Sie warteten darauf, dass es weitergehen möge. Das Dorf quoll aus den Nähten. Die Pferde des Trecks mussten sich nach dieser Belastung ebenfalls ausruhen. Für unsere Familie hatte dieser lange Marsch schwerwiegende Folgen. Unsere Mutter und der älteste Bruder wurden krank – eine Venenentzündung machte das weitere Laufen für Muttl unmöglich und Paul musste operiert werden, hier an Ort und Stelle … Er hatte sich kurz vor der Flucht auf der Schulbank einen Holzsplitter in den »Wertesten« gezogen. Dieser Schiefer, wie wir immer sagten, bohrte sich beim Laufen tiefer und tiefer und verursachte eine schlimme Blutvergiftung. Die Dorfärztin gab dem Zwölfjährigen auf dem Strohlager eine Narkose und entfernte das Übel. An eine Fortsetzung der Flucht war nun nicht mehr zu denken. Aber das hinderte die Pfaffendorfer keineswegs daran, weiterzuziehen. Später hörten wir, dass sie sich irgendwo im Rheinland niedergelassen haben sollen. Wir aber wurden durch den Holzsplitter im Gesäß meines Bruders Ostzonenbewohner und schließlich DDR-Bürger …
Für mich gab es noch einen Zwischenfall in der Schule: Ich hatte ein Klassenzimmer betreten und durch den Windzug schlug hinter mir die Tür zu. Zu spät merkte ich, dass die Innenklinke fehlte, konnte also nicht mehr heraus. Und obwohl Leute auf dem Flur waren und mein hartnäckiges Pochen, Rufen und Weinen gehört haben müssten, half mir niemand. Ich öffnete in meiner Not das Fenster, setzte mich auf den Sims und sprang in den Schulhof. Zum Glück lag das Klassenzimmer Parterre, die Höhe betrug vielleicht zweieinhalb bis drei Meter – für einen knapp Sechsjährigen eine beachtliche Höhe … Jedenfalls tat mir alles weh und nur mit Mühe schleppte ich mich die Steinstufen nach oben zu meiner Mutter, die mich sogleich hinlegte und tröstete.
Alles ist unsicher, der Krieg noch nicht zu Ende. Auf Befehl der Nazi-Verwaltung werden meine Mutter und meine beiden ältesten Brüder (sie waren 12 und 10) zur Straße Richtung Wassergrund beordert. In Höhe des Rittergutes müssen sie mit anderen Ortsbewohnern und dem »Volkssturm« eine Panzersperre ausheben – für den »Endsieg« … Auf dem Taubenberg, genauer gesagt auf der hölzernen Plattform des trigonometrischen Punktes, ist eine Flak installiert worden. Von diesen so genannten »Verteidigungsmaßnahmen« überzeugt sich, die nahende Front im Rücken, ein Wehrmachtsoffizier. Er landet mit einem Fieseler-Storch, einem einmotorigen, segelfähigen Kleinflugzeug unter großem Staunen von uns Kindern auf einer nahe gelegenen Wiese. Er hält sich nur ein paar Minuten auf, um dann Richtung Böhmen wieder davon zu surren. Diese Flak auf dem Taubenberg war natürlich kein Schutz, sondern eine unerhörte Provokation für die anrückende Rote Armee und diese Panzersperre entpuppt sich als Schildbürgerei, denn Zugang zum strategisch unbedeutenden Ort Taubenheim war von allen Seiten her möglich. Eine andere Begebenheit, die möglicherweise mit der eben geschilderten in Zusammenhang stand, war weit spektakulärer und folgenschwerer. Wir Kinder wurden weggeschickt, um nicht dabei zu sein, wie Leute vom »Volkssturm« einen Russen erschossen. Wir hörten die Schüsse. Man sagte einfach, er sei ein Spion gewesen. Dieses Wort kannte ich doch …Ich weiß noch, dass es oben, am Rande des kleinen Sportplatzes war, am Jugendheim, vor einer Sandkuhle, die der Gefangene sich selbst schaufeln musste, bevor er starb und dort verscharrt wurde ... Nach der Kapitulation exhumierte man ihn und bestattete ihn vor dem Gemeindeamt. Aber auch dort fand der arme Kerl keine Ruhe. Seine Gebeine wurden später noch einmal ausgegraben und in einen Ehrenhain nach Bautzen überführt. Nach vielen Jahren sowjetischer Lagerhaft kehrte von denen, die den Russen erschossen hatten, nur einer zurück. Er setzte sich umgehend in die Bundesrepublik ab, wo er sich sicher fühlen konnte.
April 1945. Um die Taubenheimer Bevölkerung vor den heranrückenden russischen und polnischen Armeen zu »schützen«, wurde auch sie evakuiert, das heißt, man stellte ihr anheim, Richtung Prag zu ziehen. Meine Mutter glaubte, dass das das Richtige sei, denn überdies waren wir schlesischen »Umsiedler«, wie man uns Vertriebene später nach dem Potsdamer Abkommen nannte, sowieso ungebetene Gäste, die als erste wieder zu verschwinden hätten, möglichst auf Nimmerwiedersehen. Wir borgten uns einen kleinen Handwagen, warfen unsere Habseligkeiten darauf und zogen davon … abermals ins Ungewisse. Es ging über Fugau, Schluckenau, Richtung Rumburg. In Ehrenberg überholten uns auf einem Bahnübergang drei deutsche Panzer. Aus der Ferne hörten wir das Bellen einer Flak. Und dann geschah etwas Unvorstellbares: in Sekundenschnelle war der Himmel voller Flugzeuge – wie Heuschrecken. Sie ließen sich mit ohrenbetäubendem Geheul über eine Tragfläche in die Tiefe abkippen und nahmen alles, was sich irgendwie bewegte, mit ihren Bordwaffen unter Beschuss – Welle auf Welle. Es schien kein Ende zu nehmen … Ich höre heute noch das Rattern der Maschinengewehre, das Krachen und Bersten von Granaten und Häusern. Während meine Brüder in einem Bunker Zuflucht fanden, nahm mich meine Mutter in ein Bahnwärterhäuschen mit. Meine Schwester, die sich hinter einer Anschlagtafel versteckt hatte, verließ ihren Platz, weil diese Tafel sehr bald von Geschossen und Splittern getroffen wurde. Im Häuschen des Schrankenwärters befand sich bereits eine Frau mit ihrem Kleinkind. Es war kaum Platz darin. Ich hockte mich unter ein Tischchen, neben mir eine Tasche dieser Frau. Meine Mutter lehnte sich an die Wand, hinter ihr das Telefon. Plötzlich ein dumpfer Schlag – meiner Mutter fiel das Telefon auf den Rücken. Im Apparat steckte ein Granatsplitter. Dann ein leises Klirren und eine weiße Lache, die sich aus der Tasche neben mir bildete, ließ meine Mutter erschauern. Ein Geschoss hatte die Tasche durchschlagen und darin eine Flasche mit Milch, die für das Kleinkind bestimmt war …





























