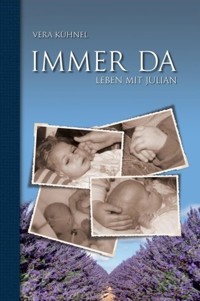
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Vera Kühnel erzählt über das LEBEN mit ihrem schwerstbehinderten Sohn Julian, der bei einem Narkosezwischenfall schwerste Hirnschädigungen davontrug. Die Autorin erzählt, wie sehr sich das LEBEN mit all ihren Träumen für die Zukunft veränderte. Sie berichtet vom Mit-ein-ander-LEBEN innerhalb der Familie und dem langsamen Annehmen der Situation bis eine "Normalität" in Harmonie erreicht wurde. Zudem prägte der jahrelange Kampf um Recht und Wahrheit das LEBEN von Julian und seiner Familie. Der Verlust nach seinem Tod ließ neue Wege nur langsam zu, die in Liebe erst wiedergefunden werden mussten. Begleiten Sie ein LEBEN mit Höhen und Tiefen, Schmerz und Freude, Resignation und Kampfgeist, Wachstum und Sinneswandel, Trauer und Liebe – das LEBEN mit Julian.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 497
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vera Kühnel (geb. 1962), Mutter von drei Kindern,
ist examinierte Krankenschwester, zertifizierte
Pflegesachverständige, integrale Lebensberaterin, Achtsamkeitstrainerin für Meditation und
Burnoutpräventionberaterin.
Sie lebt im Großraum Frankfurt / Main.
Vera Kühnel erzählt über das LEBEN mit ihrem schwerstbehinderten Sohn Julian, der bei einem Narkosezwischenfall 1989 schwerste Hirnschädigungen davontrug. Die Autorin erzählt wie sehr sich das LEBEN mit all ihren Träumen für die Zukunft veränderte. Sie berichtet vom Mit-ein-ander-LEBEN innerhalb der Familie und dem langsamen Annehmen der Situation, bis eine „Normalität“ in Harmonie erreicht wurde. Zudem prägte der jahrelange Kampf um Recht und Wahrheit das LEBEN von Julian und seiner Familie. Der Verlust nach seinem Tod ließ neue Wege nur langsam zu, die in Liebe erst wiedergefunden werden mussten.
Begleiten Sie ein Leben mit Höhen und Tiefen, Schmerz und Freude, Resignation und Kampfgeist, Wachstum und Sinneswandel, Trauer und Liebe – das LEBEN mit Julian.
Immer da
Alle Rechte vorbehalten
© Vera Kühnel
Wichtige Hinweise zum Copyright und dem
Haftungsausschluss finden Sie am Ende des Buches
Nach der überarbeiteten Auflage (5.) aus 2021
Vorlektorat: Angelika Wendler, Thomas Staufenbiel
Schlusslektorat: Heidi Ritter
Umschlaggestaltung: Thomas Staufenbiel
Autorenfoto: Picture People
www. immer-da.com
(die Liebe)
sie erträgt alles,
sie glaubt alles,
sie hofft alles,
INHALTSVERZEICHNIS:
Hinweise
Vorwort
Ein paar Worte zum Buch
Meine Geschichte
31.08.2003
I. LEBENsplan
II. LEBENswille
III. LEBENswende
IV. ÜberLEBEN
V. Anders-LEBEN
VI. Mit-ein-ander-LEBEN
VII. LEBENswandel
VIII. Weiter-LEBEN
IX. Wieder(-er-)LEBEN
X. LEBENswert(e)
XI. LEBENssinn - LEBENsweise
31.08.2018 - 3:20 Uhr nachts
Schlusswort
Danke
ABSCHLUSS
... erinnerungen bleiben oder vergehen...
... gedanken, die ein lächeln hinterlassen...
... oder tränen, die längst getrocknet sind...
Für Julian
und Alle,
Hinweise
Ich weise darauf hin, dass lediglich Vornamen im Text verwendet werden (auch die Namen mit Titeln). Einige Namen wurden auf Wunsch der Personen oder durch mich geändert, diese sind mit einem Sternchen (*) versehen.
Einiges wird aufgrund der rechtlich eingeschränkten Möglichkeiten hier nicht zu lesen sein. Dies ist eine bewusste Entscheidung zu meinem Wohle, dem meiner Familie und auch zum Schutz von ehemals Beteiligten.
Namen von Ärzten, die im Zusammenhang mit dem Prozessverfahren stehen, wurden durch Zahlen (1) ersetzt und mit zwei Sternchen (**) versehen.
Namen und Orte von Kliniken wurden durch Buchstaben (X) ersetzt und mit zwei Sternchen (**) versehen. Die verwendeten Buchstaben sind keine Namensabkürzungen, sondern wurden willkürlich aus dem Alphabeth ausgesucht. Namen von Wohnorten wurden ebenso gekürzt. Drei Punkte ersetzen zum Teil Worte, die nicht ausgeschrieben wurden.
Im ersten Jahr gab es viele Tagebucheinträge. Diese habe ich in Gegenwartsform geschrieben. Vieles, was dann folgt, habe ich teilweise sehr sachlich mitgeteilt.
Ich bitte um Verständnis, wenn nicht alles im Fluss ist, denn ich habe 10 Jahre bis zur Vollendung dieses Buches gebraucht. Ich bitte um Beachtung, dass Gedanken, die ich zu früheren Zeiten hatte, genauso gewesen sind, auch wenn diese eventuell „verbittert“ wirken könnten. Danke.
Du ..
bist gekommen
um mich zu erinnern.
Daran was Liebe ist.
Du warst ein Geschenk.
Es brauchte keine Worte.
Es brauchte nur Liebe.
Ich habe Sie erfahren.
Bedingungslosigkeit.
Durch Dich für mich.
Durch Mich für Dich.
Wir Beide durften
Ihn schließen.
Den Kreis.
Den Kreis zwischen Kind
und Erwachsenem.
Den Kreis zu Gott.
Irdisch gelebt.
Du bist zurückgekehrt.
Dorthin ..
woher Du kamst.
Woher Wir kommen.
Du hast erfüllt was Du zu erfüllen hattest.
Wir sind Liebe.
Wir waren immer Liebe.
Wir werden immer Liebe sein.
Du bist gekommen
um mich zu erinnern.
Martin Uhlemann
Vorwort
Begegnet bin ich Vera das erste Mal im September 2012. Unsere Wege kreuzten sich, als ich mich entschlossen hatte, an der Ausbildung zur Integralen Lebensberatung teilzunehmen. Als Nachzüglerin traf ich auf eine Gruppe von 50 Menschen, die unterschiedlicher kaum sein konnten. Bei aller Verschiedenheit verband uns doch eine gemeinsame Intention: persönliches Wachstum und der tiefe Wunsch, Menschen durch die Herausforderungen des Lebens bestmöglich zu begleiten. Vera fiel mir bereits am ersten Tag besonders auf. Ohne etwas über ihren bisherigen Lebensweg zu wissen, ahnte ich, dass sie eine Frau ist, die eine besondere Geschichte in sich trägt. Bei allem Optimismus, den sie verbreitete, ihrem Lachen, das durch den Raum wehte, umgab sie ein Hauch von Trauer und Wehmut.
Wir lernten uns näher kennen und Vera erzählte mir von ihrem Sohn Julian. Julian, der IMMER DA ist, der sie begleitet und oftmals leitet.
Bereits zu der Zeit, als ich Vera kennenlernte, schrieb sie an diesem Buch. IMMER DA zu schreiben war eine Herausforderung für sie. Immer wieder gab es Zeiten, in denen sie ihren Schreibfluss unterbrach, in denen sie sich eine Pause von ihren Erinnerungen und Tagebüchern nahm, doch nicht ein einziges Mal ließ sie mir gegenüber verlauten, dass sie ihr Vorhaben, IMMER DA zu schreiben, aufgibt. Vera blieb dran – und stellte sich damit zum zweiten Mal den tiefsten, höchsten, liebe- und schmerzvollsten Erlebnissen und Erfahrungen ihres Lebens mit Julian.
Entstanden ist ein emotional tief bewegendes und nachdenklich stimmendes Buch. Vera lässt uns in ihrer autobiographischen Erzählung an Julians, in Jahren kurzen und doch so reichen Leben teilhaben. An ihrem Leben als Mutter, die oft an ihre Grenzen stieß. Innen wie außen. Eine Mutter, die lernte, über sich selbst hinauszuwachsen, indem sie ihre persönlichen Bedürfnisse und Grenzen anerkannte und ihnen Raum gab. Eine Frau, die niemals aufgab und stets ihrer Intuition folgte.
Vera erzählt, was Julians Behinderung für die Familie bedeutete, für ihre Ehe, wie sie lernte, mit der Einschränkung ihrer persönlichen Freiheit umzugehen, ihr Leben zu organisieren, sich wieder Freiräume zu schaffen. Von der Zeit der Trauer nach Julians Tod und den Konsequenzen, die aufgrund der Pflegeintensität von Julian folgten.
IMMER DA ist mehr als ein Buch. Wir werden in eine Lebensgeschichte hineingeworfen. In das Leben von Julian und seiner Familie, so tief, dass der Eindruck entsteht, wir wären Teil dieser Familie und während wir Seite für Seite umblättern, schleicht sich Julian sanft in unser Herz und bleibt für IMMER DA.
Es ist eine Leseerfahrung, die uns Demut lehrt, die aufzeigt, dass Schicksal zugleich auch Wachstum bedeuten kann, dass Annahme des Unerwarteten und Hingabe an den jetzigen Moment selbst die schwierigsten Situationen in Wunder der Liebe verwandeln können. Dass Dankbarkeit, gepaart mit einem gesunden Realismus, Türen öffnet – in erster Linie die Tür zu uns selbst.
Es ist mir eine Ehre, das Vorwort für IMMER DA schreiben zu dürfen und ich verneige mich in tiefer Hochachtung vor Vera und ihrem Lebensweg. Ihr Weg zeigt auf, wie wertvoll jeder Moment ist und dass selbst die schmerzvollsten Erfahrungen uns ein Geheimnis offenbaren, wenn wir gewillt sind, der unergründlichen Spur des Lebens zu folgen.
Silke Naun-Bates
(Lebensberaterin und Buchautorin)
Ein paar Worte zum Buch
„Immer da“ ist mehr als nur ein Buch. Es ist eine Herausforderung an den Leser, ein tiefes emotionales Geständnis der Autorin und eine beeindruckende, teilweise rationale Darstellung der Lebensweise mit einem schwerstbehinderten Kind.
Der Text wirkt anfangs wie ein Aufschrei tiefer Verzweiflung, bis das Annehmen dieser unumstößlichen Tatsache das Leben von Vera und ihrer Familie veränderte. Aber nicht nur veränderte, sondern auch beeinflusste und diese scheinbar beliebig ausgewählten Menschen an ihren Aufgaben wachsen ließ, bis sie schließlich über sich selbst hinauswuchsen.
Gleichzeitig ist es ein Buch über die Liebe, die stets ihre eigenen Wege geht, fordert, nimmt und doch unendlich viel zu geben vermag. Die Liebe zu einem besonderen Kind, das ein Leben gewählt hat, welches uns als gemeinhin gesunden Menschen gänzlich fremd erscheint.
Ich habe Julian nie kennen gelernt und nur über Erzählungen seiner Familie einen kleinen Zugang zu ihm bekommen. Doch spüre ich bis heute, wie vielfältig seine Spuren sind und wie sie noch immer nachwirken.
Es ist nicht einfach, sich auf dieses Buch einzulassen, doch wer es von Herzen tut, wird berührt sein und auch für sein eigenes Leben etwas Besonderes mitnehmen.
Meine Geschichte
Im Jahr 2017 war alles wieder so richtig präsent.
14 Jahre waren vergangen und genau 14 Jahre ist Julian alt geworden. Vielleicht eine magische Zahl für neue Entscheidungen. Und so beschloss ich genau in diesem Jahr, dass ich bis zu seinem Todestag auf positive Reaktionen der angeschriebenen Verlage warten werde. Es sollte so sein, dass sich keiner der Verlage für meine Geschichte öffnen konnte.
In den folgenden Aufzeichnungen schildere ich meine Erlebnisse rund um das LEBEN von Julian. Es sind nicht nur meine Gedanken und Sorgen dieser Zeit, ich werde auch über die Zeit nach seinem Gehen berichten.
Nach all den Jahren habe ich es geschafft, mit dem Erlebten gut im inneren Frieden zu sein und einen Sinn darin zu sehen. Heute schätze ich das Gelernte und schöpfe daraus für mein WeiterLEBEN Kraft, Zuversicht und Vertrauen.
Ich habe verstanden, dass man nicht mit Allem abschließen muss. Dies wurde mir von vielen Menschen in meinem Umfeld geraten. Viel wichtiger erscheint mir das Loslassen von Groll, erfahrenem Schmerz und auch von Erkenntnissen und Gedanken, die für mich in diesen vergangenen Zeiten bestanden.
Julians LEBEN hatte nicht nur einen Sinn für ihn, für mich und für meine Familie. Ohne ihn würde es dieses Buch nicht geben.
Ein Buch zu Ehren all derer, die IMMER DA sind: Mütter und Väter, Brüder und Schwestern, Töchter und Söhne.
Für die, die sich ein Leben lang auf eine außergewöhnliche Aufgabe einlassen, wie es das Leben mit einem behinderten Kind ist und womöglich dadurch das eigene Leben fast vollständig unterordnen.
Aber auch ein Buch zum Gedenken all derer, die noch IMMER DA sind: in unseren Gedanken, Erinnerungen und in unseren Herzen, so auch mein Julian.
Dieses Buch soll dem Leser einen Einblick in ein solches Familienleben geben. Ein Stück meines – unseres – Lebens. Gleichzeitig möchte ich mitteilen, dass ein solches Leben – gut strukturiert – durchaus normal sein kann. Tatsächlich waren meine Familie und ich ein richtig gutes Team. Wir hatten auch ganz oft auch etwas zu lachen. Wenn immer nur Trägheit und Resignation geherrscht hätte, hätten wir vieles nicht so gut überstanden.
Bei allem, was zu tun ist, sollte man sich jedoch nicht selbst vergessen. Jeder Mensch darf eigene Bedürfnisse haben, wenngleich diese in solchen Situationen kaum spontan sein können. So konnte auch ich eigene Zeiten für mich nutzen und diese intensiver wertschätzen. Zugegeben, es waren wenige, doch ich verstand sie bei Weitem nicht als selbstverständlich.
Viele der Menschen, die uns begleiteten, teilten mir bei den Vorbereitungen von IMMER DA mit, dass sie und sogar ihre eigenen Familien und Bezugspersonen aus unserem Miteinander-LEBEN Einiges gelernt haben.
Auch möchte ich berichten, was sich alles bis heute für mich und meine Familie verändert hat und wie wichtig weitere Begegnungen bei dieser Entwicklung waren. Ich selbst wäre heute nicht der Mensch, der ich jetzt bin. Dieses außergewöhnliche LEBEN erweiterte nicht nur mein Bewusstsein, sondern veränderte auch mein Denken.
In den letzten Wochen von Julians Leben verstärkte sich unsere ganz besondere Ebene, die ich bis heute als „nichtweltlich“ bezeichne. Es gibt Dinge und Geschehnisse, die nicht erklärbar sind und oft erst nach einer gewissen Zeit zu bemerkenswerten Erkenntnissen führen. Heute weiß ich umso mehr:
NICHTS ist selbstverständlich und
NICHT jeder Lebensplan geht auf!
Liebe Leserin, lieber Leser,
lassen Sie sich auf diesen LEBENSWEG ein. Den LEBENSWEG von Julian, mir und meiner Familie mit Höhen und Tiefen, Schmerz und Freude, Resignation und Kampfgeist, Wachstum und Sinneswandel, Trauer und Liebe. Begleiten Sie diesen LEBENSWEG über knapp 30 Jahre.
Vielen Dank
31.08.2003
Es war eine ruhige Nacht, ich hatte nicht aufstehen müssen. Marissa hatte bei uns schlafen wollen, was nach unserem Urlaub mit der Enge im Wohnwagen ja auch einmal wieder sehr schön war. Ich war zeitig ins Bett gegangen und hatte Walter gebeten, nach Julian zu schauen, so wie wir dies immer schon handhabten. Wie immer hatte ich abends alles vorbereitet für die morgendliche Teeration, die ich mit den – in zwei Spritzen aufgezogenen – Medikamenten in die Sonde geben würde. Das Tablett mit all diesen Dingen war am Fußende von Julians Bett auf einem Brett abgestellt.
Gegen halb neun stand ich auf und ging zur Toilette. Der Weg führte vorbei an Julians Kinderbett, welches quer vor dem Fußende unseres Bettes stand.
Danach zog ich die erste 20 ml-Spritze Tee auf, öffnete den Verschluss der Magensonde und sondierte Julian den Tee.
Oh Gott!
Julian bewegte sich nicht mehr!!!!!!!!!
Entsetzt rief ich: „Walter!“
Er war sofort wach – und die Kleine auch!
Ich zitterte am ganzen Leib, schrie und weinte…
… kein Leben
… keine Regung
… kein Atem
Mein Julian
Oh mein Gott!
Meine Kinder,
mein Mann...
dieser Schmerz...
zu sehen,
I. LEBENsplan
Ein zweites Kind! Alles war im Plan! Es würde zwei Jahre nach seinem Bruder Ende September 1989 geboren werden – alles schien perfekt! Die Beiden werden miteinander spielen können und es wird kein Problem sein, bald wieder in Teilzeit arbeiten zu gehen. Ja, es war ein guter Plan.
Seit knapp zwei Jahren lebten wir wieder in dem Hochhaus, in dem wir aufgewachsen waren. Mein Mann Walter und ich hatten uns im 15. Stock eine Eigentumswohnung gekauft und genossen unser gemütliches Heim, welches wir vor dem Einzug komplett renoviert hatten und in dem wir uns eines nagelneuen geräumigen Badezimmers erfreuen konnten. Wir hatten drei Zimmer, sodass es für die ersten Jahre genug Platz für zwei Kinder sein gab.
Die gesamte Hochhausanlage liegt an einem schönen See, der von vielen Bäumen umrandet ist und den ich schon früher von meinem Kinderzimmerfenster aus sehen konnte. Innerhalb der Siedlung werden die Wege zwischen den Häusern von viel Grün umgeben. Dort gibt es nicht nur einen Kindergarten, den man zu Fuß erreichen kann, sondern auch mehrere Spielplätze, auf denen wir uns bereits in unserer Kindheit ausgetobt hatten und zu Jugendzeiten in der Abenddämmerung mit Freunden trafen. Hier würden auch unsere Kinder viele Spielkameraden finden.
Als unser erster Sohn Marius 1987 geboren wurde, war es für Walter und mich die „Krönung“ unserer bereits acht Jahre bestehenden Beziehung. Ich kann mich noch sehr gut an die intensive Zeit und die starken Gefühle der ersten Tage und Wochen mit dem Kleinen erinnern. Mutter geworden zu sein, kann man nur so beschreiben: es ist noch viel schöner als „Frisch-Verliebt-Sein“! Die Liebe zu einem eigenen Kind ist etwas ganz Besonderes und mit nichts zu vergleichen!
Vorbei waren nun die Zeiten, da wir mit unseren Freunden ganze Nächte beim Grillen, Feiern und Zelten verbrachten. Das war für uns in Ordnung, denn wir waren nun Eltern und wussten, dass Anderes Priorität hatte.
Aufgrund unserer Arbeitssituation hatten wir zuvor kaum Chancen, gemeinsame Urlaube zu planen. Deshalb waren wir daran gewöhnt und nutzten die gemeinsamen Zeiten intensiv dafür, miteinander etwas in unserer Region zu unternehmen. Wir genossen den Sommer an verschiedenen Seen, freuten uns im Winter über den Schnee im nahegelegenen Spessart oder wagten uns auf das gefrorene Eis unseres Sees.
Aber auch zuhause fühlten wir uns immer sehr wohl. Wir waren dankbar, wenn Marius uns anlachte und sich durch Versteck- und Fangenspiele ermuntern ließ. Wir lachten mit ihm über quietschende Entchen in der Badewanne und waren stolz, wenn er ein Puzzle ganz alleine fertigstellte. Seine Bitte, ihm etwas vorzusingen, konnte ich ihm nur dann abschlagen, wenn fremde Zuhörer in der Nähe waren.
An schönen Tagen machten wir Spaziergänge, besuchten meinen Vater im nahegelegenen Schrebergarten und konnten beobachten, wie unser Bub mit zögerlichem Anlauf jede Pfütze durchqueren musste. Wenn wir mit dem Fahrrad unterwegs waren, fuhren wir meistens am Mainufer auf flachen Wegen entlang, um dann bei einem Eis oder auf einem Spielplatz Rast zu machen. Marius saß nur zu gerne in seinem Kindersitz auf meinem Fahrradlenker und konnte so die Welt auf anderer Ebene betrachten.
Gut vorbereitet war es kein Problem, mit einem Kleinkind unterwegs zu sein. Mit dem Auto besuchten wir Verwandte in Köln und Berlin. Sie freuten sich, den Kleinen auch endlich sehen zu können. Die Urgroßeltern und die Großtanten waren mächtig stolz.
Marius war nie ernsthaft krank. Nur einmal steckte er sich bei einem seiner Cousins mit Windpocken an. Trotz allem war er fröhlich und „litt“ nicht darunter, obwohl sogar sein kleines Gesicht mit roten Pocken übersät war. Mir tat es sehr leid, wenn er mich dann mit seinen hellen Augen ansah. Sein Lächeln brachte mich jedoch immer wieder auf andere Gedanken. Diese Krankheit war eine kurzfristige Sache.
In den frühen Morgenstunden kuschelte Marius am liebsten mit uns im „großen“ Bett oder schlief dort auch einmal eine ganze Nacht. Er war immer ein fröhliches Kind, hatte kaum Grund zum Jammern und konnte sich stundenlang mit Wäscheklammern beschäftigen oder sich an Gänseblümchen erfreuen.
Das Weihnachtsfest mit seinen erwartungsvollen Kinderaugen zu erleben oder die überraschten Ausrufe, wenn er ein buntes Osterei hinter einem Strauch fand, war ein außerordentliches Glück. Wir konnten ihm auch nicht wirklich böse sein, wenn wir ihn dabei „erwischten“, wenn er Süßigkeiten aus dem Schrank nehmen wollte, nachdem er feststellte, dass dieser einmal nicht abgeschlossen war und er sich unbeobachtet fühlte.
Gemeinsame Aktivitäten für Walter und mich, waren nur selten möglich. Nur wenn wir einen Babysitter für Marius hatten, ließ es sich einrichten, dass wir gemeinsam Essen, ins Kino oder auf ein Live-Konzert gehen konnten.
Alles in allem waren wir glücklich und zufrieden mit unserem Leben und unserem „Erstgeborenen“, wie ihn sein Vater oft liebevoll nannte. Es war schön zu sehen, wie Marius sich entwickelte und jeden Tag etwas Neues entdeckte.
Bald schon sollte sein Geschwisterchen auf die Welt kommen, dann würde unser Glück und unser Leben wohl nur noch perfekt sein, auch wenn sich dadurch wieder neue Einschränkungen ergeben werden.
Während ich im Pflegedienst arbeitete, war Marius sehr gut bei meinen Eltern untergebracht. Sie lebten mit meiner älteren Schwester Caren in der nachbarlichen Wohnung.
Alles war gut organisiert – überwiegend meine Mutter kümmerte sich vormittags um Marius. Aber auch mein Vater hatte Zeit für ihn, denn er hatte als selbständiger Architekt im gleichen Haus sein Büro nur eine Etage tiefer.
Marius spielte zu gerne mit Mark und Kevin, den beiden Söhnen meiner jüngeren Schwester Ellen. Wenn ich Spätdienst hatte, war er oft bei ihr, wo ihn Walter dann abholte. Wenn meine ältere Schwester Caren Zeit hatte, ging sie mit ihm spazieren. Er genoss die Zeit an den Wochenenden, die er mit seinem Papa allein verbringen durfte, wenn ich im Dienst war. Ich wusste wohl, dass er in dieser Zeit auch einiges tun durfte, was ich vermutlich nicht erlaubt hätte.
Walter musste als Maler in seinem ehemaligen Lehrbetrieb oft Überstunden machen. So war unter der Woche tagsüber kaum eine Unterstützung in der Kinderbetreuung durch ihn möglich. Das war so für uns in Ordnung, denn damals hätten wir an dieser Situation nichts ändern können und auch nicht wollen. Wir gingen beide gerne unserer Arbeit nach und hätten es uns nicht anders vorstellen können.
Ich hatte immer sehr gerne in der Krankenpflege gearbeitet, doch dachte ich auch darüber nach, dass es schön wäre, mehr Zeit mit meinem Kind verbringen zu können. Wir könnten an den Vormittagen spazieren gehen oder spielen und ich müsste ihn nicht jeden Morgen so früh wecken. Natürlich war es von Vorteil, dass ich Marius nur über den Flur zu meinen Eltern bringen und ihn nicht auch noch komplett anziehen musste. Auch seine Spielsachen waren so immer in der Nähe.
Manchmal wünschte ich mir, einfach ein bisschen mehr zuhause zu sein, Marius hätte dann seinen Schlafanzug bis mittags anlassen können, wenn es uns danach gewesen wäre.
Aber auch damals genügte uns ein Einkommen nicht. Wir hatten die Eigentumswohnung gekauft und waren finanziell darauf angewiesen, dass auch ich etwas dazu beitrug. Wegen der humaneren Dienstzeiten hatte ich nach zehn Monaten Erziehungszeit in einen Pflegedienst gewechselt. Der Frühdienst begann dort erst um kurz vor acht Uhr. Schichtarbeit in einer Klinik wäre kaum möglich gewesen, da auch Walter schon um 6:30 Uhr aus dem Haus musste.
Meine Arbeit machte mir viel Spaß, viele nette Patienten durfte ich versorgen und auch einmal einen Plausch mit ihnen halten. Ich hatte ein eigenes Dienstfahrzeug und somit war alles entspannter, da wir immer nur ein einziges Auto finanzieren mussten.
Wir hatten wirklich alles, was man sich nur wünschen konnte und nun sollte das Glück noch perfekter werden. Mit einem zweiten Kind, das unsere kleine Familie komplett machen würde, so wie wir es uns immer gewünscht hatten.
Am Sonntag, dem 5. Februar, wollten wir den Faschingszug in unserer Kreisstadt besuchen. Im Jahr zuvor hatten wir mit der Clique und einem eigenen Wagen am Umzug teilgenommen. Vorneweg hatte ich damals Marius in seinem Kinderwagen geschoben, während ich Bonbons in die Menschenmenge warf. Das war für mich ein einmaliges, unvergessliches Erlebnis.
Dieses Mal würden wir wieder Zuschauer sein. Ich war sehr gespannt, wie mein kleiner Sohn diese Attraktion erleben würde. Das Wetter war perfekt für diesen Tag: trocken, leicht sonnig und nicht zu kalt.
Marius hatte sich schon Tage zuvor gefreut, endlich sein Kostüm anziehen zu können. Nach unseren Erklärungen zu dieser Veranstaltung freute er sich nun auf eine reichliche Ausbeute an Bonbons und weiteren Süßigkeiten. Seine blonden Locken verschwanden zum Teil unter der von mir gestrickten Marienkäfermütze passend zum Kostüm. Auf sein Näschen malte ich noch einen runden schwarzen Punkt und fertig waren wir!
Wir verabredeten uns mit den Schwiegereltern und Walters Schwester Trixi am gleichen Treffpunkt wie in den vergangenen Jahren. Garantiert würde keine Langeweile aufkommen, während wir auf den Beginn des Zuges warten wollten.
Die ersten Wagen konnte man schon von weitem hören, während sie sich langsam durch die frei gehaltene Gasse der Straße schlängelten. Stimmungsmusik sowie Instrumenten-Darbietungen von Musikvereinen aus unserer Gegend untermalten die Attraktion. Menschen in farbenfrohen Kostümen riefen in Feierlaune laut „Helau“ aus den Wägen und warfen im Vorbeigehen Bonbons und Konfetti in die Zuschauermenge.
Walter trug Marius die meiste Zeit auf dem Arm oder setzte ihn auf seine Schultern. Von dort oben konnte er den Trubel mit großen Augen verfolgen. Ich fing die bunten Bonbons für ihn oder sammelte sie vom Boden auf und hortete sie in einer Tasche. Es muss wohl für ihn ein kleines Abenteuer gewesen sein, denn seine Aufregung war förmlich zu spüren. Ich freute mich, dass er so viel Spaß daran hatte.
Nach einer Weile suchte ich nach meinen Eltern, die unweit unseres Platzes mit Bekannten verabredet waren, um sie kurz zu begrüßen. Auf dem Rückweg traf ich eine ehemalige Arbeitskollegin, sodass ich eine Weile nicht in der Nähe meiner Familie stand. Ich bekam mit, wie durch die Menschenmassen ein Rettungsfahrzeug mit Blaulicht fuhr, machte mir jedoch keine Gedanken darüber. In diesem Moment rannte mir Trixi völlig verzweifelt entgegen. Atemlos und aufgeregt teilte sie mir mit, dass Marius vom Rettungsdienst in die Klinik gefahren worden war, da er fast von einem der Lastzüge überrollt worden wäre. Mein Gott, dieser Schrei in mir durchfuhr meinen ganzen Körper. Völlig verzweifelt rannte ich sofort ins Krankenhaus, welches ich nach fünf Minuten erreichte. Da saß der Kleine in der Notaufnahme auf dem Schoß seines Vaters und weinte wegen der Schmerzen in seiner Hand. Jede seiner Tränen waren auch meine. Es „zerriss“ mir das Herz! Marius war sichtlich froh, dass ich nun auch vor Ort war und wich mir nicht von der Seite.
Walter erzählte mir, dass er Marius von seiner Schulter heruntergenommen und wieder auf den Boden gestellt hatte, als der Umzug dem Ende zuging. Eine daneben herlaufende Passantin hatte den Kleinen unachtsam umgestoßen, sodass Marius vor einen fahrenden Faschingswagen gefallen war. Walter hatte ihn zwar zurückgezogen, trotzdem war doch noch ein Reifen über seine kleine Hand gerollt. Zum Glück hatte der Rettungswagen in unmittelbarer Nähe gestanden und so konnte gleich geholfen werden. Vor lauter Panik hatte niemand sofort daran gedacht, mir Bescheid zu geben. Das war sicherlich auch gut so!
Ich machte mir selbst Vorwürfe, nicht bei meinem Kind geblieben zu sein, war aber auch verärgert über die unvorsichtige Passantin. So machte ich mir Gedanken darüber, was in nur einer EINZIGEN Sekunde passieren kann. Ich beruhigte mich wieder und war einfach nur froh, dass alles doch nicht so schlimm war.
Nachdem beim Röntgen starke Prellungen festgestellt wurden, bekam Marius eine Unterarm-Gipsschiene zur Schonung. Er hatte kaum noch Schmerzen, hätte aber zur Nacht noch ein Schmerz-Zäpfchen erhalten können, was uns der Arzt empfahl.
Gegen Abend verspürte ich Unterleibsschmerzen, war aber nach diesem Tag mit seinem dramatischen Ereignis kaum in der Lage, dies einzuordnen. Am Folgetag meldete ich mich krank, um den Frauenarzt aufzusuchen, der mich nur für diesen Tag krankschrieb, da soweit alles in Ordnung war. Alles stabilisierte sich wieder und ich konnte wieder arbeiten gehen.
Aufgrund dieses krankheitsbedingten Ausfalles teilte ich zeitnah die „frohe Botschaft“ meiner Vorgesetzten mit, die sich über die Ankündigung des Nachwuchses freute. Meine Patienten, die auf meiner Tour zu versorgen waren, könnte ich während der Schwangerschaft auch weiterhin betreuen. Bei der körperlich anstrengenderen Pflege würde mich eine Kollegin oder ein Zivi (Abkürzung für Zivildienstleistende) unterstützen, wurde mir zugesichert. Außerdem war ja noch so viel Zeit bis zur Entbindung, die für den 25. September 1989 berechnet worden war. Über die Schwangerschaft machte ich mir keine Sorgen. Bei Marius hatte ich bis zum letzten Tag vor dem Mutterschutz Schichtdienst auf der unfallchirurgischen Station in Vollzeit verrichten können. Hochschwanger hatte ich sogar noch den Umzug vorbereitet, geplant und beim Umbau in der Wohnung mitgeholfen.
Die Erziehungszeit mit Erziehungsgeldansprüchen war inzwischen auf ein Jahr erhöht worden und die Leistungen würden mir vermutlich auch wieder komplett zukommen. Ich hatte keine Bedenken, dass auch mit zwei Kindern alles gut zu strukturieren und organisieren wäre. Warum sollte ich nicht auch das hinbekommen? Die Frage des anschließenden Wiederarbeitengehens stellte sich vorerst nicht. Ob nun in etwas weniger Teilzeit im Pflegedienst oder Nachtdienste in einer Klinik, alles wäre nach einem Jahr sicher wieder möglich. Im öffentlichen Dienst könnte ich mich auch erst einmal drei Jahre beurlauben lassen. Entscheidungen darüber waren jedoch vorerst nicht zu treffen.
II. LEBENswille
Mitte März verspürte ich während des Dienstes leichte, ziehende Schmerzen im Unterleib. Marius schlief, als ich von der Arbeit nach Hause kam und so legte ich mich ebenfalls hin. Gegen 15 Uhr wurde ich wach, weil mein Bett wackelte. Das Hochhaus war in Schwankungen gekommen, was ich so noch nie zuvor erlebt hatte. Schon aus der Kindheit kannte ich es, Auswirkungen von Erdbeben aus angrenzenden europäischen Regionen zu „registrieren“. Darüber musste ich mir keine Sorgen machen.
Bei all dieser Unruhe verspürte ich ein starkes Ziehen im Unterleib und stand auf. Erschrocken stellte ich fest, dass ich Blutungen hatte. Unter Tränen weckte ich Caren, die am Vormittag auf Marius aufgepasst hatte und auf der Couch schlief. Ich hatte Angst um dieses ungeborene Wesen und musste unentwegt weinen. Meine Schwester Ellen kam mit ihren Kindern und fuhr mich zum Frauenarzt, wo ich sofort untersucht werden konnte. Dieser klärte mich auf, dass er mich in die Klinik einweisen müsse. Bei der Ultraschalluntersuchung waren die Herzschläge des ungeborenen Babys auf dem Monitor zu sehen, was mir Sicherheit vermittelte. Trotzdem teilte der Arzt mir mit, dass es passieren könnte, das Kind zu verlieren. Geschockt und ständig weinend warf ich zuhause meine Sachen in die Reisetasche.
Walter musste verständigt werden, daher rief ich die Ehefrau seines Chefs an, sie möge ihm ausrichten, dass er sich umgehend zuhause melden solle, sobald er von der Baustelle zurück wäre. Mein kleiner Sohn verstand das alles nicht und doch hatte er meine Ängste wohl auch fühlen können und wirkte ebenso traurig. Nun sollte ich von ihm getrennt sein, was zuvor immer nur stundenweise geschehen war. Keine Gutenacht-Geschichte von Mama und keinen Gutenacht-Kuss. Schweren Herzens trennte ich mich von ihm, um mich in die Klinik bringen zu lassen. Nach der Aufnahme im Krankenhaus wurde ich untersucht. Mit meinem Ungeborenen war soweit alles in Ordnung, wie mit dem Ultraschallgerät gesehen werden konnte. Nun musste ich liegen und durfte noch nicht einmal aufstehen, um zur Toilette zu gehen. Ich hatte unglaubliche Angst, mein Kind zu verlieren.
Es war ein altes Krankenhaus, welches um die Jahrhundertwende erbaut worden war. Von breiten Gängen mit hohen Wänden gingen die Zimmer ab, die mit bis zu sechs Krankenbetten ausgestattet waren. In jedem Zimmer gab es ein Waschbecken mit einem Vorhang als Sichtschutz und große doppelflügelige Fenster, von denen aus man auf den Pfortenbereich mit dem Hubschrauberlandeplatz und die Blumenbeete schauen konnte. Auf dem Gang befanden sich Gemeinschaftstoiletten sowie auf wenigen Stationen auch ein Pflegeduschbad. Insgesamt waren alle Stationen etwas unübersichtlich angelegt und teilweise ohne räumliche Trennung. Die gynäkologische Station war in der ersten Etage mit dem Aufzug zu erreichen. Es war für mich ein Glück, dass mich die Schwestern noch aus der Ausbildungszeit kannten. Somit hatte ich den Luxus in einem Einbettzimmer untergebracht zu werden. Ruhe war nun angesagt und es war auch gut, dass ich keine Zimmernachbarinnen hatte.
Ich lag alleine im Bett und fühlte mich, getrennt von meiner Familie, auch genau so. Sehnlichst erwartete ich den Besuch von Walter. Als er dann kam, nahm er mich in die Arme und ich fing wieder an zu weinen. Ich erzählte ihm, was alles passiert war und von meiner Angst – Angst, das Kind zu verlieren.
Als Walter gegangen war, hielt ich meine Hände schützend auf meinen Bauch und fragte mich immer wieder, was wohl noch kommen würde. Ich selbst konnte nichts weiter tun, als ruhen und abwarten.
Warum habe ich in dieser Schwangerschaft
solche Probleme?
Fast vollständige Bettruhe einhalten zu müssen, ohne das Zimmer verlassen zu können, bedeutet, dass man vieles im Bett erledigen muss (Körperpflege, Ausscheidungen etc.) Nun war ich selbst Patient und machte diese Erfahrung am eigenen Leib.
Walter besuchte mich täglich mit oder ohne Marius, denn er war oft auch bei den Großeltern, die ihn dann mitbrachten.
Ich hatte den „Luxus“, vom Zimmer aus telefonieren zu können. Damals war das kein Standard. So konnte ich nach vorherigem Einwählen durch den Pförtner mit Marius telefonieren. Obwohl ich mich am Telefon nicht viel mit ihm unterhalten konnte, war es immer schön, seine Stimme zu hören. Anrufe von Walters Tante Elly aus Berlin heiterten mich auf und beruhigten mich immer wieder. Sie war auch Krankenschwester und hatte eine besondere Art, mir Kraft und Zuspruch zu geben.
Ich las viel und konnte mich mit dem kleinen tragbaren Fernseher etwas ablenken, den Walter mitgebracht hatte.
Mein Zustand besserte sich und ich konnte glücklicherweise bereits nach einer knappen Woche wieder entlassen werden. Ich sollte jedoch auch zuhause ruhen und war von diesem Zeitpunkt ab krankgeschrieben.
Inzwischen erfuhr ich, dass in einem ca. 150 Kilometer weit entfernten Ort in der Rhön eine Sprengung ein Erdbeben verursachte und dies die Schwingung unseres Hochhauses ausgelöst hatte.
Meine Gedanken bewegten sich jedoch nicht mehr um dieses Ereignis, obwohl es sich ja doch um etwas Außergewöhnliches handelte. Für mich war es nur noch wichtig, meinem Baby zuliebe zu ruhen.
Jede Woche fuhr mich Ellen zu meinem Frauenarzt zur Untersuchung. Der Arzt erzählte davon, dass ich Anspruch auf eine „Haushaltshilfe“ hätte, die durch die Krankenkasse finanziert werden konnte (Anspruch besteht bei im Haushalt lebenden Kindern unter zwölf Jahren, bzw. Kindern mit Behinderung. Siehe auch bei den Begriffserklärungen am Schluss des Buches). Durch ein zufälliges Treffen von Walter mit unserer Bekannten Karin kam die Idee auf, dass sie diese Hilfe übernehmen könnte. Durch ihre Unterstützung ging dann zuhause alles etwas entspannter zu. Karin hatte auch einen kleinen Sohn, den sie oft mitbrachte. So musste Marius nicht immer auf seinen Papa, die Tanten oder die Großeltern warten, um an die frische Luft oder zum Spielplatz zu kommen und hatte einen Spielkameraden.
Ende März bekam ich ganz plötzlich wieder stärkere Blutungen, sodass ich sofort meinen Frauenarzt anrief. Ich war völlig fertig und weinte wieder unentwegt. Er empfahl, sofort in die Klinik zu fahren, sollte es noch schlimmer werden. Ab sofort blieb ich wieder dauerhaft liegen. Nach zwei Tagen flehte mich Walter fast an, nun doch in die Klinik zu fahren. Es ging mir immer schlechter, da ich auch noch zusätzlich an einer Erkältung litt.
So ließ ich mich doch wieder in die Klinik bringen. Der Arzt untersuchte mich und wir konnten auf dem Ultraschallmonitor unser winziges Baby sehen. Es war schlimm, zugleich dieses kleine Wesen und dann das skeptische Gesicht des Arztes zu sehen. Ich hatte die ganze Zeit nicht aufhören können zu weinen.
Mehr als uns gegenseitig zu trösten und darauf zu hoffen, dass alles gut werden würde, blieb uns nicht.
Die Ursache sei eine Eihautablösung und vorzeitige Wehen, erklärte uns der Arzt.
Per Infusion (mit Infusomat mit eingestellter Stundenlaufzeit) bekam ich nun rund um die Uhr wehenhemmende Medikamente in die Vene verabreicht. Dies schränkte meine Mobilität noch zusätzlich ein. Ich hatte wieder strenge Bettruhe, was in einem Mehrbettzimmer nicht unbedingt angenehm ist.
In meiner Verzweiflung betete ich sehr oft. Ich vertraute darauf, dass sich alles so fügen möge, wie es sein solle. Meine Angst, das Kind doch noch zu verlieren, war jedoch immer da.
Will dieses Kind nicht leben?
Immer wieder kreisen meine Gedanken darum!
Walter ging während dieser Zeit weiterhin regelmäßig zur Arbeit, kümmerte sich liebevoll um Marius und besuchte mich pünktlich jeden Abend. Erst viel später erfuhr ich, dass er oft müde und unkonzentriert auf der Arbeit war und auch einige Fehler gemacht hatte, die ihm sonst nicht passiert wären.
Marius war unter der Woche oft bei den Schwiegereltern. Es gab einige Tage, an denen ich ihn nicht gesehen habe. Ich litt sehr darunter, von meinem kleinen Kind getrennt zu sein. Das ist wohl für keine Mutter einfach.
Auch Arbeitskolleginnen kamen zu Besuch und ließen schöne Grüße von meinen Patienten ausrichten.
Schon bald hatte ich einen „Krankenhauskoller“, weinte nur noch, sehnte mich nach meiner Familie und meinem Zuhause. Mein Kind wurde mir immer fremder, die schönsten Zeiten des Tages verbrachte er nicht mit mir. Als meine Schwiegermutter ihm dann bei einem Besuch ohne seine Aufforderung den Schnuller in den Mund steckte, wurde ich sauer. Ich wollte nicht, dass er tagsüber den Schnuller nimmt! Das ließ ich sie zum wiederholten Mal wissen. Daraufhin verließen sie das Zimmer. Es war alles zu viel für mich. Ich heulte Walter die Ohren voll, dass ich das alles nicht mehr aushalten könne. Ich wollte doch miterleben, wie mein Kind jeden Tag etwas Neues entdecken und neue Worte sprechen lernen würde. Ich jammerte und hatte das Gefühl, dass mir alles Glück zunehmend entglitt. Walter versuchte mich zu beruhigen und meinte, ich solle mit dem Arzt darüber reden. Karin hatte sich gut eingearbeitet und kümmerte sich prima um den Haushalt.
Nach mehr als zwei Wochen wollte ich dann sogar das Krankenhaus auf eigene Verantwortung verlassen. Die Medikation sei bereits einige Zeit auf Tablettenform umgestellt, argumentierte ich bei meinem Stationsarzt. Diese könne ich auch zuhause einnehmen. Nach der Chefarztvisite wurde ich nach drei Wochen endlich entlassen.
Der Frühling hatte inzwischen ohne mich begonnen! Die Knospen an den Bäumen waren leuchtendgrün und die Frühjahrsblumen blühten in den schönsten Farben. All das hatte ich nur aus dem Krankenhausfenster sehen können. Nun konnte ich endlich wieder frische Luft einatmen und war froh, wieder nach Hause zu kommen.
Das Bangen um mein Baby, dieses kleine Wesen, dessen Leben doch gerade erst beginnen sollte, bestimmte die nächsten Monate das Zusammenleben unserer Familie.
Insgesamt war es sehr erleichternd, dass Marius kein „Mamakind“ war und er während meines stationären Aufenthalts gut damit zurechtgekommen war. Nun war ich wieder da, konnte mich mit ihm beschäftigen und ihm etwas vorlesen. Es tat mir jedoch sehr leid, dass ich nicht in der Lage war, ihn zum Spielplatz zu begleiten.
Auch Hochheben durfte ich ihn nicht, was jedoch im Alltag mit einem Kleinkind kaum komplett zu vermeiden ist. Wenn ich alleine mit ihm war, konnte ich jederzeit meine Mutter zu Hilfe holen. Schon während meiner Klinikaufenthalte durfte er oft bei Papa im Bett schlafen und war nun offensichtlich froh, dass nun auch seine Mama wieder dabei lag. Meine Familie unterstützte mich so gut sie konnte. Meine Mutter kochte Essen, ging mit Marius spazieren und machte für uns die Einkäufe.
Durch das Ruhen war ich vom Leben draußen abgeschnitten. Das galt für Kontakte, Unternehmungen und zeitweise sogar für mein Kind. Aber es sollte ja nur eine gewisse Zeit sein und ich musste das einfach durchhalten. Auch der Sommer sollte wohl spurlos an mir vorübergehen, denn ich musste ruhen, ruhen und nochmals ruhen. Während sich alle anderen in Schwimmbädern oder am See vergnügten, lag ich auf dem Bett oder der Couch, las einen Roman nach dem anderen oder schaute Fernsehen.
Aber ich sollte für dieses „Opfer“ mit einem Kind belohnt werden und daher war diese Zeit absehbar. Kleine Bewegungen des Babys konnte ich sehr intensiv spüren. Dies kannte ich so nicht, denn in meiner ersten Schwangerschaft war ich viel unterwegs gewesen und hatte nicht so viel Ruhe. Es ist ein besonderes außergewöhnliches Gefühl, wenn sich so ein kleines Wesen im Unterbauch bemerkbar macht. Ein leichtes Klopfen an meiner Bauchdecke spürte ich immer wieder. Ich kann es kaum beschreiben, weil es einfach nur schön war. Meine Hosen passten nicht mehr, der Bauch wuchs, jedoch hätte niemand vermutet, dass ein zweites Kind unterwegs war, da ich trotzdem noch sehr schlank war.
An den zunehmend warmen Wochenenden fuhren wir zu den Schwiegereltern. Sie bewohnten ein älteres Haus mit einem schönen Garten. Dort konnte Marius spielen, sich mit deren Hund amüsieren und schaukeln, während ich mich auf dem Liegestuhl entspannte und mir die Sonne auf den Bauch scheinen ließ. Die Schwiegereltern versorgten uns gut und gerne. Um Essen und Trinken mussten wir uns nicht kümmern.
Ich wagte nur sehr kurze Wege in Begleitung von Walter an den Wochenenden; stets war Marius dabei fröhlich, verpasste keine Pfütze oder fuhr uns mit seinem Dreirad davon.
In diesen langen Wochen sah ich oft außer meiner Familie, Karin und meinem Frauenarzt keinen einzigen Menschen. Zu den Praxisbesuchen brachte ich eine Videokassette mit und dann wurden Ultraschalluntersuchungen aufgezeichnet.
Wie schnell das Baby doch gewachsen war:
das kleine Herzchen klopfte
und ich konnte den Kopf und
auch die Ärmchen sehen!
Alles war gut organisiert, sodass ich mir keine Sorgen machen musste. Ich ruhte, nahm meine Medikamente zu festen Zeiten (auch nachts) ein und las viel. Ich kümmerte mich zuhause um Marius, soweit das ohne körperliche Anstrengung möglich war. Ich vermisste trotz allem meine Freiheit, selbständig die Wohnung zu verlassen.
Dieses „Eingesperrt-Sein“ stand mir oft jedoch bis zum Hals, obwohl mir ja nichts anderes übrigblieb. Marius lenkte mich immer wieder mit seinem freudigen Wesen ab, sodass ich diese Gedanken zum Teil wieder vergaß. An guten Tagen konnte ich es nicht lassen, leichte Hausarbeit zu machen. Das begrenzte sich aber aufs Aufräumen und Geschirr spülen. Ich telefonierte viel mit Freunden und Verwandten, um weiterhin Kontakte zu halten.
Dabei konnte ich mich auch immer über den Zustand meiner Freundin Martina aus Berlin erkundigen, die mit dem dritten Kind schwanger war. Rein zufällig hatten wir sogar genau den gleichen Entbindungstermin. Sie ging noch in Teilzeit arbeiten und alles war in Ordnung. Wir hatten die Ausbildung zur Krankenschwester gemeinsam absolviert und später auf der gleichen Station gearbeitet. Ihre beiden älteren Kinder waren bereits meine Patenkinder.
Plötzlich erlitt ich am 11. Juli 1989 den Blasensprung. Das war in der 29. Schwangerschaftswoche und damit viel zu früh. Mein Frauenarzt beruhigte mich, als er mir mitteilte, dass es nun wohl doch zu einer Frühgeburt kommen würde. Ich solle mir keine Sorgen machen, mit moderner Intensivmedizin hätte das Kind gute Chancen. Sofort musste ich wieder in stationäre Versorgung. Es war keine Zeit zum Warten, sodass ich mit dem Taxi in die Klinik fuhr. Marius blieb bei meiner Mutter, sie arbeitete zum Glück nur wenige Stunden bei meinem Vater im Büro und hatte daher meist flexibel Zeit.
In der Klinik wurde sofort das CTG (Cardio-Tocogramm / Wehenschreiber) angelegt. Der mir gut bekannte Stationsarzt kam hinzu und bedauerte, dass ich „es nun doch nicht weiter geschafft“ hätte, beruhigte mich jedoch, indem er mir vermittelte, gut aufgehoben zu sein. Wieder wurden Infusionen mit wehenhemmenden Medikamenten angehängt und Bettruhe verordnet. Die Herztöne des Babys waren rhythmisch (stets zwischen ca. 120 und 150 Schläge pro Minute), leichte Wehen wurden aufgezeichnet.
Dieses Mal war ich auf der Wöchnerinnen-Station, auf der ich nach meiner Ausbildung ein halbes Jahr gearbeitet hatte. Daher war ich sehr vertraut mit den Räumlichkeiten und dem Personal dieser Station und des Kreißsaales. Das war durchaus ein Vorteil und ließ Vertrautheit zu. Die Ungewissheit und die Angst, was nun werden würde und das stetig wiederkehrende Ziehen im Unterbauch ließen mich kaum zur Ruhe kommen. Sofort wurden notwendige Prophylaxen durchgeführt, um die Lungenreife des Kindes zu unterstützen sowie Infektionsprophylaxen zur Geburtsvorbereitung als Standard bei vorzeitigem Blasensprung. Jede Stunde musste ich die Körpertemperatur messen und notieren. Mir wurde erklärt, dass bei Temperaturanstieg sofort eine Geburt in die Wege zu leiten wäre per Kaiserschnitt. Ich sollte erst einmal „nüchtern“ bleiben und bekam nichts zu essen und zu trinken. Nach einigen Stunden im Kreißsaal wurde ich in ein Vierbettzimmer verlegt, verstand mich sofort mit den anderen Schwangeren und einer Mutter, die bereits eine Frühgeburt hinter sich gebracht hatte. Ich hielt wieder Bettruhe und spürte dabei, dass das Kleine auch zur Ruhe kam. Dann bemerkte ich wieder seine Bewegungen und wünschte, dass es noch so lange wie möglich in meinem Bauch bleiben durfte.
Am Abend erzählte Walter mir, dass Marius sehr viel Spaß beim Spielen mit seinen Cousins und auch mit seiner Tante Trixi und deren Hund hatte. Ich musste mir um meinen großen Sohn keine Sorgen machen.
Am nächsten Tag erkrankte Walter fiebrig und kam nicht. Und das an seinem Geburtstag!
Am darauffolgenden Tag, dem 13. Juli, war sehr viel Betrieb auf der Station. Meine Bettnachbarin Manuela, die schon einige Wochen stationär lag, bekam nun auch zunehmend Wehen in der 34. Schwangerschaftswoche. Es entstand insgesamt eine bis dahin ungewohnte Unruhe im Zimmer, denn die Hebamme sah immer wieder nach ihr. Im Kreißsaal war viel zu tun und so hatte sie kaum Zeit, das CTG im Zimmer anzulegen. Deshalb legte ich es mir teilweise selbst an (ich wusste ja wie, da ich auf dieser Station schon einmal gearbeitet habe). Schon bald wurde ich in einen anderen Raum gebracht, um mehr Ruhe zu haben und von der Hebamme aus der Nähe besser überwacht werden zu können. Gegen Abend verschlechterte sich mein Zustand, das CTG zeigte fast permanent Wehen an und die Herztöne des Babys fielen dadurch immer wieder etwas ab. Innerhalb weniger Minuten wurde entschieden mein Kind per Kaiserschnitt (Sektio) zu holen. Mehr als zehn Wochen zu früh!!!
Ich ließ alles mit mir machen, denn ich war von den letzten Tagen und den vergangenen nervenaufreibenden Monaten einfach nur endlos erschöpft.
NOT-SEKTIO
Mein zweiter Sohn Julian Andreas wurde am 13.07.1989 um 21:06 Uhr mit einem Gewicht von 960 Gramm und einer Körpergröße von 34 Zentimetern geboren.
Der Kleine wurde sofort mit dem Rettungswagen in die Kinderklinik verlegt, sodass ich ihn nicht sehen konnte, da ich noch in Narkose lag. Walter wartete auf dem Gang vor dem Operationssaal. Als ich herausgeschoben wurde, teilte er mir freudig mit, dass er den Kleinen habe sehen können und er aber doch sehr klein sei. Walter blieb noch eine Weile bei mir, obwohl ich eigentlich nur geschlafen hatte.
Auch meine Bettnachbarin Manuela wurde gegen Morgen wieder in unser Zimmer gebracht. Sie hatte in der gleichen Nacht ihren ersten Sohn auf normalem Geburtsweg mit einem Gewicht von knapp 2.000 Gramm entbunden.
Am nächsten Tag war Walter schon in der Kinderklinik gewesen. Julian würde beatmet und hätte eine Unmenge an Schläuchen an seinem kleinen Körper. Es ginge ihm den Umständen entsprechend gut und er habe wie sein Bruder – und Walter selbst – blonde Haare! Die Polaroid-Fotos von der Intensivstation ließen vieles vermuten – ich war sehr gerührt, aber auch noch zu schwach, um alles richtig wahrzunehmen.
Marius war bei seinen Großeltern auch über Nacht gut untergebracht. Dort konnte er sich freier bewegen und sein Vater war etwas flexibler. Ein Besuch von ihm wäre die ersten Tage in beidseitigem Interesse nicht sinnvoll gewesen. Walter lieh sich eine VHS-Videokamera aus und zeigte mir einen Tag später die Aufnahmen auf dem Display. Julian war wirklich ein winziges kleines Wesen! Beatmet im Brutkasten zappelte er ein wenig mit seinen Ärmchen und Beinchen. Es war so erleichternd zu wissen, dass es ihm nach all den Strapazen der letzten Monate gut ging.
Frisch operiert war ich sehr geschwächt, hatte starke Schmerzen, vor allem durch die Nachwehen und schlief viel. Zweimal täglich wurde ich mit Hilfe der Schwestern kurz zum Bettenmachen mobilisiert, bekam die ersten drei postoperativen Tage nichts zu essen, sondern ausschließlich Infusionen. Nach Entfernen der Bauchdrainagen (im Untergewebe liegende kleine Schläuche zur Absaugung von Blut und Sekreten) und des Blasenkatheters war ich wieder etwas mobiler und konnte endlich meine eigene Kleidung anziehen. Der Einschuss der Muttermilch wurde von Anfang an täglich durch Abpumpen mittels einer elektrischen Muttermilchpumpe forciert. Als ich wieder aufstehen konnte, suchte ich zu dem Zweck des Abpumpens einen Raum am Ende des Ganges auf. Dort war man ungestört und die Kinderkrankenschwestern standen mit Rat beiseite. Sie füllten die Milch in kleine Gläschen ab, die mit Namen und Datum gekennzeichnet und dann eingefroren wurden. Das war noch sehr anstrengend. Ich hatte jedoch den Ehrgeiz, so schnell wie möglich fit zu werden und stand immer wieder auf, um ein paar Schritte zu gehen. Julian konnte ich erst nach vier Tagen besuchen, vorher hätte ich diese weiten Strecken noch nicht laufen können. Walter holte mich aus dem Krankenhaus ab und erklärte mir in der Kinderklinik die Instruktionen, die man als Besucher zu tätigen hatte: Schutzkleidung, Schleuse und Händedesinfektion.
Oh, mein Gott
was für ein winziges kleines Kind!
Mein Kind – mein Baby – ich weinte vor Glück! Glücklich darüber, dass er lebt, aber auch, dass er nun weiterleben durfte außerhalb meines Körpers. Seine blonden Haare glänzten an seinem winzigen Köpfchen. Diese erste Begegnung mit meinem zweiten Kind war so anders als erwartet. Ich fühlte mich schlecht. Ich konnte ihn nicht in den Arm nehmen (das war zu diesem Zeitpunkt den Eltern nicht gestattet). Er war so klein. So nah konnte ich ihn sehen und anfassen und doch war er so fern von mir.
Trotz meiner beruflichen Vorbildung war es ein Schock, wie mein Kleiner da so lag und sehr schlimm für mich, ihn so zu sehen. Ich war traurig, dass ich ihm diesen wertvollen Schutz, den mein Körper ihm noch so viele Wochen hätte bieten sollen, nicht mehr geben konnte.
So viel Technik und Unruhe für dieses kleine Wesen! Das letzte Viertel einer Schwangerschaft musste mein Baby nun umgeben von Medizin und künstlicher Wärme wachsen. Es tat mir so unendlich leid.
Durch die runden Luken-Öffnungen (zwei auf jeder Seite, für je eine Hand) im Inkubator (Brutkasten) konnten wir Julian streicheln. Er war so winzig – so zart und zerbrechlich! Ich traute mich kaum, ihn anzufassen.
Julian lag nackt nur mit einer offenen Miniwindel bedeckt auf einer Schaffellunterlage. Der Kleine wurde über einen Tubus (Beatmungsschlauch in der Luftröhre)beatmet, der in eins seiner Nasenlöcher geschoben und dort mit Pflaster fixiert war. In dem anderen Nasenloch lag eine Magensonde und es gab einige venöse Zugänge – teilwiese am Kopf – zur Versorgung mit Flüssigkeit und Medikamenten mittels Perfusor (sehr langsame Verabreichung milliliterweise von Flüssigkeiten über eine 100 ml-Spritze). Elektroden klebten auf seinem Brustkorb zur Überwachung der Herz- und Atemfrequenz über Monitore. Eine winzige Blutdruckmanschette war an seinem Beinchen fixiert.
Sein kleines Köpfchen passte gerade einmal in eine Männerhand, seine Arme waren so dick wie ein Männerdaumen, die Füße maßen höchstens vier Zentimeter.
Ich war einfach nur überwältigt von dieser ersten Begegnung mit diesem winzigen lebendigen Wesen – meinem Kind! Ich durfte ihn anfassen, ihn streicheln und einfach nur glücklich sein, darüber, dass er lebt.
Nach dieser ganzen Anstrengung war ich zudem wohl nicht ganz fähig, diese Situation vollständig mit allen Emotionen aufzunehmen.
Jeden Tag würde ich ihn nun besuchen, auch wenn es mich noch so anstrengen würde!
Da ich den Ablauf im Klinikbetrieb kannte, ließ ich mich am achten postoperativen Tag entlassen. Das war etwas früher als üblich. Manuela war auch längst zuhause, sie war ja nach einer „normalen“ Geburt schnell wieder fit. Wir hatten uns versprochen, in Verbindung zu bleiben und uns für ein Kaffeetrinken verabredet, wenn insgesamt Ruhe und Routine eingekehrt wäre.
Auch zuhause musste ich weiterhin die Milch abpumpen und einfrieren und diese dann in einer Kühltasche zu den Besuchen in der Kinderklinik mitbringen. Jeden Tag besuchten Walter und ich den Kleinen gemeinsam. Marius brachten wir meist zuvor zu den Schwiegereltern. Sie wohnten unweit der Klinik. Dort konnte er im Garten spielen, sich austoben und wurde natürlich auch ein wenig verwöhnt.
Ich war noch lange nicht wieder leistungsfähig und musste mit Heben von schweren Lasten noch vorsichtig sein. Doch ich war froh, endlich wieder zuhause zu sein. Ich musste nun auch nicht mehr ruhen. Trotzdem ich zuhause wieder einiges selbst erledigen konnte, entlasteten mich meine Schwestern bei der groben Hausarbeit, was mir sehr half. Meine Mutter kochte teilweise für uns drei mit. Außerdem unterstützten die berufstätigen Schwiegereltern so oft sie konnten. Walter wurde auf der Arbeit wieder voll eingesetzt und machte Überstunden, wie es im Sommer auf Baustellen üblich ist. Für Marius kehrte wieder Ruhe zuhause ein, ich hatte wieder Zeit für ihn und kümmerte mich sehr intensiv. Aufholen konnten wir die verlorene Zeit nicht. Doch nun war jede freie Minute ein Geschenk und ich genoss sie mit ihm. Marius war immer ein ausgesprochen liebes, schnell zufriedenes und nicht quengliges Kind. Das erleichterte insgesamt das Miteinander und die besondere Situation.
Während ich mich in den nächsten Wochen sehr schnell erholte, gedieh Julian langsam, aber stetig. Da der Saugreflex eines Frühchens nicht gleich vorhanden sein kann, wurde er weiterhin mit kleinsten Portionen Muttermilch in Spritzen (ml-weise) über die Magensonde ernährt. Die Beatmung wurde bald nur noch assistiert, er konnte sozusagen schon alleine atmen. Nur bei Bedarf wurde Sauerstoff zur Unterstützung der besseren „Sauerstoff-Sättigung“ hinzugegeben. Im Inkubator war er inzwischen mit einem Oberteil und mit kuscheligen Stricksöckchen bekleidet und hatte schon etwas „speckigere“ Beinchen. Nach knapp vier Wochen durften wir Julian endlich mit Hilfe der Schwestern aus dem Brutkasten nehmen. Er lag dann eingewickelt in warme Decken in meinen Armen.
Wie lange hatte ich darauf gewartet!
Doch hatte ich Angst, etwas falsch zu machen, denn er war immer noch so klein, so zerbrechlich und so leicht! Ich wusste gar nicht recht, wie ich ihn halten sollte. Einfach ruhig sitzen, das war das Beste, dann konnten wir beide uns spüren und er wusste sicher, dass ich seine Mama bin.
In der Hoffnung, dass auch Julian „groß“ werden würde, blieb im Moment nichts als abzuwarten. Ein Restrisiko durch Spätfolgen besteht bei einem Frühchen aber immer.
Jedoch ließen die Fotos von ehemaligen kleinen Patienten im Flur mit Dankesgrüßen der Eltern, Mitteilungen der aktuellen Körpergewichte und freudigen Babygesichtern die Hoffnung auf eine fast „normale“ Entwicklung steigen.
Mit Manuela telefonierte ich einige Male, ihr Sohn entwickelte sich gut, sie war durch ihre Ausbildung als Kinderkrankenschwester die beste Betreuung für ihn. Sie beruhigte mich ein wenig, als sie mitteilte, dass eine ihrer Bekannten auch ein sehr kleines Frühchen hatte, welches wohl noch etwas „schmächtig“, jedoch kerngesund und inzwischen im Kindergartenalter sei. Das Mädchen hatte damals auch nur ein knappes Kilo gewogen. Auch meine Großmutter berichtete mir, dass das frühgeborene Kind eines ehemaligen Nachbarsjungen vollständig gesund sei. Eine angeheiratete Verwandte erzählte mir von ihrem Geburtsgewicht von knapp über einem Kilogramm, als sie in den 1950ern geboren wurde und zuhause lange mit Wärmflasche warmgehalten wurde.
So wurde die Hoffnung auf eine vollständige Gesundung und Entwicklung sowie auf ein baldiges, komplettes Familienleben dadurch noch zusätzlich gestärkt.
Die Station bestand aus mehreren Zimmern auf der linken Seite des Ganges. Rechts waren Funktionsräume, wie „unreine“ Räume, Schwesternzimmer, Bettenlager usw. Man konnte von jedem Zimmer durch große Fensterscheiben hindurch in die anderen Räume sehen.
Julian lag, solange die Atmung assistiert werden musste, anfangs im hinteren Zimmer der Station, in dem drei Inkubatoren standen. Am Eingang des Zimmers lag ein Mädchen. Sie war schon sehr kräftig und wohl schon einige Monate alt. Die Kleine musste noch beatmet werden und es sah nicht so aus, als käme sie je von der Beatmung „los“. Ihre Eltern waren täglich da und eine Zuversicht auf ein gesundes Kind, welches sie eines Tages mit nach Hause nehmen könnten, schien wohl vorerst aussichtslos.
Bei all diesen Eindrücken und den täglichen Neuaufnahmen von winzigen Babys blieb nur Dankbarkeit, dass Julian doch so schnell alleine atmen und der Tubus schon nach vier Wochen komplett entfernt werden konnte. Mein Sohn wog da bereits 1.220 Gramm, war 38 Zentimeter groß und wurde daher in eines der vorderen Zimmer verlegt. Dort lag er anfangs noch im Inkubator, später in einem Wärmebettchen und schließlich in einem normalen Säuglingsbettchen. Ganz normale Babykleidung wurde ihm nun angezogen. Weiterhin wurde er immer noch per Monitor überwacht. In diesen Zimmern war es aber bedeutend ruhiger. Es gab keine Geräusche der Beatmungsmaschinen mehr! Nur noch das Piepsen der Geräte ringsherum oder das Schreien der anderen Babys war zu hören. Hier war – im Gegensatz zur Erstversorgung – eine Schwester für mehrere Kinder zuständig.
Egal, wann wir kamen, konnten wir ihn einfach aus dem Bettchen nehmen, ihn gleich ansprechen und ihm ein Küsschen geben, wenn er nicht gerade schlief. Lediglich die Kupplungsstecker der Überwachungsleitungen vom Monitor mussten anfangs noch von der Kinderkrankenschwester gezogen werden, was wir unter Anleitung dann auch selbst hinbekommen haben.
Eine der Kinderkrankenschwestern erzählte uns, dass der Saugreflex vor der ursprünglich errechneten 36. Schwangerschaftswoche kaum vorhanden sei. Man könne um diesen Zeitpunkt immer wieder probieren, ob der Kleine an einem Schnuller nuckeln würde. Das tat er dann auch bald. Außerdem wuchsen ihm erst in dieser Zeit seine Wimpern. Er hatte zuvor wirklich keine.
Ich kam meist alleine zu den Mahlzeiten, um ihn zu „füttern“. Es war sehr wichtig, dass das die Eltern übernahmen und auch vom Personal so gewünscht. Oft schrie er schon bei meinem Eintreffen, weil er so hungrig war; teilweise hatte die Kinderkrankenschwester schon begonnen, ihm das Fläschchen zu geben. Julian spürte es wohl schon sehr viel mehr, dass ich nun bei ihm war. Wir waren uns ja schon lange zuvor vertraut, denn meine Stimme kannte er sicher. Wenn ich Julian auf dem Arm hielt und er dort einschlief, konnte er sicherlich wieder das Klopfen meines Herzens spüren. Das war ja lange Zeit in meinem Bauch immer für ihn ein Zeichen, dass er gut aufgehoben ist.
Marius war während meiner Aufenthalte in der Kinderklinik oft bei seinen Großeltern oder bei Freunden. Wie alle anderen Familienmitglieder durfte auch er seinen Bruder nicht besuchen. Sie konnten lediglich auf dem Balkon stehen und durch die Scheibe in das Zimmer schauen. Erst als wir Julian nach einem weiteren Zimmerwechsel ans Fenster getragen hatten, konnte Marius in Begleitung seiner Großeltern oder Tanten seinen kleinen Bruder auch endlich sehen.
Es war eine unruhige Zeit für uns: dieses Warten auf unser zweites Kind, das ständige Hin- und Herfahren in die Kinderklinik, die Koordination der Betreuung für Marius, all das bestimmte unseren Tagesablauf. In der übrigen Zeit nahm ich mir sehr viel Zeit für Marius. Er hatte viel Spaß, wenn ich ihn auf dem Fahrrad mitnahm oder mit ihm gemeinsam auf der Schaukel saß. Er lernte in diesen Wochen sogar, ohne Windeln auszukommen.
Mit etwa acht Wochen hatte sich Julians Geburtsgewicht bereits verdoppelt und er war knapp 40 Zentimeter groß.
Bei zunehmend sommerlichen Temperaturen und dem ständigen Hin- und Herfahren in die Klinik war es für mich immer schwieriger, genug zu trinken, um ausreichend Muttermilch zu „produzieren“. So stillte ich bald ab und Julian wurde nach Aufbrauchen der tiefgefrorenen Muttermilch mit industrieller Milchnahrung ernährt.
Der Kleine hatte nicht immer ausreichend Kraft, das Fläschchen komplett leer zu trinken, sodass die Magensonde noch eine Weile lag, um den Rest der Nahrung sondieren zu können.
Es machte so viel Freude zu sehen, wie er zunahm und sich immer mehr dem Gewicht näherte, das nach 40 Schwangerschaftswochen normal ist.
Julian schrie, wenn er Hunger hatte und nuckelte liebend gern auf seinem Schnuller. Er sah so süß aus! Es war so schön, zu wissen, dass die schlimmste Zeit wohl bald überstanden war.
Zuhause war schon fast alles vorbereitet, die Babykleidung, die bereits sein Bruder getragen hatte, war gewaschen, auch wenn diese teilweise für den kleinen „Zwerg“ noch viel zu groß war. Die Babywiege, der Sterilisator für die Fläschchen und der Baby-Autositz waren besorgt.
An schönen Tagen besuchten Marius und ich meine Freundin Gabi und ihre Mädchen in deren Schrebergarten. Dort konnte er mit den beiden und mit weiteren Kindern aus dieser „Siedlung“ im Sandkasten spielen oder schaukeln. Gabi hatte oft Kaffee dabei und so hatte auch ich etwas Abwechslung und andere Gesprächsthemen.
Mit meinem Vater, Ellen und ihren Kindern unternahmen wir eine Fahrradtour am Main entlang Richtung Stadt, diese schöne Zeit musste noch ausgenutzt werden. In spätestens zwei Jahren würde auch Julian dabei sein, wenn wir uns zu solchen Unternehmungen auf den Weg machen würden. Es war für mich eine Freude, da ich nach der langen Zeit des Ruhens nun wieder komplett mobil sein durfte.
Mitte September wurde uns nach einer Untersuchung mit Hirnstrommessung mitgeteilt, dass Julian (wie viele Frühchen) immer wieder Atemaussetzer habe. Deswegen sollte er für zuhause ein Überwachungsgerät bekommen, welches die Frequenz der Atemzüge misst und bei Aussetzern Alarm schlägt. Auch in der Klinik war er mit einem ähnlichen Gerät, einer „Apnoe-Matratze“ (Matratzenauflage mit Sensoren, reagiert auf „Nicht-Atmen“, Nicht-Bewegen des Brustkorbes mit Alarm) versorgt. Ein solches Gerät, welches dann im Sanitätshaus zu besorgen wäre, bekämen wir noch verordnet. Mittlerweile trank Julian so gut, dass die Magensonde entfernt werden konnte. Er wog bereits 2.600 Gramm, also fast so viel wie ein „normales“ Neugeborenes.
Als meine Freundin Martina mir mitteilte, dass sie ihren Sohn Andreas am 27. September 1989 entbunden hatte und alles unproblematisch verlaufen war, freute ich mich sehr. Der Junge war sehr kräftig und sogar ziemlich groß, obwohl seine Mutter eine sehr zierliche Person war. Wohl dachte ich in diesem Moment daran, dass Julian auch erst zu diesem Zeitpunkt hätte geboren werden sollen. Sicher würden die beiden eines Tages miteinander spielen können, wenn sie sich begegnen werden.
Anfang Oktober kam der Augenarzt zum wiederholten Mal zu Julian zur Kontrolle. Diese Kontrollen sind bei Frühgeborenen, die beatmet wurden, üblich. Sie dienen der Früherkennung von Netzhautschädigungen durch Beatmungszeiten. Der Augenarzt hatte den Verdacht eines Glaukoms (grüner Star) im linken Auge und ordnete eine Augendruckmessung des Auges an, welche in Narkose durchgeführt werden sollte. Uns wurde erklärt, dass das keine große Sache sei. Bei Babys könne man den Augendruck nur unter Narkose messen. Bei Bewusstsein können falsche Werte entstehen, weil die Kinder unruhig werden und dabei schreien. Am 9. Oktober sollte diese Untersuchung in einer Augenklinik in der Ambulanz stattfinden. Normalerweise würde der Augenarzt die Messung selbst durchführen, aber es war zu diesem Zeitpunkt organisatorisch in der hiesigen Klinik nicht möglich. Sollte sich dabei eine Indikation zu einer Operation bestätigen, müsste Julian dort stationär aufgenommen werden.
Walter und ich fuhren am Sonntag vor diesem Termin gemeinsam in die Kinderklinik, um Julian sein Fläschchen zu geben. Zu diesem Zeitpunkt trank er täglich sechs Mahlzeiten mit je 70 Gramm, was schon richtig gut war. Den gemeinsam mit der Kinderärztin ausgefüllten Fragebogen für die Narkose unterschrieben wir nach einem kurzen Gespräch. Sie riet mir, auf jeden Fall mitzufahren, was ich sowieso hätte tun wollen, um ggf. weitere Fragen und etwaige Entscheidungen durch einen Erziehungsberechtigten vor Ort besser klären zu können. Nur diese eine – letzte – Hürde sollte noch genommen werden, danach dürfe Julian nach Hause. So wurde es uns zuversichtlich mitgeteilt.
Er kommt nach Hause – schon bald!





























