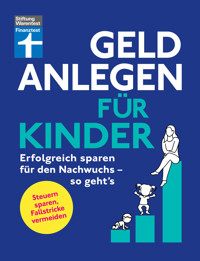Immobilien verschenken und vererben - Steuer- und Erbrecht innerhalb und außerhalb der EU, Erbstreitigkeiten vermeiden E-Book
Brigitte Wallstabe-Watermann
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Stiftung Warentest
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Über die Hälfte aller Erbschaften enthalten Immobilien Sie nennen eine oder mehrere Immobilien Ihr Eigen und machen sich Gedanken darüber, wie Sie Ihr(e) Objekt(e) am besten weitergeben? Besser schon zu Ihren Lebzeiten oder wenn Sie dereinst mal nicht mehr sind? An einer Immobilie hängt oft das Herz und sie lässt sich schlecht unter mehreren Erben aufteilen. Auch Erbschaftssteuer wird immer häufiger fällig. Schuld sind stark gestiegene Immobilienpreise und die neue Bewertung von Immobilien durch das Finanzamt seit 2023. Wer seinen Nachlass regeln möchte, steht daher vor vielen Fragen: Ist es sinnvoll, eine Immobilie zu verschenken, um Erbschaftssteuer zu sparen? Wie kann ich sie trotzdem weiter nutzen? Wie dafür sorgen, dass sie in der Familie bleibt? Wie vermeide ich Streit unter meinen Erben? Die passende Lösung für Sie Ein Patentrezept, wie Sie Ihre Immobilie am schlausten verschenken oder vererben, gibt es nicht. Denn nicht nur die Zahl der Bedachten und der Wert der Immobilie sind wichtig, sondern vor allem, was Sie wollen. Nehmen Sie sich daher Zeit, um Ihre Ziele genau zu definieren. Es gibt viele Wege, den Übergang gut zu regeln. Das Buch hilft einfach und übersichtlich, die passende Lösung zu finden und durch frühzeitige Schritte Erbstreitigkeiten zu vermeiden und Steuern zu sparen. - Immobilien verschenken: Wie Sie ein Wohnrecht behalten und wann sich eine Schenkung rückgängig machen lässt - Immobilien vererben: Wie Sie Ihren Partner absichern und den Zugriff unerwünschter Erben verhindern - Steuern sparen: Legale Tricks, um die Steuern klein zu halten - Immobilien im Ausland: Steuer- und Erbrecht für die wichtigsten Länder innerhalb und außerhalb der EU
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dr. Stefan Bandel, Brigitte Wallstabe-Watermann,Dr. Gisela Baur, Antonie Klotz, Hans G. Linder
Immobilien verschenken und vererben
Inhaltsverzeichnis
Was wollen Sie wissen?
Die passende Lösung für Sie
Wer erhält meine Immobilie, wenn ich nichts tue?
Wer hat Anspruch auf einen Pflichtteil?
Was will ich erreichen?
Vererben oder verschenken?
Immobilien verschenken
Die Steuer klein halten
Mietobjekte verschenken
Ein Haus teilen oder an mehr als eine Person verschenken
Immobilien mit Schulden
Schenkung und Pflichtteil
Ausgleichsregelungen für Schenkungen
Wenn Beschenkte Sozialleistungen beziehen
Schenken, aber bleiben – Nießbrauch und Wohnrecht
Geld oder Pflege – Schenkung mit Gegenleistung
Die Schenkung widerrufen – wann das möglich ist
Immobilien vererben
Das rechtssichere Testament
Testament oder Erbvertrag?
Wunscherben einsetzen, den Nachlass aufteilen
Testamentsvollstreckung
Rechte übertragen, Pflichten auferlegen
Vor- und Nacherbfolge: Über mehrere Erbfälle gestalten
Pflichtteile berücksichtigen
Der Ehepartner soll das Familienheim allein erhalten
Partner ohne Trauschein
Patchworkfamilien fallen aus dem Rahmen
Lösungen für besondere Fälle
Schritt für Schritt: So planen Sie Ihren Nachlass
Steuern vermeiden
Mehr vom Erbe erhalten – steuerschonend schenken
Auf den Wert der Immobilie kommt es an
„Entscheidend ist der Verkehrswert“
Steuerfreies Familienheim
Von Ketten und Schaukeln – weitere Möglichkeiten
Immobilien im Ausland
Immobilien in EU-Ländern
Immobilien außerhalb der EU
Lösungsansätze für alle Fälle
Wichtige Länder in Kürze
Hilfe
Kosten und Gebühren
Abkürzungen
Stichwortverzeichnis
Impressum
Was wollen Sie wissen?
Sie nennen eine oder mehrere Immobilien Ihr Eigen – und machen sich Gedanken darüber, wie Sie Ihr(e) Objekt(e) am besten weitergeben. Besser schon zu Ihren Lebzeiten oder wenn Sie dereinst mal nicht mehr sind? In diesem Buch finden Sie alle wichtigen Antworten zum Thema Verschenken und Vererben von Immobilien im Privatvermögen. Ein paar besonders drängende Fragen bekommen Sie hier bereits in Kürze beantwortet.
Erbt mein Partner auf jeden Fall, wenn ich sterbe ?
Vorsicht, so pauschal trifft das nicht zu. Verheiratete und Verpartnerte haben zwar ein gesetzliches Erbrecht, aber sie erben selten das gesamte Vermögen allein. Und Unverheiratete gehen komplett leer aus, selbst wenn sie schon Jahrzehnte zusammenleben. Wer nicht Ehegatte oder eingetragener Lebenspartner ist, wird laut dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) wie ein Fremder behandelt, wenn es der oder die Verstorbene nicht anders verfügt hat. Ein gemeinsamer Erbvertrag kann Abhilfe schaffen. Ein Nachteil aber bleibt bestehen: Das von Erbschaftssteuer freigestellte Vermögen bleibt so oder so deutlich geringer als bei Ehegatten. Mehr dazu erfahren Sie unter „Partner ohne Trauschein“, S. 121.
Nach dem Gesetz erben mein Ehepartner und meine Kinder – das ist genau, was ich will. Muss ich trotzdem etwas tun ?
Das kommt darauf an. Gerade wenn Sie eine Immobilie vererben wollen, kann die gesetzliche Regelung zu echten Problemen und Streit führen. Denn nach dem BGB erben alle gemeinsam alles. Das heißt, die Immobilie gehört nach Ihrem Tod all Ihren Erben gemeinsam – und was damit geschieht, müssen daher auch alle gemeinsam entscheiden. Werden sie sich untereinander nicht einig, droht vielleicht sogar eine Zwangsversteigerung. Selbst wenn alle Erben guten Willens sind, kann ein Verkauf anstehen: Denn Immobilien sind häufig der wesentliche Teil des Erbes. Um jedem seinen Anteil zu geben, muss das Haus oder die Wohnung dann zu Geld gemacht werden. Wer das nicht möchte, kann gegensteuern. Mehr dazu siehe „Was will ich erreichen?“, S. 25.
Ich will mein Haus per Testament vererben. Muss ich dann auf jeden Fall zum Notar ?
Nein, nicht zwingend. Ob eine Immobilie zu Ihrem Nachlass zählt oder nicht, ist egal – Sie können Ihr Testament auch ganz allein aufsetzen, ohne dass es ein Notar beurkunden muss. Es kann allerdings ein Risiko bergen, sich nicht von Fachleuten wie einem Notar oder Fachanwalt für Erbrecht beraten zu lassen. Das Testament könnte zum einen formal ungültig sein, zum anderen könnte es inhaltlich falsch, unklar oder unpassend abgefasst sein – oder womöglich Folgen haben, die Sie nicht bedacht haben. Mit einem notariellen Testament lässt sich so etwas vermeiden (siehe „Testament oder Erbvertrag?“, S. 97).
Ich bin auf die Einkünfte aus meiner Immobilie angewiesen. Daher kommt eine Schenkung für mich nicht infrage, oder ?
Auch wenn Sie Ihre Immobilie bereits zu Lebzeiten verschenken, können Sie unter Umständen damit immer noch Einkünfte erzielen. Möglich wird das zum Beispiel mit der Vereinbarung eines Nießbrauchs. Dieser etwas altertümlich anmutende Begriff bedeutet, dass Sie den Gebrauch Ihres Hauses weiterhin „genießen“ können – dazu zählen beispielsweise die Einkünfte aus einer vermieteten Immobilie, die Sie verschenken. Der Nießbrauch kann bis zu Ihrem Lebensende oder auch nur auf eine bestimmte Zeit festgesetzt werden.
Regelungen in einem Erbvertrag kann man allein nicht mehr ändern, sind Erbverträge daher nicht riskant ?
Das kann man so nicht sagen. Für jede einzelne Regelung im Erbvertrag kann festgelegt werden, ob sie vertraglich bindend ist, das heißt einseitig nicht mehr geändert werden kann, oder nicht. Es kann auch eine eingeschränkte Änderbarkeit vereinbart werden, etwa im Kreis der gemeinsamen Abkömmlinge, nicht aber zugunsten Dritter. Ein Erbvertrag ist formal schon dann gegeben, wenn nur eine einzige Regelung erbvertraglich bindend ist, alle anderen Regelungen aber einseitig und jederzeit frei widerruflich sind. So kann zum Beispiel erbvertraglich bindend dem Ehepartner ein Wohnrecht und der Hausrat vermacht werden, während die gesamte sonstige Vermögensverteilung durch verschiedene vertragliche Regelungen frei widerrufen werden kann. Selbst für vertraglich bindende Verfügungen kann zu Lebzeiten der Beteiligten ein Rücktrittsvorbehalt vereinbart werden. Man muss nur wissen, wie viel Bindung man will und dies dann im Vertrag entsprechend regeln.
Ist es nicht besser, meine Immobilie(n) noch zu Lebzeiten zu verschenken, um Steuern zu sparen ?
Das lässt sich pauschal nicht beantworten und ist unter anderem abhängig von der Höhe und Zusammensetzung Ihres gesamten Vermögens und der Anzahl Ihrer Erben. Bei Schenkungen erneuern sich die Freibeträge zwar alle zehn Jahre, aber niemand weiß zum Glück, wie lange man lebt und wie oft man das ausnutzen kann. Man muss auch berücksichtigen, dass man für seinen Lebensabend Vermögen übrig haben sollte, von dem man zehren kann. Im Todesfall wird Erbschaftssteuer erst fällig, wenn Ihre Erben die steuerlichen Freibeträge ausschöpfen. In süddeutschen Großstädten mag das allerdings schon bei einer vermieteten Eigentumswohnung, die an einen Erben übergeht, der Fall sein. Diese Frage will daher gut durchdacht sein. Das selbst bewohnte Familienheim kann zum Beispiel unter gewissen Voraussetzungen unabhängig von seinem Wert steuerfrei vererbt werden (siehe „Steuern vermeiden“, S. 129).
Darf ich mein Testament am Computer tippen und dann unterschreiben ?
Das ist ein Formfehler, der das Testament unwirksam werden lässt! Die Folge: Es würden die gesetzlichen Erbregelungen gelten, von denen Sie mit Ihrem Testament ja gerade abweichen wollten. Um Gültigkeit zu erlangen, muss ein selbst verfasster letzter Wille von Anfang bis Ende handschriftlich abgefasst sein und am Ende mit Ort, Datum und Ihrer Unterschrift versehen sein; mehrere Seiten gehören durchnummeriert (siehe „Das rechtssichere Testament“, S. 92).
Die passende Lösung für Sie
Ein Patentrezept, wie Sie Ihre Immobilie am schlauesten verschenken oder vererben, gibt es nicht. Denn nicht nur die Zahl der Bedachten und der Wert der Immobilie sind wichtig, sondern vor allem, was Sie wollen. Nehmen Sie sich daher Zeit, um Ihre Ziele genau zu definieren.
Wovon sprechen wir? Geht es darum, das Familienheim für kommende Generationen zu erhalten? Oder wollen Sie eine vermietete Immobilie samt Einkünften als Geschenk übertragen und das möglichst steuersparend? Wollen Sie Ihr Vermögen jetzt schon gerecht verteilen und so später Streit zwischen Ihren Kindern vermeiden? Oder soll jemand – aus welchem Grund auch immer bevorzugt werden?
Motive, über die Regelung des eigenen Nachlasses nachzudenken, gibt es viele – genau wie das deutsche Recht eine Vielzahl von Lösungsmöglichkeiten bietet. Einige sind einfach, manche hochkomplex. Dieser Ratgeber hilft Ihnen dabei, Ihre Gedanken zu ordnen und Lösungswege zu finden.
Um den besten Weg für Ihre Situation umzusetzen, werden Sie höchstwahrscheinlich juristischen Beistand brauchen. Es ist wichtig, dass Sie dann nicht unvorbereitet mit komplizierten Regelungen konfrontiert werden und die richtigen Fragen stellen können. Oft ist der Notar in Immobilienfragen die richtige Adresse. Den müssen Sie in vielen Fällen, etwa bei jeder Schenkung, ohnehin einbinden. Bei einigen anderen Anliegen ist es zwar nicht vorgeschrieben, aber sinnvoll. Etwa wenn Sie ein Testament schreiben wollen. Denn so stellen Sie sicher, dass es juristisch wasserdicht ist und Ihr letzter Wille später einmal tatsächlich gilt.
HÄTTEN SIE’S GEWUSST?
Auf gut 11 Milliarden Euro beliefen sich die Festsetzungen von Erbschafts- und Schenkungssteuer im Jahr 2022. Insgesamt haben die Finanzämter Erbschaften und Schenkungen im Wert von 101,4 Milliarden Euro der Steuer unterworfen.
Bei knapp 40 Prozent der steuerlich relevanten Übertragungen ging es 2022 übrigens um Grundvermögen.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass nur ein Bruchteil aller Erbschaften und Schenkungen besteuert wird, da die meisten Übertragungen unterhalb der Freibeträge liegen. Sie tauchen daher nicht in der Statistik auf. Experten schätzen die Summe aller Übertragungen pro Jahr auf 400 Milliarden Euro.
Quellen: Statistisches Bundesamt; DIW
Wer welche Immobilie wann und unter welchen Bedingungen erhält, das können Fachleute wie gute Notare oder Fachanwälte für Erbrecht für Sie im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten gestalten – egal ob Sie über eine Übertragung zu Lebzeiten oder erst nach Ihrem Tod nachdenken. Eines kann sie oder er aber sicher nicht: Erraten, was Sie am Ende erreichen wollen.
Ganz wichtig ist daher im ersten Schritt, dass Sie sich mit Ihren Wünschen, aber auch mit den Vorstellungen der anderen Beteiligten beschäftigen, bevor Sie sich mit den verschiedenen Möglichkeiten der Übertragung auseinandersetzen. Machen Sie sich ausgiebig Gedanken über das gewünschte Ergebnis, nicht aber über den Weg dorthin, denn als „Lotsen“ stehen Ihnen Fachleute für Erbrecht zur Seite.
Im Idealfall erarbeiten Sie in Ruhe eine einvernehmliche Lösung mit allen Betroffenen. Das ist vielleicht nicht einfach, doch eines ist klar: Nichts zu tun, ist in den meisten Fällen die schlechteste Lösung. Denn wenn Sie keine anderen Regelungen erlassen, gilt auch für Immobilien die gesetzliche Erbfolge. Die kann für viele Probleme sorgen – und daher zu unerwünschten Ergebnissen führen.
Wer erhält meine Immobilie, wenn ich nichts tue?
Das Bürgerliche Gesetzbuch schreibt genau vor, wer das Vermögen bekommt, wenn Erblasser nichts festlegen. Manches scheint gut geregelt. Aber Nichtstun birgt große Tücken.
Mehr als jeder zweite Erbfall in Deutschland wird ohne Verfügung der verstorbenen Person abgewickelt – dann greifen die gesetzlichen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB). Prinzipiell folgt das BGB dem gesunden Menschenverstand. Die meisten Menschen haben mehrere Angehörige, und das BGB geht davon aus, dass sie auch nach ihrem Tod vor allem die Kernfamilie versorgt haben wollen, also zuallererst Ehepartner oder eingetragenen Partner und die eigenen Nachkommen.
Das entspricht oft dem, was Erblasser wollen, aber eben nicht immer: Auch wenn es keine eigenen Kinder gibt, erbt ein Ehepartner oder eine -partnerin zum Beispiel nicht unbedingt alles. Und wenn Sie weder verheiratet sind noch in einer eingetragenen Partnerschaft leben, hat Ihr Lebensgefährte gar keinen Anspruch, selbst wenn die Lebensgemeinschaft seit Jahrzehnten bestanden hat. Daher ist es wichtig, dass Sie zunächst herausfinden, ob die gesetzliche Erbfolge in Ihrer Situation Ihren Wünschen entsprechen würde. Nach dem BGB werden die Erben schrittweise bestimmt.
Die Ansprüche von Partnern
Zunächst werden die Ansprüche von Ehepartner und Partnern einer eingetragenen Lebenspartnerschaft abgedeckt. Dabei ist es egal, ob eine Lebenspartnerschaft seit Herbst 2017 in eine „Ehe für alle“ umgewandelt wurde oder nicht. Denn Lebenspartnerschaften sind seit 2005 sowohl rechtlich als auch steuerlich den Ehen gleichgestellt. Sie bekommen genau wie die Ehepartner nach dem Ehegattenerbrecht einen erheblichen Anteil des Vermögens.
Doch schon hier wird es hoch kompliziert. Denn der Anteil, den der Partner oder die Partnerin im Erbfall erhält, hängt zum einen vom Güterstand ab, also davon, ob Sie einen Ehevertrag abgeschlossen haben oder nicht. Zum anderen auch davon, welche und wie viele andere Erben existieren. Grundsätzlich gilt aber:
Mindestens ein Viertel des Vermögens bekommen die Partner immer. Wenn Verstorbene keine Kinder haben, ist es mindestens die Hälfte.
Zirka 90 Prozent der Ehepaare schließen keinen Ehevertrag ab. Sie leben dann im Güterstand der Zugewinngemeinschaft. In diesem Fall bekommen die Partner zu ihrem Anteil ein weiteres Viertel als „pauschalen Zugewinnausgleich“ dazu. Zur Gütertrennung siehe Tabelle „Was Ehegatten und eingetragene Lebenspartner erben“, oben.
Nur wenn es keine Kinder, Enkel, Eltern, Geschwister, Großeltern, Onkel, Tanten oder irgendwelche Nachkommen von diesen Verwandten gibt, fällt das komplette Vermögen an den Partner.
Geordnet erben
Beispiel: Ein Ehemann und Vater stirbt. Seine Ehefrau erbt mit Tochter und Sohn. Das Kind der Tochter erbt nichts. Aber: Lebt die Tochter beim Tod ihres Vaters nicht mehr, rückt die Enkelin in ihre Erbposition auf. Dann erben Ehefrau, Sohn und Enkelin.
Was Ehegatten und eingetragene Lebenspartner erben
*) Ist ein Großelternteil verstorben, erbt der überlebende Ehegatte anstelle seiner Abkömmlinge auch dessen Teil. Sind keine Abkömmlinge vorhanden, geht der Anteil an die anderen Großelternteile.
Ehegatten, die mit der verstorbenen Person in einem Haushalt gelebt haben, haben in der Regel zudem Anspruch auf den „Voraus“. Daher dürfen sie nicht nur ihre Hochzeitsgeschenke behalten. Auch alle Haushaltsgegenstände, Bücher, Teppiche und Möbel, die das Paar bisher gemeinsam in seinem Haushalt genutzt hat, gehen an den überlebenden Ehepartner und werden nicht Teil des Gesamterbes. Das gilt zum Beispiel auch für ein gemeinsam genutztes Auto. Ausgenommen sind nur die Gegenstände, die Verstorbene ganz alleine genutzt haben, zum Beispiel Schmuck oder eine teure Kameraausrüstung.
In der Regel dürfen Partner den kompletten Hausstand behalten, je nach Lebensstil vor dem Erbfall auch wertvolle Teppiche oder Gemälde – außer sie sind der einzige Vermögensgegenstand im Erbe der Verstorbenen. Der „Voraus“ wird bei der Berechnung der Ansprüche von Partnern auf das übrige Erbe nicht angerechnet, das heißt, er ist ein zusätzliches Erbe des Partners.
Die Ansprüche von Verwandten
Alles, was nicht an einen Partner geht, wird an die Verwandtschaft der Verstorbenen verteilt. Wer da am Zug ist, wird nach Verwandtschaftsgrad entschieden. Entsprechend teilt das BGB die Angehörigen in verschiedene „Ordnungen“ ein.
1. Ordnung: Eigene Kinder sind Erben erster Ordnung, und wenn es die gibt, sind alle anderen aus dem Familienclan von der Erbfolge ausgeschlossen. Als Kinder gelten alle ehelichen, unehelichen und adoptierten Kinder der Verstorbenen. Sie sind immer absolut gleichberechtigt, wenn Erblasser nichts anderes verfügt haben.
Ist jemand aus der Erbordnung bereits verstorben, übernehmen dessen Nachkommen automatisch seinen Platz. Ist zum Beispiel ein Kind bereits tot, hat aber selber zwei Kinder hinterlassen, dann rücken diese Enkel zu gleichen Teilen an dessen Stelle in die erste Ordnung auf und verdrängen alle anderen mit niedrigeren Ordnungsnummern aus der Erbfolge. Dasselbe gilt für alle anderen Ordnungen. Ist der Bruder oder die Schwester des Erblassers erbberechtigt und bereits verstorben, geht dieser Anteil an seine oder ihre Kinder, also an Neffen oder Nichten.
2. Ordnung: Nur wenn es keine eigenen Kinder gibt, kommen andere Verwandte zum Zug. Auch hier hat das BGB eine Reihenfolge festgelegt. Zuerst wären die Eltern (Erben zweiter Ordnung) an der Reihe. Wenn sie bereits verstorben sind, deren Nachkommen, wobei für jeden Elternteil dessen jeweilige Nachkommen an seine Stelle treten.
3. und weitere Ordnungen: Gibt es die nicht, dann sind Großeltern (Erben dritter Ordnung) beziehungsweise deren Nachkommen an der Reihe. Und wenn auch die nicht existieren, dann kommen noch die Urgroßeltern beziehungsweise deren Abkömmlinge zum Zug (Erben vierter Ordnung). Anschließend die Abkömmlinge noch entfernterer Voreltern (Erben fünfter oder noch höherer Ordnung). Nach deutschem Recht kann auch der entfernteste Verwandte noch erben, wenn es keine näheren Verwandten gibt.
Wer würde mich beerben?
Haben Sie einen Ehepartner oder leben Sie in einer eingetragenen Partnerschaft?
Ist gar kein leiblicher Verwandter zu ermitteln und kein Partner vorhanden, fällt das Erbe an den Staat.
Der Nächste ist an der Reihe
Nach der gesetzlichen Erbfolge sind zum Beispiel die Enkel anstatt des bereits verstorbenen Kindes erbberechtigt. Auch wenn etwa ein lebendes Kind das Erbe ausschlägt, sind automatisch dessen Kinder an der Reihe. Ausschlagen kann daher sinnvoll sein, wenn der Berechtigte das Erbe nicht braucht und direkt an seine Kinder weitergeben will, denn steuerlich gilt das nicht als Schenkung des eigentlich Erbberechtigten.
Die gesetzliche Erbfolge und der Ordnungsrang der Erben entscheiden also über die Erbansprüche der Angehörigen. Sie bestimmen aber noch mehr. Sie sind die Grundlage für die Höhe der Besteuerung des Erbes und der sogenannten Pflichtteile.
Im Steuerrecht gilt: Je enger die verwandtschaftliche Beziehung zwischen Erben und Erblassern, desto höher die Freibeträge und desto niedriger die Erbschaftssteuersätze auf höhere Summen (siehe „Mehr vom Erbe erhalten“, S. 130). Auch der Pflichtteil, den nahe Verwandte einklagen können, wenn die Verstorbenen sie ausdrücklich enterbt haben, orientiert sich an der gesetzlichen Erbfolge (siehe „Wer hat Anspruch auf einen Pflichtteil?“, S. 20).
Alles für alle
Vielleicht denken Sie jetzt, die gesetzliche Erbfolge ist genau für Sie gemacht? Denn Sie leben zum Beispiel in einer Ehe oder eingetragenen Partnerschaft mit zwei Kindern. In einer Zugewinngemeinschaft würde also die eine Hälfte Ihres Vermögens an Ihren Partner oder die Partnerin gehen, jeweils ein Viertel an die Kinder. Und das entspricht ja ziemlich genau dem, was Sie sich vorstellen. Klingt doch gut, meinen Sie? Ist es aber oft nicht. Denn Erben nach dem BGB heißt auch: Was bisher den Verstorbenen gehörte, gehört nun allen Erben zusammen, und das können viele Personen aus unterschiedlichen Generationen sein – mit unterschiedlichen Interessen und Bedürfnissen.
Alle Erben gemeinsam treten nämlich das Gesamterbe an. Dazu gehört alles, von der wertvollen Skulptur aus dem Büro der verstorbenen Person, die alle immer besonders schön fanden, über deren Fotosammlung oder Armbanduhr bis hin zu Geldbeständen auf Konten und natürlich auch alle Immobilien – das gesamte Eigentum eben. Mit enthalten sind aber auch alle Bankschulden und andere Verbindlichkeiten.
Und jedem einzelnen Erben gehört nun entsprechend seines Erbanteils ein Stückchen von jedem einzelnen Gegenstand und logischerweise auch von jeder Immobilie.
Weil nun aber jedem ein Teil von allem gehört, kann niemand mehr alleine handeln. Gibt es mehr als einen Erben, entsteht also automatisch eine Erbengemeinschaft. Die muss gemeinsam und einvernehmlich alle Angelegenheiten erledigen.
Vom Verkauf der Skulptur über die Verwendung der Armbanduhr bis hin zur Neuvermietung der Wohnung oder der Rückzahlung eines Darlehens: Theoretisch braucht die Erbengemeinschaft für jeden Schritt die Unterschrift oder zumindest das Einverständnis jedes einzelnen Erben. Und alle müssen sich darüber einig werden, wie sie das Gesamterbe auflösen, also konkret festlegen, wer welchen Teil vom Erbe bekommt. Das klingt leichter als es ist, denn noch einmal: Diese Erbauseinandersetzung findet nach einem Trauerfall statt, der alle belastet und nicht unbedingt rationaler handeln lässt. Schießt nur einer quer, sind Probleme und Streit programmiert.
Das wird in Ihrer Familie nicht passieren, glauben Sie? Nun, bis Sie zum Erblasser werden, geht hoffentlich noch viel Zeit ins Land und man weiß nie, was das Leben so bringt. Was ist, wenn ein Mitglied der Erbengemeinschaft ein Kind aus einer anderen Beziehung ist? Sorgeberechtigt ist dann meist dessen anderer Elternteil, der mit Ihrem jetzigen Partner vielleicht in tief verwurzelter Feindschaft verbunden ist.
Glauben Sie wirklich, dass die Erbengemeinschaft, in der dann beide vertreten sind, harmonisch und einvernehmlich die Dinge regeln wird? Oder eines Ihrer Kinder hat einen Partner, der ganz neue Vorstellungen von Gerechtigkeit in die Familie trägt, die mit denen der anderen Kinder komplett über Kreuz liegen? Oder ein Erbe ist vielleicht hoch verschuldet, und Gläubiger wollen Zugriff auf seinen Erbteil. Oder, oder. Problematisch oder zumindest kompliziert wird es meist, wenn ein Mitglied der Erbengemeinschaft
geschäftsunfähig ist, etwa wegen einer Erkrankung,
minderjährig ist,
schwer erreichbar ist, weil es zum Beispiel einen Wohnsitz im Ausland hat,
verschuldet ist,
oder auch nur entscheidungsschwach oder streitsüchtig.
Sind Minderjährige Mitglied in der Erbengemeinschaft, wird es in Sachen Immobilien schnell umständlich. Denn er oder sie hat alle Rechte und Pflichten aus dem Erbe, kann sie aber bis zum 18. Lebensjahr nicht selbst ausüben. Bis dahin handeln die Eltern oder ein Vormund für die jungen Erben. Das heißt, ihnen gehört zwar das Vermögen samt Immobilienanteilen, verwaltet wird es aber von anderen – zum Beispiel den Eltern oder einem Elternteil.
Streit ums Haus ist programmiert
Gibt es mehrere Erben, erben sie alles gemeinsam: das Haus, Bargeld, die Uhr, den Schrank. Ein Haus lässt sich nicht einfach aufteilen. Stellt sich nur einer der Erben quer, droht eine Zwangsversteigerung.
Gut zu wissen
Für bäuerliche Höfe gelten je nach Bundesland unter Umständen besondere und regional verschiedene Spezial-Erbvorschriften, insbesondere die Regelungen der Höfeordnung. Ziel dieser Regeln war und ist es, die landwirtschaftlichen Anwesen als Ganzes zu erhalten und an einen Erben weiterzugeben. Andere haben zwar Ausgleichsansprüche, die je nach Bundesland zum Teil niedriger sind als nach dem BGB, werden aber nicht zum Miterben des Hofes. Der Hofeigentümer und Erblasser kann durch Testament oder auf andere Weise den Hofnachfolger bestimmen, er kann auch dafür sorgen, dass die Höfeordnung nicht zur Anwendung kommt. Wer einen Bauernhof übertragen möchte, sollte sich auf jeden Fall kompetent beraten lassen.
Die sind per Gesetz verpflichtet, ihre Aufgabe zum Nutzen ihres Schützlings zu erfüllen. Konkret heißt das, dass sie Bargeld anlegen müssen, nichts aus dem Erbe verschenken dürfen und bei allen „wesentlichen Rechtsgeschäften“ eine Genehmigung des Familiengerichtes einholen müssen.
Zu diesen „wesentlichen Rechtsgeschäften“ zählt auch jede Verfügung über Immobilien, also zum Beispiel der Verkauf. Wenn der Erbe oder die Erbin Teil einer Erbengemeinschaft ist, die den Verkauf einer Immobilie anstrebt, muss also erst einmal das Familiengericht gefragt werden. Das ist nicht unmöglich, aber in der Regel zeitaufwendig.
Und mehr noch: Die Eltern oder der Vormund können das Kind zudem nicht bei Angelegenheiten vertreten, bei denen sie selbst beteiligt sind. Nachdem die Eltern aber selber oft Teil der Erbengemeinschaft sind, betrifft das dann die gesamte Erbauseinandersetzung. Will man also das Erbe aufteilen, muss vom Gericht ein Nachlasspfleger für das Kind bestellt werden, der alleine im Interesse des Kindes handelt.
Im schlimmsten Fall gipfelt der Konflikt in einer Zwangsversteigerung.
Generell gilt: Einfache Lösungen in einer Erbengemeinschaft gibt es nur für teilbare Vermögensgegenstände wie ein Bankkonto. Alle unteilbaren Dinge werden aufwendiger. Das betrifft nicht nur die Skulptur und die Armbanduhr, sondern vor allem auch Immobilien. Im schlimmsten Fall gipfelt der Konflikt in einer Zwangsversteigerung.
Interessenskonflikte
Angenommen, ein Mitglied der Erbengemeinschaft möchte ein Einfamilienhaus gern selber nutzen. Ein andere Person will es aber lieber abreißen und als Bauunternehmerin ein Mehrfamilienhaus auf dem Grundstück errichten. Eine Dritte will das Ganze möglichst schnell verkaufen. Kommt es zu keiner einvernehmlichen Lösung, kann jedes Mitglied der Erbengemeinschaft die Erbauseinandersetzung – also die Teilung des Nachlasses – verlangen.
Teilbar ist eine Immobilie aber nur, wenn sie in Geld umgewandelt wird. Jeder Erbe hat das Recht, hierfür die Zwangsversteigerung zu beantragen und wird damit in der Regel Erfolg haben. Wirtschaftlich ist das für alle ein Fiasko, denn eine Zwangsversteigerung bringt meist einen weit niedrigeren Erlös als ein freier Verkauf.
Die gesetzliche Erbfolge ist also nur dann eine gute Lösung, wenn es aller Wahrscheinlichkeit nach zu keinerlei Interessenkonflikten und Kämpfen in der Erbengemeinschaft kommt. Das kann der Fall sein, wenn mehrere kooperationswillige volljährige Personen sich ein Erbe teilen. Vor allem, wenn niemand besondere Interessen an etwas hat.
Ganz sicher können Sie sich aber nur dann sein, wenn es nur einen Erben oder eine Erbin gibt, beispielsweise weil
Sie einen gesetzlichen Alleinerben haben. Also wenn Sie zum Beispiel keinen Partner haben und genau einen nahen Verwandten, der nach Erbfolge alles erben wird – zum Beispiel als verwitwete Person mit einem Kind.
Sie einen Partner haben, aber keine anderen Erben bis zur dritten Ordnung, also keine eigenen Nachkommen, keine Eltern mehr, keine Geschwister oder deren Nachkommen, keine Großeltern, Tanten, Onkel, Neffen, Nichten oder deren Abkömmlinge. Dann wird Ihr Ehepartner Ihr Alleinerbe.
In allen anderen Fällen spricht für eine Erbengemeinschaft und damit für das Nichtstun eigentlich nur ein einziger Gedanke: Damit behandeln Sie Ihre Erben tatsächlich absolut gleich, jede und jeder hat dieselbe Einflussmöglichkeit auf das weitere Geschehen. Und wenn alle rational und vernünftig vorgehen, kann das gut laufen.
Das ist dann relativ wahrscheinlich, wenn es mehrere gleichberechtigte Miterben gibt und wenn die Probleme, die sich aus einer Erbengemeinschaft ergeben können, nicht so schwer wiegen. Zum Beispiel, wenn eine unverheiratete oder verwitwete Person alles an ihre Kinder oder mehrere Geschwister oder die Eltern vererbt.
Aber vielleicht wäre es allen lieber, Sie würden die Dinge vorab regeln und es erst gar nicht darauf ankommen lassen? In vielen Fällen stellt sich die familiäre Situation nämlich komplizierter dar – oder die gesetzlichen Erben sind einfach nicht die Wunscherben.
Wer hat Anspruch auf einen Pflichtteil?
Ganz frei können Sie Ihr Vermögen mit einem Testament oder einer Schenkung nicht verteilen. Ehegatten und nahe Verwandte haben Anspruch auf einen Pflichtteil.
Wollen Sie jemanden besonders bedenken oder verhindern, dass ein ungeliebter Verwandter Zugriff auf Ihre Immobilie bekommt? Dann kommen Sie an einem Testament oder einer Schenkung nicht vorbei. Denn solange Sie nichts tun, gilt immer die gesetzliche Erbfolge. Doch selbst, wenn Sie ein Testament schreiben, müssen Sie gut rechnen. Denn das Erbrecht stellt Angehörige unter besonderen Schutz – nahe Verwandte oder Ihren Ehegatten können Sie nach dem Gesetz schlicht nicht komplett enterben. Ihnen steht ein Pflichtteil zu.
Mindestbeteiligung
Der Pflichtteil ist eine gesetzlich vorgeschriebene Mindestbeteiligung am Nachlass, die nahen Verwandten zusteht, wenn Verstorbene sie per Testament oder Erbvertrag von der Erbfolge ausgeschlossen haben. Der gilt auch, wenn einer von mehreren Erben „über Gebühr“ im Nachlass bedacht wird und die anderen weniger als ihren Pflichtteil erhalten würden. Sie haben dann womöglich einen Anspruch auf einen Zusatzpflichtteil gegen besonders bedachte Erben.
Wer ist pflichtteilsberechtigt?
Anspruch auf den Pflichtteil haben Abkömmlinge des Erblassers, also Kinder, Enkel und Urenkel. Auch die Eltern der verstorbenen Person sind pflichtteilsberechtigt. Wie bereits bei der Erbfolge schließt die Existenz naher Verwandter die Pflichtteilsrechte entfernterer Verwandter aus. Ist ein Kind Erbe, können Enkel, Urenkel oder die Eltern keinen Pflichtteil fordern.
Ferner haben enterbte Ehegatten oder Lebenspartner einen Anspruch auf einen Pflichtteil. Dessen Höhe hängt vom Güterstand zum Todeszeitpunkt ab. Bei Zugewinngemeinschaft (also dem gesetzlichen Güterstand, wenn nichts anderes bestimmt wurde) dürfen Enterbte den genau ausgerechneten Zugewinnausgleich sowie einen kleinen Pflichtteil fordern, der sich aus der Hälfte des gesetzlichen Erbteils errechnet. Der pauschalierte Zugewinnausgleich in Höhe von einem Viertel des Nachlasses kommt in diesem Fall nicht zum Tragen.
Wem steht ein Pflichtteil zu?
Anspruch auf den Pflichtteil haben enterbte Abkömmlinge des Erblassers, eventuell auch seine Eltern, wenn es keine Kinder gibt. Auch dem enterbten Ehegatten oder Lebenspartner steht ein Pflichtteil zu.
Man unterscheidet zwischen Pflichtteilsanspruch, Zusatzpflichtteil und Pflichtteilsergänzungsanspruch. Pflichtteilsansprüche bestehen, wenn die oben genannten Personen nicht im Testament bedacht sind. Ein „Zusatzpflichtteil“ kann unter Umständen Erben zustehen, die im Testament weniger bedacht wurden, als ihnen nach dem Pflichtteilsrecht zustehen würde. Ein „Pflichtteilsergänzungsanspruch“ (Paragraf 2325 BGB) hingegen kommt bei Schenkungen in Betracht: Haben Erblasser vor ihrem Tod eine Schenkung gemacht, so können Pflichtteilsberechtigte als Ergänzung des Pflichtteils den Betrag verlangen, um den sich der Pflichtteil erhöht, wenn der verschenkte Gegenstand dem Nachlass hinzugerechnet wird (siehe „Schenkung und Pflichtteil“, S. 57).
Geschwistern, Großeltern und anderen weiter entfernten Verwandten steht ebenso wenig wie nichtehelichen Lebenspartnern ein Pflichtteil zu. Sofern die verstorbene Person sie in ihrem Testament nicht bedacht oder sogar ausdrücklich enterbt hat, gehen sie leer aus.
Auch Ex-Ehegatten haben keinen Anspruch auf einen Pflichtteil. Sie können aber gegebenenfalls von den Erben die Weiterzahlung von Unterhalt bis zur Höhe des (fiktiven) Pflichtteils verlangen. Gleiches gilt für in Trennung lebende Ehegatten, selbst wenn die Scheidung noch nicht rechtskräftig ist; liegen die Voraussetzungen für eine Scheidung vor, reicht es, wenn die Scheidung eingereicht wurde und beide Partner damit einverstanden waren.
Gut zu wissen: Pflichtteilsansprüche verjähren grundsätzlich nach drei Jahren mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Erbfall eingetreten ist. Pflichtteilsberechtigte müssen Kenntnis davon haben, dass sie im Testament nicht bedacht wurden. Wissen sie hingegen nichts von dem Erbfall, etwa weil sie schon seit Jahren im Ausland leben und keinen Kontakt mehr hatten, dann greift 30 Jahre nach dem Erbfall die kenntnisunabhängige Verjährung.
Pflichtteilsberechtigte haben gegenüber den Erben einen Auskunftsanspruch – sie müssen darüber informiert werden, was alles zum Nachlass gehört. Sie haben also Anspruch auf ein Verzeichnis der Nachlassgegenstände und -schulden sowie über Schenkungen, die der Erblasser getätigt hat, soweit diese einen Pflichtteilsergänzungsanspruch begründen können.
Gut zu wissen
Es gibt Alternativen. Um den Streit über die Verwendung einer Immobilie zu verhindern und einer Person die Verfügungsmacht darüber zu geben, müssen Sie nicht unbedingt alle anderen auf ihren Pflichtteil herabsetzen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, jemanden in einem Testament eine Immobilie zuzuschreiben, etwa durch eine Teilungsanordnung, ein Vorausvermächtnis („Wunscherben einsetzen, den Nachlass aufteilen“, S. 101) oder „Testamentsvollstreckung“, S. 106.
Pflichtteil senken oder entziehen?
Zu erreichen, dass Pflichtteilsberechtigte nichts oder nur sehr wenig bekommen, ist nicht einfach. Im Prinzip gibt es drei Wege:
Sie dürfen bei Ihrem Tod nichts hinterlassen, sprich müssen Ihr Vermögen vorher an die anderen verteilen. Und das rechtzeitig, denn jede Schenkung gilt als Teil des Erbes, solange sie noch nicht mehr als zehn Jahre her ist.
Die Berechtigten verzichten auf ihren Pflichtteil.
Sie erreichen einen Entzug des Pflichtteils. Das kommt allerdings nur in extremen Ausnahmefällen in Betracht.
Streit mit dem schwarzen Schaf der Familie oder eine zerrüttete Ehe reichen nicht aus, um Kind oder Ehepartner nicht nur zu enterben, sondern auch den Pflichtteil zu entziehen. Er kann nur ausnahmsweise entzogen oder beschränkt werden, wenn Pflichtteilsberechtigte etwa eine schwere Straftat begangen haben – zum Beispiel, wenn sie dem Erblasser nach dem Leben trachten oder wegen einer vorsätzlichen Straftat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr ohne Bewährung verurteilt wurden. Ein solcher Pflichtteilsentzug muss aber im Testament oder im Erbvertrag extra verfügt und begründet werden. Verwandte, bei denen das möglich ist, wünscht sich keiner.
Neigt ein Kind zum Beispiel zur Verschwendungssucht oder ist es überschuldet, können Eltern das Vermögen für spätere Generationen sichern, indem sie den Pflichtteil zwar nicht streichen oder vermindern, wohl aber dessen Verwendung beschränken. Dazu können sie die gesetzlichen Erben der Pflichtteilsberechtigten zu Nacherben oder Nachvermächtnisnehmern ihres Kindes einsetzen, das dann den Pflichtteil nicht nach Belieben verprassen, wohl aber noch Früchte daraus ziehen kann. Zudem können sie für den Pflichtteil dieses Kindes Testamentsvollstreckung anordnen.
Den Pflichtteil berechnen
Der Pflichtteil entspricht immer der Hälfte des jeweiligen gesetzlichen Erbteils. Ein enterbter Ehegatte, der nach Güterstand Anspruch auf die Hälfte des Vermögens hätte, kann beispielsweise einen Pflichtteil von einem Viertel einfordern.
Kein Recht an der Immobilie
Eine enterbte Person wird aber nie Mitglied der Erbengemeinschaft, der Pflichtteil ist lediglich ein Anspruch auf eine Geldzahlung. Das ist ein Vorteil, weil die Enterbten kein Eigentumsrecht an der Immobilie haben. Sie können bei der weiteren Verwendung der Immobilie also nicht mitreden, auch nicht direkt auf den Verkauf dringen oder gar eine Zwangsversteigerung veranlassen.
Jemanden zu enterben ist daher nur selten ein Ausdruck eines tiefen Zerwürfnisses in der Familie, sondern meist eine rationale Entscheidung – oft mit dem Einverständnis aller Beteiligten. Ein häufiger Fall ist die Enterbung der eigenen Kinder zugunsten des Ehepartners. So ist sichergestellt, dass der Partner die alleinige Verfügungsmacht über das gemeinsame Wohnhaus oder die Wohnung behält, ohne umständliche Erbauseinandersetzung und lästige Notartermine.
Den Partner als Erben einzusetzen, kann sinnvoll sein. Sie stellen so sicher, dass er sein Leben auch dann im gemeinsamen Zuhause verbringen kann, wenn Sie zuerst sterben sollten. Und die Ansprüche anderer Erben aus ihrem jeweiligen Pflichtteil sind oft niedriger als gedacht. Das zeigt das Beispiel auf Seite 24. Auch wenn die gegenseitige Versorgung des Partners wohl das häufigste Argument dafür ist, die gesetzliche Erbfolge außer Kraft zu setzen, gibt es auch andere Fälle, in denen das sinnvoll ist. Eine Patchworkfamilie zum Beispiel (siehe „Patchworkfamilien“, S. 123).
Wann ist der Pflichtteil fällig?
Grundsätzlich ist der Pflichtteil beim Tod des Erblassers sofort fällig. Falls das zu einer unbilligen Härte gegenüber dem Erben führt, kann die Zahlung allerdings gestundet werden – etwa, wenn der Erbe gezwungen wäre, das Familienheim zu verkaufen, um Pflichtteilsansprüche sofort zu erfüllen. Beispiel: