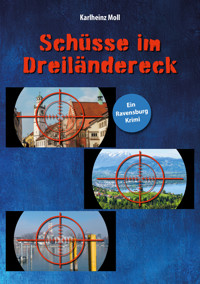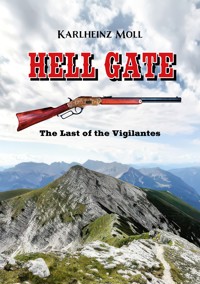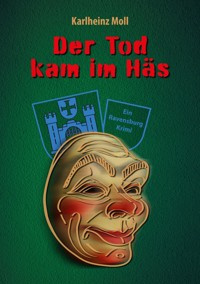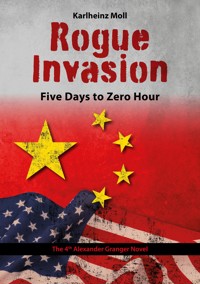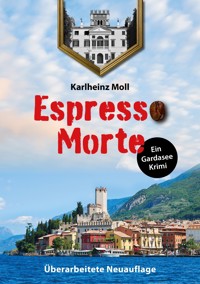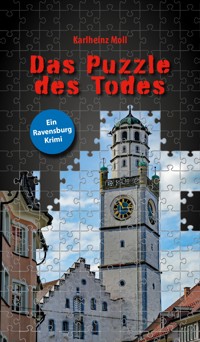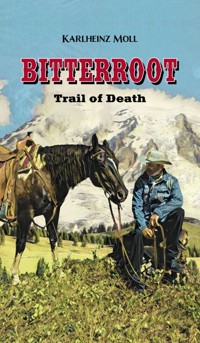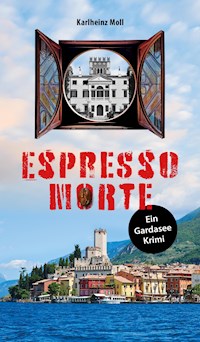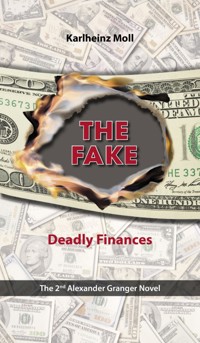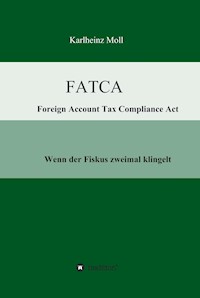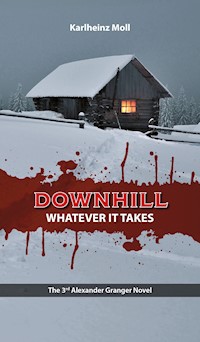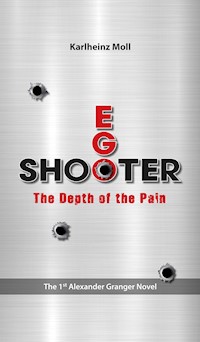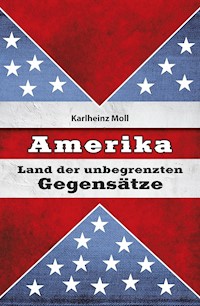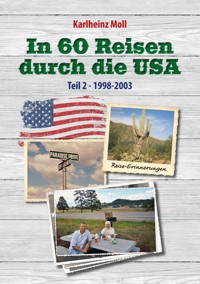
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
"In 60 Reisen durch die USA" erzählt von den 60 Reisen, die meine Frau Claudia und zwischen 1992 und 2020 zusammen absolvierten. Als Erinnerung an 35 glückliche und schöne Jahre, habe ich einen wichtigen Teil unseres gemeinsamen Lebens, den USA Reisen, in dieser Buchreihe verarbeitet. In diesem Teil 2 geht es um die Reisen zwischen 1998 und 2003, die, wie schon in den Vorjahren, von sehr viel gefahrene Kilometern durch die weiten, teils unberührten Landschaften des Westens der USA und Teilen von Westkanada gekennzeichnet waren. Hinzu kamen jährliche Aufenthalte in Florida, sowie einmalige Besuche in Massachusetts, Texas und Tennessee. Zu den Höhepunkten der hier erzählten Reisen gehörten unsere nach elf Jahren "wilder Ehe" erfolgte Hochzeit in Nashville, die Sichtung von Walen in Boston, eine Begegnung mit Geronimo in Tombstone und ein Reiterlebnis in Clinton.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Karlheinz Moll
In 60 Reisen durch die USA
Teil II 1998 - 2023
© 2024 Karlheinz Moll
Korrektorat: Dr. Maria Karafiat
Cover/Grafik: Petru Stendl, Intergrafos
Softcover:
978-3-384-15888-8
Hardcover:
978-3-384-15889-5
E-Book:
978-3-384-15890-1
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors.
Für Claudia (31.01.1962 – 19.03.2022)
In Liebe und in Erinnerung an 35 gemeinsame, schöne Jahre.
Vorwort
Ein Jahr, vier Monate und sieben Tage sind vergangen, seit ich meine geliebte Frau Claudia durch ihren Krebstod verloren habe und ich die ersten Zeilen dieses Buches in meinen Laptop getippt habe.
In Erinnerung an unsere 35 glücklichen und schönen Jahre hatte ich bereits damit begonnen, einen wichtigen Teil unseres gemeinsamen Lebens, Reisen in die USA, in einem Buch zu verarbeiten.
„In 60 Reisen durch die USA“ erzählt in mehreren Bänden von unseren 60 Reisen, die wir zwischen 1992 und 2020 zusammen in den Vereinigten Staaten von Amerika unternahmen.
Wie schon in Teil I stehen in dieser Reiseerzählung die gemeinsamen Erlebnisse aus der damaligen Reisezeit von Claudia und mir im Vordergrund, unter gelegentlicher Bezugnahme auf historische und aktuelle Ereignisse.
Grundlagen für diese Reiseerinnerungen bildeten wiederum Claudias akribisch geführten Reisetagebücher, unzählige, auf Fotos festgehaltene Eindrücke und eigene Erinnerungen. Ab 1998 kamen auch noch umfangreiche Filmaufnahmen hinzu, da Claudia in den Jahren, bevor Smartphones Einzug hielten, unsere Reisen auf unzähligen Videokassetten dokumentierte, die ich mir auch heute noch gerne ansehe. Gerade diese Videobänder zeigen, wie sehr sich die USA in den letzten knapp 30 Jahren vielerorts doch verändert haben, aber an anderen Stellen noch fast wie damals aussehen.
In diesem Teil II geht es um die Reisen in die Vereinigten Staaten ab 1998, in denen weiterhin viele Kilometer gefahren wurden, viele uns noch unbekannte Orte besucht wurden und wir neue Eindrücke gewinnen konnten. Zudem standen einige Höhepunkte auf dem Programm, nicht zuletzt unsere Hochzeit 1998, die für uns so ganz anders ausfiel, als man das vielleicht gewohnt ist, und dadurch erst recht für uns unvergesslich blieb.
Für mich war das Schreiben an diesem zweiten Teil wieder eine Fortsetzung der Zeitreise und ein intensiver Rückblick auf die wunderbaren Jahre, die ich mit der Liebe meines Lebens verbringen durfte.
Inhalt
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Widmung
Vorwort
Reise 11 Hochzeitsglocken 28.02. – 14.03.1998
Vorbereitungen
Nashville
„Ja, wir wollen“
Memphis
Jack Daniels
Orlando
Reise 12 Business 18. – 25.07.1998
Vorbereitungen
Boston Harbor
Whale Watching
Arbeitsbeginn
Baseball und Trolley
Filene’s Basement
Vom Boston Harbor ins Le Méridien
Rückreise
Reise 13 Gabelflug 28.08. – 18.09.1998
Vorbereitungen
Von Los Angeles zum Lake Tahoe
Vom Lake Tahoe zum Crater Lake
Vom Crater Lake nach Idaho Falls
Von Idaho Falls nach Salt Lake City
Rückreise
Reise 14 Geronimo 17.02. – 06.03.1999
Vorbereitungen
Von Atlanta nach Tombstone
Reiterei und Ballerei
Orlando
Rückreise
Reise 15 Rocky Mountains 27.08. – 18.09.1999
Vorbereitungen
Von Salt Lake City nach Missoula
Von Missoula nach Cheyenne
Von Cheyenne nach Denver
Reise 16 Erstes Mal Business Class 23.02. – 12.03.2000
Vorbereitungen
Anreise in der Business Class
Neues auf dem Las Vegas Strip
Orlando
Reise 17 Lonestar 08. – 30.09.2000
Vorbereitungen
Von Houston nach Bandera
Von Bandera nach San Antonio
Von San Antonio nach Houston
Reise 18 Sonnenschein 22.02. – 09.03.2001
Vorbereitungen
Orlando
Fort Myers
Sarasota
Kissimmee
Reise 19 9/11 24.08. – 15.09.2001
Vorbereitungen
Von Seattle nach Hope
Von Hope nach Missoula
Von Missoula nach Seattle
Reise 20 Fast leeres Florida 23.02. – 09.03.2002
Vorbereitungen
Kissimmee und Orlando
Reise 21 Fan Fair 21. – 17. 06.20021
Nashville
Reise 22 Coaching 11.10. – 31.10.2002
Vorbereitungen
Von Los Angeles nach San Diego
San Diego / La Jolla
Von San Diego nach Los Angeles
Reise 23 Winterferien 22.02. – 09.03.2003
Vorbereitungen
Orlando und Kissimmee
Reise 24 Echo Valley Ranch 05. – 27.09.2003
Vorbereitungen
Von Everett zur Echo Valley Ranch
Echo Valley Ranch
Von der Echo Valley Ranch nach Missoula
Von Missoula nach Seattle
Ausblick auf Teil 3
Zeittafel (2004 – 2020)
Zum Autor
Bibliographie
Vorschau
In 60 Reisen durch die USA
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Widmung
Vorbereitungen
Von Missoula nach Seattle
In 60 Reisen durch die USA
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
Reise 11 Hochzeitsglocken28.02. – 14.03.1998
Vorbereitungen
Im Frühjahr 1998 waren Claudia und ich fast schon 11 Jahre glücklich zusammen, auch ohne Trauschein. Dennoch unterhielten wir uns nach der Rückkehr von unserer letzten Reise im September 1997 darüber, ob wir nicht doch langsam „ehrbare“ Verhältnisse schaffen sollten. Seit wir 1992 das erste Mal in den USA gewesen waren, beschäftigten uns Gedanken, ob wir unseren Lebensmittelpunkt einmal in die Vereinigten Staaten verlegen wollten. Über meine Tätigkeit beim Bankhaus State Street standen die Chancen nicht schlecht, einmal eine Stelle in Boston zu bekommen. Ich weiß nicht mehr, wie ich Claudia dann genau gefragt habe, ob sie meine „gesetzliche angetraute“ Frau werden wollte, zumindest bin ich aber nicht auf die Knie gerutscht und hatte auch keinen Verlobungsring dabei.
Während wir selbst lange nicht übers Heiraten nachdachten, wurden um uns herum zahlreiche Ehen geschlossen, so manche zwischenzeitlich auch wieder geschieden. Als wir überlegten, wo und wie wir heiraten wollten, stand eines für uns sofort fest: So nach klassischem Muster kam für uns auf gar keinen Fall in Frage. Eine große Sause mit vielen Leuten stand somit ebenso wenig auf dem Programm, wie ein Hochzeitstag mit straffem Programm von Fototermin über Standesamt bis zur Brautentführung. Schnell war uns klar, dass wir eigentlich nur unter uns sein wollten und wir in den USA heiraten wollten. Damit hatte ich auch meinen „Marschbefehl“, unsere Hochzeit in den USA zu organisieren, die im Rahmen unserer jährlichen „Winterferien“ in Florida stattfinden sollte.
1997 gab es zwar schon das Internet, aber für uns war es damals wirklich noch etwas „Neuland“, also anders als die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel, die das auch erst 2013 für sich feststellte. Auch der vormalige Tennisprofi Boris Becker war erst ab 1999 „drin“. Mit „drin“ ist natürlich sein AOL-Internet-Zugang aus der bekannten Werbung gemeint, und weder die Besenkammer, in der er, ebenfalls 1999, „drin“ war und auch nicht der Knast im Vereinigten Königreich, in dem er erst viele Jahre später ebenfalls „drin“ war. Auch waren wir von einem Internetanschluss in unserer Mietwohnung noch Lichtjahre entfernt. Eine Recherche im Netz über das Heiraten in den USA gab es somit kaum.
Stattdessen rief ich beim amerikanischen Generalkonsulat in München an, um in Erfahrung zu bringen, wie denn eine Heirat in den USA ablaufen würde und wie diese später auch in Deutschland Anerkennung finden würde.
Unsere Idee war zwar in Florida zu heiraten, aber auch ein neues Reiseziel in unseren zweiwöchigen Aufenthalt mit aufzunehmen. Schon länger wollten wir mal das Herz der Country Musik besuchen: Nashville. Damit es mit der Heirat auch zeitlich klappen würde, wollte ich die erforderliche Lizenz zu heiraten, „Marriage License“ genannt, dabei auch schon in Nashville besorgen, während die eigentliche „Vermählung“ in Orlando stattfinden sollte.
Trotz inzwischen einiger USA-Erfahrung hatte ich bei den ersten Recherchen für die Hochzeitsvorbereitungen einen wichtigen Punkt erst eine kurze Zeit vor dem Abflug herausbekommen. Hochzeiten sind in den USA Sache der Bundesstaaten. Es war also nicht möglich, im US-Bundesstaat eine Heiratslizenz zu besorgen und damit dann in Florida zu heiraten. Aber das tat unserem Vorhaben keinen Abbruch und wir disponierten kurzfristig um.
Wir hatten uns nach der Klarstellung rasch entschlossen, in Nashville auch auf dem Papier zu heiraten und damit dort offiziell, den „Bund fürs Leben“ zu schließen.
Die Buchungen für den Flug und Mietwagen erfolgten auch in 1998 noch „analog“, somit durch den Gang ins Reisebüro. Unsere Hotels wollten wir wie immer direkt in den USA buchen.
Unseren Eltern sagten wir erst kurze Zeit vor der Abreise, was wir vorhatten, was vor allem bei Claudias Eltern, die damals schon lange voneinander geschieden waren, mit wenig Begeisterung aufgenommen wurde. Das hatte Claudia zwar erwartet, es war für sie aber kein Grund, von unserem Plan abzuweichen.
Nashville
Der Flug nach Nashville gelang nicht ohne umsteigen. Wieder einmal ging es zuerst um 11:15 Uhr von München mit DL33 nach Atlanta. Während des Fluges blätterte ich in einem kleinen Reiseführer über Nashville.
1779 wurde durch James Robertson und einer Gruppe von Wataugan Indianern das Fort Nashborough gegründet, benannt nach Francis Nash, einem Veteranen des Unabhängigkeitskrieges. Wataugan steht dabei sowohl für einen gleichnamigen Stamm der Cherokee wie auch einen Fluss, an dem sie siedelten. In den Folgejahren wurde die schnell wachsende Siedlung in Nashville umbenannt und wurde 1806 zuerst einer Stadt und später zur Kreisstadt bzw. zum County Seat und 1843 dann die Hauptstadt von Tennessee.
Der Start des Radioprogramms Grand Ole Opry, einer Sendung für Country Music, im Jahr 1925 bildete den Grundstein für den Status von Nashville als “Music City USA”.
Während ich noch in dem Reiseführer blätterte, sah Claudia einige Reihen vor uns die Speiseausgabe langsam näherkommen. Wie erwartet standen wieder die üblichen Verdächtigen, ein Nudelgericht und etwas, was uns als Hühnchen angeboten wurde, auf der Speisekarte. Wir waren wie immer froh, auf unsere Strategie als Selbstversorger gesetzt zu haben. Claudia hatte uns wieder einen klassischen Nudelsalat vorbereitet, der in Anbetracht der von Delta offerierten Alternativen wie Haute Cuisine mundete.
Bevor wir in Atlanta landen konnten, waren wir erst noch eine Weile um Atlanta herum unterwegs. Wegen einiger Turbulenzen kreisten wir noch 20 zusätzliche Minuten über dem Flughafen, bis wir endlich zur Landung ansetzen konnten. Da wir nicht die einzige Maschine waren, die sich Atlanta eine Weile von oben ansehen durften, war der Ankunftsbereich vor der Einwanderungsbehörde entsprechend gut gefüllt. Wir hatten zwar noch gut eine Stunde Zeit, bis unser Anschlussflug nach Nashville abheben sollte, die Menschenmassen vor uns machten uns aber dennoch nervös. Claudia mogelte uns dann mit dem Verweis auf unseren „Connecting Flight“ nach vorne. Aus heutiger Sicht vielleicht nicht ganz fair den anderen Wartenden gegenüber, was für uns damals aber vermutlich zweitrangig war. Außerdem war Claudia dabei sehr höflich und die meisten in der Schlange zuvorkommend.
Der 1926 eröffnete Hartsfield-Jackson International Airport war auch schon 1998 der Flughafen mit dem höchsten Passagieraufkommen. Wie viele Passagiere es damals waren, weiß ich nicht mehr, aber heute sollen es über 90 Millionen Fluggäste pro Jahr sein, die in Atlanta ein-, aus- und umsteigen. Zur letzten Kategorie gehörten wir. Nach den Einwanderungsformalitäten und den vielen Stempeln in unseren Reisepässen ging es einen Stock tiefer, wo das Gepäck auch schon auf dem Band lief. Nach der Zollinspektion konnten wir das Fluggepäck auch gleich wieder auf ein anderes Förderband legen, von wo aus es zu unserer Anschlussmaschine transportiert wurde.
Auf wie immer ewig langen, komplett mit Teppichböden ausgelegten Gängen gelangten wir zu unserem Zug, einer unter dem Flughafen verkehrenden U-Bahn, die die Terminals miteinander verband. In den mit Menschenmassen gefüllten Gängen strömte uns auch wieder der typische, süßliche Geruch in die Nase, wie es ihn nur auf amerikanischen Flughäfen zu geben scheint.
Um 17:15 Uhr hob unser Flieger für die kurze Strecke von knapp einer Stunde ab. Durch die Zeitverschiebung von einer Stunde zwischen Georgia und Tennessee kamen wir praktisch zur selben Zeit in Nashville an, wie die Abflugzeit. Im Ankunftsbereich deckten wir uns gleich mit einem Stapel an Papier ein. Ganz obenauf natürlich die Couponhefte für die Hotels, danach eine Karte von Tennessee und ein Stadtplan von Nashville.
Noch im Flughafengelände nahmen wir vom Autovermieter Alamo unseren Mietwagen, einen smaragdgrünen Geo Metro, ein zwischen 1989 und 2001 von Chevrolet gebauter Kleinwagen, wie sie heute, wo vor allem große Pick-ups und SUVs die Straßen dominieren, in den USA kaum noch zu sehen sind.
Müde vom langen Flug mussten wir uns trotzdem noch durch den Feierabendverkehr von Nashville wälzen. Die vielen Baustellen erschwerten die Orientierung genauso wie die in der Dunkelheit schwer identifizierbaren Ausfahrten. Es dauerte etwas, bis wir den richtigen Exit 87 fanden, da es eine Abfahrt A und B gab, aber nur eine führte uns zur Trinity Lane, wo Claudia aus dem Couponheft ein Ramada Motel für USD 46 ausfindig gemacht hatte, in dem wir uns für die nächsten drei Tage einquartierten. Ohne den Coupon wären es über USD 60 gewesen. Todmüde fielen wir kurz nach dem Einchecken in die Federn.
Obwohl wir am 1. März, ein Sonntag, aufgrund des Jetlags bereits um 4 Uhr morgens wach wurden, dudelten wir noch bis 6 Uhr vor uns hin, bis das Shoney‘s Resteraunt nebenan öffnete. Was gab es für einen besseren Start in den Tag und hier in Nashville als mit einem üppigen Frühstücksbuffet, neben einer größeren Auswahl an Obst natürlich auch mit kalorienreicher Kost, bestehend aus Spiegeleiern und Bacon. Das Shoney‘s hier in Nashville sah den bisherigen Restaurants dieser Kette, die wir aus dem Westen der USA und auch aus Florida gut kannten, sehr ähnlich.
Am Sonntag öffneten selbst in den USA die Geschäfte erst gegen 11 Uhr, wo für uns wichtige Einkäufe anstanden. Die Zeit bis dahin überbrückte Claudia mit etwas Faulenzen und ich vergrub mich in die Lehrbücher meines berufsbegleitenden MBA-Studiums. Danach drehten wir eine Runde durch das historische Viertel von Nashville. Wir kamen vorbei an einem Schild, wo von den ersten Indianern, die während der sogenannten „Mississippi Periode“ zwischen den 1000ern und 1400er-Jahren hier gesiedelt hatten, erzählt wurde. Später waren es Stämme der Cherokee, Choctaw, Chickasaw und Creek, von denen es Zeugnisse bis zurück in die Mitte des 18. Jahrhunderts gab.
Als nächstes kamen wir an dem in den 1930ern errichteten Nachbau von Fort Nashborough vorbei. Das tatsächliche Fort soll allerdings viermal größer gewesen sein und zwischen 1780 und 1792 Schutzraum für weiße Siedler geboten haben, bis mit den umliegenden Indianerstämmen zumindest ein temporärer Frieden geschlossen werden konnte. Daran schloss sich die 2nd Avenue an, die früher Market Street hieß, zu einer Zeit im 19. Jahrhundert, als Nashville noch die größte Stadt westlich der Appalachen war.
Bevor es auf Shoppingtour ging, stärkten wir uns ein zweites Mal im Ponderosa Steak House in der gleichen Straße. Auch die Ponderosa Steak-House-Kette kannten wir inzwischen seit vielen Jahren. Was uns allerdings auffiel, war die etwas dürftige Auswahl an der Saladbar. Ob das nur dieses Lokal betraf oder die ganze Kette zwischenzeitlich etwas nachlässiger wurde, fragten wir uns. Nach einem kleinen Steak, Baked Potatoes und einem Gang zur Saladbar waren wir bereit für den wichtigen Einkauf.
Von unserem Motel fuhren wir den Briley Parkway entlang, vorbei an einem Factory-Outlet und der Grand Ole Opry bis zur 1971 eröffneten Rivergate Mall im Stadtteil Goodlettsville. Auf der Freifläche der Mall zwischen ihren 80 Geschäften, darunter auch die inzwischen geschlossenen Geschäfte Sears und Macy’s, gab es auch einen Goldhändler namens „Gold Valley“, wo wir uns unsere Trauringe aussuchten. Uns wurden 585er bzw. 14 Karat Goldringe empfohlen. Zuerst kosteten die Ringe für unsere damaligen Verhältnisse schon happige 59 USD für Claudias Ring und 74 USD für meinen. Merkwürdigerweise kosteten dann beide zusammen nur 97 USD, sogar inklusive der Verkaufssteuer (Sales Tax). Es ging so ein bisschen zu wie auf einem orientalischen Bazar, nur eben mitten in Tennessee.
Mit den Ringen ausgestattet hatten wir alles beisammen für unsere am Folgetag geplante Hochzeit. Wir waren neugierig und auch etwas aufgeregt, wie das alles ablaufen würde.
„Ja, wir wollen“
Nach dem Frühstück, wieder im Shoney`s, machten wir uns über die 2nd Street auf den Weg zum Howard-School Building, um uns dort unsere Heiratslizenz (Marriage License) zu besorgen, was ein bisschen mit dem Aufgebot beim Standesamt in Deutschland vergleichbar war.
Das 1940 errichtete Howard School Building erschien uns als ein in die Jahre gekommener Backsteinbau, in dem etliche Behörden der Stadtverwaltung von Nashville untergebracht waren. In Deutschland neigen wir ja schnell dazu, die überbordende Bürokratie und die antiquierten Arbeitsabläufe zu kritisieren, nicht selten zu Recht. Allerdings ging es hier in Nashville im Jahr 1998 auch so zu, wie wir das aus deutschen Amtsstuben kannten. Auch hier wurde stapelweise Papier hin- und hergeschoben, Formulare wurden mit vielen Durchschlägen ausgefüllt und die Schreibmaschinen sahen aus, als wären sie schon zu Zeiten des früheren Bürgermeisters Ben West aus den 1950ern im Einsatz.
Das „Bewahren“ historischer Büromittel hatte für uns auch seine Vorteile. Die Heiratsurkunde (Marriage Certificate), die wir später zur Vermählung brauchen würden, wurde komplett manuell erstellt. Eine Mitarbeiterin des Standesamtes erstellte die Urkunde mit schwarzer Tinte in einer altertümlichen Dokumentenschrift. So schön die geschwungenen Buchstaben auf der Urkunde auch aussahen, musste die Mitarbeiterin dennoch zweimal von vorne beginnen, da sie unsere Namen nicht richtig schrieb. Beim ersten Mal war es mein Vorname, der der Sachbearbeiterin Schwierigkeiten beim Schreiben bereitete, beim zweiten Versuch war es dann Claudias Geburtsname Höck, bei dem sich der Umlaut scheinbar schwer von ihrem Reisepass abschreiben ließ.
Die Ausstellung der Heiratsurkunde kostete überschaubare USD 31. Als Geschenk bekamen wir dann eine Plastiktüte mit, kein Scherz, gratis Waschmittelproben. So etwas muss einem erst einmal einfallen. Wir hatten aber nicht lange Zeit, uns darüber zu amüsieren, da wir schon im Gerichtsgebäude bzw. Court House City Hall erwartet wurden.
Am Eingang des Gerichtsgebäudes mussten wir zuerst einmal durch eine Sicherheitsschleuse. In einem öffentlichen Gebäude überprüft zu werden wie an einem Flughafen, mag heute etwas ganz Normales sein, im März 1998 erschien uns das aber doch etwas seltsam. Aber auch hier hielten wir uns nicht lange mit Gedanken dazu auf, sondern machten uns auf den Weg in den vierten Stock, zum Amtszimmer des „Judge“. Dieser erschien auch schon nach weniger als fünf Minuten und hielt sich nicht lange mit Floskeln oder einem klärenden Eröffnungsgespräch auf, da er unsere Vermählung zwischen zwei von ihm geführte Gerichtverhandlungen „geschoben“ hatte.
Kaum hatten wir dem Richter die vom Standesamt vorab ausgefüllte Heiratsurkunde und auch die Ringe übergeben, legte er auch schon los. Der Richter sprach sehr schnell und Claudia hatte Schwierigkeiten, seinen Ausführungen zu folgen und das von ihm Vorgesagte nachzusprechen, antwortete aber an der entscheidenden Stelle mit „Yes“.
In knapp zwei Minuten war alles vorbei und der Richter erklärte uns zu „Mann und Frau“, bevor er sich schon wieder in seiner schwarzen Robe aus dem Staub machte. Wir wagten es erst gar nicht, seine Assistentin zu fragen, in welcher Sache oder gegen welche Ganoven er Recht zu sprechen hatte. Interessanterweise war die Amtshandlung der Vermählung durch den Richter kostenlos. Auf dem Schreibtisch der Assistentin stand eine kleine Box für Spenden bereit und statt einer Gebühr spendeten wir eine Handvoll Dollar für gute Zwecke.
Beim Verlassen des Gerichtsgebäudes schauten wir auf die große Uhr am Eingang. Insgesamt war nicht einmal eine Stunde vergangen zwischen dem Betreten des Standesamtes als ledige Leute und dem Verlassen der City Hall als verheiratetes Paar. In Summe genau das Gegenteil, wie man sich das vielleicht so allgemein vorstellt, aber in etwa genauso, wie wir uns das vorgestellt haben. Heiraten mal ganz anders.
Als Eheleute fuhren wir den Music Valley Drive entlang und besuchten das Country Hall of Fame Museum. Viele in der Hall of Fame aufgenommenen Stars der amerikanischen Country Music kannten wir kaum oder gar nicht. Da war zum Beispiel Ernest Tubb, der bereits 1965 aufgenommen wurde, dessen Namen wir zwar aus einem Text des Liedes „Ich möcht‘ so gerne mal nach Nashville“ der deutschen Countryband Western Union kannten, dessen Musik uns aber ansonsten nichts sagte. Im gleichen Lied wurde auch Hank Snow besungen, dessen Bild ebenfalls im Museum hing und der 1979 in die Hall of Fame aufgenommen wurde. Dann waren da die Sons of the Pioneers, die mir aus alten Westernfilmen mit Roy Rogers und Gene Autry bekannt waren, deren Konterfeis ebenfalls als aufgenommene Mitglieder zu sehen waren. Die uns beiden bekannten Country Stars unserer Zeit, von Alan Jackson über George Strait bis zu Garth Brooks und Shania Twain waren 1998 vermutlich noch zu jung, um in die Hall of Fame aufgenommen zu werden.
Nach dem Mittagessen im Old Country Buffet, ein weiteres Kettenrestaurant, das wir seit einigen Jahren kannten und schätzten, mitten in der Rivergate Mall fiel uns zwischen einem Target und einem Walmart Superstore ein Geschäft mit dem Namen Media Play auf. Das Geschäft war riesengroß, fast so groß wie ein Walmart, aber randvoll mit Medienartikeln von VHS-Kassetten, die gab es damals noch, CDs, Bücher, Comicheften und allerlei Figuren aus Star Wars und Disney Filmen. Für einen Filmfan wie mich eine Goldgrube. Offensichtlich war Media Play eine richtige Kette mit Filialen in vielen Staaten, insgesamt sollen es bis zu 72 Geschäfte gewesen sein. Später wurden die Media Play Geschäfte von Best Buy übernommen, vergleichbar mit Media Markt im deutschsprachigen Raum, bis der Online-Handel der Kette den Garaus machte und sie wie so viele von der Bildfläche verschwanden. Begeistert ging ich die mit Spielfilmen beladenen Regale entlang, während sich Claudia die CD-Abteilung anschaute. Der Nachmittag war nicht nur gerettet, sondern ging auch sehr schnell vorüber. Voll beladen mit Videokassetten und etlichen CDs fuhren wir zurück in unser Motel und machten uns für das Abendprogramm frisch.
Am Abend gab es dann doch noch eine „Hochzeitsfeier“, auch wenn nur wir zwei davon wussten, als wir den Wildhorse Saloon in der 2nd Avenue von Nashville betraten. Der erst 1994 eröffnete Wildhorse Saloon war eine Mischung aus einer bis zu 2.000 Besucher fassenden, riesigen Diskothek, in der über drei Etagen hinweg Countrymusik gespielt wurde, mehreren Bars und einem Restaurant.
Die Diskothek war gefüllt mit Menschen in Cowboy-Outfit und wir zögerten nicht lange, sondern begaben uns auch gleich auf die Tanzfläche, wo wir mit einem Diskofox ganz gut zu Countrysongs von Alan Jackson und George Strait tanzen konnten.
Etwas später gab es dann Line Dance, wo sich auf der riesigen Tanzfläche schnell viele Leute einfanden, zu denen wir uns dazugesellten. Es fiel uns zu unserer eigenen Überraschung gar nicht schwer, den Schritten zu folgen. Es war eine schöne Atmosphäre und so ganz anders als eine klassische Hochzeitsfeier.
Müde, aber glücklich fuhren wir am Ende unseres ungewöhnlichen, aber dafür umso schöneren Hochzeitstags zu unserem Motel zurück.
Memphis
Nach einer ruhigen Nacht saßen wir morgens um halb sieben im Shoney’s zum Frühstück und schauten uns Prospektmaterial und das Couponheft von Memphis an.
Wann sich die ersten Indianer in der Gegend des heutigen Memphis angesiedelt hatten, ist nicht genau bekannt, aber zumindest als eine unter der spanischen Krone geführten Expedition unter Hernando de Soto dort in den 1540er-Jahren hier vorbeikam, waren schon Menschen vor ihnen da. Die Spanier bauten dann 1795 mit Fort San Fernando die erste Befestigung und damit begann auch die Besiedelung durch europäische Einwanderer. Briten, die schon vor den Spaniern ein über fünftausend Acres großes Stück Land in Tennessee für sich reklamierten, gründeten 1819 dann die Stadt Memphis, angelehnt an die frühere Hauptstadt in Unterägypten.
Während des amerikanischen Bürgerkriegs (Civil War) stand Memphis auf der Seite der Konföderierten. Unionstruppen besetzten die Stadt 1862 nach der Schlacht von Shiloh bis zum Ende des Krieges. Nach der Zeit des Wiederaufbaus (Reconstruction) des Südens, knüpfte Memphis wieder an ihren vorherigen Status als Handelszentrum an.
Der heiße Kaffee im Shoney’s wärmte uns wieder etwas auf, denn draußen war es in der Nacht ziemlich kalt geworden, erst recht, weil wir Temperaturen, die wir um diese Jahreszeit in Florida gewohnt waren, auch hier im Süden Tennessees erwartet hatten. Wir hatten für den Urlaub schlichtweg nur sommerliche Kleidung bei uns, aber hatten natürlich noch unsere Jacken dabei, die wir eigentlich erst auf dem Rückflug wieder aus dem Gepäck holen wollten.
Frisch gestärkt mit Spiegeleiern und Bacon Strips, ging es auf dem I-240 westwärts Richtung Memphis, vorbei an Lexington, Jackson und Brownsville. Diese drei Städte machten im amerikanischen Bürgerkrieg auf sich aufmerksam, was wir den „Historical Markers“ an Rastplätzen am Wegesrand entnehmen konnten.
Bevor Truppen der Konföderierten nach Jackson vorrückten, kam es am 18. Dezember 1862 zum Ende der Schlacht um Lexington, bei der sich Colonel Robert G. Ingersoll der „Blauen“, dem Rebellen Captain Frank B. Curley ergab.
In und um Jackson kam es während des Bürgerkriegs am 19. Dezember 1862 zu einem Versuch der Konföderierten, den Vormarsch der Unionstruppen Richtung Vicksburg zumindest zu verlangsamen. Nathan Bedford Forrest, ein General der “Grauen”, gelang es dabei, einen Teil der Eisenbahnlinie nach Corinth, Mississippi, zu zerstören und damit Truppentransporte zu verzögern. Genutzt hatte das den Rebellen dennoch nicht viel, da der Unionsgeneral und spätere US-Präsident die Schlacht um Vicksburg am 4. Juli 1863 gewann.
Brownsville wurde zwischen 1862 und 1864 mehrmals Opfer von Überfällen der Konföderierten-Armee, Deserteuren und den Südstaaten zuzuordnenden Guerrillas. Am 29. August 1863 sollen es 50 Guerillas gewesen sein, die einen Teil der Stadt niederbrannten. In späteren Jahren, vor allem in den 1930er- und 1940er-Jahren waren es dann Lynchmorde weißer Mobs, im Kern ging es ihnen darum, die schwarze Bevölkerungen von Wahlen abzuhalten oder einfach nur ihre Bürgerrechte einzufordern, die Brownsville unrühmliche Schlagzeilen bescherte.
Beim Exit 21 verließen wir die Interstate und erreichten auch unser Motel, das Ramada Limited, für das wir trotz Coupon noch immer satte USD 48 auf den Tisch legen mussten. Nachdem wir unser Gepäck im Zimmer deponiert hatten, wartete in der „Cafeteria“ schon ein üppiges Buffet auf uns, eines der vielen Kettenrestaurants, die inzwischen schon lange von der Bildfläche verschwunden sind. Hier gab es auch eine für uns neue Bezahlform. Wurden wir bei Buffetrestaurants bislang immer gleich am Eingang zur Kasse gebeten, stand hier die Bezahlung erst nach dem Mahl am Ausgang an.
Als Verdauungsspaziergang flanierten wir durch die Mall of Memphis, wieder eine dieser Megamalls, wie sie damals nur die USA hervorgebracht hatten. Die Mall wurde 1981 eröffnet und das Erste, was uns beim Betreten ins Auge fiel, war die riesige Eislauffläche, die in die Mall hineingebaut worden war. Wer heute bei einem Besuch in Memphis Lust hat, einen Einkaufsbummel mit einer Runde auf den Kufen zu verbinden, wird schwer enttäuscht. Die Mall, mit allem, was darin war, wurde 2007 dem Erdboden gleich gemacht.
In den 1980er und 1990er-Jahren, also auch noch zu der Zeit, als wir 1998 Memphis besuchten, war der Einkaufstempel als „Mall of Murder“ verschrien. Zahlreiche Morde und Schießereien, schon damals wie heute Alltag in den USA, rund um und sogar in der Mall verhalfen ihr zu dem unrühmlichen Spitznamen. Auch wenn wir davon bei unserem Besuch nichts merkten, war die Mall 1998 wohl schon im Niedergang. 2001 zogen einige der großen Ankermieter, unter ihnen JC Penney, heute auch pleite, und Dillards, aus der Mall aus und bald kaufte dort kaum einer mehr ein. Nach mehreren Umbauten und Renovierungen konnte die Schließung letztlich nicht mehr aufgehalten werden.
Nur wenige Autominuten von unserem Motel im Stadtteil Whitehaven waren es zum 1982 eröffneten Elvis-Presley-Museum Graceland. In dem Haus, in dem Elvis von 1957 bis zu seinem Tod 1977 gewohnt hatte, buchten wir die „Mansion Tour“ und die „Car Tour“. Bevor wir die Touren starten konnten, gab es noch ein obligatorisches Foto vor dem Eingang des Hauses. Dieses Foto war für uns über die ganzen Jahre hinweg quasi so etwas wie unser nicht ganz offizielles Hochzeitsfoto.
Ein Shuttlebus der Tour fuhr uns die paar Schritte über die Straße vom Eingang Gracelands zum eigentlichen Haus, in dem der King of Rock 'n' Roll seinerseits residiert hatte. Als erstes leitete uns die Tour vom Flur der Villa nach rechts in das Musikzimmer, gefolgt vom Esszimmer auf der linkten Seite, danach kam die Küche, dann die Treppe hinunter in das Billardzimmer und der sogenannte Dschungelraum, in dem auch ein kleiner Wasserfall eingebaut war. Weiter ging es in einen Raum behangen mit Gold- und Platinschallplatten, seiner Uniform aus seinem ab dem 1. Oktober 1958 in der Ray Barracks Kaserne in Friedberg absolvierten Militärdienst, gefolgt von seinen Konzertklamotten, von edlen Maßanzügen bis zu den „Strampelanzügen“, mit denen er in den letzten Jahren in Las Vegas auftrat. Bei Gelegenheit soll er auf der Bühne in Las Vegas auch Karateeinlagen zum Besten gegeben haben.
Gerne hätten wir den einen oder anderen der Tour Guides gefragt, in welchen Supermärkten der vielleicht nur vermeintlich tote Elvis Presley am ehesten bei seinen Einkäufen anzutreffen wäre. Da wir aber nur mobile Abspielgeräte für die Audiotour umgehängt bekamen, mussten wir unsere Neugier zügeln. Wir können aber bestätigen, dass wir während unserer 60 Reisen durch die USA zwischen 1992 und 2020, in denen wir in unzähligen Supermärkten eingekauft haben und dort sehr vielen Menschen begegnet sind, keinen Elvis Aaron Presley getroffen haben, zumindest soweit wie wir das beurteilen konnten.
Nachdem wir alle Räume in dem Haus besichtigt hatten, führte uns die Tour hinaus in den Garten, wo einige Pferde grasten. Ob diese Pferde schon zu Lebzeiten von Elvis hier waren, er womöglich in seinen Western „Flammender Stern“ (Flaming Star) oder „Charro“ auf ihnen ritt, konnten wir nicht ausfindig machen. Im Memorial Garden fand sich letztlich das Grab des King und seiner Eltern.
Der Shuttlebus fuhr dann wieder ein paar Meter wieder auf die andere Straßenseite, wo das Automuseum auf uns wartete, in dem Fahrzeuge ausgestellt waren, mit denen Elvis zwischen den 1950ern bis zu seinem Tod im Jahr 1977 durch die Lande fuhr. Kurz vor dem Ende der zwei Touren kamen wir noch in einen kleinen Vorführungsraum, dem privaten Kino von Elvis, in dem Ausschnitte aus den 31 Filmen gezeigt wurden, die er zwischen 1956 und 1969 gedreht hatte.
Aus einem amerikanischen Museum oder einer sonstigen Attraktion kommt man selten heraus, ohne noch durch einen Souvenirladen geschleust zu werden. Hier in Graceland war das nicht anders. Wir ließen uns dann auch dazu verführen, noch ein paar Filmpostkarten mit dem Konterfei des King als Andenken zu erwerben, was uns als eine überschaubare Ausgabe erschien.
So viel musische Kultur machte hungrig, weshalb uns der „Golden Corral“ mit seinem üppigen Buffet gerade recht kam. Die überbordende Auswahl der Speisen wurde wieder etwas ausgeglichen durch deren überschaubare Qualität: Ganz egal, was wir uns vom Buffet nahmen, es schmeckte alles ähnlich zu Tode gekocht. Zur Verdauung fuhren wir noch etwas durch Memphis, bis uns die Müdigkeit so langsam wieder in unser Motel zurücktrieb.
Jack Daniels
Nashville stand am nächsten Tag noch einmal auf unserer Agenda, nicht nur, weil wir von hier aus auch weiter nach Florida weiterfliegen wollten.
Nach einer weiteren Nacht in Memphis fuhren wir zuerst wieder auf dem I-40 zurück nach Nashville. Am Exit 216 C verließen wir die Interstate und quartierten uns in der Nähe des Flughafens ein. Das recht neu aussehende Super 8 Motel lockte mit einem Preis von USD 40, einem Pool und einem Hot Tub. Die 10 % Rabatt bekamen wir dieses Mal nicht nur wegen des Couponhefts, das Claudia unter dem Arm hatte, sondern auch durch unsere VIP-Card, die wir seit einiger Zeit besaßen.
Schon damals war die 1974 gegründete Motel-Kette bekannt für ihre günstigen Preise gepaart mit sauberen Zimmern. Wir konnten damals gut feststellen, wie sich diese Kette von direkten Mitbewerbern wie Motel 6 oder auch den teureren, aber sehr in die Jahre gekommenen und völlig überteuerten Best Western absetzen konnte. Heute gehört Super 8 Motel als Teil der Wyndham Gruppe mit über 2.000 Häusern zu einer der größten Hotelketten weltweit.
Nur wenige Meilen, also eine Kurzdistanz in Amerika, waren es vom Super 8 Motel zu einem weiteren Shoney’s, die es damals noch fast überall gab. Gut gestärkt fuhren wir von dort die knapp 70 Meilen nach Lynchburg, um die Jack Daniels Destillerie zu besichtigen. Einem alten Spruch zufolge kann man bei fehlenden sozialen Kontakten ja immer noch auf drei bewährte Freunde zurückgreifen, namentlich Jack Daniels, Jim Beam und Johnny Walker, aber nur, wer es mag und mit den Nebenwirkungen zurechtkommt.
Die Destillerie, mehr eine Schaubude, war im Stil einer alten Hütte gebaut, so wie man sich früher Schwarzbrennereien im Hinterland Tennessees vorstellt. Vermutlich war das auch der Eindruck, den die Destillerie bei den Besuchern erwecken wollte. Die Führung war für uns beide sehr informativ. Auch wenn wir selbst so gut wie keinen Alkohol tranken, schon erst recht keinen Whiskey, lauschten wir interessiert der Geschichte von Jack Daniels. Demnach wurde dort seit 1866, also gleich nach dem Bürgerkrieg, bis heute der inzwischen weltbekannte Tennessee Whiskey gebrannt, mit einer kurzen Auszeit während der Prohibition.
Nach dem Vortrag wurden wir durch die historische Destillerie geführt. Dort standen in dem Holzverschlag dann ein paar riesige, hölzerne Bottiche, jeder mit einer bestimmten Verarbeitungsstufe von Mais und Malz. Im Raum wehte ein intensiver Geruch von Holzkohle, der Jack Daniels seinen typischen Geschmack geben soll. Wir durften unsere Nasen in einen der Bottiche mit der Maische stecken. Wenn wir länger als nur einen kurzen Moment den Alkoholschwall, der uns aus dem Bottich entgegenwehte, eingeatmet hätten, wären wir ruckzuck betrunken gewesen, ohne auch nur einen Schluck getrunken zu haben.
Auf der Rückfahrt nach Nashville waren wir zwar nicht betrunken, dafür war unser Mietwagen nicht mehr ganz auf der Höhe. Der Motor knatterte und schnaufte, als wäre er in den letzten Zügen. Wir waren froh, als wir am Motel ankamen und die Weiterreise nach Florida am nächsten Morgen bevorstand. Die drei Meilen vom Hotel zum Flughafen sollte der Wagen wohl gerade noch schaffen, hofften wir.
Orlando
Schlecht ausgeschlafen frühstückten wir noch einmal im Shoney’s. Das Restaurant war schon frühmorgens ungewöhnlich voll. Über mehrere Tische verteilt saßen mehr oder weniger ähnlich gekleidete Menschen, die uns an die Mennoniten erinnerten, denen wir in Montana schon öfters begegnet waren. Ob es sich bei der großen Gruppe auch um Mennoniten, Amish oder eine ähnliche Religionsgemeinschaft handelte, die sich in Kleidung aus dem 18. oder 19. Jahrhundert kleideten, konnten wir nicht ausmachen. Auf der Straße standen keine Pferdekutschen, somit sprach einiges gegen die Amish, aber Mennoniten, die sogar in Flugzeugen unterwegs waren, hätten es auch sein können. Allerdings, so hatten wir erfahren, war es auch den Amish, selbst denen der „alten Ordnung“, für die Ausübung ihrer Berufe erlaubt, moderne Geräte, Maschinen und Computer zu nutzen. Allerdings eben nur im Beruf, im privaten Umfeld waren moderne Hilfsmittel nicht erwünscht, wie wir erfuhren.
Unser schwer hüstelndes Auto schaffte es, die letzten Meter bis zum Flughafen, wir kamen nach der Rückgabe auch sehr zügig durch den Check-in und auch unser Flug nach Orlando hob pünktlich um 10:25 Uhr vom Nashville International Airport ab und erreichte nach einer Stunde Flugzeit zwei Stunden später Orlando. Grund war die eine Stunde Zeitverschiebung, die wir uns auf dem kurzen Flug einhandelten.
Wir hatten zwar eine Stunde „verloren“, dafür aber etliche Grad an Wärme gewonnen. Hier in Orlando begrüßten uns sehr warme Temperaturen, so wie wir das aus den vergangenen Jahren auch gewohnt waren und worauf wir nach der doch frischen Luft in Nashville und Memphis auch gehofft hatten.
Zwar kam unser Gepäck sehr zügig aus dem Gepäcklaufband daher, dafür war die Wartezeit bei der Alamo Autovermietung mit über 45 Minuten umso länger. Offensichtlich waren zeitgleich mit uns einige andere Maschinen in Orlando gelandet und praktisch alle brauchten Mietwagen. Doch das Warten hatte sich dann doch auch gelohnt. Wir bekamen einen sehr neu aussehenden, bordeauxroten Mitsubishi Mirage. Bestellt hatten wir einen simplen Mietwagen aus der Economy Kategorie, bekommen haben wir ein Mid-size Fahrzeug mit gerade einmal 1.800 Meilen auf dem Buckel.
Schon beim Einsteigen wechselte Claudia von ihren festen Schuhen in Flip-Flops und schälte sich aus den langärmligen Klamotten. Was so eine Stunde Flug alles ausmachen konnte. War es in Nashville noch frisch und regnerisch, wurden wir hier mit strahlendem Sonnenschein und sehr warmen Temperaturen begrüßt.
Kaum zwischen Kissimmee und Orlando angekommen, führte uns der Weg und vor allem der Hunger direkt zu unserem bekannten „Bill Wong Famous Buffet“, dem China-Buffet-Restaurant, das wir seit einiger Zeit schon gut kannten. Für uns war das immer noch das beste China-Restaurant, das wir in den USA erlebt hatten und das einzige, wo selbst ich als heikler Esser vom Buffet etwas mehr als nur das übliche Lo Mein essen konnte. Es kostete wie im Vorjahr noch immer USD 21 zusammen.
Nach ein paar Einkäufen fuhren wir um halb fünf in unser Motel, dem Quality Inn Plaza, schon damals eine sehr einfache Unterkunft, aber für unsere Zwecke und unser Budget vollends ausreichend.
Im Motel lag auch wieder die seit 1982 erscheinende USA Today aus, eine landesweit erscheinende Tageszeitung, die von der Aufmachung her vergleichbar irgendwo zwischen den deutschsprachigen, teilweise reich bebilderten Blättern Bild (Deutschland), Blick (Schweiz) bzw. Krone (Österreich), journalistisch aber bis heute eher mitte-links ausgerichtet ist.
Die USA Today gab es in den 1990ern in fast allen Kettenhotels, in denen wir übernachteten, kostenlos. Wenn es keine Zeitung gab, konnte man sie zumindest an einem der überall aufgestellten Zeitungskästen für zuerst 25 Cent, dann 50 Cent kaufen. In späteren Jahren gingen die Preise immer weiter rauf, das Blatt war aber zumindest weitläufig verfügbar. Heute muss man die USA Today wie eine Stecknadel im Heuhaufen suchen. Nur noch wenige Hotels, zum Beispiel das Ramada in der Tower Road am Denver Flughafen, bietet seinen Gästen die USA Today noch kostenlos an.
Zeitungskästen gibt es praktisch überhaupt nicht mehr und wenn, dann findet sich darin heute nicht zwingend eine Zeitung. In manchen Staaten gibt es als Antwort auf die Opioid Krise in den USA nun in den Kästen ein Nasenspray als Erste-Hilfe-Maßnahme bei einer Drogenüberdosis, insbesondere Fentanyl. Man muss auch teilweise weit fahren und dann auch noch früh dran sein, um in einem der wenigen Geschäfte, das noch Tageszeitungen führt, ein Exemplar zu bekommen, wo die USA Today dann gleich mal USD 3 kostet.