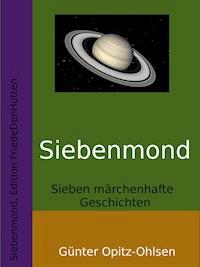Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Unter kurzen Geschichten ist allerlei literarisches Kurzes zu verstehen. Dazu gehören Kurzgeschichten, Dramoletti und feuilletonistische Betrachtungen, die ich im Laufe der Zeit auf unserer Homepage friededenhuetten.de veröffentlicht habe. In den Reflexionen beschäftige ich mit Berlin, der Stadt, in der ich lebe. Abgeschlossen werden die kurzen Geschichten mit Reisebeschreibungen. Von einen dieser Minireisen nach Krakow am See stammen auch die Schneckenfotos, die jeden Teil der Sammlung einleiten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 305
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Günter Opitz-Ohlsen
In den Sand geschrieben
Kurze Geschichten
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Teil 1: Kurze Geschichten
Das Erdloch
Der freie Fall
Der Wartekünstler
Ausgezeichnet
Der Sammler
Nebel
Der Rattenfänger
Die unerträgliche Bedeutungslosigkeit des Seins
Der Gnom
Abgestellt
Eine kleine Bettgeschichte
Der alte Mann und das Buch
Cagla weint
Der Plumpsack
Der Patient
Sponsor gesucht
Eine kleine Rolltreppengeschichte
Eine kleine Weihnachtsgeschichte
Die Herrin
Die letzten Sekunden
Der Sammler
Der Koffer
Die Geschichte von Wullepulle
Die gelben Riesen
Teil 2: Reflexionen
Freiheit – ein Albtraum
Die Entdeckung der Kälte
Das Goldene Kalb
Simplizius 2012
Gautama
Dereinspaziert
Der Komparse – eine Ortsbestimmung
Galois Traum
Reinhold Burger – der Erfinder
Der Herr der Ringe
Der Speckstein
Paul Nipkow
Die Brunnenstraße in Berlin
Der Berliner Hauptbahnhof
Teil 3: Dramolleti
Herbert wird Millionär
Das himmlische Manna
Das letzte Experiment
Das Recht ist bei den Göttern
Teil 4: Kleine Fluchten
Usedom auf Usedom
Rostock und nicht Rohstock
Krakow am See
Impressum neobooks
Teil 1: Kurze Geschichten
Das Erdloch
Ich wohne im Erdloch, mitten im Wald. Kein Anschluss ans Stromnetz. Stattdessen Solarzellen, an einem Mast montiert. Projekt Alpha des Landschaftsverbandes Berlin. Das Schild habe ich an den Mast angebracht, damit keiner auf dumme Gedanken kommt. Geld habe ich genug.
Alles fing mit einem 200.000 Euro Kredit an. Den hat mir damals meine Bank gegeben, weil ich im eigenen Haus leben wollte. Das Haus war eine Schrottimmobilie. Ich habe sie billig bekommen, für 100.000 Euro. Lag in bester Wohngegend. Direkt neben den Luxusvillen in Berlin Pankow. Für 10.000 Euro hat mir eine Schlepperbande 10 Moldawier geliefert. Die haben für mich das Haus saniert. Gewohnt haben sie in der Schrottimmobilie. Wasser- und Stromanschluss gab es ja noch. Für 2000 Euro im Monat haben die Tag und Nacht geackert. Nach 2 Monaten war alles fertig. 2 Luxuswohnungen mit echtem Stäbchenparkett. Ich glaube, die Menschen, die Geld haben, haben Angst, dass ihr Geld irgendwann einmal nichts mehr wert ist. Dann brauchen sie etwas anderes, womit sie tauschen können. So bin ich die Wohnungen auch schnell losgeworden. Haben mir 500.000 Euro eingebracht. Damit konnte ich den Kredit abzahlen und die Moldawier natürlich auch. Die waren so dankbar, dass wir zusammen moldawisches Richtfest gefeiert haben. Danach bin ich auf die Idee mit dem Erdloch gekommen. Habe lange den Grunewald nach einer günstigen Stelle abgesucht. Die einzigen Besucher, die sich an meinem Erdloch blicken lassen, sind die Wildschweine. Angst ums Geld habe ich auch nicht. Wer in einem Erdloch wohnt sorgt sich eher darum, dass er unerkannt bleibt und verschwiegene Freunde hat.
Zuerst hatte ich nur ein Zimmer, nein, ein Loch in meinem Erdloch. Ein Ein-Loch-Erdloch sozusagen. Es war nass und im Winter kalt. Aber mit den 200.000 Euro, die ich vom Hausverkauf übrig hatte, konnte ich mir schon etwas Luxus in meinem Erdloch leisten. Eine schnelle Internetverbindung und eine komplette Wärmeisolierung zum Beispiel. Das mit den Schrottimmobilien und den Moldawiern habe ich dann mehrmals gemacht. Seit 10 Jahren mache ich das inzwischen.
Die Moldawier sind immer ehrlich zu mir gewesen. Dadurch sind meine Gewinne immer größer geworden. Den Moldawiern konnte ich sogar mehr zahlen. Die haben sich wie die Schneekönige gefreut. Als sie aber hörten, dass ich in einem Erdloch wohne, haben sie mich ausgelacht. Aber dann habe ich es ihnen gezeigt, und sie haben mich blöd angeguckt. Mein Erdloch haben sie aber trotzdem prima ausgebaut. Inzwischen wohne ich in einem Elf-Loch-Erdloch, vergleichbar mit einer Villa. Ich habe Heizung, Strom, Energiespeicher und Wasseraufbereitung. Bin schließlich nicht an die Kanalisation angeschlossen. Natürlich lebt es sich in einem Erdloch sehr zurückgezogen. Der einzige Kontakt nach draußen sind die Moldawier, das Internet und die Arztbesuche. Alles andere lasse ich mir inzwischen von Menschen meines Vertrauens anliefern. Verschwiegenheit ist sehr wichtig. Will schließlich nicht auffliegen. Obwohl ich in RTL oder anderen Schrottsendern bestimmt eine prima Realityshow abgeben würde.
Die Moldawier führen inzwischen das Geschäft. Davon hat das Dorf, aus denen die alle kommen, mächtig profitiert. Die waren sogar im Fernsehen und ihr Dorf musste als Musterbeispiel deutsch-moldawischer Wirtschaftsbeziehungen herhalten. Aber über mein Erdloch sagen sie nichts, und das ist gut so. Ich glaube, sie sind meine Freunde.
Inzwischen bin ich sehr reich geworden. Ca. 60 Millionen Euro habe ich angehäuft. Ich lebe sehr zurückgezogen in meinem Erdloch.
Einmal wollten die Moldawier mir eine Freude machen und mich mit einem Mädchen aus ihrem Dorf verheiraten. Da aber habe ich direkt nein gesagt. Ich will einer Frau mein Leben nicht zumuten. Zu der Zeit, als ich die erste Schrottimmobilie saniert habe, habe ich auch mit den Moldawiern dort gewohnt. Zwischen all dem Bauschutt und dem anderen Gerümpel. Das hat mir Spaß gemacht. Nie mehr wollte ich in einem gewöhnlichen Haus wohnen. Am liebsten auf der Müllhalde, aber da wäre ich aufgefallen. So gute Möglichkeiten wie im Wald hat man dort auch nicht. Also bin ich auf die Idee mit dem Erdloch gekommen. Bereut habe ich es noch nicht. Doch, einmal schon. Ich habe eine Frau kennengelernt. Ich glaube, sie mochte mich. Aber als ich ihr das mit dem Erdloch erzählte, ist sie schreiend aus dem Lokal gelaufen, in dem wir uns verabredet hatten.
Was soll ich sagen? Mir geht es gut. Ich habe viele Freunde in Moldawien und alles, was ich zum Leben brauche. Aber was soll ich mit dem ganzen Geld machen? Irgendwann werde ich sterben. Ein Grabzimmer haben mir die Moldawier schon gebaut. Ich wollte es so haben, wie die Ägypter. Den Moldawiern braucht man nur ein Foto zu zeigen, und schon machen sie dir den schönsten Sarkophag, den man sich vorstellen kann. Als Grabbeigaben werde ich ein paar Goldklumpen und eine Kette aus Messing, die ich von meinem Vater geerbt habe, hineinlegen lassen. Der war Schreiner, hat aber so viel gesoffen, dass sich meine Mutter von ihm trennen musste. So bin ich auch als Kind allein groß geworden. Freunde auf der Schule hatte ich nicht. Ich war unauffällig. Habe mich aus allem raus gehalten, so gut es eben ging. Nur einmal hatte ich Ärger, als einer von mir Schutzgeld forderte, damit er mich nicht verprügelt. Das habe ich dem Direktor gemeldet. Aber ich habe dem gesagt, dass er bei der Geldübergabe schon dabei sein sollte. Hat geklappt. Der Schüler ist sofort von der Schule geflogen. Hat sein Abitur auf dem dritten oder vierten Bildungsweg gemacht und sogar ein Buch geschrieben: Wie mache ich meine erste Million. Das hat ihn dann zum Millionär gemacht.
Mein Geld könnte ich verbrennen oder den Wildschweinen verfüttern. Vielleicht mögen die das. Besser wäre eine Stiftung, dann könnte ich mir ein Denkmal setzen lassen. Aber einer, der im Erdloch wohnt, ist kein gutes Vorbild. Dann gebe ich lieber alles den Moldawiern. Die werden sich bestimmt freuen, ach, was sage ich, die werden mich verehren.
Dass ein Erdloch solche Auswirkungen auf ein ganzes Leben haben könnte, hätte ich anfangs nicht gedacht. Aber ich mache mir mal wieder zu viele Gedanken. Ob ich nun im Erdloch, im Bauwagen oder im Eisenbahnwaggon wohne, spielt eigentlich gar keine Rolle mehr. Hauptsache ist, die Moldawier bleiben bis zu meinem Tod bei mir. Aber daran zweifle ich nicht mehr.
Der freie Fall
Es ist kalt. Die Luft ist feucht, der Himmel ist grau. Und wenn sich einmal ein Lichtstrahl in diese Gegend verirrt, dann vergoldet er den Herbstwald für kurze Zeit: Das Rot leuchtet weit und der leichte Wind lässt die Blätter zu Boden tanzen. Ein Spiel mit Farben und Formen, ein Spiel, das alles gibt, bis es dunkel wird im Land, bis der Schnee die Landschaft einhüllt, zudeckt für den langen Winterschlaf. Das Baumhaus steht immer noch.
Wie lang ist es her? 40 Jahre müssen es bestimmt sein. Das Dorf hat sich wenig geändert. Die Felder sind abgeerntet. Sie liegen brach. Im Märzen der Bauer sein Rösslein anspannt. Was wird gepflanzt? Weizen und Roggen für das täglich Brot oder Mais für unser täglich Benzin, das du uns heute gibst, damit wir aus unserm Dorf in alle Himmelsrichtungen entschwinden können. Doch, der Glanz der alten Tage ist vorbei. Den Bauer im Dorf gibt es nicht mehr, die Hotels, früher beliebter Urlaubsaufenthalt, sind heute Seniorenresidenzen. Das Dorf liegt im Dornröschenschlaf und kein Prinz ist in Sicht, der es wieder zum Leben erwecken könnte.
Selbst die Dorfschenke hat jetzt noch geschlossen. Als er noch jung war, war sie schon morgens geöffnet, beherbergte Skatspieler einer Generation, die den Krieg noch aktiv mitgemacht hatte und ihn noch so in der Erinnerung lebendig hielt, als würde die Achtung einer Person von den alten Geschichten abhängen. Ein Gedenkstein erinnert an die Gefallenen für Kaiser und König, für den Diktator, der immerhin Autobahnen gebaut hat, und jetzt sogar für die Demokratie, die überall auf der Welt erkämpft werden muss oder, besser gesagt, mit Blut bezahlt wird. Mittags ging es dann schon hoch her im Dorfkrug. Die alten Lieder wurden gesungen, als könnte man sich die Traumatisierung weggröhlen. So war das damals.
Der Dorfplatz ist immer noch der alte Platz, auf dem er steht. Hier sind noch die hohen Buchen und die Birken zu sehen, die er auch aus seiner Kindheit kannte. Gibt es eigentlich Orte, die der Veränderung trotzen? Das Haus, die alte Schule, gibt es noch, aber eine Schule ist es längst nicht mehr. Die Kinder im Dorf müssen in die nächste Kreisstadt fahren, um fürs Leben zu lernen, oder vielleicht doch nur für die Schule? Viele werden es nicht sein. Zu jener Zeit gab es für alle Kinder im Dorf auch nur einen Raum. Da waren acht Klassen untergebracht und er konnte im ersten Schuljahr den Stoff der zweiten, dritten oder vierten Klasse mithören. Er ist sich heute sicher, dass er nie mehr so viel gelernt hat wie damals im ersten Schuljahr.
Den alten Eingang gibt es immer noch und das Vordach auch. In der Erinnerung erscheint alles viel größer. Wie lächerlich kommen ihm nun die Ausmaße des Hauses, des Hofes und des Vordachs vor. Als hätte eine Fee alles verkleinert, damit er mehr in den Blick bekommt, vielleicht auch das Ganze erkennen kann, das sich hinter jedem Ensemble versteckt.
Sieben war er damals nicht, denn mit sieben ist er in die Schule gekommen. Also muss er sechs gewesen sein, als er den Bastelbogen im Lebensmittelgeschäft sah, ein Flugzeug aus Balsaholz, das musste er haben. Er sparte etwas von seinem Taschengeld, bis er den Preis bezahlen konnte. Er war sehr froh und das Flugzeug war im Nu zusammengebaut. Und wie schön es fliegen konnte. In der großen Küche aber war kein Platz zum Fliegen und das Wohnzimmer war tabu. Aber da gab es ja noch den Flur. Der war ideal als Flugplatz geeignet. Hier konnte das Flugzeug auch einen Abstecher ins Badezimmer oder ins Schlafzimmer unternehmen. Dort lag der Vater krank im Bett. Er hatte nichts gegen die Fliegerei. Und das Spiel wurde immer wilder, immer schneller, immer besser. Zielfliegen war angesagt. Wie muss das Flugzeug abgeworfen werden, damit es weich in der Badewanne oder direkt neben dem Badeofen landet? Doch dann flog das Balsaholz doch irgendwo anders hin und er versuchte es noch einmal. Hartnäckigkeit zeichnet den Gewinner aus.
Doch am Ende hat er es doch verloren, das geliebte Flugobjekt. Es entschwand aus dem offenen Flurfenster mitten auf das Vordach. Dort lag es, unerreichbar, es sei denn … Dem Vater konnte er nichts erzählen, der hätte sich nur aufgeregt, und er war krank. Kranke benötigen Bettruhe, das hatte der Arzt verschrieben. Und Mutter? Sie war nicht da. Bestimmt einkaufen. Sonst hatte sie ihn immer zum Einkaufen geschickt. Er war allein. Allein auf sich gestellt. Also, warum nicht aus dem Fenster klettern, auf das Vordach und sich dann das Flugzeug einfach holen? Er war schon groß genug, um aus dem Fenster zu steigen. Auf dem Vordach fand er zunächst keinen richtigen Halt. Es war mit Moos bedeckt. Glitschig – wie eine Eisbahn im Winter. Da sind sie immer geschlittert. So nannten sie es, wenn sie mit den Schuhen auf der Eisbahn rutschten. Das Vordach war ein wenig geneigt. Zuerst fand er noch Halt am Fenster. Dann bückte er sich und hielt sich am Dach fest. Dort gab es Haken, an denen er sich festhalten konnte. Er lag auf dem Bauch, seine linke Hand hielt den Dachhaken und die andere streckte sich nach dem Flugzeug. Er war noch zu weit weg. Ein paar Zentimeter nur. Er rutschte etwas nach rechts. Jetzt war er fast dran am Flugzeug. Mit dem Mittelfinger konnte er es schon greifen, aber der rostige Rettungsanker gab nach. Langsam zuerst nur – und er schaute auf seine linke Hand. Hochziehen konnte er sich nicht, dann würde das gebogene Eisen herausgerissen werden. Doch so auf dem Bauch liegenbleiben konnte er auch nicht. Ein Dilemma, wie so oft in seinem Leben. Noch hielt der Haken, wurde aber immer länger. Das Kind sah, wie sich der Dachhaken Millimeter für Millimeter aus seiner Verankerung löste, und es war nur eine Frage der Zeit, bis er endgültig nachgab. Der Blick des Jungen war jetzt starr auf den Haken gerichtet. Das Flugzeug existierte nicht mehr, nur noch seine Hand und das Eisen. Und an der Hand war sein Rest, der drohte hinab zu rutschen vom bemoosten Vordach. Warum war er nur auf das Dach geklettert?
Er rutschte. Zuerst nur langsam, dann konnte er sehen, wie das Fenster, als sei es auf eine Gummileinwand gemalt, immer weiter weg rutschte. Jetzt hatten seine Beine auch schon die Dachrinne erreicht. Da konnte er sich festhalten. Noch versuchte er, sich mit seinen Fingern im bemoosten Dach zu fest zu krallen, aber er fand keinen Halt mehr. So glitt er dem freien Fall entgegen, und als er schließlich die Dachrinne in den Händen hielt, war er längst zu schwach, sich zu halten. Zu schwach, sich daran festzuhalten. Zu schwach, um sich selbst Halt zu geben. Zu schwach, um den Fall zu verhindern.
Der Rest war eine Sache von Sekunden. Er fiel vom Dach. Unten befand sich der mit Basaltsteinen gepflasterte Vorhof. Er schlug hart auf. Auf sein Kinn schlug er auf. Der Schlag raubte ihm das Bewusstsein. Er musste sich wie eine Katze im Fall noch gedreht haben, sonst wäre er mit dem Hinterkopf auf das Pflaster geknallt. Das wäre es dann gewesen. Es herrschte Totenstille. Eine Sekunde, zwei Sekunden, drei Sekunden Stille. Eine sehr lange Zeit für den Vater, der seinen Sohn nicht mehr im Flur spielen hörte. Vier Sekunden. Es war immer noch still. Der Vater stand auf. Er schaute aus dem Schlafzimmerfenster, auf den Vorhof. Dort sah er ihn auf dem Pflaster liegen. Fünf Sekunden. Und er starrte ihn an. Jetzt war es doch geschehen. Der unvorsichtige Junge war gefallen. Er riss das Fenster auf. Sechs Sekunden. Er schrie und starrte auf den regungslosen Körper. Sieben Sekunden. Da war das erlösende Geräusch. Das, was er herbeigesehnt hatte. Die Stille hatte ein Ende. Der Junge schrie. Er spürte seinen Schmerz. Er kam wieder zu Bewusstsein. Das Leben hatte ihn wieder. Zwei blutenden Knie, keine Knochenbrüche, nur das Kinn aufgeschlagen. Eine Narbe wird bleiben, aber sonst war er wohlauf. Er wurde neben seinen Vater ins Bett gelegt. Zwei Kranke hatte die Mutter nun zu versorgen.
Die Erinnerung verschwindet im Herbstgrau. Er hat den Fall überlebt und ist sich heute gewiss, dass er ohne Schmerzen ist. Der Fall ist nichts und der Aufprall auch nichts, wenn du bewusstlos oder aber tot liegen bleibst. Er sieht sich auf einem Dach. Viel höher als das Vordach, und er könnte springen, ja, weil er keine Schmerzen empfinden würde, weil alles sehr schnell ginge, weil alles sehr leicht wäre, weil alles eben genauso unspektakulär wäre wie das Hinfallen. Mehrmals ist er in seinem Leben gefallen, aber nie konnte er den freien Fall bewusst erleben. Dieses Gefühl der Schwerelosigkeit, nur für wenige Sekunden. Was würde er dafür geben?
Er verlässt den Ort. Er steigt in sein Auto. Fährt zur nächsten Tankstelle. Ein Plakat fällt ihm auf. Es gibt einen Flugplatz am Ort. Segel- und Motorflug, Fallschirmspringen, alles, was der fallsüchtige Urlauber braucht, um sich wieder zu spüren. Alles, was das Dorf als einen Urlaubsort erhält. Die Hotelzimmer sind belegt mit Fallsüchtigen. Hier haben sie ihr Paradies gefunden. Überlegen muss er nicht. Er wird nicht wieder zurück in die Großstadt fahren. Er wird hier bleiben, an dem Ort seiner Kindheit wird er bleiben, und den Fall vielleicht hundertmal wiederholen, damit er endlich weiß, wie es ist, wenn man fällt.
Der Wartekünstler
Vor ihm liegt ein langer, von Sonnenlicht durchfluteter, das Haupt- mit dem Nebengebäude des JobCenters verbindender Gang. Sternchen in Herberts Augen versetzen ihn für einen kleinen Moment lang auf eine paradiesische Südsee-Insel. Energiequantenspeicherung, denkt er, weniger Probleme.
Was aus all den Patenten geworden ist, die dieser Karl Hans Janke damals angemeldet hatte, als er im Irrenhaus saß? Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sich darunter ebenfalls das Patent für die Energiequantenspeicherung befand, das jetzt, begraben unter Folianten in der einst hierfür zuständigen Abteilung des Patentamts, längst verschimmelt oder von der Treuhand ordnungsgemäß in den Papierkorb abgewickelt worden ist. Maschinen, angetrieben durch eine nie versiegende Energiequelle, hätten für die Menschheit arbeiten können. Der Himmel auf Erden! Es kommt ihm vor, als sei dies die einzige vernünftige Möglichkeit, den Mythos der Babylonier in eine Wirklichkeit zu transponieren. Dass ein Janke zu seiner Zeit für verrückt erklärt wurde, stellt sich in diesem Zusammenhang als Normalzustand heraus. Heute hätte er bessere Chancen. Bleibt: auf einen zweiten Janke zu hoffen.
Herbert malt sich aus, wie er als Warteberater durch das Land zieht und Politiker, Manager oder andere zahlungskräftige Kunden in seine Philosophie einweiht. Von den exponentiell steigenden Wartezeiten würde er berichten, die nun in Kauf zu nehmen seien, weil die Gelegenheit verpasst wurde. Warteformel, Wartebuch, Warte-DVD, Wartespielzeug, Warte-T-Shirt: der Zweck des Wartens liegt schließlich in seiner Auflösung – insofern gibt es immer eine zweite Chance. Herberts Kalkulation zufolge müsste die Weltbevölkerung immerhin 400 Jahre auf den nächsten Janke warten, der dann wiederum seinen Energiequantenspeicher der Öffentlichkeit präsentierte.
Herbert liebt es, über Möglichkeiten in ferner Zukunft zu spekulieren. Wie werden wissenschaftliche Erkenntnisse in 400 Jahren vorliegen? In Buchform sicherlich nicht! Seiner Meinung nach können hier nur Quantencomputer zum Einsatz kommen, die Daten auf atomarer Ebene speichern, verarbeiten und über ein mit dem menschlichen Körper verbundenes Interface, direkt ins Gehirn injizieren. Die Datenspeicherung und Datenübertragung wird somit kein Problem darstellen. Aber wie werden Daten erhoben, wie werden sie verarbeitet?
Im Keller des Ägyptischen Museums in Kairo gibt es immerhin 150.000 Ausstellungsstücke aus über 4500 Jahren ägyptischer Geschichte, wovon nur ein kleiner Teil dem Besucher überhaupt zugänglich ist. Weil verhindert werden konnte, dass die kulturellen Schätze des Landes ins Ausland geschafft wurden, hat man große Teile des Bestandes in Ermangelung ausreichender Ausstellungsfläche kurzerhand in den Keller verbannt. Also türmen sich die Funde im Keller des Museums. Heute weiß niemand mehr, wem und welchem Fundort die zahlreichen Schätze der ägyptischen Geschichte zuzuordnen sind.
So schaffte man sich eine zweite Ausgrabungsstätte und beschäftigt derzeit etliche Praktikanten, die die unterlassene Buchführung nachholen sollen. Herbert ist immer wieder aufs Neue amüsiert, wenn er im Internet über das Ägyptische Museum in Kairo liest. Dort findet er zum Beispiel Sätze wie: „Zwar ist nur ein kleiner Teil dem Besucher zugänglich ...“, oder „Die zur Verfügung stehende Zeit während einer Ägyptenreise reicht bei weitem nicht aus, um überhaupt einen Einblick geschweige denn Überblick über die Exponate zu gewinnen ...“. Peinlich findet Herbert es, wie die Ägypter mit ihrer eigenen Geschichte umgegangen sind. Ein guter Vorsatz zwar, aber eine denkbar schlechte Ausführung.
Würde dasselbe Schicksal nicht genauso den Erkenntnissen eines zweiten Janke in etwa 400 Jahren widerfahren können? Verschollen in den Open-Access-Servern der Wissenschaftswelt. Herbert stellt sich den neuen Beruf des Wissenschafts-Archäologen vor. Fleißige Menschen, die das Datenmaterial der Vergangenheit durchforsten und bereinigen und so neue Ausgrabungsgebiete erschließen. Natürlich wird ihre Sisyphusarbeit von Computern unterstützt, ansonsten hätten sie kaum die Chance gehabt, den entsprechenden Artikel eines zweiten Janke entdecken zu können, den dieser bereits 300 Jahre zuvor veröffentlicht hatte. Die Lorbeeren hingegen hätte ein anderer bekommen, der sich besser vermarkten konnte als dieser flinke, drahtige ca. 1,70 große Mitarbeiter, der vor seinen Kunden – oder sind es in seinem Fall die Hilfebedürftigen? – ins nächste Amtszimmer zu fliehen scheint.
Das eindrucksvollstes Warteerlebnis in seinem bisherigen Leben hatte Herbert allerdings, als er vor Jahren mit einem Mietwagen an der Küste Portugals entlang fuhr: Steilküste, verträumte Buchten, romantisch bis in den letzten Quadratmeter. Abends, kurz vor Sonnenuntergang, sind die Parkplätze an den Steilküsten allerdings voller Autos: Richtung Meer ausgerichtet und die Türen weit geöffnet. Einheimische blicken auf die offene See und warten auf die Seefahrer, die schon vor langer Zeit hinausfuhren, um die Welt zu entdecken. Einige unter ihnen kehrten zurück, andere nicht. Und so wartet man immer noch auf die Rückkehr der verschollenen Helden wie der Christ auf das Reich Gottes. Eine schöne Wartevorstellung, die sicherlich in Herberts Vorträgen ihre Erwähnung finden sollte.
Herbert bastelt in Gedanken weiter an seiner Vortragsreihe und ist, wie von unsichtbarer Hand geleitet, inzwischen im Warteraum des JobCenters angelangt. Ein weiß gestrichener Raum mit Krankenbetten in jeder Ecke und Stuhlreihen wie im Kino offenbart sich ihm. Sphärische Musik rieselt aus in der Decke eingelassenen Lautsprechern und die Jalousien sind zugezogen. Die Mittagshitze ist unerträglich geworden. Herbert ist nicht der einzige, der schwitzt.
Jedes Ding hat seine Geschichte, geht es ihm weiter durch den Kopf. Die geschichtliche Dimension des Wartens muss er in jedem Fall in seinem Vortrag verwursten. Was würde sich besser dafür eignen als das Schicksal des Gotenkönigs Alarich? Eigentlich wollte er seinem Volk Siedlungsgebiete verschaffen, um in Frieden leben zu können. Nach Herberts Meinung waren dies eher bescheidene Wünsche, die Alarich hatte. Weil er aber nicht zerstören, sondern verhandeln wollte, belagerte er Rom und setzte damit in Ravenna den jugendlichen Kaiser Honorius unter Druck. Letztendlich wurde seine Taktik nicht von Erfolg gekrönt, denn die Gegenseite verfügte ihrerseits über Druckmittel. Sobald aber absehbar war, dass ein Patt im Warteduell entstehen würde, sah Alarich gute Chancen für Honorius‘ Bereitschaft, den Vertrag zu unterzeichnen. Manchmal ist ein Patt besser als ein vernichtender Sieg, denn ein mit einem gleichberechtigten Partner abgeschlossener Vertrag ist per se dauerhafter als einer, den man unter der Bedingung der verletzten Eitelkeit des Besiegten unterzeichnet.
Ja, Warten ist eine aktive Handlung des Menschen, der dies bewusst tut, auf dass das, was er angestoßen hat, seine Früchte tragen möge. Dazu gehört der Mut zum Risiko ebenso wie die Geduld und der Eigensinn und, nicht zu vergessen, die richtige Verpackung. Bevor Herbert allerdings nach weiteren geschichtlichen Quellen suchen kann, blickt er in zwei dunkle Kinderaugen.
Erst jetzt bemerkt er, dass er nicht allein im Wartezimmer des JobCenters ist. Im Raum ist eine Familie mit Baby, dazu mehrere junge Leute. Draußen, auf dem Flur, wartet eine Afrikanerin, zu der das Kind gehört, das Herbert gerade anlacht und ihm seine offene Hand entgegenstreckt. Es will nicht betteln, dies ist nicht die Szene für Brot für die Welt, nein, das Kind will Herbert begrüßen. „Na, bist du alter Sack auch hier? Na, klar ich kann dich doch nicht allein hier sitzen lassen!“ – Er zeigt dem Kind seine flache Hand: „Give me five!“. Der Kleine kennt das und schlägt ein. Schließlich lachen beide und das Kind geht zur nächsten Wartenden. Herbert versteht nicht, was die Frau sagt, sieht weiter in sich hinein, verliert den Kleinen aus den Augen.
Benin, vor 500 Jahren, die Portugiesen sind unterwegs, um die Welt zu vermessen. Sie suchen neue Handelsverbindungen und der Handel mit Menschen ist sehr lukrativ zur damaligen Zeit. Doch woher soll die begehrte Ware kommen, wenn nicht aus dem Ursprungsland. Benin, ein aufstrebendes Volk, dessen Machthaber nicht davor zurückschrecken, Nachbarvölker zu überfallen und die Gefangenen auf dem Sklavenmarkt anzubieten. Begehrte Handelswährung ist die so genannte Manilla, schwere Reifen aus Bronze und viel zu groß, um den Arm oder den Hals einer Schönen zu schmücken. Davon haben die portugiesischen Handelsherren mehr als genug, und der Tauschhandel ist perfekt: Begegnung und Austausch zugleich, wie Herbert es in der Ausstellung in Dahlem einst lesen konnte. „Menschen gegen Messing“ dies wäre sicherlich zu plakativ gewesen, hätte man diese Formulierung auf den Schautafeln wiedergefunden. Das Messing wurde eingeschmolzen und zu Ehren des Königs von Benin zu besonders kunstvollen Gegenständen weiterverarbeitet, die man ebenfalls in der Ausstellung bewundern konnte.
Welcher Tauschhandel wird sich hier im JobCenter abspielen, sobald er vor dem Fallmanager steht? Ein wenig zittern ihm die Beine, es ist schließlich das erste Mal. „Ene, mene, muh und arm bist du!“ Aber – wie geht es dann weiter? „Arm bist du noch lange nicht, sag mir erst wie alt du bist? 54! 1,2,3,..., 52, 53, 54 – und raus bist du.“
Herbert wird plötzlich klar, dass er sich diesmal auf eine sehr lange Wartezeit wird einstellen müssen. Eine Schwester betritt den Warteraum und ruft den nächsten Hilfebedürftigen für das RNA-Interferenz-Experiment auf. Ihr folgt ein Auszubildender, der alles protokolliert. Das Gespann verschwindet im Flur. Ein Kunde flucht so laut, dass Sicherheitskräfte ihn wegschaffen müssen. Ein Doktor erscheint im Wartezimmer und sucht den Raum nach einem vermissten Hilfebedürftigen ab.
Wohin soll Herbert seinen Schritt in diesem Allerweltsbasar richten? Wie fremd ist ihm dies Bühnenbild mit der ausgeprägten Leidenschaft fürs Hintergrundgeschäft und die dazu notwendige Doppelmoral geworden, die vonnöten ist, um den Laden am Laufen zu halten. Die Schreckensnachrichten werden ebenso durch den Äther gedreht wie die Hoffnungsnachrichten heruntergeleiert. In all den Geschäften, vollgestopft mit Körben, Anzügen oder mit Salami, jeden Kubikmillimeter bis unter die Decke ausgenutzt oder sogar bis an die Eingangstür gestapelt, wird er seine Daseinsberechtigung niemals finden. Der Hund, der vor dem Salamigeschäft auf sein Herrchen wartet, hat einen sonderbaren gequälten Gesichtsausdruck. Nur eine Pfote trennt ihn vom Wurstparadies. Wie von einer unsichtbaren Energiewand zurückgehalten, regt er sich nicht, lässt sich nur im Vorübergehen ankläffen, um sich zu versichern, das sich das Leben durch alle Zwiebelschichten zu ihm durchbohren kann.
Antworten auf Fragen wird Herbert hier nicht finden. Möglicherweise Jahre später, aber wird er solange durchhalten können? SSRI-Pillen hat er schon verschrieben bekommen. Aber eine dauerhafte Erleichterung würde seiner Meinung nach nur dann eintreten, wenn er endlich der Gruppe der Oxytocin-Patienten zugeordnet würde, schließlich hat er keine CCR5-Delta32 ähnliche Genmutation, die ihn schützen könnte. Nein, Arbeit muss er sich selber suchen, die ist hier nicht im Angebot. Eine plakative Aktion muss her, um sich Gehör zu verschaffen. In der Öffentlichkeit auftreten, selbstbewusst, fordernd. Wenn er jünger gewesen wäre, dann hätte er zu solchen Mitteln gegriffen. Jetzt muss er den Sündenbock spielen, für ein Bild, das in den Rahmen passt.
Galois war 18 Jahre, als er über seinen Freitod nachdachte. Schon damals hatte er die moderne Mathematik im Kopf, die später, in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts, Grothendieck weiter entwickeln sollte. Aber erst 60 Jahre nach Galois' Tod wurden seine Aufzeichnungen gefunden, wurde er verstanden, wurde er gewürdigt. Zu spät für ihn, denn er hatte sich für den inszenierten revolutionären Heldentod entschieden. Aber in seinem letzten „Mémoire“, in dem er seine Theorie zusammenfasste und durch weitere Theoreme ergänzte, schloss er mit folgender Bemerkung: „Fragt Jacobi und Gauß nach ihrer Meinung in der Öffentlichkeit – nicht über die Wahrheit dieser Theoreme, sondern über ihre Bedeutung.“.
Die milchigen Fenster machen den Staub sichtbar, der in der Luft liegt. Ein Staub, der sich in der Kleidung festsetzt, der, eingeatmet, sich auf die Lungenbläschen legt und ganz langsam die Luft zum Atmen nimmt. Dieser Staub, der mit jedem gesprochenen Wort wieder in die Atemluft zurückgeworfen wird, setzt sich unbemerkt in millionenfachen Neuronen und Synapsen fest und hinterlässt eine Matrix, die die kleinste Bewegung berechenbar macht.
So spiegelt sich derjenige, der an den Strippen zieht, sich in demjenigen wider, der an den Strippen hängt. Minimale Muskelzuckungen können große Ausschläge bewirken, wie das Heben eines Armes oder das nach vorne Stellen eines Beines. Auch für ein weit aufgerissenes Maul reicht eine kleine Handbewegung aus. Die Marionette ist gleichsam wie ein Verstärker, der den gewollten Bewegungen einen derartigen Schwung verleiht, dass die Umstehenden etwas Eigenständiges, durch unsichtbare Hand Gelenktes, wahrnehmen.
All dies basiert auf dem Hebelgesetz, das die Arbeit als ein Produkt aus Kraft und Weg beschreibt und somit auch erklären kann, warum nur geringe Kräfte nötig sind, um Großes zu bewegen. Gerade in diesem Augenblick scheint ihm dies nicht nur logisch, sondern auch durch das Experiment verifiziert. Was aber würde geschehen, wenn die Raumzeit in dem Maße gekrümmt wäre, dass sich in noch so kleinen Umgebungen keine lokalen kartesischen Koordinaten, die aus Sicht des Beobachters Vergleichbares, Intersubjektives lieferten, für die Marionette mehr fänden, sondern alles der Radikalität des Subjekts überlassen wäre?
Herbert ist allein im Wartezimmer. Bald müsste auch er aufgerufen werden. Oder war schon jemand da? Er wird nervös, steht auf, geht zum Fenster, dreht sich um, geht zur offenen Tür und schaut in den leeren Gang. „Bitte folgen Sie mir. Sie sind heute der Letzte!“, steht auf einem DINA 4 Blatt geschrieben, das mitten auf dem blankgeputzten JobCenter-Boden liegt. Er hebt es auf, geht zurück in den leeren Warteraum und setzt sich auf einen der freien Sitzplätze am Fenster.
Ausgezeichnet
Herbert schaut durchs Fenster auf die gegenüberliegende Straßenseite, zu Lidl, und denkt an Möhren, Kartoffeln und Kohl. Die Haustür fällt hinter ihm ins Schloss und er huscht an den Schritt fahrenden Autos vorbei. Da ist das Ei – so nennt er bei sich den Wohnwagen, den ein Unbekannter hier abgestellt hat und vor dem er nun steht. Er liest auf dem am hinteren Ei-Fenster angebrachten Pappschild: 10 Euro pro Tag; eine Woche: VB. Darunter die Telefonnummer, die Herbert umgehend anruft. Die Stimme am anderen Ende der Leitung versichert ihm, alles sei ernst gemeint und kein Joke. Warum auch nicht, denkt Herbert, geht diesmal nicht in den Supermarkt und macht auf dem Absatz kehrt.
Irgendwo hat er noch Karteikarten, die er jetzt gut gebrauchen kann. Auf ein noch unbeschriftetes Blatt Papier im DIN A3-Format schreibt er: 1 x Waschraum benutzen: 2 Euro, 1 x Betreten der Terrasse: 1 Euro, 1 x Übernachtung im Hochbett pro Person, Frühstück incl. 12 Euro, Waschen und Toilette gratis dazu. Er platziert das Schild in das Wohnzimmerfenster, das zur Straßen hin liegt. Was hat er noch zu vermieten? Die Bücher in seinem Bücherregal – für nur einen Euro oder vielleicht kiloweise? Die Kleidung, die er jeden Tag trägt, versieht er ebenfalls mit Preisschildern. Die Lederjacke für nur 15 Euro, die Schuhe, nagelneu für 10 Euro und selbst das Hemd ist für 2 Euro zu haben. So ausgezeichnet macht er sich auf seinen täglichen Weg in die Stadt.
In der Straßenbahn sieht er einen älteren Mann. Ein Preisschild mit der Aufschrift „5 Euro“ klebt an seinem Hut. Ein Jugendlicher klappert mit einer Geldbüchse: eine kleine Spende für meine Abifeier! Der 5-Euro-Hut neben ihm will wissen, ob der Abiturient überhaupt einen Spendensammelausweis habe, denn nicht jeder x-Beliebige könne in Deutschland Geld sammeln. Die Fenster der Straßenbahn sind mit Zetteln verklebt. Herbert sieht auf seine „15“ und denkt, dass man in diesen Zeiten nur noch als Papierverkäufer Geld verdienen könne. Fast wäre er gegen ein 4.500 Euro-VB- Auto gerannt, als er die Straßenbahn verlässt.
Auf dem Bürgersteig bietet ein arbeitsloser Mann seine Dienste als Vorleser und Schreiber für 50 Cent pro Seite an. Eine Frau fragt Herbert, ob er nicht für 7 Euro 50 pro Stunde durch die Stadt geführt werden wolle? Ein fliegender Händler mit Zigaretten und Schnaps im Bauchladen kreuzt seinen Weg. Ein paar Schritte weiter sitzt ein Maler, der für 20 Euro Porträts anfertigt. Musik ist heute auch im Angebot: eine regungslose menschliche Musikmaschine, die gegen einen kleinen Obulus von 1 Euro angeworfen werden kann, hat sich kurz vor einer großen Straßenkreuzung aufgestellt.
An der Ampel stehen Kinder mit Eimern. Sobald ein Auto anhält, stürzen sie sich nach vorn und putzen die Windschutzscheibe für einen Euro Minimum. Daneben wartet der fliegende Zeitungsverkäufer, der den Autofahrern mehrere Tageszeitungen mit gleichlautenden Schlagzeilen anbietet. Auf der gegenüberliegenden Seite der Kreuzung hat sich ein Getränkeverkäufer postiert. Hart umkämpftes Terrain, denkt Herbert und wartet auf Grün, um endlich zur S-Bahn-Station zu kommen. Auf dem Bahnsteig wird er von einem Würstchenverkäufer empfangen, der die Wartenden mit Bockwurst und Bratwurst versorgt. Diesmal für nur 80 Cent. Sehr preiswert, denkt Herbert, aber er hat jetzt keinen Hunger.
Sein Handy hat sich noch nicht gemeldet. Er denkt an den mit dem Ei. Ob der schon einen 10-Euro-Schläfer gefunden hat? Da ist sein Angebot mit dem Hochbett und dem Frühstück für 12 Euro doch wesentlich besser. Also, warum rufen die Touristen nicht massenweise an?
Ein Baby lacht ihn aus einem Kinderwagen an. Seine Mütze ziert ein 2-Euro-Preisschild. Die Jacke ist für 4 Euro und der Kinderwagen für 100 Euro zu haben. Die S-Bahn fährt ein, Herbert rechnet mit ein paar Millionen, aber er ist enttäuscht, als er kein Preisschild erkennen kann.
Der Sammler
Das Sammeln ist dem Menschen in die Wiege gelegt, genetisch kodiert so wie das Jagen. Seiner Notwendigkeit beraubt treten beide Tätigkeiten im hochtechnisierten Zeitalter in entfremdeten Formen auf. Macht gewinnt man, wenn man Daten sammelt, sie auswertet und dann eventuell manipuliert, damit die Person in der Öffentlichkeit bloß gestellt wird und endlich in den wohlverdienten Ruhestand geschickt werden kann. Gemeiner wird es, wenn Geheimdienste und Polizei auf Datensammlungen zurück greifen. Hier kann der Person ein mächtiger Schaden entstehen. Die Person wird unter Druck gesetzt etwas zu behaupten, was aus ihrer Sicht einfach nicht wahr ist. Die Inquisition hat in der Demokratie sehr viele Gesichter aber eins davon ist das grausigste: wenn ein Rechtsstaat zu seinem eigenen Schutz das Recht bricht und später den Rechtsbruch nicht mehr aufklären kann, weil Behörden, Geheimdienste und andere verdeckt, gelogen und gemauert haben.
Besser sind die Menschen dran, die etwas Kurioses sammeln. Parkuhren oder Knöllchen. Um die Sammlung interessant zu gestalten, muss sie inzwischen den Globalisierungsfaktor aufweisen. Ein Knöllchen aus Hiddensee reicht nicht mehr, obwohl es sich hier um eine Kuriosität handeln würde. Nein, das Knöllchen muss schon aus einem anderen Land sein. So kämen die Falklandinseln genauso in Frage wie vielleicht Grönland, damit eine sehr gute Knöllchensammlung entsteht.
Manche Menschen sammeln große Dinge, weil sie im Leben immer große Dinge geleistet haben. Große Dinge brauchen viel Platz. Jeder kennt Sammlungen alter Autos, die, bedingt durch ihr Alter eben, immer der gehobenen Finanzkaste zuzuordnen sind. Ganze Inseln benötigt man heute schon, um Sammlungen solcher Art auszustellen. Das ist mit den Museen nicht anders.
Sammeln soll eine Leidenschaft sein. Aber was ist, wenn man etwas sammelt, das keinen Platz benötigt, das eben gar nicht sichtbar ist aber trotzdem vorhanden. So geht es mir. Ich sammle Erinnerungen anderer Menschen. Sie werden meiner Meinung nach in einem Bereich meines körperlichen Dasein gespeichert, auf den noch nicht einmal mein Unterbewusstsein Zugriff hat. Irgendwo unter meiner Bauchdecke muss es sein. Dort sind die Erinnerungen drin. Denn manchmal spüre ich ein Kribbeln an einer ganz bestimmten Stelle meines Bauches. Da muss es sein. Die Erinnerungen kann keiner sehen, selbst ich kann sie nicht sehen. Es sind eben konservierte Erinnerungen und ich bin die dazu gehörige Konservendose mit einem mehrjährigem Haltbarkeitsdatum.
Es war vor etwa zehn Jahren, da stellte ich fest, dass ich diese besondere Gabe habe. Ich kannte eine sehr schüchterne Frau, die als Kind von ihrem Onkel sexuell missbraucht worden war. Sie litt unter Albträumen und wollte ihrem Leben ein Ende setzen. Doch dann kam ich. Der Retter aus der Erinnerungsmaschine. Ich sprach mit ihr eines Abends über diese schrecklichen Erlebnisse. Warum sie sich mir gegenüber so geöffnet hat, kann ich nicht sagen. Ich hielt ihre Hände und plötzlich veränderte sich ihr Gesicht derart als wäre sie von ihren traumatischen Erlebnissen geheilt worden. Sie konnte sich auf Nachfrage meinerseits nicht mehr an diesen Missbrauch erinnern. Ihr Leben änderte sich schlagartig. Sie ging in die Öffentlichkeit, hatte keine Beziehungsängste mehr und wurde eine sehr bekannte Regisseurin von Dokumentarfilmen. Sie war geheilt und ich war der Grund dafür. Eigentlich dachte ich, es hätte sich um eine einfache Übertragung der Erinnerungen gehandelt. Aber es ist dann doch ganz anders. Ich erkläre es mir immer wie folgt: die Konservendose der traumatisierten Menschen ist löchrig. Durch diese Löcher können dann die grausamen Erinnerungen entweichen. Aber der traumatisierte Mensch versucht immer mit allen Kräften die Löcher zu stopfen. Komme ich dann, so entweicht die Erinnerung vollständig und wird in meiner Konservendose aufbewahrt. Aber die hat keine Löcher, nein, die ist absolut dicht. Nichts kann aus ihr entweichen und ich kenne die Erinnerungen, die ich aufbewahre, auch gar nicht. Ich weiß nur, dass sie eben in Schach gehalten werden und ihrer furchtbare Wirkung nicht mehr entfalten können.