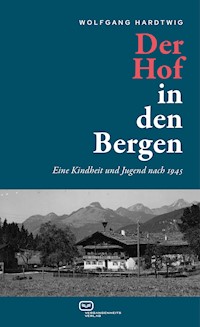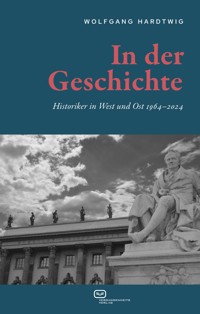
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vergangenheitsverlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wolfgang Hardtwigs "Der Hof in den Bergen, Eine Kindheit und Jugend nach 1945" ist der erste Teil seiner Autobiografie – und war ein großer Erfolg. Zahlreiche Rezensionen und mehrere Auflagen bezeugen das breite Interesse an seiner "intellektuellen Heimatliteratur" über seine Kindheit und Jugend auf dem Land in Oberbayern, von der Gustav Seibt in der SZ schrieb, man könne eine autobiografische Erzählung kaum besser machen. Im vorliegenden zweiten Teil der Autobiografie beginnt der junge Wolfgang Hardtwig sein Studium der Geschichte in Basel, wechselt nach München, um dort zu promovieren und sich zu habilitieren, tritt seine erste Professur in Erlangen an und lehrt zeitweise in Atlanta, USA. 1992 wechselt er an die Humboldt-Universität zu Berlin – für das DDR-Regime zuvor ein Zentrum marxistisch interpretierter Kultur- und Gesellschaftswissenschaft. Seine Berufung und seine Arbeit dort sind Teil der ebenso notwendigen wie umstrittenen Reformen der Universitäten in Ostdeutschland. Hardtwig räsoniert über das Studieren im alten Sinne, er beschreibt Varianten der traditionellen "Ordinarien-Universität" und ihre Krise während der Studentenrevolution 1968 sowie in den Reformjahren danach. Den west-östlichen Transformationsprozess beschreibt er auf der Basis seiner persönlichen Erinnerungen und ausgewählter Quellen. So beleuchtet er erstmals die Positionen und Kontroversen an den ostdeutschen Universitäten der 1990er-Jahre aus der Innensicht eines westdeutsch geprägten unmittelbar Beteiligten. Die Profilierung als Historiker und die Mitwirkung in der akademischen Selbstverwaltung ermöglichen symptomatische Einblicke in den heutigen Wissenschaftsbetrieb und in die akademische Arbeit. Wolfgang Hardtwig bietet über die autobiografische Betrachtung hinaus eine vorzüglich geschriebene Studie über die Kulturen des Studierens und Lehrens im fundamentalen Wandel der deutschen Universitätssysteme seit den 1960er-Jahren und leistet damit auch einen signifikanten Beitrag zum Verständnis der prekären Geschichte der deutschen Vereinigung von 1990 bis heute.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 470
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolfgang Hardtwig,
1944 in Reit im Winkl geboren, war Professor für Neuere Geschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin und Autor zahlreicher Veröffentlichungen zur politischen Kulturgeschichte. Seine Arbeitsschwerpunkte sind die Kultur- und Sozialgeschichte Deutschlands vom 16. bis 20. Jahrhundert sowie die Geschichte der Geschichtsschreibung und Geschichtstheorie.
Wolfgang Hardtwigs „Der Hof in den Bergen, Eine Kindheit und Jugend nach 1945“ ist der erste Teil seiner Autobiografie – und war ein großer Erfolg. Zahlreiche Rezensionen und mehrere Auflagen bezeugen das breite Interesse an Hardtwigs „intellektueller Heimatliteratur“ über seine Kindheit und Jugend auf dem Land in Oberbayern, von der Gustav Seibt in der SZ schrieb, man könne eine autobiografische Erzählung kaum besser machen.
Im vorliegenden zweiten Teil der Autobiografie beginnt der junge Wolfgang Hardtwig sein Studium der Geschichte 1964 in Basel, wechselt nach München, um dort zu promovieren und sich zu habilitieren, tritt seine erste Professur in Erlangen an und lehrt zeitweise in Atlanta (USA). 1991 wechselt er an die Humboldt-Universität zu Berlin – für das DDR-Regime ein Zentrum marxistisch interpretierter Kultur- und Gesellschaftswissenschaft. Seine Berufung und seine Arbeit dort sind Teil der ebenso notwendigen wie umstrittenen Reformen der Universitäten in Ostdeutschland.
Hardtwig räsoniert über das Studieren im alten Sinne, er beschreibt Varianten der traditionellen „Ordinarien-Universität“ und ihre Krise während der Studentenrevolution 1968 sowie in den Reformjahren danach. Den west-östlichen Transformationsprozess beschreibt er auf der Basis seiner persönlichen Erinnerungen und ausgewählter Quellen. So beleuchtet er erstmals die Positionen und Kontroversen an den ostdeutschen Universitäten der 1990er-Jahre aus der Innensicht eines westdeutsch geprägten unmittelbar Beteiligten. Die Profilierung als Historiker und die Mitwirkung in der akademischen Selbstverwaltung ermöglichen symptomatische Einblicke in den heutigen Wissenschaftsbetrieb und in die akademische Arbeit.
Wolfgang Hardtwig bietet über die autobiografische Betrachtung hinaus eine vorzüglich geschriebene Studie über die Kulturen des Studierens und Lehrens im fundamentalen Wandel der deutschen Universitätssysteme seit den 1960er-Jahren und leistet damit auch einen signifikanten Beitrag zum Verständnis der prekären Geschichte der deutschen Vereinigung von 1990 bis heute.
In der Geschichte
Wolfgang Hardtwig
In der Geschichte
Historiker in West und Ost 1964–2024
Impressum
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN: 978-3-86408-331-0
eISBN: 978-3-86408-338-9
Korrektorat: Dr. Malte Heidemann
Titelgestaltung: Stefan Berndt – www.fototypo.de
Grafisches Gesamtkonzept, Satz und Layout: Darius Samek– www.dariussamek.de
© Copyright: Vergangenheitsverlag, Berlin / 2024
www.vergangenheitsverlag.de
Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen und digitalen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten.
Meinen Mitarbeitern und den Teilnehmern am Forschungs-Kolloquium gewidmet
Inhalt
Sprung in die Welt
Alteuropa und moderne Welt. Studieren in Basel
Revolte oder Karriere. Studieren in München
Kunst und Geschichte. Jacob Burckhardt
Lust am Disput oder: Zur Theorie der Geschichte
Akademischer Hazard und Ankunft im Amt
Das gute Amerika
Ein Anfang „drüben“: Berlin, Chemnitz, Dresden
Die deutsche Vereinigung und der Neuaufbau der Humboldt-Universität zu Berlin
Die Ritter-Kommission
Berufung nach Berlin und Einrichtung in Ost und West
Kampf um Fink und die Neuberufenen
Ost gegen Ost, Dissidenten versus Partei
Evaluierungsprobleme
Berliner Szene I: Amüsement, Groll und Gewalt
„Wahrnehmungen“ – deutsches Befinden in Ost und West
Lehre zwischen Ost und West
Berliner Szene II: Hauptstadt im Werden
Berliner Szene III: Christo und die Verhüllung des Reichstags
Wie man sich selbst verwaltet: Das Professorium
Wie man den Mangel verwaltet: Der Akademische Senat
Forschen und Organisieren
Schluss
Nachwort und Dank
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Sprung in die Welt
Das hier vorgelegte Buch setzt die Lebenserinnerungen fort, die ich 2022 mit „Der Hof in den Bergen. Eine Kindheit und Jugend nach 1945“ begonnen habe. Dort ging es um das Heranwachsen in einer bildungsbürgerlichen Familie, die es 1943 auf einen oberbayerischen Bauernhof verschlagen hatte. Hier sollen nun die Jahre seit dem Beginn meines Studiums 1964 bis heute mit dem Schwerpunkt auf meiner Tätigkeit als Historiker an der Humboldt-Universität zu Berlin dargestellt werden. Es geht auf den folgenden Seiten anders zu als in der (vermeintlichen) Idylle des oberbayerischen Bergdorfs. Diese Feststellung betrifft nicht nur den Inhalt, sondern auch die Form der Darstellung. Sie muss notwendigerweise nüchterner ausfallen als die Schilderung der frühen Jahre.
Nach Studien-, Assistenten- und Privatdozentenjahren in Basel und München wurde ich zuerst auf eine Professur in Erlangen und dann, 1991, auf einen Lehrstuhl an die Humboldt-Universität berufen. Die ehemalige Friedrich-Wilhelms-Universität war im 19. und frühen 20. Jahrhundert zum Mittelpunkt der deutschen Universitätslandschaft aufgestiegen und sollte nach dem Willen der Politik nach der Vereinigung wieder in eine ähnliche Position gebracht werden. Dafür musste sie zumindest in den ideologieanfälligen Fächern von Grund auf reformiert werden. Das ging nicht ohne harte Friktionen und einen kompletten Neuaufbau des Instituts für Geschichtswissenschaft vonstatten – und ich geriet mitten in diese Kämpfe hinein. Auch die Stadt Berlin selbst wurde aus ihrem seltsamen Zustand zwischen Frontstadt im Kalten Krieg und insularer Beschaulichkeit gerissen. Der Hauptstadtbeschluss des Bundestages vom Sommer 1991 brachte eine gesellschaftlich-politische und urbanistische Transformationsdynamik voller Spannungen und Verwerfungen in Gang.
Als neuberufener Westler geriet ich in der Universität in die Position sowohl des Akteurs als auch die des Betrachters und in der Stadt in die eines Bürgers, der diesen gewaltigen Wandel täglich bei der Fahrt zwischen Wohnung und Büro und bei Wanderungen durch die alte Mitte Berlins sinnenfällig erlebte. Mit einem Terminus aus der Ethnologie hätte ich die eigene Position als die eines „teilnehmenden Beobachters“ beschreiben können – wäre ich nicht selbst zu sehr in das Geschehen involviert gewesen.
Mir waren damals die singuläre Situation und meine Position darin bewusst. Ich suchte ihr mit Hilfe zweier Strategien einigermaßen gerecht zu werden. Im Tagebuch hielt ich, so gut es unter dem Druck der Anforderungen und des Zeitmangels ging, das alltägliche Geschehen fest, mit dem niedrigen Erkenntnishorizont, aber auch der Nahsicht und dem subjektiven Erfahrungsgehalt, den der Tagebucheintrag mit sich bringt. Und ich versuchte insbesondere in den Jahren 1992 bis 1994 in zwei Veranstaltungsreihen, diese emotional gefärbte Nahperspektive zu ergänzen durch die reflektierte und objektivierende Sicht professioneller Beobachter des Zeitgeschehens. Diese war freilich ebenfalls von dem emotional gesättigten Erfahrungsfundus der unterschiedlichen Intellektuellen- und Wissenschaftskulturen in Ost und West durchdrungen.
Bei der Durchsicht der Quellen für diese Niederschrift stelle ich erstaunt fest, wie viele der drückenden Probleme unserer heutigen intellektuellen und politischen Kultur damals, in den frühen 1990er-Jahren, bereits in nuce erkennbar waren und auch beim Namen genannt wurden; Prägungen durch jahrzehntelange Diktaturerfahrung und Meinungssteuerung im Osten und vielfach unreflektierte und selbstgewisse, auch primitive Siegermentalität im Westen. Vorurteile und Wahrnehmungssperren hier wie dort. Unverständnis für die östliche Lebenswelt und Lebensleistung im Westen und Unverständnis der liberal-kapitalistischen modernen Gesellschaft und ihrer politischen Ordnung im Osten. Gefühlsmäßige Verwurzelung in der Loyalität zu den hegemonialen Mächten im dualistischen Weltsystem des Kalten Kriegs. Und allerorten Kränkbarkeit und Unduldsamkeit im Umgang mit Menschen aus dem jeweils anderen System.
Mein Lebensweg im Zeitraum von 1964 bis heute umfasst nahezu sechs Jahrzehnte eines – aus heutiger Sicht – anfangs verhaltenen, seit 1989 aber grundstürzenden Wandels, erlebt und beobachtet in der Nussschale einer Existenz, die, heruntergedimmt in die Sekurität einer bürgerlichen Lebensweise, doch einiges von den Wellenbewegungen der Ereignisse zu spüren bekam. Viel Glück und ein wenig eigene Steuerungsbemühungen bewirkten, dass die Nussschale nicht umkippte oder an einem öden Uferabschnitt auf dem Trockenen landete. Wie sich davon erzählen lässt, habe ich in der Einleitung zum ersten Band erläutert. Andere oder gar bessere Formulierungen dazu wollen mir nicht einfallen. Angesprochen werden aber muss das Thema. Ich wiederhole hier also die entsprechende Passage und hoffe dabei auf das Einverständnis der Leserinnen und Leser: Die Erzählung kann die Form eines bloßen Berichts über die Abfolge von Ereignissen haben, einer breiten Schilderung des Lebens und seiner Buntheit, eines Gespinsts von Reflexionen, die mehr oder weniger fest an zwei Angelpunkten in der Zeit, Anfang und Ende, befestigt sind; schließlich eines diskursiven Erzählens, das nach Ursachen und Wirkungen fragt. Es gibt den auktorialen Bericht von Erzählern, die vorgeben, das Ganze der erzählten Vergangenheit zu überschauen und die wahren Ursachen und Verflechtungen des Geschehens aus dem Verborgenen freizulegen; es gibt das bewusst perspektivische Erzählen von Autoren, die die Gebundenheit ihrer persönlichen Sicht auf die Vergangenheit literarisch einzuholen wissen; und es gibt die Erzähler, die die Fragmentiertheit ihres Wissens und Berichtens systematisch reflektieren und dieser Fragmentiertheit auch literarische Form geben. In der Realität wird die Erzählung immer eine Kombination aus diesen Idealtypen sein und das Schreiben seine eigene Logik entwickeln.
Doch sollte sich der Autor der Zugänge, die sich ihm jeweils aufdrängen, bewusst sein. Rein auktoriales Erzählen verbietet sich beim Niederschreiben von Erinnerungsskizzen von selbst, da sich der Autor der Verlässlichkeit seines Gedächtnisses nie sicher sein, aber auch aus dem Horizont seiner aktuellen Selbstbewusstheit und seines heutigen Wissens über die damaligen Vorgänge nicht herausspringen kann. Ein Erzählen nach dem Muster moderner fiktionaler Literatur, das die Lücken, Sprünge und Unschärfen der Erinnerung auch im Aufbau der Erzählung widerzuspiegeln vermag, ist dem Historiker unvertraut. Es empfiehlt sich also ein diskursives Erzählen ohne die Fiktion, einstige Gefühls- und Bewusstseinszustände, so wie sie wirklich gewesen sind, exakt darzustellen; ohne die Fiktion auch, das Geschehene hinreichend erklären zu können; und ohne die Fiktion schließlich, die Relevanz der unterstellten Zusammenhänge jeweils „richtig“ einschätzen zu können. Andererseits wird der Erzähler gerade bei autobiografischen Skizzen ohne die Fiktion eines sinnvollen Zusammenhangs der Zustände und Vorgänge zwischen einem gesetzten Anfang und einem ebenso gesetzten Ende nicht auskommen können. Er braucht eine – wenn auch noch so subjektive – Begründung für sein Schreiben, denn was hätte das Erzählen für einen Sinn? Sie besteht in der Fiktion eines durch die bloße Existenz des autobiografischen Erzählers mehr oder weniger deutlich gegebenen inneren Zusammenhangs der dargestellten Ereignisse, unterhalb aller selbstverständlichen (auto)biografischen Illusionen und Irrtümer. Dass es sich dabei wirklich nur um eine Fiktion handelt, wie manche modernen Theoretiker meinen, erscheint mir unwahrscheinlich. Persönlich will ich mir den Glauben daran, dass es etwas gibt, was einen Lebensgang ungeachtet aller Brüche, Kontingenzen und vom Erzähler unterstellten fiktiven Zusammenhänge im Innersten zusammenhält, nicht nehmen lassen.
Alteuropa und moderne Welt. Studieren in Basel
Die Studienjahre habe ich als eine Zeit kaum getrübten Glücks in Erinnerung. Ich kam weg von zu Hause, die Nöte und Beschwernisse der Schulzeit waren vergessen, es begann etwas Neues und Abenteuerliches. Zwar gab es ein grundsätzliches Problem: die Finanzierung. Aber hier griffen die Mechanismen von familiärer Solidarität. In Basel lebte eine entfernte Verwandte aus dem Nürnberger Familienzweig, Sophie Grether. Sie stammte mütterlicherseits aus einer alten Basler Familie, die durch Pharmaziehandel zu beträchtlichem Wohlstand gekommen war. Sophie war die Witwe des Erlanger Theologen Oskar Grether, einer bemerkenswerten Persönlichkeit. Wo er hinkam, zog er mit seiner Körpergröße von über zwei Metern die Blicke auf sich und hieß daher in seinem Bekannten-, Kollegen- und Schülerkreis gern der „Finger Gottes“. Wegen seines Nonkonformismus blieb er im „Dritten Reich“ und auch längere Zeit danach ohne Berufungschancen, wurde aber von seinen Fakultätskollegen gern mit den schwierigen Bereinigungsaufgaben nach 1945 betraut. Seine prekäre Stellung erschließt sich aus der Ernennung zum Oberassistenten im Oktober 1944, zum Diätendozenten für Alttestamentliche Theologie im Juni 1946 und zur Ernennung zum außerplanmäßigen Professor im Mai 1947. Einen Namen machte er sich als Verfasser einer kanonisch gewordenen „Hebräischen Grammatik“. Vierzigjährig erlag er einem Herzversagen und ertrank bei einem Bad in der Nordsee. Seine unstudierte, ungemein kluge, tatkräftige und zugewandte Frau gab ihrem Leben einen neuen Sinn als langjährige Vorsitzende des Basler Frauenvereins, einem Stützpfeiler des Basler Wohltätigkeitssystems, für den es jedes Jahr einen Haushalt von mehreren Millionen Franken zu verwalten galt. Sophie Grether brachte in ihrem schönen Haus im Nonnenweg nahe dem Spalentor zunächst meine Schwester und später auch noch eine Kusine für einige Studiensemester unter. Für mich finanzierte sie die Unterbringung in einem evangelischen Studentenheim ganz in der Nähe.
Gartenseite des Alumneums in Basel, Hebelstraße 17
Das Alumneum in der Hebelstraße 17, in dem ich logierte, war ein Gebäude aus dem 17. Jahrhundert, mitten in der langen und schmalen Häuserzeile, die von ähnlichen Fassaden gesäumt war und an deren Ende sich das kantonale „Bürgerspital“ befand, ursprünglich im 18. Jahrhundert das Stadtschloss des Großherzogs von Baden. Das Haus war im Lauf der Jahrhunderte mehrfach ergänzt und erweitert worden und bestand jetzt aus dem alten dreigeschossigen Hauptbau mit dem Gesicht zur Hebelstraße und den hofartig in den großen Park hineinragenden Flügeln für die Studentenzimmer und die Wirtschaftsräume. Die von den Herbergseltern bewohnte Beletage zierten schön bemalte Paneele aus dem 18. Jahrhundert. Die – ausschließlich männlichen – Studenten waren in Ein- und Zweibettzimmern untergebracht. Ich stieg von Semester zu Semester auf, vom Zweibettzimmer im Erdgeschoss gleich neben dem Eingang zum Zweibettzimmer im zweiten Stock und schließlich zum Einbettzimmer im ersten Stock.
Geleitet wurde das Heim von einem international bekannten Theologen, Professor Oskar Cullmann, und seiner schmalen, ausgemergelt wirkenden Schwester, einem stadtbekannten, durchaus liebenswerten Musterexemplar an Altjüngferlichkeit. Im spartanischen Speiseraum präsidierten die beiden jeweils an einem der zwei langen Tische, an denen wir dreimal am Tag zu festgesetzter Zeit und gleichsam wohlgescheitelt Platz nahmen und nach dem vom studentischen Senior gesprochenen Gebet die Mahlzeiten zu uns nahmen. Die Speisen wurden gekocht und hereingereicht von zwei italienischen Frauen mittleren Alters, zu denen sich ein näherer Kontakt niemals ergab. Am oberen Ende der beiden Tafeln regierte entweder das – selten lebhafte – Gespräch des schon betagten Theologen Cullmann oder ein nur gelegentlich unterbrochenes Schweigen. In größerer Entfernung vom Kopf der Tafel wurde die Unterhaltung lebhafter, in Gang gebracht meist von den drei oder vier Medizinern unter uns und einem frohgemuten und ungenierten französischen Theologen namens Jean-Marie aus dem Elsass. Cullmann bot viel Anlass zu grotesker Nachahmung und Spott. Er war auf Vortragsreisen weit in der Welt herumgekommen und von seiner Kirche zudem zum offiziellen lutherischen Konzilsbeobachter beim Zweiten Vatikanum (1962–1965) in Rom bestellt worden. Bei Gelegenheit einer Privataudienz bei Papst Paul VI. hatte dieser ihm einen seltenen Bibeldruck aus dem 16. Jahrhundert zum Geschenk gemacht. Solche Würden und Besitztümer boten dem alten Herrn bei Tisch in regelmäßigen Abständen Gelegenheit, seine Verdienste den jungen Leuten wieder in Erinnerung zu rufen, indem er etwa fragte: „Waren Sie schon in Rio de Janeiro?“ oder: „Haben Sie auch ein Chalet in Chamonix?“. Der Student antwortete jeweils wahrheits- und erwartungsgemäß mit „Nein, Herr Professor“, worauf dieser, behaglich zurückgelehnt und wegen seiner krankheitsbedingt mit kleinen Häkchen an der Brille hochgezogenen Augenlidern von oben herabschauend, die rechte Hand zu einer Art Segensgeste erhob und befriedigt erklärte: „Aber ich!“ Im Übrigen strahlte er eine würdige Güte aus und wurde von uns durchaus respektiert. Dazu trug sicher auch bei, dass sein persönlicher Assistent, ein kluger und ein wenig spöttischer etwa 35-jähriger Wiener, gelegentlich verlauten ließ, der alte Herr habe längst seinen Glauben verloren. Ich habe mich manchmal doch gefragt, wie sich der – immerhin hochangesehene und vielgefragte – Theologe dabei wohl gefühlt haben mag.
Im Kreis der etwa 25 Bewohner des Alumneums, das ursprünglich nur für evangelische Theologiestudenten gedacht war, nahm deren Zahl kontinuierlich ab. Daher war die Leitung des Hauses, zu der noch der alte Eduard Thurneysen gehörte, einer der ersten und wichtigsten Mitstreiter Karl Barths bei der Begründung der „Dialektischen Theologie“ Anfang der 1920er-Jahre, dazu übergegangen, auch Vertreter weltlicher Fächer aufzunehmen. So gab es den einen oder anderen Philologen oder Kunsthistoriker, vor allem aber Mediziner, zum Teil aus Skandinavien und den USA. An den Skandinaviern konnte man die Auswirkungen der heimischen Prohibition studieren. Sie neigten zu, natürlich geheimen, Alkoholexzessen, bei denen sie ganz unter sich blieben. Vor allem die Mediziner mischten die etwas quietistische Atmosphäre des Hauses mit einem belebenden Quantum an herbem Witz und Zynismus auf. Besonders tat sich dabei ein kleiner sommersprossiger jüdischer Kommilitone aus New York hervor – und klagte dabei auch heftig über das unnötige Latein-Lernen-Müssen. Sein Studium in Basel nahm allerdings ein vorzeitiges Ende. Eines Tages saß er mit traurigen Augen bei Tisch und verabschiedete sich – durchaus wehmütig – für immer. Gern hatte er uns wiederholt sein besonders schönes Exemplar des in Medizinerkreisen so geschätzten Modellskeletts vorgeführt. Eines Tages hatte er es unter seinem Kittel auf seinem Körper festgeschnallt und den Mantel dann beim Sezieren in der Pathologie geöffnet. Die Universitätsleitung bewies wenig Sinn für diesen kleinen Spaß, was wohl auch den aus Pietätsgründen besonders strengen Sitten beim Sezieren geschuldet war, und erteilte unwiderruflich das Consilium Abeundi.
Insgesamt dominierte aber im Alumneum immer noch der ernsthafte Ton schweizerischer Kandidaten für das Pfarramt, aufgelockert durch den einen oder anderen Norddeutschen oder Württemberger, die am ehesten noch das kritische Element verkörperten – durch Naserümpfen über die Theologie Oscar Cullmanns und sonstiger Basler Koryphäen, vor allem aber durch die immerwährende Klage darüber, dass Karl Barth nun doch kein „Kränzchen“ bei sich zu Hause mehr abhielt. „Kränzchen“ hieß in Basel ein Kolloquium ernsthafter Art mit kleiner Teilnehmerzahl. Unsere norddeutschen Theologiestudenten fanden das Wort nicht gewichtig genug und protestierten heftig, als Cullmann einen kleinen hausinternen Lesezirkel, den wir fakultätenübergreifend gegründet hatten, als „Kränzchen“ bezeichnete. Auf das Barth’sche Kolloquium vor allem hatten sie gehofft, als sie beschlossen hatten, in Basel zu studieren. Überhaupt hatten nicht nur die Theologie, sondern auch die Geistes- und Sozialwissenschaften durch das kurz zuvor erfolgte Ausscheiden sehr alter Koryphäen und anerkannter Sonderlinge ein klein wenig an Glanz eingebüßt: Karl Barth und Karl Jaspers – die im Übrigen gerne gleichzeitig gelesen hatten, zum Verdruss vor allem der ihretwegen nach Basel geeilten deutschen Studierenden; Wolfram von den Steinen und Edgar Salin, Mediävist der eine und Nationalökonom der andere und beide entschiedene Georgeaner. Ich selbst hatte das Glück, gerade noch rechtzeitig vor dem nächsten Generationenbruch in Basel eingetroffen zu sein. In meinem dritten Semester starb der Germanist Walter Muschg 64-jährig mitten aus seinem prallen akademischen Alltag heraus an einem Herzinfarkt. Bald danach hörten die Historiker Werner Kaegi und Edgar Bonjour auf, ebenso der Kunsthistoriker Joseph Gantner und der Archäologe Karl Schefold, Georgeaner auch er.
Der erste große Modernisierungsschub nach 1945 stand der Universität aber noch bevor. Das hatte Nachteile, aber vor allem für Studenten wie mich, die nach einigen Semestern wieder nach Deutschland zurückgingen, auch den Vorteil, den Universitätsbetrieb alten Stils – noch dazu in einer bemerkenswerten Spätblüte – kennenlernen zu können, ohne in ihm steckenzubleiben. Das betraf zunächst die Räumlichkeiten. Das Historische Seminar, das waren drei oder vier größere Zimmer unter dem Dach eines hohen alten Gebäudes am Stapfelberg. Sie enthielten die – sehr überschaubare – Bibliothek, die zu einem beträchtlichen Teil aus der nachgelassenen Privatbibliothek eines früheren Ordinarius und Burckhardt-Editors, Emil Dürr, bestand. Man stieg über eine steile Treppe von der Breiten Straße aus hinauf. Das Institut lag also mitten in der Altstadt und strahlte einen starken, wenn auch etwas modrigen Hauch von altdeutscher Romantik aus. Von „Institut“ konnte man eigentlich nicht sprechen, denn weder saßen die Professoren dort, noch gab es ein Sekretariat, immerhin aber einen Assistenten, der pro Woche zwei Stunden Dienst tat. Das Kunsthistorische Seminar logierte, mit modernerer Ausstattung, im Erdgeschoss des Kunstmuseums, eines Neubaues von 1936, entworfen von dem Basler Architekten Rudolf Christ und dem Stuttgarter konservativ-modernistischen Baumeister Paul Bonatz, dessen Bahnhofsbau gerade mit Ausnahme der Hauptfassade dem Mammut-Projekt „Stuttgart 21“ zum Opfer gefallen ist. Auch das Germanistische Seminar war in einem alten Gebäude untergebracht und verbreitete, obwohl weiträumig, die Aura eines intimen Studienorts in einem alteuropäischen Stadtambiente.
Kollegiengebäude der Universität Basel um 1960
Die Wege, die man durch die Altstadt zu gehen hatte, waren kurz genug, um überall rechtzeitig anzukommen, ausgehend vom gemäßigt modernen, angenehm überschaubaren Kollegiengebäude von Roland Rohn aus dem Jahr 1939 am Petersplatz. Sie führten mitunter auch den Rheinsprung entlang und quer über den immer in großer Stille daliegenden Münsterplatz – so wie auf dem berühmten Altersfoto mit Jacob Burckhardt, das ihn, die Abbildungsmappe unter dem Arm, auf dem Gang zur Vorlesung im damaligen Kollegiengebäude auf dem Rheinsprung zeigt. Zu jeder Jahreszeit lag die Aura eines von modernem Leben durchpulsten, aber doch spätmittelalterlich-frühneuzeitlich geprägten Architekturensembles aus schmalen Häusern, hohen Giebeln, geformten Fassaden aus rotem Sandstein in den Straßen, Gassen, Treppen und baumbestandenen Plätzen des alten Stadtkerns, aber auch über den bürgerlich-wohnlichen Stadterweiterungszonen des 19. Jahrhunderts jenseits des Spalentors, etwa rund um das Parkgelände der alten „Schützenmatte“.
Schweizerischer Wohlstand und schweizerische Aufgeräumtheit unterstrichen die Atmosphäre der Frische, die sich vom Rheinstrom her unaufhörlich erneuerte, wenn nicht gerade ein Hauch von Föhn oder, im Hochsommer, aus dem Rheingraben herandringende brütende Hitze über der Stadt lag. An den Rändern von Altstadt und Neustadt des 19. Jahrhunderts schlug hie und da der großstädtische Verkehr herein, verlief sich dann aber bald. Von den Chemiewerken rheinaufwärts war kaum etwas zu bemerken, und die Skandalaktionen der Firma Roche, wie das Ablassen stark giftiger Brühe in den Rhein, lagen noch in einer weiteren Zukunft. Bei jedem Gang durch die Stadt spürte ich die einzigartige Ausstrahlung dieses Stadtkörpers. Dass das Studienglück dieser ersten drei Semester mir auch die Stadterfahrung verschönte und romantisierte, will ich heute gerne zugeben. Der Ort und seine Universität hatten es mir so angetan, dass mein erstes eigenes Proseminar, 1969 erstmals und dann noch öfter gehalten, von der „Deutschen Stadt um 1500“ handelte. Natürlich hängt die Qualität einer Universität nicht von den Räumen ab, in denen sie forscht und lehrt. Aber es macht für die Lebensqualität von Forschenden und Lehrenden schon einen Unterschied, ob sie sich in einem ansprechend-urbanen Ambiente bewegen oder in einem auf die grüne Wiese oder in ein Neubauviertel gesetzten gesichtslosen Betonblock aus den 1960er- oder 70er-Jahren. Nicht der Unterschied zwischen Alt und Neu gab dabei den Ausschlag, sondern die kommunikative Qualität der Architektur – das heißt, dass auch Neubauten mitunter einen gewissen Charme entwickeln konnten, wie bei der sogenannten „Bahnhofshalle“ in Bielefeld. Deutsche Universitätsneubauten aus dieser Zeit sind doch überwiegend von erschreckender Einfalls- und Lieblosigkeit. 1989 hatte ich bei einem – erfolglosen – Bewerbungsvortrag in Bochum, dem sogenannten „Vorsingen“, die Genugtuung, dass einer der Professoren aus der Berufungskommission, der sich über meinen Vortrag offenbar über die Maßen erregt hatte, sich auf dem Weg zur Diskussion ein paar Räume weiter hoffnungslos verirrte. Mein Bedauern, in Bochum nicht reüssiert zu haben, hielt sich dann auch in Grenzen.
Der zweite große Vorteil meines Basler Anfangssemesters lag in den noch ganz vorbürokratischen Studienformen. In der Geschichtswissenschaft gab es noch keine getrennte Zuteilung von Lehrkontingenten und Scheinen an Alte, Mittlere und Neuere Geschichte, jedenfalls nicht außerhalb des Rahmens der Schweizerischen Geschichte. Es gab auch keine Proseminare. Interessenten an bestimmten Einführungsveranstaltungen belegten ein spezielles Seminar, etwa in Paläografie, oder einen mittellateinischen Lektürekurs. Schon im zweiten Semester drang ich in das Hauptseminar von Werner Kaegi über das „Basler Konzil“ vor und musste dafür weder irgendwelche Scheine vorweisen noch eine Hauptseminararbeit schreiben. Eine solche war erst im zweiten Hauptseminar vorgesehen, nachdem man sich im ersten „etwas umgesehen“ hatte. Ich ging also zu Semesterbeginn einfach in Kaegis Sprechstunde und bat darum, teilnehmen zu dürfen. Auf seinen Einwand hin, das sei doch etwas verfrüht, behauptete ich, eigens seinetwegen aus Deutschland gekommen zu sein – und wurde mit dem Satz aufgenommen: „Dann freue ich mich, Sie dort zu sehen.“ Grundkenntnisse in der Technik des wissenschaftlichen Arbeitens erwarb ich gleichzeitig in einem gründlichen germanistischen Einführungskurs. In der Kunstgeschichte hatte der Ordinarius Joseph Gantner vor den Eintritt ins Hauptseminar eine Folge von drei Proseminaren jeweils zu den Gattungen „Architektur“, „Malerei“ und „Plastik“ gesetzt, die er selbst abhielt.
Vom ersten Semester an in direktem Kontakt mit den Professoren zu studieren, war damals in Deutschland in den Massenfächern wie Germanistik, Geschichte und Kunstgeschichte schon kaum mehr möglich. Gewiss, es gab auch Nachteile: die unsystematische Grundlagenausbildung in der Geschichte; die gelegentliche Neigung der bedeutenden alten Herren zum Schwadronieren und Geschichtenerzählen; vor allem die Hemmung, für banale Fragen der Studienorganisation die Sprechstunden der Ordinarien aufzusuchen – und mit den Assistenten, sofern es sie gab, hatte man noch sehr viel weniger zu tun als mit den Professoren. Die damals in Deutschland schon fest institutionalisierte Belehrung der „Undergraduates“ durch Assistenten bot demgegenüber beträchtliche Vorteile: das frische und ehrgeizige Engagement des akademischen Nachwuchses, die flache Hierarchie und intensivere wie breitere Kommunikation im Seminar und danach, die fehlende Fremdheit zwischen weit auseinanderliegenden Generationen. Andererseits sollte man das weiter ausgreifende und tiefere Wissen der Älteren, ihre größere pädagogische Erfahrung, die manchmal, wenn auch keineswegs immer, ins Gewicht fielen, nicht unterschätzen, ebenso wie auch die Aura bedeutender Gelehrter und die subkutane Wirkung ihrer Autorität. Die fehlenden Technikkenntnisse in der Geschichtswissenschaft konnte ich nachholen, als ich mein erstes eigenes Proseminar vorzubereiten hatte. Joseph Gantners Proseminare in der Kunstgeschichte fand ich zwar manchmal etwas schlicht angelegt, sie beeindruckten mich aber doch als souveräne Hinführung zu den Werken. Und an Kaegis ganz und gar unpädagogischen Hauptseminaren faszinierte mich der quirlige und unkonventionelle Redestrom des quecksilbrigen kleinen Mannes mit dem großen kahlen Schädel.
Bei dem Germanisten Walter Muschg landete ich im dritten Semester im Hauptseminar über „Die Lyrik Mörikes“. Hier herrschten zahlenmäßig auch schon Verhältnisse, wie ich sie bald darauf in München vielfach antraf. Das Seminar fand mit rund achtzig Teilnehmenden in einem der geräumigeren Hörsäle statt. Persönlicher Kontakt mit dem großen Mann ergab sich in den zweieinhalb Semestern meines Studiums bei ihm nur drei Mal: zunächst in Gestalt eines kurzen Wortwechsels vor der versammelten achtzigköpfigen Mannschaft nach einer Frage von ihm, der abrupt mit seiner Aufforderung endete: „Bleiben Sie sachlich!“ Dann bei der Rückgabe der Seminararbeit, die er gründlich korrigiert hatte, abschließend aber mit einem von ihm nur in zwei Sätzen erläuterten „ungenügend“ bewertete; und schließlich in einem Rencontre am Ende des zweiten Semesters, als ich mir nach der Vorlesung sein Testat zu holen hatte. Er schaute mich, nachdem ich mich in einer langen Schlange schrittweise nach vorne gearbeitet hatte, kurz an, beugte den Oberkörper ablehnend nach hinten und äußerte abweisend: „Ich kenne Sie nicht!“ Meine etwas betretene Antwort – „Ich war aber bei Ihnen im Seminar“ – genügte ihm.
Der Germanist Walter Muschg, vor 1945
Mein ursprüngliches Berufsziel war das Lehramt für Deutsch und Geschichte an Gymnasien. Daher stand zunächst die Germanistik im Vordergrund des Studiums. Ich hörte beim Altgermanisten Heinz Rupp Vorlesungen über einen Stoff, der mich nicht wirklich interessierte. Eine Klausur in Althochdeutsch ging beinahe schief. Der spätere Literaturwissenschaftler (Lausanne und Zürich) und bekannte Autor Christiaan Hart Nibbrig und ich saßen nebeneinander und übersetzten beide irrtümlich dieselbe falsche Stelle aus dem vorgegebenen Text von Notker dem Deutschen. Als Rupp bei der korporativ vorgenommenen Notenvergabe den Fall ausdrücklich ansprach, erbleichten wir zunächst beide, bevor die Entwarnung kam; wir hatten beide nicht viele, vor allem aber ganz unterschiedliche Fehler gemacht, sodass wir trotz des gemeinsam falsch gewählten Textes brauchbare Noten bekamen.
Neben dem eher unbeteiligt absolvierten altgermanistischen Pflichtprogramm standen strahlend im Zentrum des Germanistikstudiums die Vorlesungen von Walter Muschg. Er war einer der Stars der Universität Basel – zu Recht. Seine Laufbahn hatte er zunächst als Lyriker und Dramatiker begonnen, und unter den Studierenden kursierte hartnäckig das Gerücht, er habe die Ausgaben seiner frühen dichterischen Versuche später selbst aufgekauft. 1936 mit 38 Jahren bereits auf den Basler Lehrstuhl gekommen, hatte er dort alsbald auf verschiedene Weise von sich reden gemacht. Thomas Mann erwähnt ihn mehrfach in den Tagebüchern aus seiner Zürcher Zeit, teils weil kurz über ein gemeinsames Zeitschriftenprojekt nachgedacht worden war, teils weil die scharf kritische Haltung des Basler Professors seinem Werk gegenüber Thomas Manns Missfallen erregte. Zeitweise erwog er, sich wegen der Grenznähe zu Deutschland in Basel niederzulassen, die Ablehnung des dortigen Germanisten sprach dann aber doch für Zürich, zumal er in der dortigen Literaturszene mit dem befreundeten Emil Oprecht, der nicht nur seine Werke, sondern auch die von Mann mitherausgegebene Zeitschrift „Maß und Wert“ (1936–1940) verlegte, und mit der Nähe zum bedeutenden Zürcher Schauspielhaus gut vernetzt war. Muschg war mit mehreren seiner Werke auch in Deutschland bekannt geworden. Sein Hauptwerk, die „Tragische Literaturgeschichte“ von 1948, erschien 1969 in vierter Auflage und noch 2010 kam eine weitere Auflage auf den Markt. Das Buch ist ein Unikum und alles andere als ein Produkt strenger Literaturwissenschaft. Es bietet vielmehr eine Art Poetologie auf der Grundlage biografischer Problemlagen und Konflikte der Dichter. Es geht letztlich darum, die Schöpfungen des dichterischen Menschen nach Typen ihres Weltbezugs zu beschreiben und zu klassifizieren. Im ersten Kapitel unterscheidet Muschg unter der Überschrift „Weihe“ die Typen „Magier“, „Seher“, „Sänger“ und im zweiten Kapitel „Die Entweihung“ die „Gaukler“, „Priester“ und „Poeten“. Zu den „Magiern“ zählt Muschg etwa den jungen Goethe sowie die Romantiker einschließlich Wagner und Nietzsche, Rimbaud und Rilke; zu den „Gauklern“ die „literarische Unterwelt der mittelalterlichen Spielleute“, „bürgerliche Vaganten“ wie Johann Christian Günther, Lessing, den „Wanderer Goethe“ sowie die europäischen „Poètes maudits“ des späten 19. Jahrhunderts, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Wedekind. Dann wechselt die Perspektive des Buches und wendet sich – wie man ironischerweise mit Thomas Mann sagen könnte – den Leiden und der Größe der Meister zu sowie der dichterischen Verarbeitung ihrer tragischen Lebensumstände: Armut, Leiden, Liebe, Schuld usw. In meiner ersten Seminararbeit überhaupt, die erwähnte über Mörikes Gedicht „An eine Äolsharfe“, hatte ich mich vorsichtig, weil ich mich dabei nicht recht wohlfühlte, an dieses Modell angelehnt – und bekam dann zu hören: „So arbeitet man heute nicht mehr.“ Die Bewunderung für Buch und Autor bekam einen leichten Dämpfer, der aber das Vergnügen an Muschgs Vorlesungen nicht minderte.
Muschg war ein kämpferischer Gelehrter und mischte die Literaturkritik der Nachkriegszeit gerade auch in Deutschland kräftig auf. Er zählte zu den Schweizer Autoren und Literaturkritikern, die in der partiellen geistigen Lähmung der späten 40er- und frühen 50er-Jahre in Deutschland „einsprangen“ und für frische Impulse sorgten, wie Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt, Max Rychner oder auch Emil Staiger. Methodisch wie temperamentsmäßig war Muschg der Antipode zur reinen textlichen Strukturanalyse und zum inhaltlichen Klassizismus seines Zürcher Kollegen Staiger, der dementsprechend auf die deutsche Literaturwissenschaft der zwei unmittelbaren Nachkriegsjahrzehnte einen sehr viel größeren Einfluss gewann. Muschg, der sofort nach dem Krieg wieder den Kontakt nach Deutschland suchte, hatte 1956 unter dem Titel, „Die Zerstörung der deutschen Literatur“, eine Sammlung von Rezensionen aus der Nachkriegsgeschichte herausgebracht, in denen er die Sterilität der in Deutschland damals noch angesehenen Literatur der „Inneren Emigration“, also von Autoren wie Werner Bergengruen, Hans Carossa und Ernst Wichert, beklagte und sich für die in Deutschland noch so gut wie unbekannte Emigranten- und Außenseiterliteratur etwa von Alfred Döblin, Hermann Broch und Hans Henny Jahnn eingesetzt hatte. 1961 war eine Studie „Von Trakl zu Brecht. Dichter des Expressionismus“ gefolgt. Zudem engagierte sich Muschg stark für die politische Dichtung des „Jungen Deutschland“. So war es denn auch kein Zufall, dass der junge Rolf Hochhuth ausgerechnet in Basel auftauchte, wo ich ihn gelegentlich zum Seminar eilen sah und wo er Muschg zum Betreuer seiner Dissertation wählte.
All diese Frage- und Frontstellungen waren auch in Muschgs Vorlesungen mehr oder weniger gegenwärtig. Ihr Besuch glich einer kultischen Handlung für alle Literaturinteressierten. Muschg war selbst ein „Magier“, genauer gesagt ein Vortragsmagier. Der immer in einen dunklen Anzug gekleidete Mann näherte sich mit kurzen Schritten auf Füßen, die an den Spitzen weit auseinandertraten, dem Pult, öffnete seine schmale Mappe, die nie mehr enthielt als das Vortragsmanuskript, wandte sein Gerhard-Hauptmann-artiges Haupt dem Publikum zu – und sofort senkte sich atemlose Stille über den Raum, immerhin größter Hörsaal, Nr. 1, oder bei einer einstündigen Poetikvorlesung über den großen Saal des nahegelegenen Bernoullianum. Muschg war ein immer enthusiasmierter, mitunter auch zorniger Rhetor. Einmal hörte ich Hart Nibbrig neben mir murmeln: „Gottvater spricht“ – es war keinesfalls ein nazarenischer Gottvater, eher ein michelangelesker. Ich hörte seinen – gerade bei Klassik und Romantik stehenden – Zyklus bis zu Muschgs plötzlichem Tod kurz vor Weihnachten 1965. Unvergesslich sind mir bezeichnenderweise nicht die Passagen über Goethe und Schiller, sondern die über Heinrich von Kleist und Jean Paul, über Tieck und Wackenroder, über Eichendorff und den „Absturz ins Triviale“ bei Fouqué und Zacharias Werner. Unvergessen auch, mit wie nachdrücklichem Feuer er Gedichte des „Jungen Deutschland“ rezitierte und besprach: Heines „Deutschland, ein Wintermärchen“ und vereinzelte „Gedichte an Mathilde“ aus der „Matratzengruft“. Heines antipathetische Subversion und sein grimmig-verzweifelter Humor auf dem Sterbelager hatten es ihm angetan – ebenso wie die Kampflieder Georg Herweghs und Ferdinand Freiligraths: „Reißt die Kreuze aus der Erden/Kreuze sollen Schwerter werden“ oder „Herwegh, eiserne Lerche“. Im Seminar konnte Muschg aufbrausen und hartnäckigen Widerspruch, den alt gewordene Doktoranden aus den hinteren Reihen gelegentlich vorzubringen wagten, förmlich niederbrüllen – oder auch die versammelte Studentenschar vor sich anfahren: „Was sehe ich hier – zwanzigjährige Greise“, wobei der zugleich drohende und singende Ton seiner Stimme noch sekundenlang über den erstarrten Körpern der „Greise“ lag. Gleich darauf beklagte er, dass niemand mehr Gedichte kenne, und deklamierte unvergleichlich eindrucksvoll aus Gottfried Kellers „Siebenundzwanzig Liebesliedern“ mit der nach dem Höhepunkt des dritten Wortes der ersten Zeile, dem „Spiegeln“, unaufhaltsam abfallenden Kadenz der lebenslangen Entfernung vom Glück:
Ich will spiegeln mich in jenen Tagen,
Die wie Lindenwipfelwehn entflohn,
Wo die Silbersaite, angeschlagen,
Klar, doch bebend, gab den ersten Ton,
Der mein Leben lang,
Erst heut noch, wiederklang,
Ob die Saite längst zerrissen schon.
Gegenüber dem herrischen Rhetoriker Muschg stellte der Kunsthistoriker Joseph Gantner eine geringere Herausforderung dar. Das lag auch daran, dass ich das Fach eher kavaliersmäßig betrieb, zum Vergnügen und für die „Bildung“, nicht mit der ernsthaften Vorstellung, damit später mein Geld verdienen zu müssen. Dass im weiteren Studienverlauf dann doch die Literaturwissenschaft auf der Strecke blieb und ich als zweites Nebenfach im Rigorosum Kunstgeschichte wählte, war damals noch nicht abzusehen und hat mich selbst überrascht. Gelegentlich träume ich heute noch, ob ich mich nicht besser auf die Kunstgeschichte konzentrieren solle, und sehe mich träumend auch nach einem passenden Habilitationsthema um. Tatsächlich sind das Albträume, da sie die Möglichkeit verpasster Alternativen andeuten. Aber letzten Endes fiel mir die Entscheidung für die Geschichte dann doch leicht. Sowohl bei der Literatur wie bei der bildenden Kunst schreckte ich davor zurück, immer nur mit Artefakten und dem permanenten Spiel mit dem – nicht einmal immer nur schönen – Schein und, wie mir damals schien, der Beliebigkeit seiner wissenschaftlichen Deutungskategorien zu tun zu haben. Konkreter, handfester und lebendiger war da schon das Handeln selbst, wenn auch nur im defizienten Modus der Vergangenheit. Dass auch die Geschichte nur über sublime und in gewisser Weise ebenso beliebige Deutungssysteme zu erschließen ist, entging mir damals noch, war auch in damaligen Studiengängen noch kein so selbstverständlicher Bestandteil der methodischen Einübung in die Kunst der Interpretation wie seither. Immerhin wurde ich schon im zweiten Semester in den altmodischen Bücherzimmern des Historischen Seminars mit Johann Gustav Droysens Historik bekannt gemacht – was mir dann selbst in München noch einen deutlichen Vorsprung gegenüber den gleichaltrigen Kommilitonen verschaffte. Droysens „Enzyklopädie und Methodologie der Geschichte“ von 1857 war das deutschsprachige Grundlagenwerk zur Theorie der Geschichtswissenschaft, das, über ein Jahrhundert hinweg mehr oder weniger vergessen, als wichtigster Bezugspunkt für die in den 1970er-Jahren anlaufenden neuen geschichtstheoretischen Debatten diente.
Auch Gantner war kein Stubengelehrter, doch lag seine Sturm- und Drangzeit schon weit zurück. Er hatte sich um 1930 in der für die Moderne ungewöhnlich offenen Bürgerstadt Frankfurt/Main als Kunstkritiker für den Expressionismus und überhaupt für die aktuellen Strömungen der Gegenwartskunst engagiert und in einem Buch Strukturähnlichkeiten zwischen der romanischen und der modernen Plastik herausgearbeitet. Jetzt konnte es vorkommen, dass kurzfristig Frontstellungen und Deutungskämpfe aus der Zeit der klassischen Moderne an die Oberfläche traten, so etwa, als er nach dem Tod von Wilhelm Worringer im März 1965 in der Vorlesung einen ausführlichen Nekrolog über diesen vortrug und dabei vor allem das Verdienst seines Bestsellers „Abstraktion und Einfühlung. Ein Beitrag zur Stilpsychologie“ von 1908 für die Anerkennung des Abstraktionsstrebens in der modernen Kunst würdigte. Doch solche Momente blieben vereinzelte Sternstunden. Vorlesungen und Seminare boten in der Regel eine gediegene Einführung ins kunsthistorische Handwerk, das er selbst in den ersten Jahren seiner Basler Amtstätigkeit etwa durch die Herausgabe mehrerer Bände zur Inventarisierung der Kunstdenkmäler der Schweiz praktiziert hatte.
An den Gantner’schen Proseminaren sagten mir nicht zuletzt die äußeren Umstände zu: die schönen Räume, das Café und überhaupt die Atmosphäre des Kunstmuseums sowie der Flor der Kommilitoninnen, wobei das Fach insgesamt noch sehr viel stärker „männlich“ dominiert war als heute – ebenso wie die Geschichtswissenschaft. Selbst wenn ich nicht wirklich tief einstieg in das Fach, so erhielt ich doch nicht zuletzt durch die systematisch angelegten Proseminare Gantners eine gewisse Trittsicherheit im weiten Gelände dieser Disziplin, die mir später immer wieder zugutekam. Daneben lernte ich in einer Übung des außerordentlichen Professors und Direktors des Historischen Museums in der Barfüsserkirche, Hans Reinhardt, im Basler Münster genau hinzuschauen – und unbefangen meine Erkenntnisse von mir zu geben. Die Schweizer Mitstudierenden äußerten sich einfach nicht. Sie starrten auf die Pfeiler, Lisenen, Kapitelle und Triforien und waren durch keine Bemühung des Dozenten dahin zu bringen, einen Seheindruck oder eine These verlauten zu lassen. Das gab der Veranstaltung im Kreis von nur fünf oder sechs Adepten etwas Quälendes, das noch auf die Spitze getrieben wurde durch die Mühe, die der Dozent mit dem Hochdeutschen hatte. Die qualvolle Suche nach Worten endete aber sofort, wenn er Gelegenheit fand, ins elegant und lustvoll gesprochene Französisch überzugehen.
Von Problemen mit dem Fluss der Sprache wurde Joseph Gantner dagegen nie behelligt. Er verfügte über eine Redebegabung, die ihn – für Kunsthistoriker eine besonders wichtige Fähigkeit – unabhängig machte vom Manuskript, sodass er sich jederzeit vom Pult abwenden, einen langen Stab ergreifen und die im abgedunkelten Raum an die Rückwand projizierten Dias erläutern konnte. Ergiebig war eine Michelangelo-Vorlesung, forschungsnah und anschaulich, wenn auch etwas in die Breite gehend. Das Themenangebot der Basler Kunstgeschichte war noch ganz „klassisch“ – Architektur und Plastik des Mittelalters, Renaissancekunst in allen ihren Formen und Übungen vor Originalen, was die traditionelle Prägung in einer Stadt, in der es an Barock weitgehend fehlte, naturgemäß verstärkte. Bei Gantner verband sich diese Prägung mit dem Hochmut eines Ästhetizismus, für den nur die Beschäftigung mit den Meisterwerken der europäischen Kunstentwicklung infrage kam – was die bodenständig handwerkliche Inventarisierungsarbeit nicht ausschloss, in die ja immer, zumindest am Anfang, auch ein national-kulturelles Motiv hineinspielte. Aber er konnte die strenge Kanonisierung auch übertreiben. Ein Basler Kunsthistoriker und Restaurator, Rudolf Wackernagel, der es in der Enge seiner Heimatstadt nicht mehr ausgehalten hatte und in München am Bayerischen Nationalmuseum und am Lenbachhaus tätig war, erzählte mir gelegentlich, dass er einst von Gantner gefragt worden war, worüber er promoviere; seine Auskunft „über Prachtkutschen im 19. Jahrhundert“ hatte Gantner mit dem Satz quittiert: „Bei mir promoviert man über Leonardo!“
Die Michelangelo-Vorlesung, zu der sich fast alle jüngeren Hauptfachstudierenden einfanden, schuf allerdings wirklich eine „Basis fürs Leben“. Gerade im heutigen Studienbetrieb erscheint mir eine gründliche Einführung in einige „große“ Themen wichtiger denn je. Das gilt für die Kunstgeschichte, in der sich die Konturen des Faches in einer unkontrollierten Schwemme von „Objekten“ einerseits, einer methodisch nicht immer kontrolliert betriebenen Bildwissenschaft andererseits aufzulösen droht, ebenso wie für die Geschichtswissenschaft. Hier kann man heute sein Studium abschließen, ohne sich jemals etwa mit dem Staatensystem der Frühen Neuzeit, der Französischen Revolution, dem Bismarck-Reich oder der Weimarer Republik beschäftigt zu haben; ein Seminar über die Hexenverbrennungen und über die Symbole der Europäischen Union genügen, um die Berufslaufbahn des Historikers einzuschlagen. Das bedeutet nicht nur eine fatale Verarmung an historischem Grundlagenwissen, sondern schadet auch der Fähigkeit, historische Sinn- und Begründungszusammenhänge herzustellen, die auf solches Basiswissen angewiesen sind. Und wie soll eine der wichtigsten Aufgaben von Geschichtsunterricht und Geschichtskultur bewältigt werden, wenn es an dieser Fähigkeit mangelt: im rapiden kulturellen, ökonomischen und politischen Wandel unserer Tage das unverzichtbare Maß an Kontinuität zu sichern und dadurch Sinn- und Wertorientierung zu geben?
Nicht zu den kunsthistorischen Essentials, sondern mehr zu den gesellschaftlichen Ereignissen zählte Gantners regelmäßige einstündige Montagabend-Vorlesung im Hörsaal 1. Hier sprach er über den „Impressionismus“ oder über „Goya und Picasso“. Das war der Typus von Vorlesung für ein breiteres Publikum, ein Crêpe-de-chine-Kolleg, wie es etwa in den 30er-Jahren Wilhelm Pinder oder der Theaterwissenschaftler Arthur Kutscher in München gehalten hatten. In den ersten zwölf Reihen drängten sich ältere Herren und vor allem Damen aus der „guten“ Basler Gesellschaft. Als gewöhnlicher Student musste man rechtzeitig da sein oder von Freunden einen Platz belegen lassen, um sich überhaupt noch einen Sitzplatz zu sichern. Aber auch die Studierenden strebten wegen der Attraktivität der Themen zu dem akademischen Event, auch wenn, zumindest für meinem Geschmack, der Erkenntnisgewinn gering blieb. Beeindruckend war vor allem der elegante Fluss der Rede, meist von der Mitte eines der seitlichen Aufgänge des aufsteigenden Saales aus vorgetragen, mit Blick auf die Abbildungen an der Frontwand, wobei die Hilfskraft an den beiden Diaprojektoren jeweils nach einem Schlag des Meisters mit dem Stock auf den Boden das nächste Foto einschob. Hier herrschte nicht die Arbeitsatmosphäre der Michelangelo-Vorlesung, sondern der leichte und angenehme Erregungszustand des Dabeiseins, des Sehens und Gesehenwerdens (ein Faktum, das die stets auf Understatement bedachten Basler niemals zugeben würden), des Sichtreffens, die Sensation von Verdunkelung und Wiederbeleuchtung des Raumes, die Annehmlichkeit, schöne und allseits bekannte Bilder ansehen und in gewandten Redegirlanden beschrieben hören zu können.
Zu den wirklichen Höhepunkten des Kunstgeschichtsstudiums in Basel gehörten die Exkursionen, von denen zumindest eine in jedem Semester stattfand. Sie wurden nicht von den einzelnen Dozenten im Rahmen ihrer Lehrveranstaltungen organisiert, sondern waren Unternehmungen für alle Studierenden. An dreien davon habe ich teilgenommen und bin heute noch dankbar dafür, dass ich diese Erfahrung machen durfte. Das mag etwas emphatisch klingen, aber ich empfand es doch als etwas Besonderes, mit den Studienkollegen in dieser Weise unterwegs zu sein. Das erste Mal ging es um die Klosterreform von Hirsau im Gefolge der cluniazensischen Reform und ihre architektonischen Konsequenzen – also um den Besuch von Hirsau im Schwarzwald und um die Architektur der Parler, wofür die Hl. Kreuzkirche in Schwäbisch Gmünd angesteuert wurde. Da Tiefenbronn und Colmar nicht weitab lagen, versammelten wir uns auch noch um den Magdalenenaltar von Lukas Moser und um den Isenheimer Altar von Matthias Grünewald.
Die zweite Exkursion fiel kürzer aus und führte zunächst nach Zürich, wo der Zürcher Ordinarius Eduard Hüttinger in einer, wie ich fand, wenig erhellenden Weise durch das Museum führte. Dann aber wurde die Sammlung Reinhart in Winterthur angesteuert. Die Sammlung war damals noch nicht geteilt in eine Stiftung mit der Kunst des 19. Jahrhunderts, die in den Besitz der Stadt Winterthur übergegangen ist und dort in einem entsprechenden Gebäude untergebracht wurde, sowie die Sammlung Oskar Reinhart „Am Römerholz“ mit Hauptwerken der alten und neuen Kunst, für die auf dem Berg neben der Villa Reinhart eine neue kleine Museumslandschaft entstand. Die dem Sammler wichtigsten Werke waren seinerzeit noch im Wohnambiente der flach auf dem Hügel lagernden Villa untergebracht, die der Genfer Architekt Maurice Turrettini 1913 bis 1915 für den Industriellen Henri Sulzer-Ziegler erbaut hatte. Sie hingen im Wohn- und im Esszimmer an der Wand, und auf diesem oder jenem Möbelstück stand eine kleine Plastik von Maillol oder Giacometti. Bei dieser Exkursion ging es nicht darum, einzelne Werke mit Vortrag und Diskussion ausführlich zu besprechen, wie das in den kalten Kirchen der herbstlichen Architekturexkursion geschehen war. Vielmehr standen an diesem heißen Sommertag die Sammlung als solche im Vordergrund, der Geschmack und die individuellen kunsthistorischen Interessen von Oskar Reinhart sowie Hinweise auf das eine oder andere Gemälde. Viele waren so berühmt, dass fast jeder sie kannte, obwohl sie hier ganz in den privaten Lebensalltag des Sammlers einbezogen waren. Tatsächlich fehlte den Räumen jegliche museale Aura, man fühlte sich ganz einfach in die großzügige und elegante Villa eines sehr wohlhabenden, vor allem aber sehr geschmackssicheren Mannes versetzt.
Ich erinnere mich an einen Brueghel sowie an die unauslöschlich im Gedächtnis haftenden Porträts des Ehepaars Cuspinian vom jungen Lucas Cranach. Vielleicht haben sie sich mir besonders eingeprägt, weil ich in der Kaegi-Vorlesung gerade Feuer gefangen hatte für die Humanisten. Zum sommerlichen Ambiente passten die Cézanne-Bilder mit dem Mont Sainte-Victoire und einige andere Hauptwerke des Impressionismus. Zumindest in der Rückerinnerung dominiert indessen der Sammler und Mäzen selbst, Oskar Reinhart, diesen ganzen Besuch, obwohl – abgesehen von den Honneurs Gantners – niemand Gelegenheit hatte, mit ihm zu sprechen. Der soignierte, weißhaarige, sehr alte Herr saß im korrekten Anzug mit Krawatte aufrecht, wenn auch von Kissen gestützt, schwer in einem tiefen Sessel und drückte jedem der vorbeidefilierenden Besucher kräftig die Hand – die einzige Bewegung freilich, die ihm sein Körper noch zu erlauben schien. Als ich mich vor dem 85-jährigen Patriarchen verbeugte, erinnerte ich mich plötzlich, schon in ganz anderem Zusammenhang von Oskar Reinhart gehört zu haben.
Auf einer der frühen Reisen mit meinen Eltern waren wir über den Sustenpass ins obere Rhônetal hinuntergefahren und nahe Sion auf ein kleines Sträßchen nach Norden abgebogen, um das zwischen Wein- und Obstplantagen gelegene Schlösschen Muzot aufzusuchen. Oskar Reinhart hatte es Anfang der 1920er-Jahre erworben und dem immer schutz- und unterstützungsbedürftigen Rainer Maria Rilke zur Verfügung gestellt. Wie so oft auf diesen Familienreisen hatte ich nicht die geringste Lust verspürt, in der brütenden Augusthitze von meinem Abenteuerbuch aufzuschauen oder gar das Auto zu verlassen, aber die Eltern waren unerbittlich. So steht mir der verwunschene Ort tatsächlich immer noch vor Augen, in dem der Dichter drei Jahre vor seinem Tod in einem letzten großen schöpferischen Aufschwung „Signale aus dem Weltall“ – wie er selbst in einem Brief schrieb – empfing und in wenigen Tagen den Zyklus der Sonette an Orpheus niederschrieb. Unbekannt war mir damals allerdings noch, dass Oskar Reinhart auch den im Ersten Weltkrieg in die Schweiz emigrierten und extrem sparsamen Hermann Hesse bis zu dessen Tod in dem berühmt gewordenen Haus in Montagnola im Tessin beherbergt hatte.
Nachdem der Studententrupp die Winterthurer Villa mit ihrer kostbaren Ausstattung verlassen hatte, erinnerte ich mich auch wieder an das Grab Rilkes. Es liegt an die südliche Chorwand der Pfarrkirche des kleinen Ortes Raron gelehnt auf einem hohen Felsrücken mitten in dem hier schon ganz flachen, aber von den hohen Bergen des Wallis gesäumten Rhônetal nahe Muzot. Man steigt von dem Ort Raron eine steile Treppe zu der bescheidenen spätgotischen Kirche hinauf. Von dort aus geht der Blick weit über das Rhônetal und zur Bergkette gen Süden hinüber. Am südlichen Langhaus schaut ein gewaltiges Fresko des Heiligen Christophorus aus dem 15. Jahrhundert in die Richtung der unauffälligen Grabstätte. Deren einziger Schmuck besteht in einem einfachen Stein, in den der berühmte Spruch eingemeißelt ist: „Rose, du reiner Widerspruch, Lust / Niemandes Schlaf zu sein unter so vielen Lidern.“ Wirklich verstanden hatte ich die Verse nicht, in Erinnerung geblieben sind sie mir aber schon. Dass ich nun vor dem Mäzen Rilkes stand, der diesen auch persönlich gekannt hatte, empfand ich als aufregend – und vor allem als höchst befremdlich, hatte ich doch das Gefühl, von der Gegenwart Rilkes durch weit mehr als durch ein halbes Lebensalter getrennt zu sein. Wahrscheinlich hat sich die Klarheit der Erinnerungsfragmente aus verschiedenen Zeitschichten in meinem autobiografischem Bewusstsein auch erst durch die Erinnerung ex post herausgeschält.
Auf einer handfesteren Ebene liegt, dass mir der alte Herr die Exkursion nach Winterthur überhaupt erst ermöglicht hat, indem er Studierenden, die die Exkursionskosten nur schwer aufbringen konnten, mit einem Zuschuss unterstützte. Noch nicht abzusehen war damals, in der Mitte der 60er-Jahre und inmitten der unangefochtenen Schweizer Wohlhabenheit, die notwendig auf die bewundernde Anerkennung durch die Nachwelt folgende Entmythologisierung von Stiftern und Mäzenen durch die Wissenschaft. Sie erhält durch die aktuellen Auswüchse von Sammeln und Stiften von Kunstwerken in Zeiten der materiellen Wertsteigerung alles Originalen gegenüber der umfassenden Reproduzierbarkeit immer neue Nahrung. Die Zeit der intensiven Erforschung des Sammler- und Mäzenatentums besonders im Deutschen Kaiserreich begann erst Anfang der 1980er-Jahre, gefördert durch das neue Interesse jetzt auch der Historiker an Kunst- und Museumspolitik, vorangetrieben aber auch durch das Bedürfnis, den Beitrag reicher jüdischer Unternehmer zur Kulturförderung im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert angemessen zu würdigen. Oskar Reinhart hatte seinen Reichtum von seinem Vater geerbt und sich lebenslang auf das Sammeln und Fördern konzentriert. Sein Verdienst ist daher hauptsächlich das eines kunstliebenden und künstlerisch umfassend qualitätsbewussten Nachgeborenen. Mein persönliches Bedürfnis nach Historisierung und kritischer Distanzierung vom Sammler- und Mäzenatentum im Stile Reinharts ist – wie ich gerne zugebe – gering. Dafür hat sich mir der Nachmittag auf dem Berg in Winterthur mit den großartigen Bildern und dem aufrecht-diszipliniert dasitzenden, aufmerksam schauenden und lebhaft Hände drückenden alten Mann zu sehr eingeprägt. Für uns Studierende bot dieser Nachmittag das Kennenlernen einer der bedeutendsten Privatsammlungen der Welt, aber auch die Begegnung mit dem wahrhaft markanten Repräsentanten einer versunkenen Epoche und eines untergehenden sozialen und kulturellen Milieus. Für die reglos dasitzende Gestalt des alten Reinhart brachte der Besuch der Studierenden in seiner Sammlung vielleicht noch einmal den Abglanz eines langen und singulären Lebens in die drückende Gegenwart des Alters. Sehr viel ernster als die Explorationen in der Basler Kunstgeschichte nahm ich das Studium der Geschichtswissenschaft. In den historischen Vorlesungen von Werner Kaegi spürte ich auch deutlich festeren Boden unter den Füßen als in der Literaturwissenschaft oder Kunstgeschichte. Zunächst hatte ich in jugendlicher Strenge gemeint, auf die weiträumigen Hauptvorlesungen der Koryphäen verzichten zu sollen, um in den ersten Semestern die für nötig erachteten Basistechniken und -kenntnisse in den spezielleren Lehrveranstaltungen der Nichtordinarien zu erwerben und mich dann den höheren Fragen guten Gewissens zuwenden zu können. Nach den ersten Basler Wochen hatte ich aber festgestellt, dass ich damit wesentliche Erkenntnismöglichkeiten verschenkte und orientierungslos im Klein-Klein verfrühter Spezialisierung steckenzubleiben drohte. Auch musste ich mir entgegen der Ideologie, die ich mir vor dem Hintergrund des väterlichen Schicksals und eines allgemeinen Ressentiments gegen die „Großkopferten“ aller Art zurechtgelegt hatte, eingestehen, dass die „Ordentlichen und Öffentlichen Professoren“, wie sie damals noch überall hießen, also die Lehrstuhlinhaber, zumindest hier und jetzt einfach besser waren als die „Nichtordinarien“. Zu diesem Befund mögen optische Verzerrungseffekte beigetragen haben: Es waren eben die Ordinarien, welche die stoffreichen und weit ausholenden Übersichtsvorlesungen anboten – oder für sich reserviert hatten; es waren die Namen, von denen man entweder schon etwas gehört hatte oder die im studentischen Palaver im Café oder auf den Fluren in aller Munde waren; es waren die Trampelpfade in die Hörsäle der Koryphäen, auf denen man dann alsbald mitlief, statt unverdrossen den Übungen oder Vorlesungen mit fünf bis fünfzehn Teilnehmenden zuzustreben. Schon im vierten Semester, in München, waren im Vergleich zu Basel die Wertschätzung von Ordinarien und Nichtordinarien und auch die Verteilung der Studentenmassen sehr viel ausgeglichener, wenngleich auch hier die „Ordinarienuniversität“ zunächst noch in voller Blüte stand.
Werner Kaegi las in einer in Deutschland schon längst ausgestorbenen Tradition „Geschichte des Mittelalters und der Neuzeit“ in einem achtsemestrigen Zyklus. Es passte gut, dass ich bei meinem Studienbeginn auf das Spätmittelalter (1250–1494) traf und in drei Semestern den Zyklus bis 1648 hören konnte. Das 19. und das 20. Jahrhundert fanden in Basel zumindest in der Allgemeinen Geschichte gar nicht statt, wenn man von einer USA-Vorlesung absieht, die der Privatdozent, spätere Basler Ordinarius und Herausgeber des Archivs für Reformationsgeschichte, Hans Rudolf Guggisberg, anbot. Kaegis Vorlesung war weitgehend frei von den bewusst-unbewussten rhetorischen Künsten und dem Blick in die Ferne knapp über die Köpfe der Hörenden hinweg wie bei Muschg oder dem unaufhaltsamen Gantner’schen Redefluss. Bis heute ist mir rätselhaft, wie der kleine Mann mit dem kugelartigen Kopf bei mir die gespannte Aufmerksamkeit und das leise Glücksgefühl erzeugte, seiner Darstellung einer sehr fernen und doch faszinierenden Welt lauschen zu können. Seine Erzählung entwickelte sich wie ein unendlicher Fries bewegter Gestalten und halb ausgeleuchteter Hintergründe. Die klare Gliederung trug sicher dazu bei, auch der freie Vortrag, der aber das Publikum selbst in Anrede und Blick kaum einbezog, sondern eher wie ein versonnenes Selbstgespräch wirkte. Nichts an dieser Vorlesung war spektakulär, die Haltung des Dozenten hinter dem Pult locker und konzentriert, die Bewegung beim gelegentlichen Umblättern der Notizen sparsam, die Stimme leise und die eines alten Mannes, aber wohltönend.
Der Baseler Historiker Werner Kaegi, um 1966
Konsequent durchgehalten, selbstverständlich und unangestrengt wirkte der europäische Zuschnitt der Vorlesung. In seinem Rahmen kamen die Staatsbildungsprozesse in Frankreich und die Wirren der Rosenkriege in England zur Sprache; das europäische Netzwerk des Humanismus mit einer leichten Betonung der Rolle Basels und des Oberrheins; der Aufstieg des burgundischen Staates mit seinem inneren Widerspruch zwischen der hochgemuten, aber unzeitgemäßen spätmittelalterlich-ritterlichen Selbststilisierung der Dynastie bei Karl dem Kühnen und dem handwerklich-kaufmännischen Reichtum der flandrischen Städte; die Rivalität der italienischen Städte und ihrer führenden Geschlechter mit einem deutlichen Schwerpunkt auf Cosimo I. de’ Medici, die innerkirchliche Reformbewegung von Thomas a Kempis und seiner „Devotio moderna“ sowie der konziliare Protest des frühen 15. Jahrhunderts. Eine eigene Vorlesungsstunde galt dem Kirchenstaat; Spanien und Portugal wurden nicht vergessen, der gefahrvolle Weg der portugiesischen Seefahrer entlang der afrikanischen Küste und die Vereinigung der spanischen Länder durch Ferdinand und Isabella. Eine große Rolle spielten die spanische Heiratspolitik des Hauses Habsburg sowie die Reichspolitik Maximilians in ihren Erfolgen und Rückschlägen zwischen dem Tiefpunkt der habsburgischen Reichsgeschichte unter dessen Vater Friedrich III. und ihrem Höhepunkt unter seinem Enkel Karl V. Bis heute erinnere ich mich daran, wie Kaegi, nachdem er die Niederlagen und die zeitweise fast aussichtslose Bedrängnis des Hauses Habsburg zwischen widerspenstigen Reichsfürsten und dem aufrührerischen Ungarnherrscher Matthias Corvinus dargestellt hatte, mit leisem Lächeln resümierte: „Zu den Herrschertugenden gehört auch die Fähigkeit zum reinen Überleben.“
Hier kamen in meinem Kopf wieder einmal zwei ganz unterschiedliche Wege der Unterrichtung und Anschauung zusammen: die vom Vater während einer Fahrt durchs Inntal erzählte Geschichte, wie sich Maximilian, der „letzte Ritter“, bei der Jagd auf einen Hirsch in den tatsächlich furchterregenden Felstürmen der „Martinswand“ bei Innsbruck verstiegen hatte und nur durch ein Wunder gerettet wurde; und die abschließende Feststellung Kaegis zum Maximilianskapitel, das Innsbrucker Grabdenkmal des Kaisers mit seinen überdimensionierten Figuren in Erz stehe jenseits des Mittelalters und atme den Geist der Schwerindustrie. Breit trug Kaegi den Einmarsch des französischen Königs Karl VIII. in Italien 1494 vor, als Beginn einer neuen Epoche, die geprägt war von der intensivierten Rivalität innerhalb der italienischen Pentarchie Mailand, Venedig, Florenz, Kirchenstaat und Neapel/Sizilien sowie dem sich verschärfenden Kampf zwischen dem deutschen Kaiser- und dem französischen Königtum.
Forschungsgeschichtlich beeindruckte mich ein Abriss über die „Wurzelzieher der Renaissance“, Paul Sabatier, Henry Thode und Konrad Burdach, die die Anfänge des neuen Geistes über Franz von Assisi und Dante immer weiter bis ins Hochmittelalter zurückverlegt hatten. Erfreulich unspektakulär war demgegenüber die Schilderung Luthers und der Reformation ohne alle Gründeleien in der Frühgeschichte des Augustinermönchs und ohne allzu starke epochal-weltgeschichtliche Posaunenstöße. Noch in den 1990er-Jahren habe ich mich in der Erinnerung an diese Vorlesung gelegentlich über die Fixierung deutscher Historiker auf die Singulariät Luthers und des „deutschen Geistes“ gewundert. Manchmal glaubte ich dann auch die Stimme Gerhard Ritters in seiner Luther-Biografie zu hören, die ich im Anschluss an die Vorlesung gelesen hatte. Lebhaft, aber ohne besondere Akzente, stellte Kaegi auch den Teil der Reformationsgeschichte dar, zu dem er selbst in den 20er-Jahren mit seiner Leipziger Promotion bei Erich Brandenburg geforscht hatte – das Verhältnis der beiden mit der Reformation sympathisierenden Extreme der humanistischen Bewegung zueinander: des aktivistischen, frühnational bewegten Reichsritters Ulrich von Hutten und des irenischen, vorsichtigen Stubengelehrten Erasmus von Rotterdam.
Es war dann auch, um der Zeit vorzugreifen, durchaus als Hommage an Kaegi und seine Vorlesung gedacht, dass ich 1982 das Thema „Ulrich von Hutten. Zum Verhältnis von Individuum, Stand und Nation in der Reformationszeit“ für die – damals in München noch übliche – Habilitationsvorlesung vorschlug. Als hilfreich erwies es sich auch, dass sich gelegentlich beim Bücherholen in der Staatsbibliothek München eine lange Unterhaltung mit Volker Press über Hutten ergeben hatte. Kaegis Dissertation von 1925 hatte noch in einem engen Zusammenhang mit einer Kontroverse gestanden, die in der Mitte der 20er-Jahre zumindest bei den Historikern Wellen schlug: Der nationalliberale Historiker und Reichstagsabgeordnete Paul Kalkoff hatte in zwei dicken Büchern gegen Ulrich von Hutten den Vorwurf erhoben, durch sein undiszipliniertes Vorgehen im Stil der Fehden des 15. Jahrhunderts gemeinsam mit Franz von Sickingen die Reformation und damit am Ende auch die Reichsautorität gefährdet zu haben. Aktuell berührte sich das Thema dagegen mit der in den 1970er- und frühen 1980er-Jahren heftigen, aber jetzt langsam auslaufenden Debatte zwischen Historikerinnen und Historikern in Ost- und Westdeutschland über das marxistisch inspirierte Theorem der „frühbürgerlichen Revolution“. Es wurde von jüngeren westdeutschen Historikern wie Thomas Nipperdey, Rainer Wohlfeil, Peter Blickle und Heinz Schilling geradezu begierig aufgegriffen, da es mit seinem sozialökonomischen Ansatz der in national- und kirchengeschichtlichen Schematismen erstarrenden Reformationsforschung neues Leben einhauchte. Es entwarf neue Fragestellungen und Untersuchungsfelder und befriedigte zugleich das agonale Bedürfnis, sich und das eigene, als „bürgerlich“ diffamierte Wissenschaftsverständnis gegen ein politisch motiviertes, aber intellektuell herausforderndes Alternativmodell aus dem gegnerischen Bruderstaat im Kalten Krieg zu behaupten. In Beziehung zu setzen waren die keineswegs per se harmonierenden Freiheitsimpulse religiöser und säkular-humanistischer Art, der prekäre Zusammenhang von Freiheit und Nationalität und die Schwierigkeit, als Mitglied des Reichsritterstandes einen tragfähigen Boden in einer sich wandelnden Gesellschaft und Staatlichkeit zu finden. So war ich Anfang der 1980er-Jahre in eine, wie ich fand, bemerkenswerte Zwischenlage zwischen drei Zeitschichten geraten: die aktuelle, in der es vor allem um die Modernisierung und „Verdichtung“ der Verfassungsstrukturen im Reich und um den Aufstieg des Kapitalismus ging; die der 20er-Jahre mit ihrem hochgepuschten Nationalismus und der Frage, welche Kräfte das Reich immer wieder so geschwächt hatten, dass es trotz seines Aufstiegs vor 1914 im Weltkrieg hatte unterliegen müssen; und die ursprüngliche und eigentliche Zeitschicht, die der Reformation selbst.