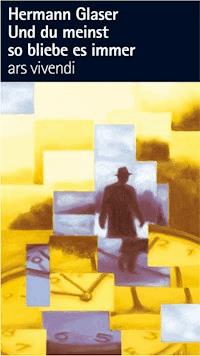14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
An Herrschaftsgeschichte besteht kein Mangel. Hermann Glasers Geschichtsbegriff ist jedoch ein anderer, umfassenderer: Er wendet sich der Geschichte und den Geschichten der kleinen Leute zu. An einer Fülle von Beispielen schildert er höchst anschaulich das Leben der Menschen im Maschinenzeitalter und zeigt, wie Maschinen den Menschen zum Schicksal wurden. Er lenkt unseren Blick auf die arbeitenden und die feiernden, auf die leidenden und die erfolgreichen Menschen im 19. und 20. Jahrhundert. Hermann Glaser sucht und sichert Spuren von Lebensformen in der Epoche der Industrialisierung, von Vorgängen und Ereignissen in der Zeit des Aufstiegs, des Niedergangs und des Neubeginns nach 1918 und 1945. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 392
Ähnliche
Hermann Glaser
Industriekultur und Alltagsleben
Vom Biedermeier zur Postmoderne
FISCHER E-Books
Inhalt
Einleitung
An Herrschaftsgeschichte ist kein Mangel; wollen wir aber Historie im umfassenden Sinne begreifen, müssen wir einer anderen Fährte folgen: uns der Geschichte und den ›Geschichten‹ der Leute zuwenden. Wenn Geschichte, wie Peter Wapnewski es einmal formulierte, nicht verwechselt wird mit bloß Gewesenem; wenn Geschichte aktiviertes Gedächtnis, eingeholte Vergangenheit ist, wenn Geschichte betreiben heißt, eine Sache aus ihren Voraussetzungen heraus und in ihren Folgen zu verstehen, als Chance, aus Vergangenem das Gegenwärtige zu begreifen und das Künftige zu vermuten, dann kann im besonderen Maße die Beschäftigung mit Industriekultur demokratischer Identität dienen.
Diese Thematik greift der vorliegende Band auf. An deutschen Beispielen schildert er das Schicksal von Menschen im Maschinenzeitalter, zeigt er, wie Maschinen den Menschen zum Schicksal wurden. Die Beispiele sind der Epoche vom Biedermeier bis zur Gegenwart entnommen. Es geht um Manifestationen des arbeitenden und feiernden, leidenden und erfolgreichen Menschen des 19. und 20. Jahrhunderts.
Der Versuch der Spurensuche und Spurensicherung handelt von den Lebensformen im Zeitalter der Industrialisierung, von den Vorgängen und Ereignissen der Mechanisierung und von ihren ›Örtlichkeiten‹. Das bedeutet, daß der dingliche Bereich eine wesentliche Rolle spielt; vor allem aber sind wichtig die Wechselbeziehungen zwischen Dingen und Bewußtsein, Empfinden und Handeln, Denken und Umwelt, die Einwirkung der Dinge aufs Bewußtsein und die umweltprägende Kraft des Bewußtseins. Zu fragen ist, wie Bewußtsein dinglich in Erscheinung tritt, und wie Bedingtheiten Bewußtsein formen. Wie aufschlußreich ist z.B. der Blick in die Wohnung eines Fabrikanten, der mit pompösem Aufwand das Erbe der Fürsten anzutreten sucht, oder in die Wohnung eines Arbeiters, der notdürftig, ohne große finanzielle Möglichkeiten, sich die Nische der Wohnküche gemütlich zu gestalten sucht. Welche Dinge und Zeugnisse wir auch angehen, sie sind komplex und bedürfen der vieldimensionalen Aufschlüsselung. Aus den Eindrücken und Abdrücken individueller Subjektivität soll Geschichte ablesbar werden. Erlebniskomplexe, Erlebnisknotenpunkte, in denen Bewußtes und Unbewußtes, Faktisches und Symbolisches, Stoffliches und Strukturelles verknüpft sind, stehen im Mittelpunkt der Darstellung, die dementsprechend mehr konkret denn abstrakt, mehr induktiv denn deduktiv, mehr impressionistisch denn systematisch vorgeht.
Die Phänomene sollen exemplarisch aufgezeigt werden, ohne daß deshalb der übergreifende Bezugsrahmen vernachlässigt wird. Industriekultur bedeutet kein Dorado, in das wir uns vor den Problemen unserer Zeit flüchten könnten. Die Maschinenzeit war voller Widersprüche, Gegensätze, sozialer Probleme. Ihr Fortschrittsglaube war vielfach fatal, da er des Denkhorizonts entbehrte. Auf der anderen Seite zeigt aber gerade diese Zeit, was es heißt, Modernität erfahren und erleiden, gestalten und auch an ihr scheitern zu müssen. Indem wir uns einer Welt zuwenden, die den unmittelbaren Ursprung unserer Gesellschaft darstellt, indem wir uns die Menschen, von denen wir abstammen, deren Probleme sowie die politischen und sozialen Auseinandersetzungen, die sie um ihre Existenz austrugen, vergegenwärtigen, werden wir unser selbst besser bewußt, erfahren wir, warum wir so sind, wie wir sind. Realistische Vorstellungen von der sinnvollen Verbesserung der Lebensformen in unserer Zeit sind besser möglich, wenn wir wissen, wie die Menschen vor uns ihr Leben bewältigten. In einer auf Selbstbestimmung beruhenden demokratischen Gesellschaft kommt solchem aufklärenden Zugang zur Geschichte eine grundlegende kulturelle Bedeutung zu. »Zukunft braucht Herkunft!« (O.Marquard)
Die Darstellung industriekultureller Faktizität erfolgt in fünf Hauptkapiteln, den allgemeinen Begründungszusammenhang absteckend:
Weichenstellung: Die Eisenbahn als revolutionäre Erfindung verändert das Bewußtsein der Menschen; diese erwachen aus biedermeierlicher Verinnerlichung; ›vertikale‹ Besinnlichkeit geht in ›horizontale‹ Expansion über; das Schienennetz erweist sich als Realisierung eines großen ›Vernetzungstraums‹; das Eisenbahnwesen bringt die Industrialisierung erst auf Touren.
Industrielandschaft: Bodenschätze werden ausgebeutet; Industrieanlagen breiten sich aus; aus Werkstätten werden Fabriken, aus Läden Warenhäuser; die Landschaft, die wirkliche wie die geistig-seelische, verändert sich. Industrialisierung bedeutet Verstädterung; die Mauern der mittelalterlichen Stadt werden aufgesprengt; Profitopolis entsteht; Bevölkerungsexplosion und Landflucht bewirken große Probleme; die städtische Selbstverwaltung wird neu organisiert, die dabei entstehenden ›Stadt-Werke‹ sind beeindruckend.
Von Ständen und Schichten: Das gesellschaftliche Leben vollzieht sich in Klassen; Bürgertum und Großbürgertum reüssieren; die Arbeiterschaft gewinnt langsam Selbstbewußtsein, nach zähen Kämpfen politische Anerkennung; innerhalb des Mittelstandes stellen die Angestellten eine besondere labile Gruppe dar: zum Bürgertum aufstrebend, oft zum Proletariat herabsinkend. Höchst unterschiedlich die Arbeits- und Lebensräume, das Wohnen, die Familienstruktur, die Erziehung, die Freizeitgestaltung. Im Überbau wird die sozialistische Bewegung zum Träger einer umfassenden und eigenständigen Arbeiterkultur, die sich zunehmend aktiv von der affirmativen Kultur der Bourgeoisie absetzt. Die Kirchen greifen soziale Ideen auf. Bürgerlicher Überbau, durch Historismus und eine Reihe ästhetischer Fluchtbewegungen geprägt, versucht, der häßlichen Welt, der Welt im Gaslicht, einen irisierenden Glanz zu verleihen. Die bürgerliche Kultur erweist sich aber auch als Entstehungsgrund emanzipatorischer, das eigene beschränkte Bewußtsein transzendierender Strömungen.
Die Lust am Untergang: Das Maschinenzeitalter steht im Zeichen der Euphorie, eines »subjektiven Wohlbefindens bei schwerer Krankheit«, einer »überbetonten Heiterkeit nach Genuß von Rauschmitteln«, einer »Hochstimmung kurz vor dem Ende«. Im Rausch des Fortschritts übersieht man zunächst die Menetekel; die kaschierte, vom Zweckoptimismus überlagerte Existenzangst führt jedoch zur Neurasthenie, die zur Zeitkrankheit wird; Tempo, Unrast, Hektik, Zerfall der Werte liegen dieser ›modernen Nervosität‹ zugrunde. Der kompakte Materialismus, Positivismus und Kapitalismus, die nach wie vor das Gefühl des Wohlbefindens suggerieren, atomisieren sich; sie werden durchlässig für neue Erlebnisformen. Kurz nachdem die Elektrizität die Welt erhellt und neue Chancen fürs kollektive Wohlbefinden illuminiert hat, »gehen die Lichter aus«: Im 1. Weltkrieg werden die zerstörerischen Elemente der Technisierung ungezügelt freigesetzt, die humanen Hoffnungen der industriekulturellen Epoche in Stahlgewittern zerschlagen. Die zwanziger Jahre bringen bei aller sozialen und wirtschaftlichen ›Häßlichkeit‹ noch einmal einen Höhepunkt kultureller Lust: als urbaner Kosmopolitismus gehen sie in die Geschichte ein; es ist eine »Lust am Untergang«. Solche ›Heiterkeit‹ wird bald gefährdet und dann hinweggefegt von der nationalsozialistischen Bewegung, deren Laut-Sprecher besinnungslosen Mechanismus und dumpfe Regression (den Rückfall auf vorzivilisatorische und vorkulturelle Bewußtseinzustände) propagieren und auf eine ganz andere Weise, als es Oswald Spengler voraussah, den »Untergang des Abendlandes« vorbereiten.
Kontinuität und Neuanfang: Gegenüber dem ungeheuerlichen, die »Industrialisierung« des Massenmordes betreibenden Nationalsozialismus bedeutet die totale Niederlage 1945 einen hoffnungsvollen Neuanfang; »neue Weichen« werden gestellt. Neben viel Anfang steht freilich auch fatale Kontinuität; die Geschichte des Autos gibt dafür ein (dingliches) Beispiel. Mit dem Aufstieg des Flugzeugs wird Geschwindigkeit immer mehr zum Prinzip; die revolutionären Veränderungen in allen industriellen Bereichen – vor allem, was die Elektronik betrifft – führen zu einem Höhepunkt moderner Entwicklung. Zugleich steigt das Unbehagen in der Zivilisation; die Postmoderne erweist sich als Zeit des Übergangs; wohin die Reise geht, ist noch ungewiß.
Zum Thema ›Industriekultur‹ steht heute, was Einzelfragen wie Schwerpunktbereiche betrifft, ein höchst umfangreiches wissenschaftliches Schrifttum, ferner eine stattliche Zahl von Quellensammlungen und Wiederveröffentlichungen autobiographischer und sonstiger Zeugnisse zur Verfügung. Wer zum Beispiel in die Kochtöpfe einer bürgerlichen oder proletarischen Küche hineinsehen will, kann aufgrund einer genauen Untersuchung »des Wandels der Nahrungsgewohnheiten unter dem Einfluß der Industrialisierung« und mit Hilfe der Reprints alter Koch- und Haushaltungsbücher den schichtenspezifischen opulenten wie frugalen Mittags- bzw. Abendtisch exakt rekonstruieren. Man möchte im Interesse demokratisch-republikanischer Identitätsbildung dieser Literatur eine größere Verbreitung wünschen. Freilich fehlt eine einigermaßen bündige Zusammenschau der verschiedenen Bereiche und Tendenzen, die plastische Darstellung von Lebens-, Erlebnis- und Handlungsräumen. Dies wird mit vorliegendem Band versucht.
Die Anmerkungen und die Auswahlbibliographie machen deutlich, wieweit der Verfasser sich dabei der Sekundärliteratur dankbar verpflichtet weiß. Die vielen eingefügten, auch längeren Zitate dienen, soweit sie Quellen entstammen, der Veranschaulichung, der ›Versinnlichung‹ des Gedankenganges; als Zitate aus dem Sekundärschrifttum fassen sie wichtige Forschungsergebnisse konzentriert zusammen; sie können so zugleich als Vademekum durchs relevante Sachschrifttum dienen. Das Zitat, meint Walter Benjamin, hat als ›Denkbruchstück‹ vor allem die Aufgabe, den Fluß der Darstellung mit ›transzendenter Wucht‹ sowohl zu unterbrechen als auch das Dargestellte in sich zu versammeln.
Die Abbildungen sind nicht nur Pendant zum Text, sie sind eigenständige Dokumente im Rahmen der Absicht, die Geschichte der Leute im Maschinenzeitalter sowohl ›zum Sprechen‹ als auch durch Bildbeispiele ›zum Ansehen‹ (und damit auch zu Ansehen) zu bringen.
Weichenstellung
1. Modellhafte Darstellung einer Eisenbahnanlage mit Umgebung. Die einzelnen Nummern markieren typische Elemente: u.a. Bahnkörper mit Durchstich (26), Viadukt (28), Felseneinschnitt (29), Tunnel (30).
Das Eisenbahnwesen als Vernetzungstraum
Als der dänische Dichter Hans Christian Andersen1840 auf einer Reise nach Nürnberg kommt, ist er von der ersten Eisenbahn, die in Deutschland angelegt wurde, tief beeindruckt: »Das alte Nürnberg war die erste Stadt, die in den gigantischen Gedanken der jungen Zeit miteinstimmte, die Städte durch Dampf und eiserne Bänder zu verbinden.« In einer Postkutsche war er von Leipzig auf holprigen Straßen durch Oberfranken über Hof und Bayreuth in die alte Reichsstadt gefahren. Hier ergriff ihn das Eisenbahnfieber. Die Schienen waren ihm Zauberfäden, die der menschliche Scharfsinn gezogen hatte. In einem Triumphgefühl sondergleichen genießt der Dichter den Rausch der Geschwindigkeit; die Fahrt erscheint ihm als Wolkenflug: »Oh, welche Großtat ist doch diese Erfindung! Man fühlt sich so mächtig wie ein Zauberer der alten Zeit! Wir spannen unser magisches Pferd vor den Wagen, und der Raum entschwindet; wir fliegen wie die Wolken im Sturm, tun es den Zugvögeln nach! Unser wildes Pferd schnaubt und prustet; aus seinen Nüstern quillt der schwarze Rauch. Schneller konnte Mephistopheles nicht mit Faust auf seinem Mantel fliegen!«[1]
Am 7. Dezember 1835 hatte zwischen Nürnberg und Fürth die erste deutsche Eisenbahn, die Ludwigsbahn, auf einer sechs Kilometer langen Strecke ihren Betrieb aufgenommen.[2] Die Anregung dazu war von dem Geheimen Oberbergrat Professor Dr. med. Joseph Ritter von Baader (1763–1835) gekommen. Er hatte in Ingolstadt und Göttingen Medizin, Mathematik und Mechanik studiert und war danach für mehrere Jahre in Frankreich und England gewesen, wo er sich reiche Kenntnisse im Berg- und Maschinenbau erwarb.
»Die Erfindung der Eisenbahn mit Dampfkraft ist für den materiellen Verkehr der Staaten und für die Verbindung der Völker von einer ebenso unberechenbaren Wichtigkeit als die Erfindung der Buchdruckerkunst für ihren geistigen Verkehr«, heißt es im Aufruf Johannes Scharrers, des damaligen 2. Bürgermeisters von Nürnberg (1785–1844), dem vor allem die Verwirklichung des Projekts zu verdanken war.
Die kleine Strecke zwischen den beiden fränkischen Städten, welche die ›Feuermaschine‹ mit ihren neun angehängten Wagen (auf Schienenfahrgestelle gesetzte Postkutschen) im Dezember 1835 in etwa 13 Minuten bewältigte, war der Beginn eines Weges, auf dem auch für Deutschland der große ›Vernetzungstraum‹ des 19. Jahrhunderts Wirklichkeit werden sollte. Die Eisenbahn half die Kleinstaaterei überwinden und die nationale Einheit erreichen (auf der Schiene des technischen Fortschritts). »Mir ist nicht bange«, sagte Goethe zu Johann Peter Eckermann, »daß Deutschland nicht eins werde; unsere guten Chausseen und künftigen Eisenbahnen werden schon das ihrige thun.«[3]
Daß der Verkehr das Rückgrat der künftigen wirtschaftlichen und politischen Entwicklung in Deutschland sein werde, propagierte vor allem Friedrich List. Im Eisenbahnbau wie in dem von ihm geforderten Zollverein sah er die Grundlagen für einen glanzvollen Aufstieg Deutschlands. Solche weiträumigen Perspektiven hatte List, 1789 in Reutlingen geboren, in Nordamerika kennengelernt, wohin der junge Tübinger Professor für Staatspraxis seiner liberalen Anschauungen wegen hatte auswandern müssen (als Gründer des ›Deutschen Handels- und Gewerbevereins‹ war er zu Festungshaft verurteilt worden).
Ein Jahr, nachdem List aus Amerika zurückgekehrt war, veröffentlichte er seine Abhandlung ›Über ein sächsisches Eisenbahnsystem als Grundlage eines allgemeinen deutschen Eisenbahnsystems‹ (1833); sie blieb wie das 1841 erschienene Werk ›Das nationale System der politischen Ökonomie‹ weitgehend unverstanden. Die politischen Streitigkeiten und vergeblichen Anstrengungen zermürbten List so, daß er 1846 bei Kufstein Selbstmord verübte.
»Was wir zur Zeit«, schrieb Friedrich List1841, »in Deutschland an Eisenbahnen besitzen, ist gut als Spielzeug für die Städte und um dem deutschen Publikum einen Begriff von der Sache zu geben; der eigentliche Nutzen dieses Transportmittels aber, sein Einfluß auf die Agrikultur, die Industrie, den Bergbau, auf den innern und äußern Handel kann in großartiger Weise erst hervortreten, wenn der Osten mit dem Westen, der Norden mit dem Süden Deutschlands durch wenigstens vier Nationallinien verbunden sein wird. Allein die wichtigste Seite eines allgemeinen Eisenbahnsystems ist für uns Deutsche nicht die finanzielle, nicht einmal die nationalökonomische, sondern die politische. Für keine andere Nation ist es von so unschätzbarem Wert als Mittel, den Nationalgeist zu wecken und zu nähren und die Verteidigungskräfte der Nation zu stärken.«[4]
Die Nürnberger Lokomotive, der ›Adler‹ (bis 1852 im Dienst der Ludwigsbahn, dann nach Augsburg verkauft und wahrscheinlich dort verschrottet), die im Dezember 1835 nicht nur zweihundert Personen von Nürnberg nach Fürth transportierte, sondern ein neues kulturelles, wirtschaftliches, politisches wie gesellschaftliches Bewußtsein »beförderte«, war aus England bezogen worden. Seit Thomas Newcomens erster ›atmosphärischer Dampfmaschine‹ 1712 war dort die Nutzung der Dampfkraft systematisch weiterentwickelt worden, wobei sich besonders das Modell von James Watt als wichtig erwies. 1769 bekam er ein Patent auf eine »neue Methode zur Senkung des Dampf- und Brennstoffverbrauchs bei Feuermaschinen« – eines der bedeutendsten Patente in der Geschichte der Technologie.[5]Watt und Matthew Boulton gründeten 1775 die Firma Boulton & Watt, deren Fabrik als erste Antriebsmaschinen industriell herstellte. Der Handel blühte; den besonderen Erfolg bewirkte eine kluge Geschäftsidee: die frühe Form des ›Leasing‹. Die Maschinen wurden nicht verkauft, sondern an die Kunden unter der Bedingung gegeben, daß die Gesellschaft als Miete den Preis für die Menge Kohle bekam, die im Vergleich zu einer Newcomenmaschine vergleichbarer Größe eingespart werden konnte.
Zahllose Einzelerfindungen waren notwendig, bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine sich bewegende Dampfmaschine auf Schienen vorgestellt werden konnte; sie war für den Transport in Bergwerken gedacht. George Stephenson löste die Eisenbahnen aus dem Grubenbereich und machte sie zum öffentlichen Verkehrsmittel. 1814 wurde die Lokomotive ›Mylord‹ gebaut, am 17. September 1825 fuhr die erste öffentliche Eisenbahn mit Dampfkraft auf der Strecke von Stockton nach Darlington.
Die Fabrik von Stephenson in Newcastle/England war auch mit dem Bau des Nürnberger ›Adlers‹ beauftragt worden. In 19 Kisten verpackt, gelangte die Lokomotive per Schiff bis Köln und von da ab per Fuhrwerk nach Nürnberg. Ein William Wilson, Mitarbeiter der Firma Stephenson & Co, der nach Nürnberg per Postkutsche reiste, hatte den Auftrag, die in rund hundert Einzelteile zerlegte Lokomotive wieder zusammenzubauen. Dies erfolgte in der Nürnberger Maschinenfabrik J.W. Spaeth. Der ›Adler‹ hatte drei Achsen, sechs Räder, zwei Zylinder; seine Leistung betrug 25PS; die größte zulässige Geschwindigkeit war 23 km/h; bei Probefahrten erreichte er 40 km/h; er kostete 850 Pfund Sterling.
2. Die Eröffnung der Ludwigs-Eisenbahn zwischen Nürnberg und Fürth am 7.12.1835.
Wilson blieb übrigens in Nürnberg; er bildete bei der Ludwigsbahn-Gesellschaft neue Kräfte zu Lokomotivführern aus und arbeitete als Konstrukteur am Zeichentisch wie als Praktiker in der Werkstätte. Nach seinem Tod 1862 wurde er auf dem Nürnberger Johannisfriedhof beigesetzt.[6]
Die kleine Bahn Nürnberg–Fürth hatte ein Gleis, insgesamt zwei Weichen und sieben Drehschreiben; die letzteren waren von der Firma Spaeth hergestellt worden. Die Schienen sollten ursprünglich aus England bezogen werden – die Regierung verweigerte jedoch die zollfreie Einfuhr, weshalb eine deutsche Firma im Rheinland die Fertigung übernahm. Die Bescheidenheit im Technischen läßt uns dennoch in einem symbolischen Sinne von einer ungemein wichtigen ›Weichenstellung‹ sprechen. Nach einem Wort von Max Weber ist die Eisenbahn das revolutionärste Mittel gewesen, das die Geschichte für die Wirtschaft, nicht nur für den Verkehr verzeichnete. Sie war Wegbereiterin der Industrialisierung, ›Motor‹ des umfassenden gesellschaftlichen Wandels (Gegenkraft zum feudalen vorindustriellen Gesellschafts-, Herrschafts- und Wirtschaftssystem). Der Eisenbahnbau veränderte die Infrastruktur aller Länder und forderte darum die staatliche Wirtschaftspolitik heraus, die lange zwischen merkantilistischen und liberalistischen Konzepten und Maßnahmen schwankte. Der Eisenbahnbau als ursprünglich private Angelegenheit brachte sehr deutlich die Spannungen zwischen dem monarchisch-bürokratischen Staatsapparat und dem erstarkenden Wirtschaftsbürgertum zum Ausdruck und zum Ausbruch; das aber war ein bedeutsamer Konflikt bürgerlicher Gesellschaften auf der Stufe des Hochkapitalismus.[7]
Der Mythus vom Dampf
Als man 1875 bei dem Stiftungsfest des preußischen ›Vereins für Gewerbefleiß‹ die Hundertjahrfeier der Erfindung der Dampfmaschine durch James Watt beging, brachte der Direktor des preußischen Statistischen Büros, Dr. Ernst Engel, einen Trinkspruch aus, in dem er die Vereinigung von Technik und Natur als ›Familienbild‹ allegorisierte: »Die im Jahr 1775 vollzogene Ehe ist, trotz der großen Verschiedenheiten von Mann und Frau, eine der glücklichsten auf dem ganzen Erdenrunde und besteht noch heute. Sie ist aber auch die fruchtbarste. Ihre Sprößlinge zählen nach Hunderttausenden. Mit sehr wenigen Ausnahmen sind diese die wohlerzogensten, fleißigsten und willigsten Geschöpfe. Sie kennen keine Ruhe bei Tag und Nacht und sind wahre Muster von Fügsamkeit und Genügsamkeit. … Wo man ihnen Hütten baut und sie richtig zu nehmen weiß, folgt Glück und Segen ihrem Einzuge auf dem Fuße.«[8] Der aufbrausende, unmanierliche Gatte ›Dampf‹ bedürfe freilich stets der bezähmenden, freundlichen, harmonisierenden Gattin ›Maschine‹.
Der ›Mythus vom Dampf‹ rekurrierte auf den Mythus vom gefesselten Prometheus, vom bezwungenen Herkules. ›Des Vaters Zorn, der Mutter Kraft‹ waren zweckvoll gebändigt. Der Dampf, der ›Feuergeist‹, durfte nicht mehr in die Wolken greifen, »nicht spielen mit des Blitzes Loh’n / in Lüften nicht die Welt durchschweifen, / ein freigeborner Königssohn«.
»Nein, wo der Mensch von Eisenschienen
sein unabsehbar Netz gespannt,
da muß in harter Fron er dienen,
ein Herkules im Knechtsgewand,
da muß er mit des Windes Flügel,
wettlaufen in erglühter Hast
und über Heide, Strom und Hügel
dahinziehn die getürmte Last …«
Am Ende dieses Gedichts von Emanuel Geibel, das die Stimmungslage prometheischer Technikgläubigkeit widerspiegelt, steht freilich die eschatologische Angst vor dem »Tag des Zorns«, vor dem »Trümmersturz der Dinge« – vor dem Weltenbrand, da alles im Nichts vergeht.[9]
Die Lokomotive, das »zwanzigmeterlange Tier, / die Dampfmaschine, / auf blankgeschliffener Schiene / voll heißer Wut und sprungbereiter Gier«[10], vermittelte nicht nur individuelle und kollektive Ich-Stärke, gespeist aus dem Bewußtsein vom Sieg des Menschen über die Natur, sondern auch ein besonders ästhetisches Glücksgefühl. Wenn William Turner (1775–1851) davon sprach, daß er einen blühenden Birnbaum ebenso liebe wie eine Dampflokomotive, die Kathedrale von Reims ebenso wie eine Ölraffinerie, dann bekundete sich darin eine neue Weltsicht, die sich die Perspektive vibrierender, ›schnaubender‹, ›siedender‹ Schönheit erschloß. Turners Bild ›Rain, steam and speed – The Great western railway‹, 1844, ist charakteristisch für solche künstlerische Grundbefindlichkeit, die, gipfelnd im Impressionismus, die Kompaktheit der bisherigen Welt in Bewegung auflöste. Die Geschwindigkeit des neuen Transportmittels versetzte den Menschen in einen Zustand der Exorbitanz; es ergriff ihn gleichermaßen der Taumel der Freude wie der Schwindel der Angst, er raste einem Ziele zu und fühlte sich doch dem Ungewissen ausgesetzt. Was Maler und Dichter artikulierten, war nicht nur Ausdruck von Artistik; wiedergegeben wurde damit auch das alltägliche Lebensgefühl, das bis heute, bewußt oder unbewußt, die Freunde der Dampflokomotive nostalgisch prägt: ein Verlangen nach Auflösung, Ent-hebung, Entfernung. Wer sich dem Bahnhof nähert, den Pfiff des ankommenden Zuges hört, erwartungsvoll den Bahnsteig und dann das Abteil betritt, der löst sich aus der Enge seiner Verhältnisse, er ergreift Besitz von der Ferne, er ist versetzt in eine transitorische Welt.
3. Johann Adam Kleins »Eisenbahn-Szene bei München« (1842) spiegelt die Angst vor der ›Teufelsmaschine‹.
Der ›Wirbel des Lebens‹[11], der Bahn und Bahnhof zum Topos des Aufbruchs macht, charakterisierte den ›Zug der Zeit‹. Überall, in allen Ländern und Kontinenten, da die Eisenbahnstrecken die Grenzen der Provinzen und des Provinziellen aufsprengten, skandierte der dampfende, zischende Maschinentakt der ›Dampfrösser‹ mit den Stakkatoschlägen der Schieneneinschnitte, über die die Wagen dahinstürmten, die Melodie eines dunklen, furchtbaren Hungers nach Welt. Die Länder verfliegen, die Städte versinken, Stunden und Tage verflattern im Flug …
»Quer durch Europa von Westen nach Osten
rüttert und rattert die Bahnmelodie.
Gilt es die Seligkeit schneller zu kosten?
Kommt er zu spät an im Himmelslogis?
FortfortfortFortfortfort drehn sich die Räder
rasend dahin auf dem Schienengeäder,
Rauch ist der Bestie verschwindender Schweif,
Schaffnerpfiff, Lokomotivengepfeif …«
Der ›Blitzzug‹, den dergestalt Detlev von Liliencron als Rhapsodie der Bewegung in die Ferne rasen läßt, zerschellt an seinem ›Gegenbild‹:
»Halthalthalthalthalthalthalthalthaltein
ein anderer Zug fährt schräg hinein.«[12]
Das neue Transportmittel Eisenbahn bewirkte Panik: Stunden der Enthebung wie Sekunden des Schreckens gleichermaßen. Auf der einen Seite ein unbestimmter Glückszustand, wie ihn Hippolyte Taine in ›Carnet de voyage‹ beschreibt: »Ich befand mich allein in meinem Wagen … Die Räder rotierten unermüdlich mit einem gleichförmigen Geräusch, wie der Nachhall einer großartigen Orgel. Alle Gedanken an Irdisches und Gesellschaftliches verschwanden. Ich sah nur noch die Sonne und die Erde, die geschmückte Erde, lachend, ganz in Grün, und zwar einem vielfältigen Grün, aufgeblüht unter diesem süßen Regen von warmen Sonnenstrahlen, die sie liebkosten.«[13] Auf der anderen Seite die ständige Gegenwärtigkeit des Todes, die Angst vor dem Entgleisen des Zuges, die Ahnung von den dem Eisenbahnwesen immanenten Katastrophen (medizingeschichtlich bewirkte dies neue Formen der Hysterie und bei Überlebenden von Unglücken eine besondere Art traumatischer Schocks, wobei Sigmund Freud Eisenbahnangst und Eisenbahnlust psychoanalytisch deutete).
»Wir sind«, heißt es in einem Gleichnis von Franz Kafka – und dieses ist existentiell wie zeitgeschichtlich zu verstehen –, »mit dem irdisch befleckten Auge gesehen, in der Situation von Eisenbahnreisenden, die in einem langen Tunnel verunglückt sind, und zwar an einer Stelle, wo man das Licht des Anfangs nicht mehr sieht, das Licht des Endes aber nur so winzig, daß der Blick es immerfort suchen muß und immerfort verliert, wobei Anfang und Ende nicht einmal sicher sind. Rings um uns aber haben wir in der Verwirrung der Sinne oder in der Höchstempfindlichkeit der Sinne lauter Ungeheuer und ein je nach der Laune und Verwundung des Einzelnen entzückendes oder ermüdendes kaleidoskopisches Spiel. Was soll ich tun? oder: Wozu soll ich es tun? sind keine Fragen dieser Gegenden.«[14]
Es gehört zum Verblendungszusammenhang der durch das Eisenbahnwesen inaugurierten Epoche der Industrialisierung, daß deren Gesellschaft, zumindest in ihren ›Spitzen und Stützen‹, die Sinnfrage nicht nachdrücklich genug stellte; fasziniert vom ›Mythus des Dampfes‹ blieb Reflexion auf der Strecke.
Die Zeit rollt – manchmal auch langsam
Angesichts der Erschütterung, welche die beiden Eisenbahnen von Paris nach Orleans und nach Rouen bewirkten, erkannte Heinrich Heine, daß die Elementarbegriffe von Zeit und Raum schwankend geworden seien; die Zeit rolle rasch vorwärts, unaufhaltsam auf rauchenden Dampfwagen; die abgenutzten Ideale und Helden der Vergangenheit werde man rasch aus den Augen verlieren. »Während aber die große Menge verdutzt und betäubt die äußere Erscheinung der großen Bewegungsmächte anstarrt, erfaßt den Denker ein unheimliches Grauen, wie wir es immer empfinden, wenn das Ungeheuerste, das Unerhörteste geschieht, dessen Folgen unabsehbar und unberechenbar sind.«[15] Da man in viereinhalb Stunden jetzt nach Orleans und in ebensoviel Stunden nach Rouen reisen könne, sei das natürliche Zeitgefühl ver-setzt. Berge und Wälder aller Länder rückten auf Paris an; »vor meiner Tür brandet die Nordsee«.
Das neue Zeitgefühl bedeutete eine Ablösung vom Lebensrhythmus der statischen Agrargesellschaft. Angesichts der Verkürzung beziehungsweise Eliminierung des Zwischen-Raums, des Raumes zwischen den Orten, des ›Reiseraumes‹ (auch wenn dieser am Anfang aufgrund der geringen Geschwindigkeit der Eisenbahnen noch verhältnismäßig groß war – doch kam es nicht auf die objektive Zeitmessung, sondern auf das psychologische Zeitempfinden an!) –, angesichts solcher Erfahrung bedeutete Unterwegssein vorwiegend Start und Ziel. Die Bahnen kannten nur Abfahrt, Aufenthalt und Ankunft als Orte, und diese lagen gewöhnlich weit voneinander entfernt. Mit den Räumen dazwischen, die sie voller Geringschätzung durchquerten und die nur einen nutzlosen Anblick böten, verbinde sie nichts, heißt es in einem französischen Text aus dem Jahre 1840.[16] Nach einem Wort von John Ruskin würden die Reisenden nun wie Pakete an ihren Bestimmungsort verschickt. Die Identifikation mit der Landschaft gehe verloren.
Zugunsten eines geregelten Verkehrs vereinheitlichte man die Ortszeiten; eingeführt wurde die Eisenbahnzeit, die zunächst nur mit der Fahrplanzeit identisch war und erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts zur allgemeinen Standardzeit avancierte. 1852 hatte man sich, obgleich jede längere Zugfahrt mit einem ständigen Regulieren der Uhren verbunden war, bei den Eisenbahnverwaltungen noch gegen die ›Normalzeit‹ gewehrt.[17]
Die Ungleichzeitigkeit im Gleichzeitigen spiegelte sich nicht nur in der Unterschiedlichkeit von Eisenbahnzeit und Ortszeit; die Eisenbahn selbst nahm in sich agrargesellschaftliche Lebensformen auf, sie mehr bewahrend denn vernichtend. Während sie als Schnellzug der Industrialisierung den Rhythmus vorgab, erwies sie sich als Lokalbahn oder Vizinalbahn lediglich als Verlängerung des Kutschenzeitalters. Auf den vielen Nebenstrecken in Deutschland waren Standardisierung und Normierung zugunsten regionaler Besonderheit aufgehalten; die Uhren etwa auf der ›schwäb’schen Eisenbahn‹ schlugen eben anders, zeit-loser, un-regel-mäßiger. In Bayern war, wenn man Ludwig Thoma trauen kann, die gleichermaßen feudale wie ländliche gemütliche Eigensinnigkeit nicht nur bei Lokalbahnen, sondern sogar bei Schnellzügen gang und gäbe: »Dann Moching. Seine Königliche Hoheit fahre dorthin, um ihr Rindvieh zu sehen, der Hofveterinärarzt fahren hin, um es zu kurieren, der Verwalter fahren herein, um vom Rindvieh einen Abend wegzukommen …«[18]
Die Blütezeit der Kleinbahnen fiel auf das Ende des 19. Jahrhunderts. Die wesentlichen Hauptbahnen waren geschaffen; nun mußten kleine Nebenbahnen die Aufgabe übernehmen, Gebiete, die noch abseits lagen, aber am wirtschaftlichen Aufschwung teilhaben wollten, verkehrsmäßig zu erschließen. Im Deutschen Reich kostete 1910 ein Tonnenkilometer Ware beim Fuhrwerksbetrieb durchschnittlich 30 Pfennig gegenüber 13 Pfennigen auf Kleinbahnen; beim Reiseverkehr waren 10 gegenüber 4 Pfennig je Personenkilometer zu bezahlen. Dazu kam auch noch die Zeitersparnis. – Von den deutschen Ländern förderte Bayern mit einem Gesetz vom 19. April 1869 den Bau von Kleinbahnen; in Preußen begünstigte der Staat durch eine Reihe von Spezialgesetzen den Bau von Kleinbahnen (so durch das Preußische Kleinbahnengesetz vom 28. Juli 1892). – In Deutschland gab es 1909250 Kleinbahnen mit einem Streckennetz von 7565 Kilometern. (Die Durchschnittslänge einer Strecke der preußischen Kleinbahn betrug 34,15 km.) Damit stand Deutschland nach Ungarn und vor Frankreich an zweiter Stelle in Europa.[19]
Solche Zahlen machen deutlich, daß die vielfach ironisierte (und später romantisierte) ›Bimmelbahn‹ wie die Vollbahn von großer Bedeutung für die Industrialisierung war. Die Kleinbahn, hieß es im Berliner Tageblatt Nr. 201 von 1902, sei ein durchaus vollwertiges Glied in der Reihe der öffentlichen Verkehrsmittel. Sie unterscheide sich von den Vollbahnen dadurch, daß sie nur die Bedürfnisse eines beschränkten Verkehrsgebietes abzudecken habe. Ihr Streben gehe dahin, »durch tunlichstes Vereinfachen ihrer Einrichtungen zu ermöglichen, daß auch entlegene Gegenden in den Genuß eines Bahnanschlusses gelangen«.
Eisenbahnbau
Das Schienennetz der deutschen Eisenbahnen, deren Bau von Börsenspekulationen beflügelt wurde und einen enormen Eisenbedarf einschloß (was wiederum einen Boom bei der Stahlindustrie bewirkte), hatte 1845 eine Länge von etwa 2200 km, 1850 von rund 7500 km und zur Jahrhundertwende von mehr als 50000 km. 1917 erreichte das Schienennetz eine Ausdehnung von 65000 km.
Der Eisenbahnbau forderte den Einsatz gewaltiger Armeen von Arbeitern; beim Bau der Thüringischen Eisenbahn waren zum Beispiel 15000 Menschen beschäftigt. Ein Teil von ihnen ging zur Ernte und im Winter ins Heimatdorf zurück; die anderen waren Wanderarbeiter, die jahrelang von Strecke zu Strecke zogen. Carl Fischer, ein gelernter Bäcker, war über sechs Jahre als Erdarbeiter beim Eisenbahnbau beschäftigt. In seinen ›Denkwürdigkeiten und Erinnerungen eines Arbeiters‹, einer der wenigen Arbeiterautobiographien aus dem 19. Jahrhundert, berichtet er, wie er, als die Halle-Kasseler Bahn gebaut wurde, »nach der Bahn ging«:
»Da stellten sich bald viele fremde Leute ein: Ost- und Westpreußen, Polen und Schlesier, Pommern und Mecklenburger, Brandenburger und Sachsen, Hessen und Hannoveraner, auch einzelne Österreicher, Süddeutsche und aus der Eifel, und alle bekamen sie da Arbeit … Auch viele Einheimische aus der Umgebung waren dabei.«
Man arbeitete mit zweirädrigen Kippkarren, vor die jeweils zwei Mann gespannt waren. Das Karrenband, das man über die Schulter nahm, und der damit verbundene Strick wurden ›Zottel‹ genannt. Statt ziehen sagte man ›zotteln‹; die Männer, die paarweise einen Wagen zogen, hießen ›Zottelleute‹. Wer etwas verdienen wollte, mußte einen passenden, verträglichen Partner haben; es handelte sich um Akkordarbeit; sie wurde wagenweise bezahlt. »Ich habe in 2 Jahren da hauptsächlich nur 4 bis 5 Kameraden gewechselt und habe mich mit allen gut vertragen, bis auf einen, und mit dem habe ich grade am längsten gezottelt, der wollte mirs manchmal zu verstehen geben und nahm eine Miene an, als ob er mehr thäte als ich; aber ich wußte das besser, denn grade dieser war der Ungeschickteste von allen, die ich da gehabt habe, und als er mir das einmal zu arg machte, da wars vorbei.«[20]
4. Bahnarbeiten bei Remtershofen (Carl Herrle, 1853).
Die Arbeitsmittel waren primitiv; für die gewaltigen Erdarbeiten standen hauptsächlich nur Hacke, Schaufel und Karren zur Verfügung. Die Arbeitermassen wurden rigoros diszipliniert. Die technischen Schwierigkeiten waren groß; in den Lehrbüchern und in der Fachliteratur gab es Beschreibungen bereits fertiggestellter Strecken im Ausland, aber sonst kaum systematische Informationen; die leitenden Bautechniker mußten meist selbst die optimalen technischen Lösungen finden.
Beim Eisenbahnbau unterschied man Unterbau (Dämme, Einschnitte, Stütz- und Futtermauern, Böschungsbefestigungen, Entwässerungen, Brücken, Durchlässe, Tunnels, Wegübergänge) und Oberbau (Bettung, Schienenunterlagen, Schienenbefestigung, Schienen).[21] Erst wurde die Ackerkrume beziehungsweise der Rasen abgetragen und zur späteren Befestigung der Böschungen in Haufen bereitgestellt. In Waldungen wurden die Bäume und das Buschwerk gefällt, die Wurzelstöcke gerodet und etwaiger guter Boden abgeschält und ebenfalls zur Seite gekarrt. Leichte Bodenarten wurden mit Spaten und Schaufel, mittlere mit Spitzhacke, Breithacke, Erdkeil, Schlägel und Brechstange gelockert und abgetragen. Bei festem Fels setzte man Sprengmittel ein. Die übliche Abbaumethode bei flachen und kurzen Einschnitten war der Kopfbau: Der Einschnitt wurde in voller Breite »vor Kopf« ausgehoben und in Richtung Bahnachse vorangetrieben. Größere Einschnitte wurden »in Terrassen und Banketts« angelegt. Konnten die für die Dammschüttung benötigten Massen nicht durch den Abtrag gewonnen werden, hob man Füllgruben neben der Trasse aus. Das Aufschütten erfolgte lagenweise; der Erdkörper wurde mit zwei- und vierhändigen Handrammen gestampft; dies war äußerst anstrengend und konnte nur von den kräftigsten Arbeitern verrichtet werden. Bevor der Oberbau auf die Dämme gesetzt wurde, bekamen diese »zwei Winter zum Setzen«; in dieser Zeit sollten die Dämme, wann immer möglich, als Fuhrwege benutzt werden, um das Festwerden zu beschleunigen.
Zur Organisation des Arbeitsablaufs, im besonderen was die Karrenbeförderung des Erdreichs betraf, schrieb die Eisenbahn-Zeitung vom 31. August 1845: »Es ist wohl nicht ganz ohne Interesse zu erwähnen, daß sich die Ameisen eines ganz ähnlichen Transportsystems, versteht sich ohne Schubkarren, bedienen, wenn sie ihre unterirdischen Gänge bauen.«
Die Herstellung des Oberbaus brachte für die Bahnbauer weitaus größere Probleme als die Herstellung des Unterbaus mit sich. Oft richteten die einzelnen Privat- und Staatsbahnen ihre Oberbaukonstruktion nach dem zu erwartenden Eisenbahnbetrieb aus; plante man, wenige oder leichte Züge verkehren zu lassen, sparte man sich einen stabilen und damit teuren Oberbau. Bei der Verknüpfung der einzelnen Linien mußten dann häufig in späteren Jahren die Strecken völlig erneuert werden. 1850 traten die Techniker sämtlicher deutscher Eisenbahnen in Berlin zusammen und beschlossen »Grundzüge für die Gestaltung der Eisenbahnen Deutschlands«. Seitdem konnte eine gleichmäßige Konstruktion des Bahnbaus erreicht werden.
Das Fundament des Gleises, die Querschwellen, waren am Anfang meist aus Stein; die Holzschwellen setzten sich erst durch, als man sie durch das Tränken mit Kupfervitriol, in Bayern ab 1853, haltbarer machen konnte. Sowohl Roheisen wie Stabeisen (fertige Schienen) mußten importiert werden; die deutsche Produktion konnte mit dem raschen Zuwachs des Streckennetzes nicht Schritt halten. Die belgischen und vor allen Dingen die englischen Eisenwerke waren aufgrund »ihrer fortschrittlichen Technik, der Größe ihrer Produktionsanlagen und ihrer gut ausgebildeten Arbeiter im Gegensatz zur deutschen Eisenindustrie in der Lage, … die Massenaufträge der deutschen Eisenbahn für Schienen schnell und in quantitativer wie qualitativer Hinsicht in befriedigender Weise zu erfüllen«. (H.Wagenblaß) Die Situation der Eisenbahnarbeiter im 19. Jahrhundert spiegelt im besonderen den mit der Industrialisierung einhergehenden ›Pauperismus‹ wider; in ihm trat die Not der übermäßig stark angewachsenen Unterschicht zutage, das Massenelend mit seiner Bindungslosigkeit, der Verlust an Heimat und familiärer Geborgenheit. Immerhin bot der Eisenbahnbau dem häufig arbeitslosen Stadtwie Landproletariat eine Verdienstmöglichkeit.
Eine besondere technische Leistung stellte der Tunnel- und Brückenbau sowie die Anlage von Bergstrecken dar. Unfälle waren häufig, die Strapazen bei der Arbeit besonders groß. Die Bahn von Frankreich nach Italien durch den Mont Cenis war die erste Alpenbahn, die in geringer Höhe ein Massiv durchstieß; der Tunnel war 12 km lang; die Bauarbeiten dauerten vierzehn Jahre (1857–1871). Neun Jahre brauchte man für den Bau des 15 km langen Gotthardtunnels (1872–1881). Bis zu 2500 Menschen arbeiteten hier. Es gelang nie zufriedenstellend, die Dynamitabgase vollständig aus dem Stollen zu befördern, obwohl die zahlreich vorhandenen Wasserkräfte der Umgebung zur Drucklufterzeugung herangezogen wurden. 177 Personen verloren ihr Leben, 403 Männer wurden verletzt – oft verknüpft mit lebenslanger Invalidität. Tunnels, die ja bei vielen Strecken notwendig waren und somit zur Alltagserfahrung des Eisenbahnbenutzers gehörten, bewirkten dennoch besondere Ängste. Als Peter Rosegger mit seinem Paten die Wallfahrtskirche Mariaschutz am Semmering besucht, schauen sie sich auch die dortige Bahnstrecke an; sie beobachten dabei die Einfahrt eines Zuges »schnurgerade in den Berg hinein«:
»Schon war das Ungeheuer mit seinen hundert Rädern in der Tiefe; die Rückseite des letzten Wagens schrumpfte zusammen, nur ein Lichtlein davon sah man noch eine Weile, dann war alles verschwunden, blos der Boden dröhnte und aus dem Loche stieg still und träge der Rauch.
Mein Pate wischte sich mit dem Ärmel den Schweiß vom Angesicht und starrte in den Tunnel.
Dann sah er mich an und fragte: ›Hast Du’s auch gesehen, Bub’?‹
›Ich hab’s auch gesehen.‹
›Nachher kann’s keine Blenderei gewesen sein‹, murmelte der Jochem.
Wir gingen auf der Fahrstraße den Berg hinan; wir sahen aus mehreren Schachten Rauch hervorsteigen. Tief unter unsern Füßen im Berge ging der Dampfwagen.
›Die sind hin wie des Juden Seel’!‹ sagte mein Pate und meinte die Eisenbahn-Reisenden. ›Die übermüthigen Leut’ sind selber in’s Grab gesprungen!‹«[22]
Die Amerikaner hatten gezeigt, wie man mit Viadukten aus Holzstämmen kilometerweite Täler überbrücken konnte. In Europa bevorzugte man Eisen- und Steinkonstruktionen. Fünf Jahre lang baute man an dem Viadukt über das Göltzschtal im Vogtland; 78 m hoch führte der Weg der Bahn mehr als einen halben Kilometer weit auf steinernen Gewölben in drei Stockwerken dahin (1850). Die höchste deutsche Eisenbahnbrücke, über die Wupper, überspannte in ihrem Mittelbogen 170 m, 100 m über dem Fluß. Zur Furcht vor Entgleisung und Zusammenstoß gesellte sich die vor dem Absturz. Als am 28. Dezember 1879 bei einem Orkan der Mittelteil der Brücke über den Firth of Tay in Schottland brach und ein Zug mit etwa 200 Personen in den Strom stürzte, wurde dies als furchtbares Menetekel empfunden. Die Natur hatte der Technik getrotzt. »Tand, Tand / ist das Gebilde von Menschenhand!«[23]
Bei den Gebirgsstrecken vereinigten sich die Ingenieurskünste des Eisenbahnbaus in besonders eindrucksvoller Weise. Die Semmeringbahn, die erste Gebirgsbahn Österreichs, führte von Wien nach Triest; sie war doppelt so lang wie die Luftlinie zwischen den beiden Orten; die Steigungen wurden durch das Ausfahren von Seitentälern, durch Tunnels, Viadukte, Galerien überwunden; die Bahn wurde kühn, von Mauern und Pfeilern gestützt, an den Berghängen entlanggeführt.
Bahnhöfe – Kathedralen der Technik
Bahnhöfe: Kasimir Malewitsch nannte sie »Vulkane des Lebens«, Blaise Cendrars die »schönsten Kirchen der Welt«. Théophile Gautier sprach davon, daß in ihnen, den »Kathedralen der neuen Humanität«, die Religion des Zeitalters, nämlich die der Eisenbahnen, zelebriert werde; sie seien Trefforte der Nationen, Zentren, wo alles zusammenfließe, Kerne riesiger Sterne, deren Eisenstrahlen sich bis zu den Enden der Erde erstreckten. Es gibt kaum einen Topos des 19. Jahrhunderts, in dem der Geist der Zeit derart grandios (behaftet mit dem Hautgout des Kitsches) ›versteinerte‹. Ihre volle Pracht entfalteten die Bahnhöfe in den letzten beiden Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts. »Überall in der Welt nahmen sie die Gestalt von Basiliken, Palästen an, dekoriert mit Putz, Plüsch und Prunk. Ihre Hallen, Wartesäle und Speiselokale glichen Ballsälen mit Kassettendecken, Karyatiden, Keramiklandschaften, Wandgemälden, vergoldeten Säulen und Bronzelampen.«[24]
Auf den Lockruf der Lokomotiven antwortete man mit einem Ambiente, das in seiner Mischung aus Funktionalismus und Kulissenarchitektur, technischem Pragmatismus und überschäumendem Dekor surrealistisch anmutet (und auch immer wieder im besonderen surrealistische Maler inspirierte). In der Ausgestaltung der Bahnhöfe trat das nationale Sendungsgefühl in den Vordergrund; sie wurden zu Monumenten patriotischen Stolzes und Selbstgefühls. Man nutzte sie für historische Zwecke; sie waren Orte der internationalen Begegnung, Zielpunkte der Expreßzüge aus fernen Städten und Ländern, Sammelplätze für Truppentransporte; ihnen entquoll jeden Tag das Heer der vom Lande herbeitransportierten Industriearbeiter. Bahnhöfe waren auch Treffpunkt und Auffangstelle der Entwurzelten, derer sich Bahnhofspolizei und Bahnhofsmission annehmen mußten.
»Dokumentierte sich in den geteilten Abteilen deutlich die in Klassen geschiedene bürgerliche Ordnung, so traten doch an keinem anderen Ort die einzelnen Gruppen in eine so enge Berührung wie auf diesem Forum, das von der alles bändigenden industriellen Kultur beherrscht wurde, obschon sie sich vorerst noch nach den Bedürfnissen der eleganten Gesellschaft ausrichtete. Alle Schichten nahmen hier erstmals an einer gemeinsamen Kultur teil, auch wenn es nicht zum Bruderkuß zwischen Unternehmer und Arbeiter kam, den ein Kapitell im Bahnhof zu Metz zeigt.« (Eberhard Straub)[25]
Technisch gesprochen teilte man die Bahnhöfe je nach ihrer Verkehrsbedeutung in solche der ersten bis fünften Klasse ein; man baute Kopf- und Durchgangsbahnhöfe; der normale ›Wald- und Wiesenbahnhof‹, vor allem bei Nebenstrecken und als Haltepunkt für Personenzüge in kleineren Orten, bestand aus den durchgehenden Hauptgleisen und ein paar zum Rangieren, Abstellen und Beladen notwendigen Nebengleisen, aus dem Bahnhofsgebäude mit Schaltern, Diensträumen, Eingangshalle, Wartesaal und dem etwas abseits davon stehenden Güterschuppen.
Von besonderer Bedeutung für die Sicherheit war das Stellwerk, von dem aus die Weichenverbindungen und die Signalanlagen bedient wurden. Um die Züge zu erklettern, waren früher Holztreppen und Podeste montiert, bis die Engländer den Bahnsteig als durchgehende Plattform erfanden, demgegenüber das ursprünglich höhere Gleisniveau in der Tiefe lag. Wegen der Rauchentwicklung geleitete man die Reisenden früher erst nach Zugankunft auf den Bahnsteig. Auch die Bahnsteighallen wurden in England entwickelt: große, weitgespannte, an den Giebelfronten freie Eisenkonstruktionen auf dünnen Säulen, dem Licht oben mit langen Glasbahnen Eingang bietend. Die Empfangsgebäude wurden dem technischen Bereich als Riegel vorgeschoben und zum Stadtzentrum hin geöffnet. Kopfbahnhöfe hatten ›Schauseiten‹ nach drei Seiten hin; bei Durchgangsbahnhöfen war der vom Stadtzentrum abgewandte Teil, der auf die industriell bestimmten und in ihren Wohnverhältnissen häufig verelendeten Vororte blickte, weniger schmuckvoll gestaltet. In zahlreichen Städten entstanden ganze Bahnhofslandschaften, vor allem dann, wenn die einzelnen, zunächst privat betriebenen Strecken in Kopfbahnhöfen endeten. In Dresden etwa wurden in Betrieb genommen: 1839 der Leipziger Bahnhof, 1851 der alte Böhmische, 1847 der Schlesische, 1855 der Albert-Bahnhof (spätere Kohlenbahnhof), 1875 der Berliner Bahnhof; der Güterverkehr hatte sich in Dresden in der Zeit von 1888 bis 1892 um 17 % gesteigert; von 1883 bis 1893 nahm der Personenverkehr von 2300000 auf 4600000 beförderte Fahrgäste zu. Der Vorortverkehr stieg von 1847 bis 1892 von 40000 auf 400000 Personen.
In Berlin begann der Eisenbahnbau 1838; vor den Toren der alten Akzisemauer des 18. Jahrhunderts, an denen Zöllner immer noch Abgaben für hereinkommende Waren erhoben, entstanden Kopfbahnhöfe der zunächst eingleisigen Privatbahnen. Vom Anhaltischen Tor fuhr eine Bahn ab 1841 über Jüterbog nach Köthen, später weiter nach Leipzig, Dresden, Wien und Prag. Von dem Bahnhof in der Nähe des Potsdamer Tors reiste man über Potsdam nach Magdeburg und über Hannover in Richtung Köln. Ein Berliner Reiseführer von 1861 stellt fest, daß »jene eisernen Schienenstraßen«, auf welchen der Zeitgeist hastig und ungestüm über die Erde brause, auch nach Berlin neue und wirksame Bildungsstoffe gebracht hätten. Aber erst die Reichsgründung, der industrielle Aufschwung und die explosionsartige Zunahme der Bevölkerung machten die Eisenbahn zum dominanten Verkehrsmittel. 1879 begann die Verstaatlichung der Eisenbahnen; es entstanden Stadtbahnhöfe, so 1874–1880 der Anhalter Bahnhof mit einer eindrucksvollen Hallenkonstruktion, die von dem Ingenieur und Schriftsteller Heinrich Seidel entworfen war. Der Anhalter Bahnhof war im besonderen ein Bahnhof der Prominenz; von hier aus fuhr man nach Paris, Basel, München oder Wien. Er war entsprechend prunkvoll ausgestaltet.
Aber auch kleine Bahnhöfe zeichneten sich durch eine großbürgerliche oder feudale Aura aus. 1856 wurde wenige Kilometer südlich von Bonn, an einer der schönsten Stellen des Rheins, gegenüber dem Siebengebirge, der Bahnhof Rolandseck gebaut; hier, an der sogenannten Riviera des Rheinlandes, hatten sich im 19. Jahrhundert Kölner Patrizier niedergelassen; die Privatbahn beförderte sie am Morgen rasch zu ihren Kölner Geschäften und abends in ihre Wohndorados zurück. Als Wohnortbahnhof für den Industrieadel war dieser Bahnhof von vorneherein ein »großer Bahnhof«, »Stätte der festlichen Repräsentation einer selbstbewußten gründerzeitlichen Besinnung. Deren fortschrittlich dahineilende Symbolmaschine, das Dampfroß, erhielt in Rolandseck seinen feudalen Stall. Es führte die königlich-preußische Prominenz heran zu den Festen der Schnitzlers, Guillaumes, Mevissens. Mit den Spitzen der Gesellschaft kamen die Fürsten der Künste …«[26]
Die vornehmsten Bereiche des Bahnhofsareals waren die Wartesäle erster Klasse mit den entsprechenden Restaurationsbetrieben. Hier waren die oberen Schichten, die ansonsten die im Bahnhof sich vollziehende soziale Mischung als ästhetisch reizvolles Aphrodisiakum goutierten, unter sich. Die Struktur solcher privilegierten Abkapselung im Bahnhofsbereich wurde auf die Züge selbst übertragen, die mit ihren Wagenklassen (erste bis anfänglich vierte, später dritte Klasse) die Klassengesellschaft spiegelten. Aus der Frühzeit der Eisenbahnentwicklung berichtet Hans Christian Andersen: »Die Wagenreihe hier bildet drei Abteilungen, die beiden ersten sind bequeme, geschlossene Wagen, ganz wie unsere Diligencen, nur viel breiter, die dritte ist offen und unglaublich wohlfeil, so daß selbst der ärmste Bauer damit fährt, denn das kommt ihn weniger teuer, als wenn er den langen Weg gehen und sich unterwegs im Wirtshaus stärken oder übernachten müßte.«[27]
5. »Perspectivische Ansicht im Innern des Bahnhofs zu München«.
Heizung und Toilette fehlten in den Wagentypen der ersten Jahrhunderthälfte fast immer; in den 40er Jahren wurden die offenen Wagen aufgegeben, ab 1850 die Wagen verglast. Sonderabteile gab es für Damen; Nichtraucherabteile nur in der ersten und zweiten Klasse. 1837 erhielten die Polsterklassen Kerzenbeleuchtung und Rüböllampen, ab 1860 Gasbeleuchtung.
George M. Pullmann entwickelte in den USA besonders komfortable Wagentypen, unter anderem auch den Schlafwagen. Er und seine Konkurrenten schufen weitere Luxustypen, so den Speisewagen, den Hotelwagen (eine Verbindung von Schlaf- und Speisewagen), den Gesellschaftswagen. Auf dem europäischen Kontinent lief der erste Schlafwagen nach 1870, der erste deutsche Speisewagen etwa um die gleiche Zeit. Bis dahin hatte man beim Bahnhofswirt einen Speisekorb kaufen können, der eine kalte Mahlzeit, Wein, Teller, Besteck etc. enthielt.[28] Besonders luxuriös waren die ›Salonwagen‹ der Regierenden, etwa der Salonwagen des Fürsten Bismarck, der ihm 1871 von den deutschen Ländern zur unentgeltlichen Benützung geschenkt wurde (Mahagoni und grüne Seide, Gasbeleuchtung), oder der Salonwagen des Hofzuges König Ludwigs II. von Bayern (Holz und Stuck vergoldet, rote Seide, Deckenbild und zentrale Gasbeleuchtung). »Demokratisch möchte man die Eisenbahnen nennen, und wohl waren sie dies nach der einmaligen wirtschaftlichen und Arbeitsleistung beim Eisenbahnbau wie dank der Tatsache, daß jedermann mit dem neuen Gefährt nicht nur fahren durfte, sondern auch fahren konnte! Doch allenthalben schaute der aristokratische Zipfel der konstitutionellen Monarchien unter dem bürgerlichen Mantel der Eisenbahnen hervor.« (Wulf Schadendorf)[29]
Durch die Eisenbahn veränderte sich die Wirtschaftsstruktur der Stadt. Neue Käuferschichten wurden herbeitransportiert. Im Umfeld des Bahnhofs entstanden viele Ladengeschäfte, zunehmend auch Kaufhäuser. Die Bahnhofstraße zog Wirtschaften und Hotels an; die Fabriken suchten Standorte, die eine gute Bahnverbindung aufwiesen – sowohl für den Güterverkehr als auch für die Beförderung der Arbeiterschaft.
Parallel zur Aufwertung des Bahnhofs als Wirtschafts- und Kommunikationszentrum vollzog sich seine ästhetische Auratisierung. Der Bahnhof, nach Justinus Kerner noch dafür verantwortlich, daß die Romantik aus den Städtchen wich, wird zum Ort neuer Romantik. Als »Inbegriff von Handlung« erweist er sich als schlechthin »literarische Gegend«. Der Bahnhof – so Gerd Mattenklott in seinem Essay ›Reisezeit‹ – sei der Ort der großen Verwandlung: Arbeitszeit schlage um in Reisezeit; hier gingen die Namen verloren, würden die tausend kleinen Tode des Abschieds gestorben; das Glück des Abschieds habe selbst keinen Namen, könne keinen haben; es liege in der Erfahrung, sich verlorenzugehen und doch noch zu sein, wiedergeboren als reine Möglichkeit. Unsere Individualität erlösche in der beschleunigten Zeit, und wir fänden uns wieder als Teil eines choreographischen Arrangements, als Bestandteil eines Ornaments, eines Rätsels, das uns selbst zur Lösung aufgegeben.[30] Auf den Bahnsteigen werden Menschen und Schicksale zusammengewürfelt; es sind Topoi des Abschiednehmens und Wiedersehens, des Flüchtens und Zurückkommens, der Fremdheit und der Zuneigung. »Über den ganzen Bahnsteig hin riefen die Beamten aus, die Fahrgäste sollten einsteigen, und sofort kam mehr Bewegung – schnelles Gedränge, eiliges Gestrudel – in die wartenden Freundesgruppen. Man sah Leute einander umarmen, sich küssen, sich innig die Hände drücken, weinen, lachen, sich schnell noch einmal zu einem letzten Kuß umdrehen und dann hastig in den Wagen klettern. Und der junge Ausländer hörte nun in der fremden Sprache Ausrufe, Gelübde und Versprechungen, hörte Späße und flüchtige Anspielungen, wie sie überall einzelnen Menschengruppen geheim und teuer sind und hier lautes Gelächter hervorriefen, hörte Lebewohlworte, wie sie auf der ganzen Welt die gleichen sind« – so erfährt Thomas Wolfe den Münchner Hauptbahnhof.[31]
6. Walter Ophey: Nachts im Wartesaal (Kaltnadelradierung, um 1923).
Die Poesie des Hauptbahnhofes ist oft die des Herbstes. Unter bleiernem, herunterhängendem Himmel die grauen, weißen Dampfwolken der zischenden und schnaubenden Lokomotiven. In ihre Kapuzen tief verhüllt, laufen die Schaffner mit trüben Handlaternen den Zug entlang; Pfiffe gellen durch die nebligdunstige Atmosphäre; hinter regenbetropften Abteilfenstern die Gesichter der Abreisenden; draußen die Wartenden, fröstelnd, mit hochgeschlagenen Kragen. »Ich will, ich will vergehn in einer / Melancholie, die mich endlos einspinnt.« (Paul Heyse)[32]
Doch dann werden die Türen zugeschlagen; das Abfahrtssignal leuchtet grün; der Stationsvorsteher hebt den Stab; das Gefühl der Erleichterung, daß der Abschied überstanden ist, breitet sich aus; die quälenden Augenblicke sind vorüber; die Weichen sind gestellt; ›action‹ hat uns wieder.
Zwischen den Bahnhöfen, im Niemandsland des ›Reiseraums‹, kaum wahrgenommen, liegen die Bahnwärter- bzw. Streckenwärterhäuschen – fern der weiten Welt, die aber ständig, Zug um Zug, an ihnen vorüberrollt. »Rauch, Gestampf, Geröll, Geschrill … / alles wieder totenstill.«[33]
Das Bahnwärterhaus ist ein Ort des Idylls, dem industriellen Kreislauf ganz nahe – und doch abseits. Inmitten der rasenden Zeit ein Stückchen Beharrlichkeit. Der kleine Garten. Augenblicke panischer Ruhe. In der Stille die Gefahr: Gefährdungen muß der Bahnwärter, der die Strecke abgeht und für deren Sicherheit sorgt, abwenden; und er ist selbst ständig gefährdet, kann leicht vom Zug erfaßt und zerschmettert werden. Neben den vielen anderen Berufen, die das Bahnwesen mit sich bringt (Lokomotivführer, Heizer, Schaffner, Stationsvorsteher, Rangierer, Weichensteller, Ladearbeiter), ist der Bahnwärter im besonderen Maße einer, der sich der dämonischen Kraft und Schönheit der Eisenbahn ›ausgesetzt‹ sieht (so in Gerhart Hauptmanns Novelle ›Bahnwärter Thiel‹).[34]
Industrielandschaft
7. »Vorwärts wandeln, wiederkehren, und das Rohe neu gestalten, Ordnung in Verwirrung schalten, wird auf Erden immer währen.« (Ludwig Tieck)
Wer entfesselte Prometheus?
1885 besang Arno Holz, einer der wichtigsten Vertreter des deutschen Naturalismus, in seinem ›Buch der Zeit‹ die Poesie der industriellen Epoche. Eine Schlacht sah er gewonnen, »wie sie kein Feldherr noch erstritt«. Inmitten von Dampf und Kohlendunst schwoll ihm die Brust, »und mir ins Auge schießt der Tropfen / hör’ ich dein Hämmern und dein Klopfen / auf Stahl und Eisen, Stein und Erz«. Fortschritt und Technik erklangen ihm als süße Melodie, voll zukunftsschwangerer Töne.[35]
Als Arno Holz diese begeisterten Verse schrieb, hatte sich der Übergang Deutschlands vom Agrarstaat zum Industriestaat endgültig vollzogen. Der jährliche Verbrauch von Roheisen pro Kopf der Bevölkerung betrug 1893 etwa 99 Kilogramm, 1899 waren es 155 Kilogramm. Der Steinkohleverbrauch stieg im gleichen Zeitraum von 1940 auf 2740 Kilogramm an; die Roheisen- und Eisenproduktion nahm von weniger als 5 Millionen auf mehr als 8 Millionen Tonnen zu; die Kohlenproduktion steigerte sich von 95 auf 136 Millionen Tonnen. Am Ende des 19. Jahrhunderts lebten von 67 Millionen Deutschen kaum mehr 17