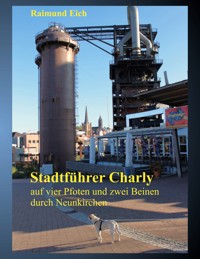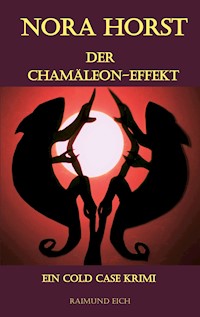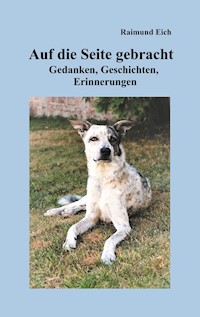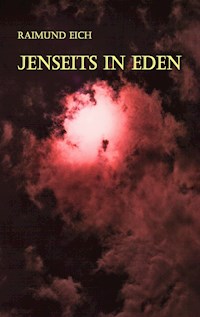Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Maria Behrmann, Leiterin der Forschungs- und Entwicklungsabteilung eines großen Unternehmens, gerät eines Tages in einem Park mit einem fremden Mann in Streit und ergreift, von seinem Benehmen völlig entnervt, schließlich die Flucht vor ihm. Doch am nächsten Abend steht der Fremde plötzlich vor ihrer Wohnungstür. Eine Begegnung, die ihr bisheriges Leben völlig verändern wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 100
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Josefs Hütte
Kapitel 1: Begegnung im ParkKapitel 2: FundsacheKapitel 3: Guten Abend, gute NachtKapitel 4: BestechungsgeschenkKapitel 5: TheoKapitel 6: NackenschlägeKapitel 7: Josefs AngebotKapitel 8: schwierige EntscheidungKapitel 9: AbschiedKapitel 10: Das ErbeNachwortImpressumKapitel 1: Begegnung im Park
„Guten Tag, darf ich mich zu Ihnen setzen?“, fragte er, und noch ehe ich etwas darauf erwidern konnte, saß er auch schon neben mir auf der Bank. Ich hätte platzen können vor Wut, denn im Park waren um diese Zeit noch genügend Bänke frei, aber nein, dieser aufdringliche Kerl hatte sich ausgerechnet meine Bank ausgesucht. Aber so etwas ist schließlich nicht verboten. Leider! Also drehte ich mich demonstrativ zur Seite und versuchte ihn zu ignorieren. Einfach aufstehen und mich auf eine andere Bank setzen, das wollte ich auch nicht.Wer weiß, wie er darauf reagieren würde, dachte ich mir.Womöglich würde er dich nochverfolgen und anpöbeln oder dich sonst wie belästigen.Ich musste daher einen Weg finden, ihn auf andere Weise loszuwerden, denn mir blieb nur noch eine knappe Stunde Zeit, bis ich im Konferenzraum meiner Firma antreten musste, um mal wieder in großer Runde eines dieser verhassten Meetings über mich ergehen zu lassen, mit denen unser Geschäftsführer, ein eingebildeter promovierter Schnösel von Ende dreißig, glaubte, seine Direktoren und Abteilungsleiter in regelmäßigen Abständen auf Erfolgskurs einschwören zu müssen. Was er darunter verstand, war ganz einfach zu erklären, nämlich drastische Reduzierung aller Kosten bei gleichzeitiger Umsatz- und Gewinnmaximierung. Jeden Erklärungsversuch von mir, das kurzfristig zwar Kosten für Forschung und Entwicklung, für die ich als Leiterin der entsprechenden Abteilung verantwortlich zeichnen musste, den Etat belasten, aber mittel- und langfristig ein Garant dafür sind, um dem Unternehmen die Existenz zu sichern, wiegelte er ab. Selbst fachlich sehr fundierte Argumente machten nicht den geringsten Eindruck auf ihn, zumal er von Technik ohnehin nichts verstand. Auf jeden Fall wurde mein Etat für Forschung und Entwicklung jedes Jahr regelmäßig gekürzt, wobei ich mich gleichzeitig für kurzfristig von ihm erwartete Entwicklungserfolge, die zwangsläufig ausbleiben mussten, vor der versammelten Unternehmensführung zu rechtfertigen hatte. Ganz im Gegensatz dazu stand der Leiter der Marketingabteilung, ein guter Bekannter von ihm, den er mit ins Unternehmen gebracht hatte, sehr hoch im Kurs, weil er es im wahrsten Sinne des Wortes verstand, dem Unternehmen und seinen Produkten nach innen und nach außen mit stets neuen und auf den ersten Blick sehr beeindruckenden Zahlen, Grafiken und Texten in edelsten Werbebroschüren einen glänzenden Eindruck zu verleihen. Doch mit dieser Art von Unternehmenspolitik würde unser Laden die nächsten zehn Jahre nicht überstehen, dessen war ich mir sicher. Aber unser Geschäftsführer hatte eindeutig nur seine persönliche Karriere im Sinn, die ihn mit Sicherheit nicht länger als seine Vertragszeit von fünf Jahren im Unternehmen halten würde, damit er sich dann neuen und für ihn möglichst noch lukrativeren Aufgaben an anderer Stelle widmen könnte. Innerhalb von fünf Jahren kann man aus einem Unternehmen bilanzmäßig zwar einiges an vordergründigem Erfolg für die Eigentümer und Aktionäre herauskitzeln, was ihm allerdings mittel- bis langfristig das Genick brechen wird. Aber bis dahin war dieser feine Herr, den es nicht im Geringsten interessieren wird, dass er letztlich einen Scherbenhaufen zurücklassen wird und viele Beschäftigte sich eines Tages auf der Straße wiederfinden werden, sicherlich längst über alle Berge. Mittlerweile trieb er schon im dritten Jahr sein Unwesen. Einige unserer besten Führungskräfte hatten daraus bereits ihre Konsequenzen gezogen und das Unternehmen verlassen. Auch ich hätte am liebsten alles stehen und liegen lassen, doch mit Ende Fünfzig irgendwo anders noch einmal von vorne anfangen, sofern man mir überhaupt noch eine Chance eingeräumt hätte, das wollte ich auch nicht und vertröstete mich damit, dass er so oder so spätestens in zwei oder drei Jahren abgelöst werden würde. Aber ich war bereits jetzt auf einem absoluten Tiefpunkt. Nervlich und seelisch dauerbelastet suchte ich daher in letzter Zeit gerne den Stadtpark unweit von unserem Betrieb auf, um wenigstens für kurze Zeit frei durchatmen und auf andere Gedanken kommen zu können, bevor ich mich wieder in die mittlerweile verhasste Tretmühle begab. Doch das gelang mir heute beim besten Willen nicht, jedenfalls nicht, so lange dieser dreiste Kerl auf der Bank neben mir saß und mir die heiß ersehnte Ruhe und Einsamkeit raubte. Aus den Augenwinkeln sah ich, wie er umständlich in den Taschen einer speckigen alten Jacke kramte, eine Tüte mit Brotresten hervorzog und ein paar Krümel mitten auf den Gehweg warf. Im Nu waren wir von einer Schar Tauben umringt, die sich laut gurrend und pickend über die Krümel hermachten, während er ihnen immer wieder etwas nachwarf.
Dieser Kerl nervte mich derart, dass ich mich zu ihm hindrehte und sagte: „Hier ist das Taubenfüttern verboten.“
„Nein, das stimmt nicht“, erwiderte er, schüttelte den Kopf dabei und warf unverdrossen weiter Brosamen auf den Boden.
So eine unverschämte Reaktion hätte ich nicht erwartet, nicht einer Frau wie mir gegenüber, obwohl er bestimmt noch ein paar Jahre älter war als ich. Vielleicht Mitte sechzig, wie ich aus seinen Lachfalten um die Augen und dem grauen Bart schloss. Aber ich würde mir schon Respekt verschaffen, denn darin war ich berufsbedingt sehr geübt. Ich schnaufte förmlich vor Wut. „Natürlich stimmt das, haben Sie denn das Schild dort drüben nicht gelesen?“, gab ich zurück und zeigte demonstrativ in Richtung Parkausgang in der Hoffnung, dass ich ihn damit verunsichern könne.
Wieder schüttelte er den Kopf. „Nein, aber dort ist auch kein Schild, das wissen Sie ganz genau.“
Ich war außer mir vor Rage, denn mit forsch vorgetragenen Behauptungen, die ich mir notgedrungen im Laufe der Jahre angewöhnt hatte, um mich gegenüber manchen Kollegen und vor allem gegenüber meinem Geschäftsführer behaupten zu können, hatte ich durchaus auch Erfolg, selbst wenn sie manchmal völlig aus der Luft gegriffen waren. Doch bei diesem Typen schienen sie wirkungslos zu verpufften. „Natürlich ist da ein Schild, ich bin ja nicht blind“, fuhr ich ihn an.
„Nein, blind sind Sie nicht, aber Sie lügen.“
Ich rang förmlich nach Luft. Noch nie hatte ein Mann gewagt, so mit mir zu reden, selbst der Geschäftsführer nicht. „Ich lüge? Was erlauben Sie sich eigentlich einer Dame gegenüber, Sie alter Kn...“ Ich schluckte das Schimpfwort in letzter Sekunde hinunter. „Lassen Sie mich endlich in Ruhe hier alleine sitzen und verschwinden Sie, sonst rufe ich die Polizei“, herrschte ich ihn an.
„Wozu? Dafür gibt es doch überhaupt keinen Grund“, sagte er und lächelte mich freundlich an.
„Und ob, weil ... weil Sie hier verbotenerweise Tauben füttern und mich der Lüge bezichtigen, darum.“
„Womit ich die Wahrheit sage“, erwiderte er mit stoischer Ruhe und fütterte weiter die Tauben, die immer dann, wenn ich etwas zu laut wurde, erschreckt aufflatterten, um sich dann aber gleich wieder vor unserer Bank niederzulassen.
„Also so etwas. Das muss ich mir von Ihnen nicht bieten lassen“, schnaufte ich, packte meine Handtasche, sprang grußlos auf und ging hastig in Richtung Parkausgang.
Kapitel 2: Fundsache
Am nächsten Abend läutete es bei mir an der Wohnungstür. Ich lag auf der Couch und sah mir eine dieser permanent über den Bildschirm flimmernden Quizsendungen an, bei der irgendwelche Kandidaten von irgendwelchen Moderatoren irgendwelche uninteressanten Fragen gestellt bekommen und dabei einen Haufen Geld gewinnen können, falls sie darauf die richtigen Antworten parat haben. Das Ganze interessierte mich überhaupt nicht, aber ich brauchte einfach ein bisschen Ablenkung, Ablenkung von einem ziemlich beschissenen Tag, an dem ich mir mal wieder vom Geschäftsführer für die Uneffizienz meiner Abteilung einen unqualifizierten Anschiss eingehandelt hatte. Außerdem war mir meine Brieftasche mit wichtigen Dokumenten abhanden gekommen. Ausweise, Führerschein, Kreditkarten, alles weg. Nicht nur das, obwohl ich sonst relativ wenig Bargeld bei mir habe, waren ausgerechnet diesmal über fünftausend Euro in der Brieftasche, weil ich mir bei einem dubiosen Schmuckhändler in einer kleinen Nebenstraße eine teure Designeruhr hatte zurücklegen lassen, die normalerweise weit über das Doppelte gekostet hätte. Er würde das Geschäft nur gegen Bargeld mit mir machen, hatte er mir am Tag vorher gesagt. Warum, das war unschwer zu erraten, aber das war mir auch völlig egal. Ich hatte krampfhaft überlegt, wo ich die Brieftasche verloren haben könnte und nachmittags vergeblich noch mehrere Geschäfte abgeklappert. Doch dann war mir dieser komische Alte auf der Parkbank wieder eingefallen. Bestimmt hatte er die Gelegenheit genutzt, mir die Brieftasche zu klauen, während er neben mir saß und mich wohl mit Absicht so provoziert hatte, dieser Mistkerl. Jetzt wollte ich nur noch meine Ruhe haben und ignorierte das Läuten, doch wer auch immer vor meiner Tür stand, er hörte einfach nicht auf damit. Irgendwann platzte mir der Kragen. Ich sprang wie von einer Tarantel gestochen auf und öffnete völlig entnervt die Tür. „Verdammt noch mal, können Sie nicht endlich mit dieser Klingelei ...“ Dann verschlug es mir fast die Sprache, denn vor mir stand der Alte, an den ich gerade gedacht hatte, und nickte mir freundlich zu. Er trug die gleiche Jacke wie am Vortag. Seinen Kopf zierte eine für sein Alter viel zu bunte Wollmütze von einem bekannten Bundesligaverein hier aus der Region. Er war größer, als ich ihn vom Vortag noch in Erinnerung hatte, als er neben mir auf der Bank saß. Sein wettergegerbtes schmales Gesicht wurde von einem relativ kurz geschnittenen grauen Bart eingerahmt, der ihm den Anblick eines verwegenen, wenn auch in die Jahre gekommenen, Freigeistes verlieh. So schien es mir jedenfalls.
„Tut mir leid, wenn ich Sie gestört habe, aber ...“
„Was wollen Sie denn hier und woher zum Teufel wissen Sie, wo ich wohne?“, fauchte ich ihn an.
„Das war kein Problem, denn die Adresse steht auf Ihrem Ausweis, Frau Behrmann“, erwiderte er und hielt mir meine Brieftasche entgegen.
Ich starrte ihn völlig entgeistert an. Blitzschnell schoss mir durch den Kopf, dass mein Verdacht gegen ihn offenbar völlig richtig war und dass er jetzt vermutlich versuchte, als ehrlicher Finder bei mir einen kräftigen Finderlohn zu kassieren.
„Oh, wo haben Sie die denn gefunden?“, versuchte ich, mit dieser zugegebenermaßen etwas dümmlichen Bemerkung mehr Zeit zum Überlegen zu gewinnen, weil ich einfach nicht wusste, wie ich mich jetzt verhalten sollte. Das Bargeld hatte ich in Gedanken schon abgeschrieben, zum größten Teil jedenfalls.Vielleicht hat er anstandshalber noch ein paar Euro drin gelassen, damit es nicht so auffällt,dachte ich. Aber egal, die Hauptsache für mich war, wenigstens die ganzen Ausweispapiere wieder zu bekommen.
„Sie sollten aber nicht so viel Geld mit sich herumtragen“, ermahnte er mich.
Ich war völlig perplex, denn eine solche Reaktion hatte ich nicht erwartet.
„Oh ja, Sie haben Recht, aber offen gestanden weiß ich gar nicht mehr so ganz genau, wie viel Geld ich gestern dabei hatte.“ Im gleichen Moment schoss mir durch den Kopf, dass ich ihm mit dieser nicht weniger blöden Bemerkung eine hervorragende Gelegenheit bot, mich übers Ohr zu hören. Daher schob ich rasch nach: „Halt, jetzt fällt es mir wieder ein. Es müssten etwa ...“
„Es sind genau fünftausendzweihundertundfünfzig Euro in Scheinen, das Kleingeld habe ich aber nicht nachgezählt“, unterbrach er mich.
Der Betrag stimmte exakt. Ich war sprachlos.
„Kontrollieren Sie bitte nach, ob es stimmt“, forderte er mich auf.
„Um Himmels Willen, nein. Ich bin Ihnen wirklich sehr dankbar, dass ich alles wieder habe“, erwiderte ich und schämte mich ein bisschen, weil ich ihm offensichtlich Unrecht getan hatte. Aber hatte ich das wirklich? Vielleicht war er auch nur auf einen kräftigen Finderlohn aus, der ihm formal ja auch zustand. Wie viel, das wusste ich nicht so genau, aber ein paar hundert Euro würden es bestimmt sein. Ich überlegte kurz, nahm aus der Brieftasche die zweihundertfünfzig Euro und wollte sie ihm in die Hand drücken. Doch er wehrte ab. „Nun nehmen Sie es schon, denn den Finderlohn haben Sie sich redlich verdient, und ich denke, Sie können es auch ...“
„Ganz gut gebrauchen, das wollten Sie doch bestimmt sagen“, unterbrach er mich und lächelte.
„Ja, äh nein. Oh Mann, es ist wirklich nicht einfach, mit Ihnen zu kommunizieren“, stöhnte ich.
Er lächelte etwas verlegen. „Vermutlich haben Sie Recht. Ich hab ´s wohl ein bisschen verlernt im Laufe der Zeit. Aber der Finderlohn wäre ohnehin nicht so hoch, höchstens einhundertfünfzig Euro, glaube ich.“
„Aber mir ist Ihre Ehrlichkeit zweihundertfünfzig Euro wert. Nun nehmen Sie sie schon.“
Wieder schüttelte er den Kopf.
„Na schön, dann eben nur einhundertfünfzig“, sagte ich und steckte den zweiten Hunderten wieder ein.
„Nein“, sagte er. „Es ist Ihr Geld und für mich war es eine Selbstverständlichkeit, es Ihnen zurückzubringen.“
„Sie sind ein Sturkopf, aber das bin ich auch, und für mich ist es genau so eine Selbstverständlichkeit, mich bei Ihnen dafür gebührend zu bedanken.“
„Das haben Sie ja gerade getan, und das reicht vollkommen. Sie können mich schließlich nicht dazu zwingen, es anzunehmen.“
Der Alte ist wohl ein bisschen verrückt, so etwas gibt es doch gar nicht, dachte ich.
„Ich bin nicht verrückt“. sagte er wie auf Kommando, was mir unerklärlicherweise etwas Schamröte ins Gesicht zauberte, eine Reaktion, unter der ich in den Teenagerjahren durchaus öfter zu leiden hatte, aber doch nicht heute, fast vierzig Jahre später.
„Keine Angst, ich bin wirklich kein Hellseher, aber dieser Gedanke stand Ihnen förmlich auf die Stirn geschrieben“, fuhr er lächelnd fort.