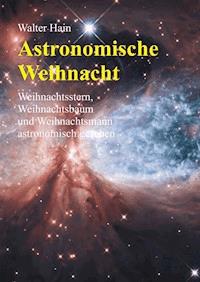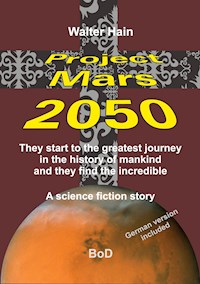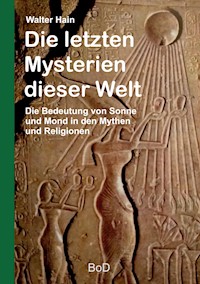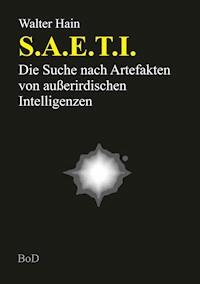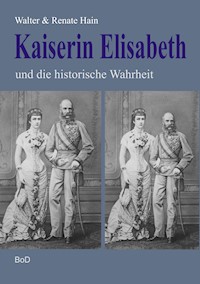
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In den vergangenen Jahren versuchten Historikerinnen, Buchautoren und Dokumentarfilmer ein anderes Bild von Sisi, der schönen Kaiserin von Österreich, zu zeichnen. Manchmal hatte man den Eindruck, sie wollen das gängige Bild zu Fall bringen. Einige sind sogar der Ansicht man muss die Geschichte umschreiben. Was stimmt nun? Hatte Sisi Liebesaffären? Hatte sie geraucht? Hatte sie im Alter ein künstliches Gebiss? War sie magersüchtig? War sie drogensüchtig? War sie bisexuell veranlagt? Gibt es ein Aktfoto von Sisi? Hatte sie einen politischen Einfluss auf den Kaiser? Hatte sie sich sozial engagiert? Und war ihre Schwiegermutter, Erzherzogin Sophie, gar nicht so böse? Und hieß Sisi eigentlich "Lisi"? Die Autoren beschäftigen sich schon seit vielen Jahren mit dem Leben der Kaiserin und versuchen der wirklichen Wahrheit auf den Grund zu gehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 585
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ich wollt', die Leute ließen mich, In Ruh' und ungeschoren, Ich bin ja doch nur sicherlich, Ein Mensch, wie sie geboren, Kaiserin Elisabeth "An die Gaffer", Winterlieder, Ischl 1887.
Für wertvolle Hilfe danken wir: Claus Christian Niesel, Oberbayern, Dr. Ingrid Haslinger, Wien, den Mitarbeitern des Haus-, Hof- und Staatsarchivs, Wien, den Kuratoren des Sisi-Museums, Wien und den Mitarbeiterinnen des Kaiserin-Elisabeth-Museums, Possenhofen.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Elisabeth, das Kind
Eine uneheliche Geburt?
München oder Possenhofen?
Das Erbe des Vaters
Das Erbe der Mutter
Die Liesl von Possenhofen
Helene oder Sisi?
Eine Braut für den Kaiser
Ein Treffen in Ischl
Nur noch Sisi!
"Wenn er nur kein Kaiser wäre!"
Elisabeth, die Kaiserin
Verlobung in Ischl
Abschied von Possenhofen
Vorbereitung zur Hochzeit
Ehevertrag und Hochzeitstag
Die Erzherzogin bestimmt
Abreise von München
Die Braut in Wien
Einzug in die Hofburg
Die Hochzeit
Elisabeth, die Gefangene
Die junge Kaiserin
Die Hochzeitsnacht
In einem goldenen Käfig
Eine Kaiserin muss repräsentieren
Die ersten Feinde
Erste Auflehnung
Erste Einsamkeit
Elisabeth, die Mutter
Die erste Geburt
Die zweite Geburt
Der Kampf gegen die Schwiegermutter
Die erste Reise nach Italien
Das Kaiserpaar in Ungarn
Der Tod des ersten Kindes
Die dritte Geburt
Ein Thronfolger
Marie und Ludwig
Krieg in Italien
Elisabeth, die Flüchtende
Die Flucht 1860
Hungerkuren und Nervenkrisen
Elisabeth auf Madeira
Zurück in Wien
Elisabeth auf Korfu
Sisi in Venedig
In Reichenau an der Rax
Wieder in Possenhofen
Die Kaiserin wieder in Wien
Noch ein Thronfolger?
Elisabeth, die Selbstbewusste
Das Ultimatum
Elisabeth setzt sich durch
Erste Kontakte mit den Ungarn
Krieg gegen die Preußen
Erstes Gespräch mit Andrássy
Andrássy und Deák beim Kaiser
Elisabeth und die Ungarnsache
Der Ausgleich mit Ungarn
Elisabeth, die Königin
Die Krönung in Ungarn
Das vierte Kind
Elisabeth gegen den Hof
Die verhasste "Kerkerburg"
Eine intime Angelegenheit
In Krankenhäusern und Irrenanstalten
"Der Wald tut mir nicht weh!"
Der Tod der Erzherzogin
Die scheue Kaiserin
Immer die "Etiquette"
Wieder auf der Flucht
Die seltsame Frau
Elisabeth, die Rastlose
Elisabeth in Gödöllö
Flirt mit einem Ballbesucher
Die Kaiserin hinter der Meute
Ein Geldsegen und ein Reitunfall
Ein Todesfall und ein neuer Reitpilot
Ein Konflikt in England
Eine strahlende Kaiserin
Die Silberhochzeit
Das Ende der Jagdausflüge
Unruhen in Triest und eine eilige Kaiserin
Elisabeth, die Nachdenkliche
Elisabeth und die "Zukunfts-Seelen"
Elisabeth, die Dichterin
Elisabeth in Griechenland
Das Tagebuch der Kaiserin
Ein Denkmal für den Meister
Trauer und Todesfälle
Die Irrfahrten der Kaiserin
Melancholie und Traurigkeit
Elisabeths Tod
Der Nachlass der Kaiserin
Elisabeth und die historische Wahrheit
Elisabeth und Erzherzogin Sophie
Elisabeth und Kronprinz Rudolf
Elisabeth und Katharina Schratt
Elisabeth und König Ludwig II.
Elisabeth und ihr "Schönheitskult"
Elisabeth und das Rauchen
Elisabeth und ihre Zähne
Elisabeth und der Aktfoto-Skandal
Das letzte Foto von der Kaiserin
Sisi, genannt auch "Lisi"
Elisabeth und ihre Brillantkrone
Elisabeth und ihre Hunde
Elisabeth und ihre Pferde
Sisi in Film und Musical
Sissi / Sissi – Die junge Kaiserin / Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin, Ernst Marischka
Erster Teil
Zweiter Teil
Dritter Teil
Zusammenfassung
Sisi, Xaver Schwarzenberger
Erster Teil
Zweiter Teil
Zusammenfassung
Elisabeth – Das Musical, Sylvester Levay & Michael Kunze
Erster Akt
Zweiter Akt
Zusammenfassung
Sisi ... und ich erzähle euch die Wahrheit, Mario Vinci
Erfolg
Andere Filme
Sisi im Theater
Zusammenfassung
Quellenverzeichnis
Andere Quellen
Zeitungen und Zeitschriften
Filme und Film-Dokus
Im Internet
Bildquellen
Vorwort
Es gibt zahlreiche Bücher und Biographien über das Leben der Kaiserin Elisabeth von Österreich, genannt auch "Sisi". Doch was ist Wahrheit, was Legende, was Mythos. Mehrere Spielfilme und TV-Dokumentationen tragen ebenso dazu bei, ein Bild der Kaiserin Elisabeth zu zeigen, das noch immer kontrovers und nicht ganz geklärt ist. Fast jede Neuerscheinung will die "Wahrheit" für sich beanspruchen. Wahrscheinlich gibt es keine endgültige Wahrheit über die Person Kaiserin Elisabeth von Österreich. Wer kann schon wirklich wissen, was und wie sie wirklich gefühlt hat; was ihre tatsächlichen Neigungen, ihre Absichten, ihre Interessen waren. Sisi war wohl weder die Märchenprinzessin, die viele in ihr sehen wollen, noch die ewig Todessehnsüchtige.
Das allgemeine Interesse an Sisi brach zweifelsohne auf nach der Marischka-Trilogie mit Romy Schneider in den Jahren 1955, 1956 und 1957. Viele fragten sich, wie die Kaiserin wirklich war und ob das alles stimmt, was da filmisch gezeigt wird. Zahlreiche Fans wollten Näheres über die Kaiserin "Sissi" (mit zwei "s" geschrieben in den Filmtiteln) wissen. Vor allem die praktisch gleichaltrige Romy Schneider, in den Anfängen der Verlobung mit Kaiser Franz Joseph und des späteren Hoflebens, begeisterte die Zuseher. Die drei Filme hatten demnach auch die entsprechend hohen Zuschauerquoten in vielen Ländern der Welt. Das ungestüme, in ländlicher Idylle aufgewachsene Mädchen gegen das strenge, ordnungsliebende Hofzeremoniell. Ein Märchen wie "Cinderella" ("Aschenputtel") war geboren. Die böse Schwiegermutter gegen ein unbeholfenes junges Mädchen. Doch war es wirklich so? Einige meinen nun neuerdings "nein".
Seit dem 100. Gedenkjahr des Todes der Kaiserin, dem Jahr 1998, hat die Titelflut literarischer Werke und filmischer Produktionen stark zugenommen. Einen wesentlichen Beitrag zum Bekanntheitsgrad und zum öffentlichen Interesse an der Kaiserin hat auch das Musical „Elisabeth“ von Sylvester Levay geleistet, uraufgeführt im Jahr 1992 im Theater an der Wien. In der Wiener Hofburg wurde im Jahr 2004 ein Sisi-Museum eingerichtet, mit unglaublich schönen Exponaten. Die "wahre Sisi" sollen alle sehen, in millionenfacher Schaulust – mit andächtigem Gang durch dunkle und mystisch anmutende Räume und anschließendem Kuchen und Kaffee im nahen Kaffeehaus der Hofburg. Sisi hautnah und niemals vergessen. Ein Erlebnis, das sich einprägsam in den Köpfen der Betrachter der schönen Dinge um die Kaiserin verewigen soll.
Und auch der Kitsch – kritisch dargestellt im Musical von Sylvester Levay – nimmt seinen gewohnten Lauf. Sisi auf Tellern und Tassen, auf Schachteln von Süßigkeiten, auf Tüchern und Decken, auf T-Shirts, auf Einkaufssackerln. Sisi als Schlüsselanhänger, als Magnetkleber und als süßes Entchen – natürlich alles mit dem obligaten Sternchen-Image. Kinder verkleiden sich als Sisi und man kann sie auch mit Hilfe von Bastelbögen ausschneiden und stilgerecht einkleiden und bemalen. Einmal Prinzessin sein, das ist der Traum vieler Kinder und pubertierender Mädchen. Sisi, die schöne aber auch umstrittene Kaiserin muss dafür herhalten – fast bedingungslos.
So wundert es nicht, dass gewisse Kuratorinnen und Historikerinnen einen Aufschrei starteten und verkündeten "es ist alles nicht so gewesen" oder "es war ganz anders". Sie schrieben Bücher mit Untertiteln wie "Wahrheit und Legende" oder "Mythos und Wahrheit", immer auf der Spur des Tatsächlichen. Oder was man so dafür hält. Man unterstellt der Kaiserin heimliche Liebschaften, stellt sie als drogensüchtige, eigensinnige, als ewig traurige und melancholische, stets dem Selbstmord nahe Person dar. Oft auch als eine ihren Vergnügungen rücksichtslos nachgehende Kaiserin, die ihren Pflichten nicht nachgekommen ist und den Kaiser im Stich gelassen hat. Auch Verschwendungssucht wird ihr unterstellt, und manche Psychologen und Psychologinnen sehen in ihr sogar eine bi- oder homosexuelle Neigung und ein "Sisi-Syndrom".
Auch das erwähnte Musical "Elisabeth" will die Wahrheit für sich beanspruchen. Letztendlich meinte eine Autorin, man müsse die Geschichte umschreiben, weil ihre Schwiegermutter, Erzherzogin Sophie, eigentlich gar nicht so böse war. Andere folgten ihr blind mit dieser zweifelhaften Ansicht. Die Person Kaiserin Elisabeth wird man nicht vollends erklären können, doch man kann sich der Wirklichkeit weitgehend nähern. Es gibt zum Glück gute Biographien, die unvoreingenommen ein Bild zeichnen, aus dem man schöpfen und die sprichwörtliche Spreu vom Weizen trennen kann. Und wenn man sich lange genug mit dem Leben der Kaiserin beschäftigt hat, Biographien und andere Druckwerke gelesen hat, und auch sonst objektiv die öffentliche Meinung über die Kaiserin "Sisi" verfolgt hat, dann ist es heute durchaus möglich der historischen Wahrheit weitgehend auf den Grund zu kommen. Durch diverse neue Veröffentlichungen ist es heute sogar notwendig, das Bild etwas zurechtzurücken, damit sich Unwahrheiten nicht wiederholen. Man kann heute, durch die Fülle des literarischen Materials, durchaus zu einem Bild kommen, das in größter Annäherung der Wirklichkeit entspricht. Man muss nicht das Rad neu erfinden. Die Kaiserin selbst wollte einmal von den "Zukunfts-Seelen" verstanden werden. Wohl auch deshalb hatte sie heimlich Gedichte geschrieben und sie den Menschen in ferner Zukunft gewidmet.
Walter & Renate Hain Wien, im Mai 2015
Elisabeth, das Kind
Eine uneheliche Geburt?
Die Spekulationen beginnen schon mit der Geburt der kleinen Sisi. Der Münchner Autor Rudolf Reiser ("Das andere Bild von Sisi") deutet an, dass Elisabeth vielleicht gar nicht die Tochter von Herzog Max in Bayern war. Dem umtriebigen Herzog schreibt man mehrere uneheliche Verhältnisse zu, deren Folge das Kind Elisabeth gewesen sein soll. "Man redet in München ganz offen über solche Beziehungen und die Tatsache, dass Frau Kuckuck ihre Eier in fremde Nester legt. Jeder weiß, was damit gemein ist", so der Autor (S. →).
Schon die Charakterzüge der späteren Kaiserin, wie ihre Liebe zur Natur und ihren Freiheitsdrang, lassen aber an derartigen Spekulationen stark zweifeln und sie eigentlich als unsinnig erscheinen. Sogar äußerlich sind sich Herzog Max und Elisabeth ähnlich. "Wenn man das Bild des Herzogs Max betrachtet, so stellt man bei ihm die gleiche Augenstellung fest wie bei Elisabeth. Sonst aber gleicht sie eher der Mutter. Und wenn auch Ludovika nie die Schönheit ihrer Töchter besessen haben mag, das feine Oval des Gesichtes, den schön geschwungenen Mund mit den zarten Lippen hat Sisi von der Mutter", (Thiele, Elisabeth, S. →f.)
"Ihr Charme hingegen kommt eindeutig vom Vater. Und wie er unterhält sie sich gerne mit den einfachen Dorfleuten. Gelegentlich sitzt sie mit dem Herzog an den Tischen der Bauern, hört den Vater Zither spielen und zu selbstverfassten Reimen singen. Sisi erbt seine künstlerischen Ambitionen, auch die Neigung zu ruhelosem Umherschweifen."
Obwohl Herzog Max "seinen legitimen Kindern im allgemeinen weniger Beachtung schenkt als seinen außerehelichen Sprösslingen", ist "Sisi eine Tochter nach seinem Geschmack, mit einem ähnlichen Naturell und Charakter, mit den gleichen Neigungen zum ungebundenen Leben, mit dem gleichen warmen Sinn für die Natur und dem gleichen Widerwillen gegen Konventionen und Heuchelei. Doch Herzog Max erzieht seine Tochter nicht, er ist ihr gegenüber eher wie ein Kamerad und Freund".
Zu all dem gibt es keine historischen Belege für eine außereheliche Geburt Sisis und eine Spekulation damit ist als absurd zu betrachten.
München oder Possenhofen?
Als Sisis Geburtsort wird manchmal das Schloss Possenhofen, in Feldafing, erwähnt, doch tatsächlich kam sie in München, im Herzog-Max-Palast zur Welt. Feldafing liegt etwa 24 Kilometer entfernt von München, am Starnberger See, dem damaligen Würmsee, und dort verbrachte die Familie die Sommerzeit. Das Schloss Possenhofen war Sisis Lieblingsschloss; sie nannte es liebevoll "Possi". Dahin flüchtete sie manchmal als Kaiserin, wenn sie genug von den höfischen Pflichten oder gar Streit mit ihrer Schwiegermutter hatte – was manche bezweifeln, aber dazu später.
Sisi wurde am 24. Dezember 1837 als Elisabeth Amalie Eugenie geboren. Sie war die zweite Tochter des Herzogs Max in Bayern (1808-1888). Die erste Tochter war Helene, geboren am 4. April 1834, davor gab es einen Sohn namens Ludwig Wilhelm, der am 21. Juni 1831 geboren wurde. Herzog Max hatte noch sieben weitere Kinder, wovon zwei im ersten Lebensjahr verstorben sind: Wilhelm Karl 1832 und Maximilian 1845. Somit hatte Sisi noch sieben Geschwister: Ludwig Wilhelm (1831-1920), genannt Louis; Helene Karoline Therese (1834-1890), Nené genannt; Carl Theodor (1839-1909), liebevoll "Gackel" genannt; Marie Sophie Amalie (1841-1925); Mathilde Ludovika (1843-1925), der "Spatz"; Sophie Charlotte Auguste (1847-1897) und Max Emanuel (1849-1893) genannt "Mapperl".
Das Erbe des Vaters
Um zu verstehen woher Sisi ihre Eigenheiten, ihren Freiheitsdrang und ihre Reiselust hatte, muss man sich etwas näher mit ihrem Vater Herzog Max beschäftigen. Sisi hatte nämlich tatsächlich viele seiner Eigenschaften von ihm geerbt. Die Kindheit verbrachte sie zunächst weitgehend unbeschwert in familiärer und nahezu ländlicher Idylle. Ihr Vater war der Sohn von Herzog Pius August in Bayern (1786-1837) aus dem Hause Wittelsbach. In seinem prunkvollen Palais in der Luwigstraße, in München, gab es ein Sing-Café (Caféchantant, auf Bayrisch ein "Brettl") und eine Zirkusarena, wo der begeisterte Reiter seinen Gästen Kunststücke vorführte oder sich als Clown verkleidete. Herzog Max war es zu verdanken, dass die zuvor als "Lumpeninstrument" angesehene Zither auch in höfischen Kreisen einen Stellenwert erhalten hatte. Sein Lehrer war der bekannte Zithervirtuose Johann Petzmayer. Auch Sisi versuchte vielleicht ein wenig Zither zu spielen. Ihr Vater, der wegen seiner Leidenschaft als Zither-Spieler "Zither-Maxl" genannt wurde, komponierte auch Musikstücke für dieses Instrument. Durch Herzog Max wurde die Zither quasi zum bayrischen Nationalinstrument.
Herzog Max "war der populärste Wittelsbacher" seiner Zeit. "Er hielt gar nichts von Etikette, umgab sich vielmehr mit einem Kreis bürgerlicher Gelehrter und Künstler in seiner berühmten 'Artusrunde" (Hamann, Elisabeth, S. →). Es wurde viel getrunken, gedichtet, komponiert und gesungen, vor allem bayrische "Schnadahüpfl" und sogenannte "Leberreime" (Corti, Elisabeth, S. →):
Die Leber ist von einem Hecht,
und nicht von einem Kater,
Laßt's schmecken euch gar fein und wohl
beim neuen Schwiegervater.
Im Jahr 1846 gab Herzog Max seine "Sammlung oberbayerischer Volksweisen und Lieder heraus" (Hamann, S. →).
Der Herzog interessierte sich aber auch für Literatur und das Theater; unter dem Pseudonym "Phantasus" veröffentlichte er zahlreiche Skizzen und Dramen. Wie sich später gezeigt hat, hatte auch Sisi einen Hang zum Theater und sie konnte auch zeichnen. Für die Kinder hatte sich der Herzog allerdings nicht besonders interessiert und er hielt auch nicht viel vom Familienleben. Sisi war aber seine Lieblingstochter. Er reiste in der Weltgeschichte herum und frönte der Jagdleidenschaft, was ebenfalls die junge Elisabeth beeinflusst hatte.
Von Jänner bis September 1838 machte der Herzog eine ausgedehnte Reise nach Venedig, Korfu, Patras, Athen, Alexandria und Kairo, wo er auf der Cheops-Pyramide Zither spielte. 1839 wurde er zum Ehrenmitglied der Bayrischen Akademie der Wissenschaften erklärt.
Seine Ehe verlief nicht harmonisch und glücklich; erst kurz vor der goldenen Hochzeit (1878) söhnte er sich mit seiner Gemahlin Ludovika aus und verbrachte mit ihr die letzten Ehejahre in friedlicher Zweisamkeit. Als er am 15. November 1888 verstarb, reisten Kaiser Franz Joseph und Kronprinz Rudolf zur Beerdigung an, nicht jedoch Elisabeth, die sich zur Erholung auf Korfu aufhielt.
Das Erbe der Mutter
Die Mutter von Elisabeth wurde als Tochter des bayrischen Königs Maximilian I. Joseph (1756-1825), in zweiter Ehe, aus einer Seitenlinie der Wittelsbacher, als Maria Ludovika Wilhelmine am 30. August 1808 geboren. Der spätere bayrische König Ludwig I. war ihr Halbbruder. Schon als Kind musste Ludovika am Hofleben ihrer Eltern teilnehmen, Theaterbesuche machen, Klassiker lesen, Geographie und Geschichte studieren, Deutsch und Französisch lernen und sich an die Hofetikette gewöhnen. Auch das hatte Sisi beeinflusst. Durch die Heirat mit Herzog Maximilian in Bayern, Herzog Max, wurde Elisabeths Mutter zur Herzogin in Bayern.
Gewöhnlich ist sie als Ludovika bekannt, sie wurde aber auch Luise und "Mimi", die Koseform für Wilhelmine, genannt. Ludovika verliebte sich zunächst in einen portugiesischen Prinzen, der aber von ihren Eltern nicht erwünscht war. Sie musste gegen ihren Willen den Herzog in Bayern heiraten, weil ihre Schwester Maximiliane – die dem Herzog bereits versprochen war – schon in jungen Jahren, vor Zustandekommen einer Verlobung, verstorben war. Auch Herzog Max selbst, der ebenfalls diese Beziehung eingehen musste, war davon nicht begeistert, weil sie ihm politische Verpflichtungen auferlegte, die ihm seine Freiheit raubten. Nach der Hochzeitsfeier am 9. September 1828 auf Schloss Tegernsee sprach Ludovika einen Fluch aus: "Dieser Ehe und allem, was daraus hervorgeht, soll der Segen Gottes fehlen bis ans Ende".
In den ersten Ehejahren machte sie mit ihrem Gemahl Herzog Max ausgedehnte Reisen in die Schweiz und nach Italien. Durch die reiche Hinterlassenschaft seiner Mutter, Amalie Luise von Arenberg (1789-1823), konnte sich der Herzog ein eigenständiges Leben ohne höfische Verpflichtungen leisten. Im Jahr 1834 erwarb er das Schloss Possenhofen am Starnberger See, das fortan der Familie als Sommersitz diente. Während der Herzog seinen Vergnügungen nachging, kümmerte sich Ludovika pflichtbewusst um den Haushalt und die Kinder. Um doch noch in die Nähe des österreichischen Kaiserhauses zu kommen, spekulierte sie bald mit der Verheiratung einer ihrer Töchter an den Wiener Hof.
Ludovika "liebte das Land und die freie Natur, kümmerte sich nicht um standesgemäße Kleidung und standesgemäße Gesellschaft. Vor dem Wiener Hof hatte Ludovika Angst. Auch mit dem Münchner Hof hatte sie wenig zu tun. Dort herrschte ihr Neffe Max II., und die herzogliche Linie der Wittelsbacher hatte keine offizielle Funktion. Ludovika war also keine höfische Repräsentationsfigur, sondern reine Privatperson. Sie lebte für ihre Kinder, die sie selbst erzog – für aristokratische Verhältnisse außergewöhnlich" (Hamann, S. →).
Ludovika starb schließlich als Herzogin-Witwe am 26. Jänner 1892, in München als letztes Mitglied der Familie des ersten bayrischen Königs Maximilian I. Drei Jahre zuvor starb ihr Enkelsohn, Kronprinz Rudolf, durch Selbstmord in Mayerling und sieben Jahre später sollte Elisabeth einem Attentat zum Opfer fallen. Der "Segen Gottes" fehlte der Familie in vielen Lebenslagen. Und auch Sisi sollte dieser Segen öfters fehlen.
Der älteste Sohn von Ludovika und Max, Ludwig Wilhelm, verzichtete auf sein Erstgeborenenrecht, um 1859 die bürgerliche Schauspielerin Henriette Mendel zu heiraten. Sie wurde in den Adelstand erhoben und zur Baronin von Wallersee ernannt. Seine Tochter Marie Louise Mendel wurde dadurch zur Marie Louise Freiin von Wallersee, und später zur Gräfin Larisch, die bei Sisi, wegen der Mayerling-Tragödie, in Ungnade fallen wird.
Sisi aber verlor im Alter von fünfzehn Jahren ihren Spielgefährten David Paumgarten, den kleinen Bruder ihrer liebsten Spielgefährtin und Freundin Irene, der nach einer Lungenentzündung starb (Corti, S. →). Das erste Mal musste sie dem Tod in die Augen sehen. In ihrer Trauer schrieb sie schmerzvoll ein Gedicht:
Du bist so jung gestorben,
Und gingst so rein zur Ruh';
Ach, wär', mit dir gestorben,
Im Himmel ich wie du.
Eine kleine Zeichnung illustriert das traurige Ereignis in ihrem Büchlein. "Ein Leichenzug tritt aus einem Tor, einzelne Gestalten gehen wie von einem Kinde aufgestellte Zinnsoldaten rechts und links vom Sarge einher", (Corti, S. →).
Aber bald schon schwärmte sie für einen jungen Mann namens Richard Graf von F., Graf F. R. oder Richard S., einem jungen Offizier am herzoglichen Hof, dem sie in ihrem Büchlein schwärmerisch ihre Liebe gestand. Niemand sollte davon erfahren. Sie schrieb bereits heimlich Verse und Gedichte von Liebe und Sehnsucht. Das Talent, das sie von ihrem Vater geerbt hatte. Ihre Mutter bemerkte jedoch ihr Verhalten dem Grafen gegenüber und verbat ihr jeglichen Umgang mit ihm. Für Sisi war etwas Besseres vorgesehen. Der Graf wurde vom Hofdienst entfernt und in die Ferne geschickt. Kurz darauf kehrte er jedoch zurück und auch er starb nach einer Krankheit (Corti, S. →; Hamann, S. →; Thiele, S. →f.) Wieder war der Tod in ihr noch so junges Leben getreten und wieder schrieb sie melancholisch:
Die Würfel sind gefallen,
Ach, Richard ist nicht mehr!
Die Trauerglocken schallen,
Oh, hab Erbarmen, Herr!
Sollte der Tod ihr ständiger Begleiter sein? Die Mutter machte sich Sorgen. Doch Sisi flüchtete zu ihren Pferden, streifte durch Wald und Flur und ihr Liebesleid und ihr Liebesschmerz verschwanden bald und waren zunächst vergessen, und sie wendete sich freudigen Dingen zu. Sie war ja noch sehr jung zu dieser Zeit.
Bild 1: Eigenhändige kolorierte Zeichnung von Elisabeth im Alter von 9 Jahren, signiert und datiert mit 1. Februar 1847 (Dorotheum Wien).
Die Liesl von Possenhofen
Der Starnberger Sisi-Sammler und Antiquar Paul Heinemann behauptete im Jahr 1998, dem hundertsten Gedenkjahr des Todes der Kaiserin, dass Sisi eigentlich "Lisi" hieß und auch mit diesem Namen unterschrieben habe. Vergleicht man – wie es Heinemann gemacht hat – ihr groß geschriebenes "S" und das "L", so zeigt sich deutlich eine Differenz. Die in ihrer Handschrift geschriebene Anrede in ihrem Vermächtnis "An die Zukunfts-Seele!" zeigt deutlich den Unterschied zwischen dem "L" bei "Liebe" und dem "S" bei "Seele". Das "L" besteht aus zwei großen Schleifen, während das "S" bei "Seele" nur eine große Schleife aufweist.
Nun zeigt aber das "S" in ihrer berühmten Unterschrift ebenfalls zwei große Schleifen, wie das "L" bei "Zukunfts-Seele". Das erhebt den dringenden Verdacht, dass Sisi eigentlich mit "Lisi" unterschrieben hatte. Der Antiquar Heinemann war sich da ganz sicher. Er stellte Schriftvergleiche an aus der Privatpost von Sisi und meinte, der Wiener Hof habe den Namen "Sissi" mit zwei "s" erfunden. Überdies nannte man Sisi in ihrer Kindheit in Possenhofen "Zopf-Liesl", wegen ihrer langen Zöpfe. Tatsächlich berichteten auch die Zeitungen aus dieser Zeit von der "Liesl" aus Possenhofen. "Liesl" ist ja die Koseform von "Elisabeth" im bayrischen und auch im österreichischen ländlichen Sprachraum
Der Kaiser nannte seine Gemahlin manchmal "Engels-Sisi", er schrieb aber eindeutig "Sisi" mit einem großen "S" davor und einem kleinen in der Mitte. Der bekannte Namenszug "Sisi", der in diversen Veröffentlichungen, in Ausstellungen, in Museen und auf Souvenirs verwendet wird, muss daher als „Lisi“ gelesen werden. Mehr dazu später.
Helene oder Sisi?
Dazu schreibt Brigitte Hamann: "Die Mutter Herzogin Ludovika war schon geraume Zeit auf der Suche nach einer passenden Partie für ihre zweite Tochter Elisabeth. Sie hatte schon vorsichtig und wenig zuversichtlich in Sachsen angefragt: 'Sisi bei Euch zu wissen, würde ich freilich als ein großes Glück ansehen … aber leider ist es nicht wahrscheinlich – denn der einzige, der zu hoffen wäre (wohl Prinz Georg, der zweite Sohn des sächsischen Königs Johann), wird schwerlich an sie denken; erstens ist sehr die Frage, ob sie ihm gefiele und dann wird er wohl auf Vermögen sehen … hübsch ist sie, weil sie sehr frisch ist, sie hat aber keinen einzigen hübschen Zug" (Hamann, S. →; nach einem Brief von Ludovika an ihre Schwester Marie von Sachsen am 7. April 1853). Sisi kam schließlich ohne eine Aussicht auf einen Bräutigam aus Dresden zurück.
Sisi war zu dieser Zeit, "ein kaum entwickeltes, noch längst nicht ausgewachsenes schüchternes Kind mit dunkelblonden langen Zöpfen, überschlanker Gestalt und hellbraunen, etwas melancholisch dreinblickenden Augen" (Hamann, S. →). Sie war wie ein Naturkind "aufgewachsen inmitten von sieben temperamentvollen Geschwistern, abseits jeden höfischen Zwanges. Sie konnte gut reiten, schwimmen, angeln, bergsteigen. Sie liebte ihre Heimat, vor allem die bayrischen Berge und den Starnberger See, an dessen Ufer das Sommerschlösschen der Familie, Possenhofen, lag. Sie sprach bayrischen Dialekt und hatte unter den Bauernkindern der Nachbarschaft gute Freunde. Ihre Bildung und ihre Umgangsformen waren dürftig. Wie ihr Vater und ihre Geschwister hielt sie nichts von Zeremoniell und Protokoll – was am Münchner Königshof aber nicht viel ausmachte. Denn der herzogliche Zweig der Wittelsbacher Familie hatte dort ohnehin keine offizielle Funktion, konnte sich also ein reiches Privatleben leisten".
Nachdem Sisi vorerst für eine Verheiratung nicht in Frage kam, legte Ludovika ihr Augenmerk auf ihre ältere Tochter Helene. Sie war gerade neunzehn Jahre alt geworden und wie geschaffen für eine hohe Stellung, für ein höfisches Leben, Sie war systematisch erzogen worden, sie sprach mehrere Sprachen, tanzte, sang und musizierte ausgezeichnet und hatte auch sonst Kenntnisse, die von einer künftigen Herrscherin verlangt wurden. Die Mutter hatte ihr das alles beigebracht, in Hinblick auf eine Heirat in höhere Kreise. Ludovika hatte immer eine solche Verbindung ins Auge gefasst. Helene sah außerdem gut aus, hatte gute Manieren und war damals wesentlich hübscher, fraulicher als Elisabeth, die eher als "hässliches Entchen" angesehen wurde. Im Alter von elf und zwölf Jahren hatte Sisi ein rundes Gesicht "ein Bauerngesicht", wie "ein Bauernmädchen, von Schönheit keine Spur" (Hamann, S. →; Corti, S. →). Jetzt, mit ihren fünfzehn Jahren, war sie zwar größer und weiblicher geworden, doch zeigte sie immer noch kindliche Züge und ein kindliches Verhalten. Elisabeth kam als Braut zu dieser Zeit nicht in Frage.
Eine Braut für den Kaiser
Im österreichischen Kaiserhaus machte sich aber auch Ludovikas Schwester, Erzherzogin Sophie, bereits Gedanken über eine mögliche Verheiratung ihres Sohnes Franz Joseph. Er wurde am 18. August 1830 auf Schloss Schönbrunn geboren und war der jüngere Sohn von Erzherzog Franz Karl und Sophie. Nachdem sein Onkel Ferdinand I., aus Krankheitsgründen sein Amt niedergelegt hatte, war Franz Karl der rechtmäßige Nachfolger. Der Familienrat sprach sich jedoch gegen den 45jährigen Franz Karl aus und beschloss einen Generationenwechsel; nicht unwesentlich daran beteiligt war die Erzherzogin Sophie. Franz Karl verzichtete daraufhin auf den Thron und so wurde Franz Joseph, im jungen Alter von achtzehn Jahren, zum neuen Kaiser von Österreich, gekrönt am 2. Dezember 1848 in Olmütz, in Tschechien.
Seine Mutter wurde am 27. Jänner 1805 als Sophie Friederike von Bayern in München geboren. Sie trug auch die Namen Dorothea und Wilhelmine. Sie war die Tochter von König Maximilian I. Joseph von Bayern und Karoline Friedericke von Baden. Ihre Eltern erzogen sie zu einer modern denkenden Person mit gewissen Freizügigkeiten, doch mit strengen Regeln. Sie war ein ausgesprochen hübsches Kind, sodass sie sogar in die berühmte Schönheitengalerie von König Ludwig I. aufgenommen wurde. Auch als junge Frau war sie von ansehnlichem Äußeren. Ihre erste Begegnung mit ihrem zukünftigen Mann Franz Karl war nicht berauschend. Die Ehe am 4. November 1824 in Wien erfolgte mehr aus politischen Gründen. Erst nach sechs Jahren und mehreren Fehlgeburten kam ihr Sohn Franz Joseph zur Welt.
Sophie hatte mit Franz Karl fünf Kinder: Franz Joseph (1830-1916); Ferdinand Max (1832-1867), der später Kaiser von Mexiko wurde; Karl Ludwig (1833-1896); Maria Anna Caroline (1835-1840), sie starb an Epilepsie; Ludwig Viktor (1842-1919); und einen Tod geborenen Sohn am 24. Oktober 1840.
Mit der Inthronisierung ihres Sohnes Franz Joseph begann jedoch die Erzherzogin ihre Fäden zu ziehen, um an der Omnipotenz ihres "Franzi" keinen Zweifel aufkommen zu lassen. Dafür gab sie sogar ihren Titel als Kaiserin hin. Aber was hätte sie schon mit dem kranken Franz Karl erreichen können? Sie musste den "an Körper und Geist schwachen" Erzherzog, den Bruder des schwerkranken Kaisers Ferdinand I. (1793-1875) heiraten. In Bayern erzählte man sich, Sophie habe aus Verzweiflung und Angst vor dieser Heirat Nächte durchgeweint. Als ihre Erzieherin dies ihrer Mutter erzählte, sagte diese ungerührt: 'Was wollen sie? Die Sache ist beim Wiener Kongress entschieden worden!" (Hamann, S. →). Mit ihrem strahlenden Sohn Franz Joseph hatte sie das große Los gezogen. Er war jung, frisch, überaus beliebt und ein williges Opfer ihrer Vorhaben. Das war nicht hinterhältig, sondern ein klares Kalkül indirekt die bedeutendste Person im Kaiserhaus zu werden. Besseres hätte ihr gar nicht passieren können.
Und so griff die Erzherzogin freudig die Bemühungen Ludovikas auf, eine ihrer Töchter dem jungen Kaiser zur Gemahlin zu machen. Auch Ludovika hatte klar kalkuliert und auch für sie wäre eine derartige Verbindung von großem Nutzen. Eine Heirat einer ihrer Töchter mit dem österreichischen Kaiser wäre eine perfekte Partie und eine willkommene Annäherung an das österreichische Kaiserhaus. In Frage kam aber nur (wie schon erwähnt) Helene, ihre älteste Tochter, obwohl man auch schon ein wenig an Sisi gedacht hatte, die "im Frühjahr 1853" dem Prinzen Georg, der zweite Sohn des sächsischen Königs Johann, begegnete" (Hamann, S. →). Die Mutter machte sich Hoffnungen, doch der Prinz zeigte kein Interesse. Auch Sisi nicht, sie war ja mit ihren fünfzehn Jahren noch so jung und weniger attraktiv als ihre Schwester Helene. So kam der Gedanke, Helene dem Kaiser als Braut schmackhaft zu machen, sowohl ihrer Mutter, als auch der Erzherzogin sehr gelegen. Es hatten sich zuvor auch schon andere Damen angekündigt. Franz Joseph war ja kein Kostverächter. Doch diese waren inzwischen schon vergeben oder kamen für die Erzherzogin nicht in Frage. Und so wurde Helene penibel auf eine mögliche Heirat mit Franz Joseph vorbereitet.
Wie sehr die Erzherzogin einer Heirat in ein Herrscherhaus nachging, zeigte ihre Reaktion nachdem sich Franz Joseph im Winter 1852 in eine Nichte des preußischen Königs verliebt hatte, doch diese bereits verlobt war. Die Erzherzogin fragte ihre Schwester Königin Elise von Preußen allen ernstes, ob man diese Verlobung nicht rückgängig machen könnte, ob sie nicht "vermieden werden könnte" (Hamann, S. →; Thiele, S. →). "Königin Elise konnte sich gegenüber den preußischen Politikern nicht durchsetzen. Eine Heiratsverbindung mit Österreich passte ganz und gar nicht in das preußische Konzept."
Die Erzherzogin wollte jedoch unbedingt eine deutsche Prinzessin an den Wiener Hof bringen und Helene kam ihr dabei sehr gelegen. Sie stammte zwar nur aus einer bayrischen Nebenlinie, aus einer weniger vornehmen herzoglichen Familie, doch sie passte zumindest altersmäßig hervorragend zum Kaiser. Und immerhin "war Bayern neben Sachsen der treueste Partner Österreichs im Deutschen Bund, eine neuerliche Verbindung zwischen Österreich und Bayern politisch durchaus nützlich" (Hamann, S. →).
In den Tagen des Jahres 1853 machten sich die Mutter von Sisi und die Erzherzogin ernsthafte Gedanken, wie sie den jungen Franz Joseph von ihrem Vorhaben überzeugen können. Gewalt kam nicht in Frage, das hatte schon Franz Joseph klar gemacht. Drängen lässt er sich nicht. Und persönlich verletzen wollte ihn seine Mutter auch nicht. Sie hat sich aber Helene als Schwiegertochter in den Kopf gesetzt. "Franz Joseph wird seine Cousine zur Frau nehmen und keine andere. Dabei scheint die Erzherzogin nicht einmal das schwerwiegende Faktum in Betracht zu ziehen, dass ihr Sohn und die Prinzessin Geschwisterkinder sind", (Thiele, S. →).
Im Juni 1853 erhielt die herzogliche Familie in Possenhofen ein offizielles Schreiben von der Erzherzogin, wonach ihre Schwester Ludovika, Herzog Max und Helene nach Ischl geladen werden, um zum Kaisergeburtstag eine eventuelle Eheschließung anzubahnen. Es wird dort einen Ball geben und diverse Feierlichkeiten, wo sich Helene und Franz Joseph näher kommen können, und vielleicht zündet der von den beiden Müttern entfachte Funke. Der Herzog zog es jedoch vor, an der Reise nicht teilzunehmen. "Er hat wenig Lust, sich von seiner herrischen Schwägerin kommandieren zu lassen." So trat Sisi an seine Stelle, "auch weil sie so sehr darum gebeten hatte" (Thiele, S. →).
Ein Treffen in Ischl
Während der Reise bereute die Herzogin "nicht, die zweite Tochter mitgenommen zu haben. Sisi zeigt sich an diesem Tag besonders aufgeweckt, unbefangen und unterhaltend, heitert ihre Schwester wenigstens hier und da auf. Sie ist der Herzogin oft zu natürlich, zu zwanglos, zu jugendhaft, und auch auf dieser Reise hat Ludovika an Sisi allerhand auszusetzen. Besonders fürchtet sie, in Ischl vor der strengen Erzherzogin Sophie und den sie begleitenden, formenstarren Hofleuten mit Sisi nicht bestehen zu können. Sie weiß, dass der ehemalige Gouverneur und jetzige Generaladjutant des jungen Kaisers, Graf Carl Ludwig Grünne (1808-1884), anwesend sein wird, und vor seinem durchdringenden prüfenden Blick ist ihr am meisten bange. Daher gibt sie während der Fahrt im Wagen allerhand wohlgemeinte Verhaltensmaßregeln für die noch kindliche Prinzessin", (Thiele, S. →f.)
Am 15. August 1853 (Hamann, 16. August) kam die kleine Gesellschaft in Ischl an (Corti, S. →; Hamann, S. →; Thiele, S. →). Eine Tante war gerade gestorben und so sind alle in Trauer gekleidet. Die hellere Kleidung war noch nicht eingelangt. Zur Gesellschaft gehörte die fünfzehnjährige Sisi, ihre neunzehnjährige Schwester Helene, Nené, ihre Mutter Ludovika, und Sisis Gouvernante Roedi (Thiele, S. →) oder Rodi (Corti, S. →). Man logierte im "Hotel Talachini", dem späteren "Kurhotel Elisabeth" oder "Hotel Kaiserin Elisabeth", nahe der Traun, das nun die Elisabeth Residenz ist.
Bild 2: Das "Kurhotel Elisabeth", auch "Hotel Kaiserin Elisabeth" in Bad Ischl im Jahr 1929; zur Zeit der Verlobung von Kaiser Franz Joseph mit Elisabeth das "Hotel Talachini" (ÖNB, Bildarchiv).
Franz Joseph fuhr "in diesem für ihn entscheidenden Frühjahr 1853 mit sehr gemischten Gefühlen nach Ischl, im Grunde nur, um seiner Mutter einen Gefallen zu tun", (Thiele, S. →). Schon am 14. August war er da; ebenso die Erzherzogin mit ihren Söhnen Karl Ludwig und Ludwig Viktor. An eine Ehe dachte Franz Joseph mit seinen zweiundzwanzig Jahren noch nicht. Dass es dazu Zeit wäre, hatte ihm seine Mutter allerdings schon deutlich gemacht. So ging er einigermaßen gelassen an die Geschehnisse heran. Helene und Sisi kannte er schon von früher, als er noch Erzherzog war. Da waren sie noch Kinder, Helene vierzehn und Sisi elf Jahre alt. Man war befreundet, mehr nicht. Auch noch etwas später erwachten in dem jungen Franz Joseph keine besonderen Gefühle – schon gar nicht solche, die an eine Heirat denken lassen, obwohl ihm sein bester Freund, der jungverheiratete Prinz Albert von Sachsen, die Ehe "in glühenden Farben geschildert hat" (Thiele, S. →). Seiner Mutter sagte er jetzt aber, "er wolle auf sein Gefühl vertrauen und Helene nur zur Frau nehmen, wenn sie ihm wirklich gefalle". Aber wen sollte er sonst heiraten? An Sisi dachte man nicht. Sie ist ja noch viel zu jung. Weder "Sophie noch sonst jemand denkt auch nur entfernt an die Möglichkeit, dass die kleine Sisi ihrer älteren Schwester den Bräutigam ausspannen könnte" (Thiele, S. →).
Während Helene, die vorgesehene Braut von der Kammerfrau möglichst vorteilhaft herausgeputzt und gekämmt wurde, damit sie nicht mit dem von der Reise staubigen Kleid vor den Kaiser erscheinen musste, kämmte sich Sisi selbst die Haare und flocht sich elegant einen Zopf. Die Erzherzogin hatte darauf ein wachsames Auge und beschrieb später ihrer Schwester Marie von Sachsen diese Frisierszene und meinte mit welcher Anmut sich die Kleine bewegte und "trotz der Trauer … war Sissy reizend in ihrem ganz einfachen, hohen, schwarzen Kleid" (Hamann, S. →). Helene dagegen wirkte in ihrem langen, schwarzen Kleid streng und unvorteilhaft gegenüber ihrer unbefangenen und kindlichen Schwester. Doch an diesem denkwürdigen Augusttag des Jahres 1853 verschwendete die Erzherzogin keine Gedanken an eine mögliche Heirat ihres Sohnes mit Sisi.
Am 16. August luden die Erzherzogin und ihre Schwester Ludovika zum Tee ein; im Seeauerhaus, an der Esplanade, dem Haus des Bürgermeisters Wilhelm Seeauer und dem späteren "Hotel Austria", heute das Stadtmuseum (Hamann, S. →f; Sachslehner, S. →). Anwesend waren die beiden Mütter, der Kaiser, Helene, Sisi, die Königin Elise von Preußen, die zwei jüngeren Brüder des Kaisers, Karl Ludwig und Ludwig Viktor und andere Verwandte. Die Stimmung war gedrückt. Es kam keine zwanglose Unterhaltung auf, jeder wusste um was es geht. Die Lage war ernst. Wie wird sich der Kaiser verhalten? Wird ihm Helene gefallen? Oder gar Sisi? Undenkbar dies auszusprechen.
"Als es zum Essen geht, hat das fortwährende Angucken des Kaisers Sisi schon völlig in Verlegenheit gebracht. Beim Speisen sitzt sie mit ihrer Erzieherin (Kammermädchen, Anmerkung der Autoren) unten am Tisch wendet sich leise zu ihr und sagt: 'Ja, die Nené hat's gut, die hat schon viele Menschen gesehen, aber ich nicht. Mir ist so bang, dass ich gar nicht essen kann" (Corti, S. →; nach einem Brief von Erzherzogin Sophie an ihre Schwester Marie von Sachsen).
Karl Ludwig beobachtete scharf und eifersüchtig die Szene. Er hatte schon lange ein Auge auf Sisi geworfen. Wird sie ihm der Kaiser vor seinen Augen wegschnappen? Die Blicke seines älteren Bruders waren für ihn überzeugend: der Kaiser hatte sich verliebt. Er sagte nach dem Treffen zu seiner Mutter Sophie, "dass in dem Augenblick als der Kaiser Sisi erblickte, ein Ausdruck so großer Befriedigung in seinem Gesicht erschien, dass man nicht mehr zweifeln konnte, auf wen seine Wahl fallen würde" (Hamann, S. →). Die Mutter war skeptisch. Karl Ludwig sagte am nächsten Tag in der Früh zu seiner Mutter: "Die Sisi hat dem Franzi so gut gefallen, viel besser als Nené. Du wirst sehen, er wird viel eher sie wählen als die ältere Schwester". Die Mutter hielt noch immer an Nené fest und sagte zu ihm: "Aber wo denkst du hin, diesen Fratz!" (Corti, S. →f; Thiele, S. →).
"Am nächsten Morgen, dem 17. August 1853, erscheint in aller Frühe der Kaiser bei seiner Mutter, die gerade erst aufgestanden war" und sagte zu ihr "mit strahlender Miene, dass er Sisi reizend fände". Sie ist so entzückend. "Sisi?" antwortete die Erzherzogin erstaunt, "aber die ist doch noch ein Kind" (Corti, S. →). "Ja gut, aber sieh doch ihr Haar, ihre Augen, ihren Charme, ihre ganze Gestalt, sie ist allerliebst", erwiderte Franz Joseph ganz aufgeregt und hatte kein Auge mehr für Nené. Er will nur Sisi. Seine Mutter meinte: "Du kennst sie ja noch gar nicht, musst besser zusehen. Du hast ja Zeit, du brauchst dich ja nicht zu eilen. Kein Mensch verlangt, dass du dich gleich verlobst". Aber der Kaiser hatte es nun eilig und meinte, "es ist viel gescheiter solche Dinge nicht in die Länge zu ziehen". Er hatte sich bereits entschieden und ließ der Mutter keine Ruhe mehr. Diese meinte: "Findest du nicht, dass Helene klug ist, dass sie eine schöne, schlanke Gestalt besitzt?" Franz Joseph daraufhin: "Nun ja, etwas ernst und schweigsam, gewiss nett, und lieb, ja aber Sisi – Sisi – dieser Liebreiz, diese kleinmädchenhafte und doch so süße Ausgelassenheit!" (Hamann, S. →).
Nur noch Sisi!
Franz Joseph wendete beim gemeinsamen Diner, wie am Vortag, kein Auge mehr von Sisi. Er "vergisst fast auf Nené, neben der er sitzt, redet kein Wort mit ihr, während Sisi drüben auf der anderen Seite des Tisches zwischen Ludwig von Hessen und Erzherzogin Sophie vor lauter Verlegenheit nicht mehr weiß, wo sie hinschauen soll" (Corti, S. →). Der Hessenprinz (Prinz Alexander von Hessen) war nicht im Bilde, er merkte nur, dass Sisi bloß Suppe mit gemischten Salat gegessen hatte. "Sie muss sich einen Fastentag ausgeschrieben haben", bemerkte er. Laut Gabriele Praschl-Bichler und einem Brief der Erzherzogin machte diese Bemerkung Louis (Ludwig Wilhelm), der älteste Bruder Elisabeths (Unsere liebe Sisi, S. →; Sophie, Ischl, 19. August 1853).
Die Mutter von Franz Joseph gab schließlich nach. Es wurde ausgemacht, "dass er am Abend, beim Ball, nicht wie es vorgesehen war und wie es auch die Etikette erfordert hätte, mit der älteren Prinzessin Nené den Kotillon tanzen würde, sondern mit Sisi, und wer je bei Hof getanzt hat, weiß, was das bedeutet" (Corti, S. →). Und ein Tanz "zweimal hintereinander mit demselben Mädchen ist fast schon ein Verlobungsversprechen".
Am Ball erschien Helene "in einem herrlichen, weißseidenen Kleid, mit Efeu über der Stirn, Sisi in einem süßen, leichten, rosaweißen Musselinkleidchen, mit einem kleinen Diamantpfeil im Haar, der ihr die goldbraunen Wellen aus der Stirn heraus nach rückwärts hält" (Corti, S. →). Sie ist "bescheidener angezogen" und wirkt gegenüber Helene eher "kindlich" (Hamann, S, →). Am ersten Tanz nahm der Kaiser nicht teil, wie auch die beiden bayrischen Prinzessinnen. "Beim zweiten Tanz, einer Polka, bat Erzherzogin Sophie Franz Josephs Flügeladjutanten, Hugo von Weckberger, er 'möge mit Prinzessin Elisabeth tanzen". Sisi, im Tanzen nicht so versiert, fürchtete, ob es ohne Tanzmeister gehen werde. Weckberger beruhigte die verlegene, befangene, schüchterne und – wie er meinte – liebreizende Prinzessin. Zum Glück war Sisi musikalisch und hielt wenigsten im Takt mit.
Der Kaiser dagegen tanzte entgegen seinen Gewohnheiten wieder nicht; stattdessen beobachtete er nur Sisi wie sie tanzte. Er will nur Elisabeth tanzen sehen, die, wie der Flügeladjutant meinte, "sylphengleich an meinem Arme schwebte" (Hamann, S. →). Und offenbar beobachtete er auch den Kaiser, denn als der Tanz beendet war sagte er: "Mir scheint, ich habe jetzt mit unserer künftigen Kaiserin getanzt" (Weckberger, S. →). Schon als die beiden Prinzessinnen den Ballsaal betraten, wussten die Gäste, dass die kleine Sisi den Kaiser entzückte. Auch sie hatte längst erkannt, dass sich der Kaiser für sie interessierte, doch "sie glaubte immer noch nicht, dass es wirklich ernst sei" (Corti, S. →). "Franz Joseph gegenüber, den sie mit frischem, freiem Handschlag begrüßt, bleibt sie eher unbefangen, nur all die anderen Leute, die sie anstarren, erschrecken sie und sind ihr furchtbar unangenehm."
Bild 3: Elisabeth in einem Boot am Starnberger See, gemeinsam mit Franz Joseph und Herzog Max, der die Zither spielt. Im Hintergrund Schloss Possenhofen. Idyllische Szene. Lithographie von Anton Schlögl (ÖNB, Bildarchiv).
Mittlerweile war es Mitternacht geworden und der Kotillon wurde vorbereitet. Und der Kaiser tanzte, wie ausgemacht, mit Sisi. Die Mütter hatten die Fäden gezogen und die anderen Beteiligten längst erkannt, was zwischen dem Kaiser und der jungen Prinzessin aus Bayern lief. Das konnte auch ihrer Schwester Helene nicht entgangen sein. Franz Joseph überreichte Sisi nicht nur den Kotillonstrauß, sondern auch alle übrigen Bukette – "ein traditionelles Zeichen dafür, dass sie seine Auserwählte war. Dieses Zeichen verstanden alle Augenzeugen – nur Sisi selbst nicht. Auf die Frage, ob ihr denn diese Aufmerksamkeit nicht aufgefallen sei, sagte sie: 'Nein, es hat mich nur geniert" (Corti, S. →; Hamann, S. →). "Es waren nur die vielen Menschen, die sie einschüchterten", schrieb später Sophie an ihre Schwester Marie von Sachsen.
Am nächsten Tag am 18. August, dem Geburtstag des Kaisers, gab es eine große Feier im Familienkreis und ein Diner. Der Kaiser war stolz darauf, dass er neben Sisi sitzen durfte. Sie aß mit gutem Appetit. Am Nachmittag gab es einen Ausflug nach St. Wolfgang am Wolfgangsee. Die Erzherzogin saß in ihrer Kalesche gemeinsam mit Sisi, Helene und Franz Joseph. Sie wunderte sich, dass ihr Sohn so lange ausgehalten hatte. "Er muss sie wohl gern haben", meinte sie später. Und Helene? Sie "erzählte sehr viel und unterhaltend, das Mädchen hat einen großen Charme für mich", meinte Sophie. Helene war die "einzige die spricht – laut, viel und lustig … nur hat man das Gefühl, dass alles etwas gepresst klingt" (Corti, S. →).
Wieder zurück in Ischl, bat der Kaiser seine Mutter, "bei Sisis Mutter vorzufühlen, 'ob sie ihn haben wolle', sagte aber auch, die beiden Mütter sollen keinen Druck ausüben. 'Meine Lage ist so schwer, dass es, weiß Gott, keine Freude ist, sie mit mir zu teilen'. Darauf Sophie: 'Aber liebes Kind, wie kannst Du glauben, dass eine Frau nicht zu glücklich ist, durch Anmut und Heiterkeit Dir Deine Lage zu erleichtern" (Hamann. S. →f; Corti, S. →f.)
Schließlich brachte die Erzherzogin ihrer Schwester Ludovika ganz offiziell den Wunsch ihres Sohnes zur Kenntnis. Diese drückte ihr "bewegt die Hand, denn sie hatte in ihrer großen Bescheidenheit immer gezweifelt, dass der Kaiser wirklich an eine ihrer Töchter denken würde". Als Ludovika das Ansinnen des Kaisers ihrer Tochter Sisi mitteilte, habe sie (laut Aussage der Erzherzogin) gesagt: "Wie soll man den Mann nicht lieben können?" Dann soll sie in Tränen ausgebrochen sein und versichert haben, sie würde alles tun, um den Kaiser glücklich zu machen und für die Tante Sophie "das zärtlichste Kind zu sein". Sisi sagte aber zugleich, "wie kann er nur an mich denken? Ich bin ja so unbedeutend!"
"Wenn er nur kein Kaiser wäre!"
Am nächsten Tag, am 19. August 1853, soll Sisi unter Tränen zu ihrer Gouvernante gesagt haben: "Ja, ich habe den Kaiser schon lieb! Wenn er nur kein Kaiser wäre!" Sisi hatte Angst um ihre künftige Stellung. Es erschreckte sie. Sie konnte gar nicht fassen, "was so plötzlich über sie hereingebrochen ist und was die Leute rund um sie herum ein namenloses Glück nennen" (Corti, S. →). Während der Unterredung mit ihrer Mutter hatte sie mehr geweint als gesprochen. Auf einem "rührigen Zettelchen" schrieb sie ihre Einwilligung an die Erzherzogin.
Sophies Kommentar dazu war: "Das ist es, was sie scheu macht, diese künftige Stellung. Der Kaiser war buchstäblich entzückt, als ich ihm diesen rührenden Ausspruch von seiner Braut erzählte, da er so viel tiefes und anspruchsloses Verständnis für ihn enthält". Dazu schreibt Brigitte Hamann: "Wie die Unterredung zwischen Mutter und Tochter wirklich verlief, ob Ludovikas und Sophies Erzählungen zu glauben ist, bleibe dahingestellt. Wenn man Ludovika später fragte, ob man denn wirklich bei dieser Entscheidung nach den Gefühlen des Mädchens gefragt habe, antwortete sie stets nur das eine: 'Dem Kaiser von Österreich gibt man keinen Korb" (Hamann, S. →). Das klingt nach einer Abwehrreaktion, um von einem psychischen Druck abzulenken, den wohl beide Mütter auf ihre Kinder ausgeübt haben. Umso mehr wenn man weiß, dass die eine auf ihre kaiserliche Stellung verzichten musste und die andere immer nach einer höheren Verbindung in ein Herrscherhaus gestrebt hatte. Dass ihre Interessen nun durch ihre Kinder weitgehend erfüllt sein würden, kam ihnen nur zu gut gelegen. Ihr Kalkül war aufgegangen.
Schon vor dem Ball waren vermutlich heimlich Weisungen und Befehle erteilt worden, um dem Kaiser nicht im Wege zustehen. Damit niemand auf die Idee käme mit der künftigen Kaiserin noch vor Franz Joseph ohne offizielle Genehmigung zu tanzen. Wenn man den Tratsch und das Getuschel am Wiener Hof kannte, dann konnte man sich gut vorstellen, was vor dem entscheidenden Kotillon geschehen war. Alle Anwesenden mussten gemerkt haben, was gespielt wurde. Wenn ein Kaiser anwesend war, entgeht das niemandem. Jede seiner Bewegungen, sein Verhalten und seine Blicke werden genau beobachtet und registriert. Niemand wagte es der Erzherzogin und ihrem Vorhaben im Wege zu stehen. Ihr Werk, mit gütiger Hingabe der Herzogin, der Mutter von Sisi, musste einfach gelingen.
Und auch Sisi hatte keine Wahl. Hätte sie dem Kaiser einen Korb gegeben, wäre das ein ungeheuerlicher Affront, ein Skandal, eine Katastrophe gewesen. Der herzogliche Zorn hätte sie ein Leben lang begleitet. Es war nur zu gut, dass sich die beiden grundsätzlich sympathisch waren, der Kaiser verliebte sich sowieso. Sisi war zurückhaltend. Sie hatte in dieser Stunde getan, was getan werden musste.
So schreibt Brigitte Hamann: "Jede der neun bayrischen Schwestern hatte ihre Herzenstragödie hinter sich. Jede von ihnen wusste, dass sie als heiratsfähige Prinzessin zum Objekt der Politik wurde und den Mann nehmen musste, den man ihr gab. Um die jungen Mädchen nicht zu verwirren, sie nicht in Konflikte zu stürzen, war im bayrischen Königshaus das Lesen von Liebesgeschichten streng verboten. Sogar die deutschen Klassiker waren deswegen verpönt" (Hamann, S. →).
Noch am Morgen, dem 19. August 1853, als Franz Joseph das Zettelchen mit der Einwilligung von Sisi erhalten hatte, dankte er zuerst ihrer Mutter, der Herzogin Ludovika und sagte ihr, wie glücklich er sei. Dann ließ er sie stehen und eilte zu Sisi. "Die ist schon auf, kommt zur Tür und Franz Joseph breitet die Arme aus, umfängt sie und küsst sie halbtoll vor Freude" (Corti, S. →f.) Elise von Preußen sah zufällig die Szene und berichtete später lachend und begeistert der Erzherzogin was sie gesehen habe. Ludovika schrieb später darüber an eine Verwandte: "Ich ließ ihn mit Sisi allein, denn er wollte selbst mit ihr reden, und als er wieder zu mir hereintrat, sah er recht zufrieden, recht heiter aus, und sie auch – wie es einer glücklichen Braut ziemt" (Hamann, S. →; Nachlass Sexau, Ludovika an Auguste von Bayern, Ischl, 19. August 1853). Und sie schrieb weiter: "Es ist ein so ungeheures Glück und doch eine so wichtige und schwere Stellung, dass ich in jeder Beziehung sehr bewegt bin." Und: Sisi "ist so jung, so unerfahren, ich hoffe aber, man hat Nachsicht mit dieser großen Jugend! … Tante Sophie ist gar so gut und lieb für sie, und welch ein Trost für mich, sie einer so lieben Schwester als zweyte Mutter übergeben zu können."
"Und nun vergessen die Schwestern Nené und alle ihre einstigen Pläne und freuen sich nur, dass doch eine ihrer Nichten Kaiserin von Österreich wird, und dass nun alles 'richtig' sei" (Corti, S. →). "Nur Karl Ludwig steht bei dem Freudentaumel etwas still beiseite; einen Augenblick schien es, als zerdrücke er eine Träne im Auge, dann kommt auch er und wünscht Sisi Glück, viel, viel Glück und küsst ihr beide Hände" (Corti, S. →).
Sisi wird später schreiben: "Die Ehe ist eine widersinnige Einrichtung. Als fünfzehnjähriges Kind wird man verkauft und tut einen Schwur, den man nicht versteht und dann 30 Jahre oder länger bereut und nicht mehr lösen kann" (Hamann, S. →; Valérie, 21. August 1889; Schad, Tagebuch Valérie, S. →).
Elisabeth, die Kaiserin
Verlobung in Ischl
Die Verlobung wurde vorbereitet. "Arm in Arm verließ das junge Paar das Hotel (Talachini, Anm. d. Autoren), um bei der Erzherzogin (im Seeauerhaus, Anm. d. A.) zu frühstücken, selbstverständlich im Kreis der ganzen Familie, die das Paar neugierig und wohlgefällig beobachtete – mit Ausnahme Erzherzog Karl Ludwig, der seine Jugendliebe verloren hatte. Franz Joseph stellte der Fünfzehnjährigen nun auch seine Adjutanten vor, vor allem den Grafen Grünne, auf dessen Urteil er sehr viel gab – auch was Frauen betraf" (Hamann, S. →).
Am 19. August 1853, um 11 Uhr, fand in der Pfarrkirche die kirchliche Zeremonie statt. "Die Gemeinde beobachtete eifersüchtig, wie Erzherzogin Sophie vor der Eingangstür zurückblieb und der kleinen Nichte den Vortritt ließ: Sisi war Kaiserbraut und von nun an höher im Rang als die Kaisermutter. Mit dieser noblen Geste erwies Sophie der kaiserlichen Hierarchie ihre Reverenz. Sisi freilich verstand diese Geste kaum. Verlegen und scheu betrat sie die Kirche, unangenehm berührt von der großen Aufmerksamkeit, die sie erregte". Die Augen der Anwesenden waren voller Tränen, man sang die Volkshymne. Franz Joseph führte Sisi behutsam zum Pfarrer und sagte:" Ich bitte Hochwürden, segnen sie uns, das ist meine Braut". Der Pfarrer folgte diesem Wunsch andächtig. Sogar der Papst sendete seinen Segen. Es gab zahlreiche Glückwünsche, Graf Grünne hielt eine Ansprache, die Braut war ergriffen und verlegen und der Kaiser hatte Mühe sie dem allgemeinen Getümmel zu entziehen.
Und Herzogin Ludovika machte sich wieder Sorgen um die Zukunft ihrer Tochter und klagte sie dem Flügeladjutanten Weckberger "wie ängstlich sie diese schwere Aufgabe mache, welche ihrer Tochter Elisabeth bevorstehe, da diese den Thron doch förmlich von der Kinderstube weg besteige. Sie hegte auch Besorgnis wegen des scharfen Urteils der Damen aus der Wiener Aristokratie" (Hamann, S. →; Weckberger, S. →). Dass diese Sorgen berechtigt waren, zeigt die spätere Entwicklung.
In Hallstatt wurde ein Diner eingenommen, dann gab es eine Spazierfahrt; die Sicht war, nach den Tagen des Regens, wieder sehr schön. Der Sonnenuntergang beleuchtete die Berge, der See schimmerte und der Kaiser erklärte seiner Braut die Umgebung. Sisi war nervös und fröstelte. Franz Joseph nimmt seinen Militärmantel, "hüllt seine Braut darin ein und flüstert ihr dabei ins Ohr: 'Weißt du, ich kann dir gar nicht sagen, wie glücklich ich bin.' Und als Mutter Sophie das hört, fühlt sie das Glück ihres Sohnes und denkt bei sich: 'Vielleicht, man weiß es nicht, vielleicht ist's so besser.' Aber der Strich durch die Rechnung (weil er nicht Nené gewählt hatte, Anm. d. A.) wurmt sie doch ein wenig. 'Du hast recht', sagt Sophie, als sie einen Augenblick mit ihrem Sohn allein ist, 'Sisi ist sehr hübsch, nur hat sie gelbe Zähne!". Sogar ihrer Mutter Ludovika sagte sie, "Sisi solle sich die Zähne besser putzen" (Corti, S. →f; Thiele, S. →, 110). Das hatte Sisi sehr gekränkt und sie war sogar ein wenig "rebellisch" geworden.
Bild 4: Elisabeth, vermutlich im Jahr 1853, noch vor ihrer Verlobung. Fotografie von Franz Hanfstaengl, nachträglich signiert mit 1859 (ÖNB, Bildarchiv).
In Wien war die Freude über die Verlobung "nicht ganz ungeteilt. Man wünschte dort wohl auch, dass der Kaiser heiratet. Aber Erzherzogin Sophie ist von der Niederwerfung der Revolution her nicht sehr beliebt. Man sieht zu sehr das Walten ihrer Hand bei dieser Verlobung und tröstet sich nur damit, dass sie wenigstens nicht genau nach Wunsch ausgefallen ist" (Corti, S. →).
Franz Joseph jedenfalls zeigte sich weiter verliebt in seine Braut. "Zu jeder Stunde entdeckt er einen neuen Reiz und einen neuen Charme an ihr. Alles was sie sagt, findet er klug, gut, gescheit und entzückend. Sisi wird gemalt, Franz Joseph sitzt dabei, um ihr die Zeit zu vertreiben, und sieht sie immerzu an. Der Künstler sagt ihm, so ein liebliches Gesicht habe er überhaupt noch nicht gemalt. Das Beste daran ist, dass das gar nicht wie Schmeichelei, sondern ganz aufrichtig klingt."
Elise von Preußen war ebenfalls von den beiden entzückt: "Es ist so schön, ein so junges Glück in einer so wunderbaren Landschaft". (Hamann, S. →; Sophie, 19. August 1853). Am Abend wurden in Ischl zehntausende Kerzen angezündet und Lampen in den österreichischen und bayrischen Farben. Auf dem Siriuskogel wurde mit vielfarbenen Lampen ein klassischer Tempel, mit den Initialen FJ und E, in den Himmel gezeichnet. Zum ersten Mal erlebte Sisi den Jubel einer wohlwollenden Bevölkerung, die ihr auf den Straßen zuwinkte und sie als künftige Kaiserin begrüßte. An diesem Tag strahlten wohl alle vor Glück. Außer Sisi, die immer noch sehr verlegen, sehr still und immer in Tränen war. Sogar das beglückte Sophie und sie schrieb an ihre Schwester: "Du kannst dir nicht vorstellen, wie reizend Sisi ist, wenn sie weint!"
Sisis Kontrahentin Helene dagegen, in Sachen Kaiserliebe die Unterlegene, war verstört und unglücklich. "Sie war schon achtzehn (1852, Anm. d. A.), also für die Vorbereitung einer neuen 'Partie' relativ alt. Selbst das prächtige Geschenk Sophies, ein Kreuz in Diamanten und Türkisen, und die Gewissheit, dass Sophie sie nach wie vor außerordentlich reizend fand, konnte Helene nicht trösten. Sie sehnte sich zurück nach Bayern, ebenso wie ihre Mutter Ludovika, die besorgt an ihre bayrischen Verwandten schrieb: 'Das hiesige Leben ist äußerst belebt. Sisi besonders ist das noch gar nicht gewohnt, besonders das späte Schlafengehen. Ich bin angenehm überrascht, wie sie sich darein findet, mit den vielen fremden Menschen zu reden und dass sie trotz ihrer Verlegenheit eine so ruhige Haltung hat" (Hamann, S. →; Nachlass Sexau, Ludovika an Auguste v. Bayern, Ischl, 26. August 1853). Hier ergibt sich ein Widerspruch, denn mit den Menschen hatte sie, nach anderen Berichten, gar nicht so viel geredet. Sie hatten sie eher verstört. Und "darein finden" musste sie sich sowieso.
Ihr Vater, Herzog Max, "wurde telegraphisch von der Verlobung informiert, ebenso der König von Bayern. Er musste ja als Chef der Wittelsbacher, seine offizielle Genehmigung zur Verlobung seiner Cousine geben. Franz Joseph dankte ihm 'unter den Regungen eines vollkommen befriedigenden Herzens" (Hamann, S. →). Er war doppelt glücklich, dass er mit seiner Wahl Sisi zu seiner künftigen Frau zu machen, seinem Herzen gefolgt war und zugleich dem Hause Wittelsbach mit seiner Mutter und jetzt auch mit Sisi, die Bande "welche unsere Familien umfasst, um so dauernder und fester knüpfen werde" (GHA München, Nachlass Maximilian II. Ischl, 22. August 1853).
Es folgte ein Fest nach dem anderen. Sisi wurde von allen Seiten beschenkt und der Kaiser gab ihr Geschmeide, Juwelen, prachtvolle Blütenranken aus Diamanten und Smaragden, die sie in ihr Haar flechten konnte, denn das war ihr schönster natürlicher Schmuck, den sogar ihre Gouvernante bewunderte. Sisi war der Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens in Ischl, man staunte sie an und rühmte ihre Anmut. Um Sisi eine besondere Freude zu machen, ließ der Kaiser sogar in der Sommervilla eine Schaukel aufstellen, die sie in kindlichem Eifer sofort benützte. Da der Kaiser bemerkte, wie groß Sisis Angst vor immer neuen, fremden Gesichtern war, ließ er den prächtigen von fünf Schecken gezogenen Wagen nicht von einem Kutscher lenken, sondern von seinem Generaladjutanten Graf Grünne, wie die Erzherzogin berichtete (Sophie, 21. August 1853). Denn er hatte bemerkt, dass sich Sisi an diesen seinen Vertrauten bereits gewöhnt hatte und ihn mochte. Das sollte sich aber später ändern. Grünne war damals 45 Jahre alt und einer der einflussreichsten Persönlichkeiten der Monarchie, ein wichtiges Mitglied der vielgeschmähten "Kamarilla" (eine Günstlingspartei, die ohne Befugnis und Verantwortung Einfluss auf den Herrscher hat) am Wiener Hof und dem Kaiser treu ergeben. Als Vorstand der Militärkanzlei war er der erste Mann der österreichischen Armee nach dem Kaiser (Hamann, S. →). Er selbst dachte sich, nun wird "dies junge Kind noch mehr Wachs sein, in der Erzherzogin Hand, als es die ältere Schwester gewesen wäre" (Corti, S. →). Womit er – zumindest für einige Zeit – Recht hatte.
Es gab noch drei Bälle in Ischl. "Sisi war laut Sophies Tagebuch weiterhin schüchtern und brav. Als Gräfin Sophie Esterházy, die bald ihre Obersthofmeisterin werden sollte, gratuliert und sagt: 'Wir sind Eurer königlichen Hoheit so dankbar, dass sie den Kaiser so glücklich machen', antwortet Sisi: 'Ich bedarf für den Anfang noch so viel Nachsicht!" (Sophie, 21. August 1853). Offensichtlich freuten sich alle, dass sich Sisi dem Kaiser hingegeben hatte, jedoch fragte kaum jemand nach ihrem Empfinden. Die ständigen Tränen müssten eigentlich Anlass genug dazu gewesen sein. Die Zeitungen konnten nur sehen, dass sie schüchtern, verlegen und still war. Ihre Gefühle zu dieser Zeit gab sie erst viel später heimlich in ihren Gedichten preis. In Ischl 1853 konnte sie nur schweigen – und weinen.
Abschied von Possenhofen
Die Verlobungsfeierlichkeiten dauerten noch bis zum 31. August 1853. "Im festlich geschmückten Salzburg wurde 'sehr zärtlich', wie Sophie in ihrem Tagebuch festhielt, Abschied genommen" (Hamann, S. →). Zur Erinnerung an die Verlobung beschließt Erzherzogin Sophie, ihre Mietvilla, (die Villa Eltz, des Wiener Notars Dr. Josef August Eltz, die 1853 im Besitz des Ischler Kreisarztes Dr. Eduard Mastalier war, Anm. d. A.), zu kaufen und sie zur "Kaiservilla" für die alljährliche Ischler Sommerfrische der kaiserlichen Familie auszubauen. Trotz der vierzehn Zimmer, die die Villa hatte, war sie für kaiserliche Ansprüche zu klein. Die Villa wurde vergrößert und erhielt – zufällig oder gewollt – durch zwei neue Flügel einen neuen Grundriss in Gestalt eines "E" – wie "Elisabeth".
Es ging wieder zurück nach Possenhofen, Franz Joseph nach Wien. Schon im Reisewagen überdachte Sisi ihre neue Lage: "Was ist denn nun geschehen? Ahnungslos ist sie damals ausgefahren und nun, mehr oder weniger wider ihren Willen, als Braut zurückgekehrt!" (Corti, S. →). Sie würde nun Kaiserin werden und solle über ein großes, mächtiges Reich, mit unzähligen Völkern, herrschen, von deren Sprache, Sitten und Gebräuchen sie gar nichts wusste. Eine schier unmögliche Aufgabe, für ein so junges Mädchen. Da waren ihre jungen "Liebschaften" in Possenhofen noch eine kleine, heile Welt. Harmlose Aufregungen gegenüber jenen, die nun auf sie warten würden. Sie sah die Schwalben ziehen und wünschte eine von ihnen zu sein, einfach weg, raus aus diesem Traum, der zur unbegreiflichen Wirklichkeit geworden war. Und sie schrieb wieder melancholische Gedichte:
O Schwalbe, leih mir deine Flügel,
O nimm mich mit ins ferne Land.
Wie selig sprengt' ich alle Zügel,
Wie wonnig jedes fesselnd Band.
Ihr Leben lang wird sie dieser Wunsch begleiten, wird sie den ziehenden Schwalben sehnsüchtig nachblicken. Jetzt aber in Possenhofen gab es kein Zurück mehr – noch hoffte sie, dass sich alles zum Guten wenden würde. Der Kaiser ist ja so lieb zu ihr. Ganz traurig sitzt er in Wien und denkt an die "göttliche Ischler Zeit", den "göttlichen Ischler Séjour" (Corti, S. →; Hamann, S. →; Thiele, S. →) mit Sisi. Er will schon im Oktober zu ihr kommen. Ein hässliches Porträt seiner Braut im Alter von 15 Jahren, mit einem Gesicht, das wie ein "weißes Mohrengesicht" aussieht, lässt er entfernen und ersetzt es durch ein schönes in Ischl gemaltes Miniaturbild seiner Braut (Thiele, Bilder, S. →).
In Wien kannte man die junge Braut kaum. Man hatte mit ihr als künftige Frau des Kaisers überhaupt nicht gerechnet. Man hatte sie nicht im Mindesten in Erwägung gezogen. Es blühte der Klatsch. Das Erste, was man vornahm war ein kritischer Blick in den Gotha, dem Hofkalender, in dem alle Personen des Hochadels verzeichnet wurden. "Und hier hielt die Kaiserbraut der Kritik nicht stand" (Hamann, S. →). Die Prinzessin Arenberg (die Mutter ihres Vaters Max) stand in ihrer Ahnenreihe. "Und diese Arenbergs waren zwar ein hochadeliges, aber kein souveränes Haus, also kein Haus, das habsburgische Ehepartner stellen durfte. Und diese Großmutter Arenberg "war wiederum mit allen möglichen anderen adeligen, aber nicht souveränen Häusern verwandt: den Schwarzenberg, Windischgrätz, Lobkovic, Schönburg, Neipperg, Esterházy. Somit war also die zukünftige Kaiserin nicht über die aristokratische Gesellschaft gestellt, sondern auch ein Teil von ihr – durch mannigfache verwandtschaftliche Beziehungen mit nicht-souveränen Häusern. Die wichtigste Vorraussetzung, um am Wiener Hof unangefochten zu sein, eine lupenreine Ahnenreihe, erfüllte Elisabeth also nicht. Sie sollte diesen Makel nur zu bald spüren".
"Auch Brautvater Max gab reichlich Anlass zu Tratschereien. Seine Zirkusreiterei, sein allzu freundschaftlicher Umgang mit Bürgern und Bauern, seine Missachtung der aristokratischen Welt, seine wenig feinen Herrenfeste in Possenhofen und München wurden reichlich beredet. Man erzählte sich, wie Herzog Max seine Kinder verwildern ließ, dass sie zwar reiten konnten wie kleine Zirkusartisten, aber kaum einen vernünftigen französischen Satz, schon gar keine 'Konversation' zustandebrachten. Das Parkett des Wiener Hofes war glatt."
Bild 5: Elisabeth im Alter von 15 Jahren mit dem "Mohrengesicht". Fotografie von Alois Löcherer, München 1853 (ÖNB, Bildarchiv).
Auch die Schlösser von Herzog Max wurden bekrittelt. Das Palais in der Ludwigstraße, in München, erbaut vom Architekten Leo von Klenze (1784-1864), war zwar durchaus standesgemäß, doch das kleine Schloss in