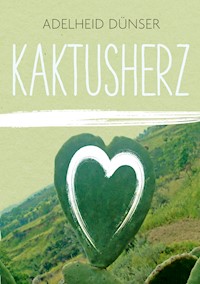
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Eigentlich wollte Peter Keßner nur eine Wohnung kaufen, um Geld anzulegen - doch die Begegnung mit dem Mieter sollte zu einem Wendepunkt in seinem Leben werden. Aus einem Impuls heraus hilft er zusammen mit seiner Frau Tanja dem älteren Mann aus seiner finanziellen und existenziellen Misere. Doch schnell entdeckt Peter in dem auf den ersten Blick verwahrlost wirkenden Mann einen bescheidenen und gutherzigen Menschen, dem von der Welt übel mitgespielt wurde. Seine tatkräftige Unterstützung wird für ihn zu einer erfüllenden Aufgabe, die lange verschüttete Gefühle in ihm freilegt. Es entwickelt sich eine intensive Bekanntschaft und Freundschaft, aus der beide reich beschenkt hervorgehen. Eine Lektüre, die nachdenklich macht, ob rein materielles Streben uns letztendlich erfüllt oder ob wir uns nicht sinnvolleren Zielen zuwenden sollten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mein Herz muss wandern
von einem Ort zum andern.
Immer wieder, immer wieder
muss ich in die weite Welt hinaus.
Es lässt mir einfach keine Ruh,
muss ferne Länder bereisenwie Italien, Spanien
und auch die Dolomiten gar.
Mein Herz muss wandern von einem Ort zum andern.
Doch darf man nie vergessen,
dass man auch eine Heimat hat,
die einem gibt
Kraft, Zuversicht, Ruhe und Geborgenheit
und uns von allen Stürmen des Lebens befreit.
Gedicht von Rolf Kengelbach für Peter Keßner,
geschrieben im Herbst 2011
Inhaltsverzeichnis
Rolf
Tanja und Peter
Rolf
Tanja und Peter
Rolf
Tanja und Peter
Rolf
Tanja und Peter
Rolf
Tanja und Peter
Nachwort
Rolf
Lebensgeschichten können spannend sein – oder so unscheinbar wie meine. Wären nicht Peter und Tanja eines Tages durch meine Wohnungstür getreten, hätte sich meine Geschichte in Luft aufgelöst. So leise, wie ich gelebt habe, so leise wäre ich gegangen. Das Schicksal wollte es anders. Und somit darf ich von meiner Existenz mitteilen.Türen spielten in meinem Leben eine große Rolle. Türen, die sich öffneten, und Türen, welche sich schlossen. Türen haben eben mehrere Funktionen. Eine Tür war ein Tor in die Freiheit oder sie war der Eingang zu einem Gefängnis. Sie konnte ein Schutzwall gegen die Außenwelt sein oder der Einlass in die Geborgenheit der eigenen kleinen Welt. Die Tür ist unschuldig. Sie zeigt immer ihre beste Seite, allein, der Mensch muss sie zu benutzen wissen. Und deshalb wurde die Tür dieser Wohnung eines Tages das größte Hindernis in meinem Alltag. Immer wieder ging mein Blick zu ihr, wenn ich in dem alten Ohrensessel meines Vaters saß. Aufstehen und hinausgehen. Wie einfach wäre das gewesen! Und wie schwer war es doch! Die Welt da draußen war irgendwann zu verwirrend, zu hektisch, zu unkontrollierbar für mich. Solange ich arbeiten ging, hatte ich durch die Tür hindurch gemusst. Da war sie kein Problem. Aber seit meiner Pensionierung blieb ich lieber hinter der Türe. Abwartend und beobachtend verweilte ich in meinen sicheren vier Wänden. Schützte mich vor zu engen Beziehungen, freundschaftlichen Abhängigkeiten und neugierigen Nachbarschaften. Bis mir die Dinge langsam entglitten.Obwohl, entglitten waren mir die Dinge schon vor langer Zeit. Vielleicht schon bei meiner Geburt, als sich über Europa die braunen Wolken zusammenzogen, auf den Straßen die Stiefel marschierten, die Leute das Geschrei eines starken Mannes bejubelten und schließlich der große Krieg begann. Zur gleichen Zeit entlockte mir das Leben das erste Lächeln, während es vielen anderen bereits im Halse stecken blieb. Als ich zu krabbeln anfing, krochen die Soldaten durch ihren ersten Kriegswinter und die Mutter holte sich Lebensmittelmarken.In Baden-Baden hielten die Menschen zuerst noch an ihren Gewohnheiten fest. Fuhren zur Kur und freuten sich über die Erfolge an der Front. Während des Fortschreitens des Mordens und Näherkommens des Grauens wuchsen meine Schwester und ich heran. Gemeinsam mit der Mutter zitterten wir um unser Leben, hungerten und bangten um den Vater. Selten wussten wir, wo er war. Die Briefe erreichten die Mutter immer erst verspätet, und ich kannte diesen Mann nur aus Erzählungen.In der vielen Zeit, die ich hatte, während ich auf meine Wohnzimmertüre starrte, zwischendurch meine Blicke über die Wände schweifen und das Muster der Tapete auf mich wirken ließ, erinnerte ich mich, wie ich, an die Hand der Mutter geklammert, durch die Fürstenfeldstraße geeilt war, als die französischen Panzer einfuhren. Der Boden zitterte und entlang der Häuserreihen wogte der Lärm der Kettenräder. Menschen rannten die Straße entlang und eilten in ihr vermeintlich sicheres Heim. Überall wurden schnell die Vorhänge zugezogen, und ein paar wenige Blicke versuchten, durch schmale Schlitze die bedrohliche Lage einzuschätzen. Die Mutter schleifte mich geradezu zurück nach Hause in die Ebersteinstraße, obwohl wir auf dem Weg zur Schule gewesen waren, um Susanne abzuholen. Sie musste sich an diesem Tage mit ihren zwölf Jahren ganz alleine durch das Chaos schlagen. Völlig verängstigt kam sie gegen Abend heim und begann zu weinen, als sie Mutter und Bruder sah. Die beiden Gestalten saßen auf dem Kanapee in eine Decke eingewickelt und schauten ihr ohne erkennbare Regung ins Gesicht. Ich, der immer eher langsam sprach und mit kurzer Zeitverzögerung, beobachtete die zitternden Lippen von Susanne. Ich erriet die Worte, welche die Menschen meiner Umgebung von sich gaben, eher, anstatt sie zu hören. Dies war mir aber zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst. Ich konnte von Susannes Lippen allerdings nicht viel mehr ablesen, als dass sie sehr vorwurfsvoll und wütend darüber, im Stich gelassen worden zu sein, bebten. Die Mutter entschuldigte sich nicht und versuchte auch nicht, Susanne zu trösten.»Was hätte ich machen sollen?«, fragte sie resigniert. »Wir haben bis jetzt überlebt, ich möchte, dass das so bleibt, bis der Vater wieder nach Hause kommt.«
Und der kam tatsächlich irgendwann aus der holländischen Kriegsgefangenschaft zurück. Ein unbekannter Mann war das, der da durch die Türe trat, zur Freude der Mutter und zum Erstaunen der Kinder. Und zum ersten Male stellte ich fest, welch große Rolle Türen in meinem Leben spielten. Oft veränderten sie meine Situationen und noch öfter ließen sie mich darin verharren.Die Heimkehr des Vaters änderte zunächst alles. Die Wohnung wurde zu klein. Der Vater duldete uns Kinder nicht im gemeinsamen Bett mit der Mutter. So mussten meine Schwester und ich von nun an im Wohnzimmer schlafen. Das Bad am Gang teilten wir uns mit französischen Besatzungssoldaten, die im Dachgeschoss wohnten. Nachdem der Vater eine Stelle bei der Sparkasse bekommen hatte, konnten wir in ein größeres Appartement ziehen, in der Nähe seines Arbeitsplatzes. Es war nicht nur ein Tapetenwechsel. Für mich war es vor allem ein Türenwechsel. Die billigen Fichtentüren in der alten Wohnung wurden durch schwere Eichentüren in der neuen ersetzt. Ich hatte ein Zimmer zusammen mit Susanne, die allerdings selten zu Hause war, da sie bereits eine weiterführende Schule besuchte, als ich erst eingeschult wurde. So hatte ich stundenlang Zeit, mit meinen Holzfiguren zu spielen und, auf die Türe starrend, zu warten, bis jemand zu mir ins Zimmer kam. Ich kannte jede Rille vom Türblatt, jedes Astauge, und die Maserungen zeichnete ich hin und wieder mit den Fingern nach. Dabei stellte ich mir den Baum vor, aus dem diese Türe geschnitten worden war. Vor meinem geistigen Auge tauchte der Wald auf, die mächtigen Stämme, Wurzeln, die über den Weg krochen, und das Gestrüpp an den Seiten. Hellgrüner Farn, stachelige Brombeerranken und allerlei Moose und Gebüsch.Sonntags machte die Familie manchmal einen Ausflug hinaus in die Natur. Da war ich glücklich. Ich roch gerne das erdige, vermodernde und morsche Holz. Aber ebenso liebte ich die frischen Gräser und Kräuter und den würzigen Duft frisch abgeschnittener Haselnussstecken. Manchmal, wenn ich meine Nase an der Türe rieb und mich so in meinen Phantasiewald versetzte, zogen feinste Küchendüfte durch das Schlüsselloch, wenn die Mutter einen Kuchen im Rohr hatte oder Pfannkuchen für uns hungrige Kinder backte. Da stand ich besonders gerne an der Türe, wartend, bis man mich rief.Dann saß die Familie um den Tisch, die Mutter servierte das Essen und bevor sich jeder etwas aus der Schüssel schöpfte, sprach der Vater das Gebet, in das sich alle der Reihe nach einfügten und es mit gefalteten Händen und hängendem Kopf mitsprachen. Kaum war das Kreuzzeichen beendet, langte der Vater kräftig in den Topf. Der Vater. Groß und hager und streng. In seinem schmalen Gesicht leuchteten die Augen manchmal besonders intensiv. Wenn er sich freute, aber auch wenn er sich ärgerte.Wenn ich an ihn denke, überkommt mich oft Wehmut, deshalb versuche ich, die Gedanken an ihn möglichst zur Seite zu schieben. Zu lebendig ist das Gefühl, ihm nicht gerecht geworden zu sein. Eine ständige Enttäuschung, wobei man doch nichts anderes wollte, als vom Vater geliebt und anerkannt zu werden. Und trotzdem fand man keinen Ausweg aus der Abhängigkeit zu ihm.Die meiste Zeit unseres Lebens lebten wir alle zusammen unter einem Dach. Die Schwester, weil sie irgendwann die Nerven nicht mehr hatte, aus der Tür zu treten und einer Arbeit nachzugehen, und ich, weil alle meine Träume, selbstständig zu werden, nur Luftschlösser waren. Ob mir meine Nerven Streiche spielten oder meine Schwerhörigkeit, ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen. In der Schule verhielt ich mich möglichst unauffällig und trainierte und verfeinerte meine Fertigkeit im Lippenlesen. Den Eltern fiel lange nicht auf, dass ich nicht richtig hörte. So genau konnte ich von der Sprache ihrer Körper ablesen, was gerade vor sich ging. Und wenn Susanne streiten wollte, dann entzifferte ich jedes Schimpfwort eher an ihren Lippenbewegungen, als dass ich es hörte. Außer wenn sie besonders laut schrie. Dann konnte ich auch auf normalem Wege hören, wie ihre Stimme mein Außenohr erreichte, der schrille Ton ins Mittelohr weitergeleitet wurde, der Schall durch die Bewegung des Trommelfells sich erhöhte und im Innenohr in Nervenimpulse umgesetzt wurde. Diese Impulse leiteten ins Gehirn weiter, was Susanne sagte, was ich aber oft trotzdem nicht verstehen konnte. Weniger des Hörens, sondern des Vorwurfes wegen.»Warum grüßt du die Kuh?«, fragte Susanne mich regelmäßig.
Die Kuh konnte die Nachbarin sein, die Verkäuferin im Supermarkt, die Spaziergängerin im Kurpark oder die Frau am Nebentisch im Kaffeehaus.
»Weil sie mich angeschaut hat, Susi«, versuchte ich, mich zu rechtfertigen.
»Dich angeschaut«, äffte die Schwester. »Davon träumst du wohl noch immer, dass dich eine anschaut! Gar nicht schaut sie. Daneben, vorbei, als ob ich Luft wäre, oder du!«
Susanne konnte es gar nicht leiden, wenn sie sich nicht beachtet fühlte. Und das kam leider ziemlich häufig vor. Da sie meistens daheim herumhockte, war sie in der Stadt auch nicht bekannt.Wenn ich eine Zeitung durchblättere, die jemand im Hof auf einer Bank liegen ließ, oder ich an meinem Sekretär sitze und meine Post durchsehe, muss ich an sie denken. Das alte Möbelstück teilten wir uns früher lange Zeit. Die linke Seite benutzte ich als Ablage, die rechte Seite Susanne. Der aus Akazienholz gefertigte Sekretär stand im Wohnzimmer. Groß und massiv, in dunklem Braun mit Messinggriffen. Auf Susannes Seite lagen fein aufgestapelt Zeitschriften und Ansichtskarten. Eine Vase, die sie stets mit Blumen füllte, eine kleine Engelsfigur und das Bild der Großeltern mütterlicherseits, darauf waren Großmutter Ilse und Großvater Robert Emil zu sehen. Auf meiner Seite standen ein Globus und das Bild der Großeltern väterlicherseits, Opa Karl Ludwig und Oma Rosa Franziska. Von ihnen hatten wir unsere Zweitnamen. Susanne Marierosa und Rolf Emil Karl hießen wir vollständig. Namen wurden in unserer Familie gerne weitergegeben.
Unter der aktuellen Tageszeitung, die der Vater am Abend auf den Sekretär legte, lag ein Atlas, in dem ich gerne blätterte und in meiner Phantasie ferne Länder und Städte besuchte. Dann träumte ich von Rio und Peking, von Australien und der Mongolei, von den Pyramiden in Ägypten und von New York. Die Erde war riesig, doch meine Welt blieb klein.Die Vase und der Engel sind verschwunden, die Bilder der Großeltern wurden durch ein Bild der Eltern ersetzt. Der Globus ist von links nach rechts gewandert. Trotzdem spürte ich noch lange die Präsenz von Susanne. Und vor allem fühlte ich die Kränkungen, die sie im Leben ertragen musste, wenn sie sich übergangen vorkam. Davon wurde sie regelrecht verfolgt und sie verdächtigte jeden, der ihr nur irgendwie in die Quere kam. Sie verlangte von uns die Bestätigung ihrer Wahrnehmungen. Es gelang nicht immer. Meistens wurden ihre Ausbrüche ignoriert, zu gewöhnt war man schon daran. Man fand Entschuldigungen, Ausreden und Beschwichtigungen. Den Eltern war es wichtig, schnell wieder Frieden herzustellen. Und ich lernte von ihnen.
Susanne hatte eigentlich ein adrettes Aussehen und auch ein vornehmes Auftreten. Beides hatte sie von der Mutter geerbt. Die kernige, kräftige Figur, dazu die schwarzen, lockigen Haare und die dunklen, leuchtenden Augen zogen manchen Männerblick auf sie. Gerne hätte sie zurückgezwinkert, allerdings kam ihr immer wieder das aufbrausende Temperament dazwischen und dazu die geringe Belastbarkeit. Die kleinste gefühlte Zurückweisung wuchs sich bei Susanne zu einer Lawine an empfundener Beleidigung aus.Das Fass vollends zum Überlaufen brachte wohl ein gewisser Herr Ralf Puchwein aus Heidelberg. Den hatte Susanne ebendort kennengelernt, als sie das Englische Institut besuchte, um ihre Englisch- und Französischkenntnisse zu vervollständigen. Während dieser Zeit wohnte sie bei der Witwe Hermann. Dort hatte sie es gut getroffen. In deren Hinterhaus bekam sie das Zimmer neben einem Medizinstudenten, der sich auf Augenheilkunde spezialisierte. Ihren Ralf Puchwein traf sie in dem Café, in welchem er als Konditor arbeitete.Das war eine schöne Zeit für die ganze Familie, mit der verliebten Susanne.»Vati, schau, was Ralf mir geschenkt hat«, strahlte sie an manchem Wochenende stolz, welches sie zu Hause verbrachte, und zeigte Blumensträuße oder süße Leckerbissen, welche er selbst gebacken hatte. Mutter träumte bereits von Verlobung und der Auflösung ihrer Sorgen. Aber auf einen Ring warteten die Damen vergeblich. Einmal stellte sich der feine Herr der Familie vor. Es war Kostümball im Kurhaus Baden-Baden. Da holte er galant seine als Zauberin verkleidete Verehrerin ab. Selbst war er gekonnt herausgeputzt als Pirat.»Gestatten, Ralf Puchwein aus Heidelberg«, stellte er sich bei unserem Vater mit einer Verbeugung vor. Mutti begrüßte er mit Handkuss. Die Eltern waren angenehm berührt und so gaben sie ihm ihre Tochter voller Vertrauen und Hoffnungen mit auf den Ball. Leider stellten sich diese als zu früh heraus. Herr Puchwein brachte Susanne zwar zuverlässig wieder nach Hause, doch dann ließ er nie wieder etwas von sich hören. Er verschwand sogar aus Heidelberg. Gerüchten zufolge verlor sich seine Spur im Café Kranzler in Frankfurt.»Wahrscheinlich war es ein Heiratsschwindler«, mutmaßte der Vater. »Hast du ihm Geld gegeben, Susi?«Wir fanden es nicht heraus. Susanne schwieg darüber und starrte grimmig vor sich hin, ohne jemals darüber Auskunft zu geben.Susannes Leidensgeschichte wurde zur Leidensgeschichte der ganzen Familie. Diese Demütigung wegzustecken ging über die Kräfte der Frauen. Wenn Susanne auf dem Kanapee saß und ihr die Tränen über das Gesicht rannen, musste auch die Mutter weinen. Wenn die Mutter weinte, verspürte ich den großen Drang, sie zu trösten. Der Vater ignorierte grimmig die traurige Stimmung zu Hause. Er begann, immer öfter seine Wochenenden am Bodensee zu verbringen. Alleine. Die Trauergesellschaft wollte er nicht dabeihaben. Also musste ich stundenlang mit Susanne Streitpatience legen, um sie abzulenken. Dabei ließ ich große Vorsicht walten, damit sie oft genug gewann, ansonsten hätte man die nächste Katastrophe ausgelöst.Wieder und wieder durchlebe ich diese Szenen, wenn ich so durch den Tag wandele und wenig Ablenkung habe. Besonders seit sich der Fernseher nicht mehr einschalten lässt. Eines Tages machte er einen kurzen Zisch und fertig war es mit der kurzweiligen Unterhaltung. Einen neuen konnte ich mir nicht kaufen. Einerseits hatte ich kein Geld und andererseits, wie sollte ich ihn transportieren? So verbrachte ich die meisten Tage bis zum Kennenlernen von Tanja und Peter in meinem geerbten, abgewetzten Ohrensessel mit Mutters Streublumenkanne voll Kaffee neben mir, den ich auch kalt gerne trank, und streifte in meinen Gedanken immer wieder durch mein vergangenes Leben und das meiner Familie.»Vati, ich habe die Kündigung bekommen«, kam Susanne eines Tages von der Arbeit nach Hause. »Nur noch bis zum Monatsende kann ich arbeiten«, berichtete sie geknickt. Ihre Stellungen wechselte sie alle drei Jahre, entweder hielt sie es dort nicht mehr aus oder man hielt es mit ihr nicht mehr aus. Das gab sie natürlich kaum zu. Man konnte es aber aus ihren Erzählungen erraten. Der Vater, der anfangs darüber schimpfte, resignierte schließlich und fand sich damit ab. Je mehr Druck er aufgebaut hatte, desto empfindsamer reagierte Susanne. Die Stelle in dem Einkaufskontor am Leopoldsplatz gefiel ihr endlich, denn der Chef, ein gewisser Herr Dr. von Mittelstaedt, war sehr nachsichtig und behutsam mit ihr. Leider schied er aus Altersgründen aus der Firma aus und der neue Chef trieb das Unternehmen in den Ruin. Das war natürlich doppelt bitter.Jeden Tag beim Frühstück wurden ab nun zuerst die Stelleninserate studiert. Im Kloster zum Heiligen Grab wurde eine Schulsekretärin gesucht. Die ideale Stelle für Susanne. Am Tage des Vorstellungsgespräches war sie aufgeregt und nervös, aber auch voller Vorfreude. Sie putzte sich tadellos heraus, bat um festes Daumendrücken und machte sich mit dem Fahrrad auf den Weg zum Kloster. Der Personalchef sprach sehr angetan mit ihr und fröhlich setzte sie sich wieder auf ihr Rad und pedalte zurück.»Vati, Mutti, Rolf!«, rief sie überdreht. »Ich glaube, ich habe die Stelle!«Gemeinsam führten wir ein Freudentänzchen auf, sodass der Küchentisch ordentlich ins Wanken kam und mit ihm das Mittagsgeschirr, welches noch darauf stand und wartete, bis es von Susanne abgewaschen wurde. Naserümpfend stellte sie sich nach unseren Gratulationen an die Spüle, ließ das Wasser einlaufen und begann mit dem Abwasch. »Das ist das Gute, wenn ich wieder arbeiten gehe«, knurrte sie mich an, »dann kann das wieder jemand anderer machen.« Dieser Jemand war die Mutter. Sie genoss es, wenn sie in Susanne Hilfe hatte, da sie sich oft nicht wohlfühlte. Kochen bereitete ihr weniger Probleme, aber nach dem Essen wurde sie schnell müde und legte sich auf das Kanapee, um die Mittagspause neben dem Vater zu verbringen, dem zwei Stunden vergönnt waren, zu essen und sich zu erholen, bevor er sich wieder auf den Weg zur Bank machte, um das Geld der wohlhabenden Baden-Badener Gesellschaft zu verwalten. Manchmal durchzuckte ihn der Neid, wenn er die Zahlen sah, mit welchen diese Leute jonglieren konnten. Sich Häuser bauen ließen, Wohnungen und Apartments in den besten Gegenden kauften oder sich die schnittigsten Automobile anschafften, die es am Markt gab. Da konnte er nicht mithalten. Nicht als Alleinverdiener, der auch noch seine erwachsenen Kinder miterhalten musste.Kurz nach dem Vorstellungsgespräch kam die Absage für Susanne. Man hatte sich für die andere Dame entschieden, welche mit ihr in die engere Auswahl gekommen war. Dies war der nächste Tiefschlag für Susanne nach dem Verschwinden des Herrn Puchwein und davon sollte sie sich nicht mehr erholen. Nie wieder ging sie zu einem Vorstellungsgespräch und nie wieder trat sie eine Stellung an. Unser Vater Karl Ludwig übernahm ihre finanziellen Verpflichtungen. Er ahnte früh, dass dies so bleiben würde. So wie er realisierte, dass Susanne wohl nie eine gewisse Selbstständigkeit erreichen würde, sah er mich heranwachsen und entdeckte auch bei mir enttäuschende Schwachstellen. Neben der Schwerhörigkeit hatte ich wie Susanne meine Empfindlichkeiten. Ich konnte es nicht leiden, wenn man mich barsch anfuhr. Auch wenn die Laute sehr gedämpft in meinen Gehörgang drangen, so erkannte ich doch an der Körperhaltung, was vor sich ging. Der Vater versuchte, mich bei der Sparkasse unterzubringen. Man nahm mich zur Probe, aber aus dem angestrebten Lehrvertrag wurde nichts. Schließlich durfte ich Akten einsortieren, Post zwischen den Filialen und den Schaltern hin und her tragen, Adressen aufkleben, Dokumente stempeln und was sonst noch so an Arbeiten anfiel, für die man keine besonderen Begabungen vorweisen musste. Ich spürte, wie man sich hinter meinem Rücken lustig machte und wie Vati sich hin und wieder für mich schämte. Er versuchte, mich anzuspornen, in der Freizeit das Bankwesen zu lernen. Das deckte sich gar nicht mit meinen Vorstellungen von einem erfüllten Berufsleben. Was ich mir genau vorstellte, konnte ich aber nicht sagen. Vor der Bank hatte ich kurz bei einem Bäcker gearbeitet, allerdings war diese Arbeit körperlich zu anstrengend. Das frühe Aufstehen, Herumschleppen der Mehlsäcke und Kneten der Teige überstieg meine Kräfte bei Weitem. So kam Vater auf die Idee mit der Bank, obwohl er eigentlich wissen musste, dass auch dies nicht in meiner Begabung lag. Aber die Hoffnung, dass aus seinem Sohn etwas Ordentliches würde, war wohl größer.
Es war mein Verhängnis, dass ich der Sohn des Kassierers war und deshalb offiziell irgendwie unter Schutz stand. Man schikanierte mich wohl auf Grund dessen hinter seinem Rücken. Manchmal gab man mir falsche Aufträge und wenn ich diese dementsprechend ausführte, gab es peinliche Belehrungen. Selten konnte ich beweisen, dass man mich aufs Glatteis geführt hatte, und wurde dafür ausgelacht. Oder man tuschelte in meinem Beisein, da man ja wusste, dass ich nicht gut hören konnte, was mich tief kränkte. Aber ich bemühte mich weiterhin, alles zur Zufriedenheit aller auszuführen, besonders des Vaters. Und doch litt ich sehr unter diesem lauernden, mitleidlosen Testen meiner Grenzen. Bis der Tag kam, an dem ich nicht mehr konnte.
»Kengelbach!«, schallte es durch die Schalterhalle. Mein Vater war an diesem Tage nicht anwesend, da er auf Schulung in Freiburg war. Also blieb nur ich übrig, der mit diesem barschen Ausruf gemeint sein konnte. Was auch daran zu erkennen war, dass dem »Kengelbach« der »Herr« fehlte.»Wo haben Sie die Akten von Herrn Freimüller hingeräumt?«
Herr Fuchs, der besonders boshaft sein konnte, wenn er einen schlechten Tag hatte, stand in seiner Bürotür, die Brille vorne an der Nasenspitze, damit er über dem Gestell die Halle mit seinen trüben Augen absuchen konnte. Ich hatte soeben der Kassiererin die Wechselscheine gebracht und blickte zu Herrn Fuchs hinüber.
»Kengelbach, haben Sie gehört, ich brauche die Akten von Freimüller!«, brüllte dieser nochmals. Ich schluckte diese Aufforderung mit einem heißen Aufwallen meines Blutes runter. Die Tonlage hatte mich in Aufruhr versetzt und ich begann zu zittern. Schon seit einer Weile konnte ich die Befehle von Herrn Fuchs kaum mehr ertragen. Dazu das bedauernde Grinsen von Fräulein Schneider, welche mir die Wechselscheine aus der Hand riss.
»Schauen Sie halt im Keller nach, Herr Kengelbach«, meldete sich der Kreditsachbearbeiter Huber. Es war mein Pech, dass in diesen Minuten keine Kunden im Schalterraum standen.»Also bitte, holen Sie jetzt die verdammten Akten«, ließ sich Herr Fuchs wieder vernehmen, nachdem ich mich nicht sofort in Bewegung gesetzt hatte. Angestachelt von meiner Wut, die trotz des harten Schluckes von vorhin weiter in mir brodelte, stapfte ich die Stufen in den Keller hinunter und schimpfte vor mich hin. Vor allem schimpfte ich mit mir selbst, weil ich mir diese Behandlung gefallen ließ und mich nicht endlich zur Wehr setzte. Diese Hilflosigkeit führte dazu, dass ich jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit musste, Magenschmerzen bekam. Und Vati wollte ich mich nicht anvertrauen, da ich in seinen Augen immer wieder sehen konnte, wie peinlich ihm meine Schwächen waren.Die Mutter war auch keine Stütze. Sie riet mir durchzuhalten, wenn ich mich in besonders verzweifelten Stunden an sie wandte. Diese Bürde sollte der Vater nicht auch noch übernehmen müssen, ängstigte sie sich. Aber durchhalten, bis wann? Bis in alle Ewigkeit? Bis ein anderer kam, den man statt mir schikanierte? Bis neue Angestellte kamen? Bis Vater von selbst dahinterkam, wie man mit mir umsprang?
Während ich die Akten suchte, stellte ich mir diese Fragen. Der dunkle, staubige Keller belastete mich zusätzlich. Eigentlich war es ja ein wunderschöner Raum mit einem Kreuzgewölbe und sichtbaren Ziegelsteinen. Einzig die modernen Stellagen verschandelten diese Architektur. Meine Nerven waren schon zum Zerreißen gespannt und dies steigerte sich noch, als ich die Akten nicht und nicht fand. Schon zum fünften Mal suchte ich die Regale ab. Eigentlich waren sie ja alphabetisch geordnet, aber vielleicht hatte ich sie aus Versehen woanders hingestellt. Nachdem mir klar geworden war, dass sie nicht zu finden waren, machte ich mich auf den Rückweg in die Schalterhalle. Als ich die letzte aus dem Keller heraufführende Stufe erreichte und langsam die Tür öffnete, hörte ich Herrn Fuchs laut lachen.»Und falls er heute noch hier auftaucht aus der Kellergruft da unten, jage ich ihn nochmals hinunter. Bis dann habe ich die Akte schon durchgearbeitet und er kann sie morgen einordnen.«
Herr Huber und Fräulein Schneider lachten mit. Inzwischen war Schalterschluss und jetzt wussten die drei, dass sie bei ihren lächerlichen Spielen nicht mehr von Kundschaft gestört wurden. Bei mir riss eine Schnur. Dieser feine Herr jagte mich garantiert nirgends mehr wie einen Hund umher. Ich stürmte an Herrn Fuchs vorbei in dessen Büro, schnappte die Akten, die Briefe, Dokumente, Schreibutensilien, kurz alles, was sich auf dessen Schreibtisch befand, und schleuderte die Sachen an die Wand und auf den Boden. Dazu schrie ich aus Leibeskräften meine Wut heraus und beschimpfte die drei Sparkassenangestellten auf das Wüsteste. Ich fuhr ihnen ordentlich in die Parade, sodass ihnen das Lachen im Halse stecken blieb. Hilflos sahen sie der Raserei zu und wussten nicht, wie sie dieser Einhalt gebieten sollten. Fräulein Schneider kam schließlich auf die Idee, den Direktor anzurufen, welcher im Eiltempo aus dem dritten Stock herunterkam.»Herr Kengelbach, Herr Kengelbach«, trat er beschwichtigend auf mich zu. Ich erkannte ihn zum Glück noch, bevor ich den Locher, welcher sich in meiner Hand befand, nach ihm werfen konnte. Daraufhin fing ich an zu schluchzen. Meine ganze Wut brach in Verzweiflung zusammen.»Na, na, Herr Kengelbach«, versuchte Direktor Götz, mich zu beruhigen, und nahm mich an der Schulter. »Ich bringe ihn jetzt nach Hause«, sagte er zu den anderen. »Und wenn ich wiederkomme, erklären Sie mir ausführlich, was hier passiert ist.« Die drei nickten verschreckt.In seinem Arm untergehakt, machte ich ein paar unsichere Schritte und dann waren wir auf dem Weg zu seinem Auto. Trotz der kurzen Strecke fuhr er mich nach Hause. Wohl um danach umso schneller wieder in der Bank zu sein.
Die Mutter fiel natürlich aus allen Wolken, als sie die Wohnungstür öffnete. Sie sah von meiner schluchzenden Gestalt zum Direktor und wieder zurück und konnte die Situation nicht einordnen.»Ich bringe Ihnen Ihren Sohn, Frau Kengelbach«, sagte Direktor Götz bestimmt. »Es gab einen Vorfall in der Bank. Am besten besprechen Sie das mit ihm und Ihrem Mann. Ich muss sofort wieder zurück!«
Mutti nahm mich in Empfang und brachte mich gemeinsam mit Susanne in mein Zimmer.»Mach Tee, Susi!«, befahl die Mutter. Sie zog am Anzugärmel, als ich keine Anstalten machte, mich zu entkleiden. Auch das Hemd knöpfte sie mir auf und stülpte das Pyjamaoberteil über meinen Kopf, wie sie es früher gemacht hatte, als ich noch ein kleiner Junge war. »Die Hose ziehst du aber selbst aus«, sagte sie finster und ging in die Küche. Der Teekessel vibrierte leicht auf der Gasplatte und im Sieb lag lose der Kamillentee. Ausgerechnet Kamillentee!»Ach Susi«, seufzte die Mutter. »Kamillentee kann Rolfi doch nicht ausstehen«.
Diese schaute sie mit großen Augen an. Man sah den Schrecken darin, welcher sie bei meinem Auftauchen durchfahren hatte, so erzählte es mir die Mutter später.
»Gib mir den Melissentee raus.« Mutti tauschte die beiden intensiv riechenden Teesorten aus und goss das kochende Wasser darüber, nachdem der Kessel zu singen begonnen hatte. Auf dem blaugeblümten Tablett trug sie die Kanne, eine Tasse und eine Schüssel Honig zu mir ins Zimmer. Dort lag ich unter dem großen Federbett und rührte mich nicht.»So, Junge, jetzt trinkst du mal den Tee und dann warten wir, bis Vati nach Hause kommt. Spätestens um acht müsste er hier sein, wenn er den Zug rechtzeitig erreicht hat.« Sie stellte das Tablett auf den Nachttisch und zog sich geräuschlos zurück.»Was wohl passiert ist?«, fragte Susanne vom Wohnzimmerdiwan aus.»Das wird der Vati schon herausfinden«, antwortete die Mutter und widmete sich wieder ihrer Zeitschrift. Susanne vertiefte sich in ein Kreuzworträtsel und beide hingen schweigend ihren Gedanken nach, die alle möglichen Szenarien entwarfen.Die Uhr tickte an der Wand. Eine originale Schwarzwalduhr, auf die der Vater besonders stolz war. Ein schmales Häuschen mit einem Schindeldach, darunter das Fenster, aus dem zu jeder vollen Stunde der Kuckuck rausgeschossen kam und mit seinem Rufen die Uhrzeit bekannt gab. Das Ziffernblatt mit den römischen Zahlen war eingebettet zwischen zwei weiteren Fenstern, darunter eine Alpenszene. Die Pendel waren Tannenzapfen nachgebildet. Jeden Abend vor dem Schlafengehen zog der Vater die Uhr mit liebevollen Handgriffen auf. Das war für alle das Zeichen, sich für das Bett fertig zu machen. Keiner kam jemals auf den Gedanken, länger sitzen zu bleiben, wenn er dies tat.Um halb acht ertönte die Uhr mit einem Glockenschlag und gleichzeitig hörten Susanne und die Mutter, wie sich der Schlüssel im Schloss drehte. Beide setzten sich mit angehaltenem Atem kerzengerade auf. Vati schloss die Tür hinter sich, stellte seinen Aktenkoffer neben die Garderobe, zog den Mantel aus und hängte ihn an den Haken. Seinen Hut legte er auf die Ablage und schlüpfte aus den Schuhen.»Ahhhh«, entfuhr es ihm, als er in seine weichen Pantoffel schlüpfte. Zuerst ging er ins Bad und wusch sich gründlich die Hände, ehe er ins Wohnzimmer schritt. Dort sah er in die angespannten Gesichter der Frauen.»Guten Abend«, begrüßte er sie. Und nach kurzem Innehalten: »Ist etwas passiert?«
Die Mutter fing sofort an zu schluchzen und Susanne stimmte mit ein.
»Rolfi ist von Herrn Götz nach Hause gebracht worden«, kam es stockend aus Mutters Mund. »Wir wissen nicht, was vorgefallen ist. Herr Götz hat sich nicht geäußert, und Rolf mussten wir sofort ins Bett legen.«
Der Vater runzelte die Stirn und rückte seine Brille zurecht. »Auch das noch«, murmelte er. Als er resolut an meine Zimmertür klopfte, rührte ich mich nicht, selbst dann nicht, als der Vater ins Zimmer polterte. Die dicke Federdecke blieb als Schutzhülle über mir liegen und Vater wollte nicht daran zerren. So zog er sich wieder zurück und setzte sich mit einem lauten Seufzer in seinen geliebten Ohrensessel. »Morgen ist es noch früh genug, wenn wir dann die Geschichte erfahren«, sagte er, ohne in die neugierigen Gesichter der Frauen zu blicken. Dann nahm er die Zeitung und vergrub sich dahinter.Wenn ich so darüber nachdenke, spüre ich noch immer das weiche Federbett auf mir und wie geborgen und beschützt ich mich darunter fühlte. Fern von diesen bösen Arbeitskollegen, fern von der traurigen Mutter, fern vom strengen Vater, fern von der mitleidigen Schwester. Vor allem fern von der Welt und ihren hohen Ansprüchen. Ich wollte weder den Tee trinken, noch dem Vater Rede und Antwort stehen. Einfach für immer und ewig unter dieser flauschigen Decke liegen bleiben, was auch noch länger der Fall gewesen wäre, wenn ich nicht doch irgendwann gegen Morgen den Gang auf die Toilette hätte antreten müssen. Beim Zurückschleichen erwischte mich dann der Vater. Verschlafen trat er aus der Schlafzimmertür. Im Flur standen wir uns gegenüber.»Erzähl jetzt«, herrschte er mich an. »Die halbe Nacht konnte ich kein Auge zutun bei dem Gedanken, was mich heute in der Bank erwartet.«»Du weißt doch, dass sie mich immer von A nach B schicken, wenn es ihnen gerade lustig ist«, brachte ich stotternd heraus. »Und gestern habe ich es einfach nicht mehr ausgehalten. Wieso soll ich Akten aus dem Keller holen, die längst auf dem Schreibtisch liegen? Der Herr Fuchs kann mich einfach nicht leiden und ich ihn auch nicht. Ich will ihn nie wiedersehen. Und heute schon gar nicht.«
»Was heißt das?«, fragte der Vater streng. »Gehst du heute nicht zur Arbeit?«





























