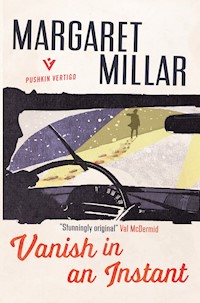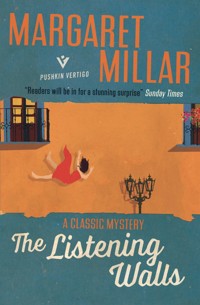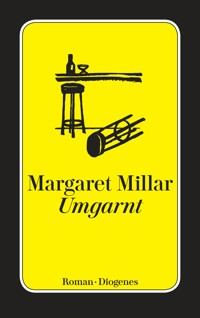7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
»In einem Ferienhaus an der amerikanischen Pazifikküste wird eine Familie aus der Ferienruhe aufgestört: Die attraktive Hausbesitzerin erscheint, um Überreste ihrer dunklen Vergangenheit zu beseitigen. Sie hat es abgesehen auf Vater und Tochter, und beide drohen ihrer Faszination zu erliegen – durchaus im wörtlichen Sinne übrigens, denn die geheimnisvolle Fremde kann nicht lieben, sie hat ein ›Kannibalenherz‹.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Margaret Millar
Kannibalen-Herz
Roman
Aus dem Amerikanischen von Jobst-Christian Rojahn
Diogenes
{5}Einem alten Freund, großartigen Kritiker und überaus phantasiebegabten Angler:
Harry E. Maule
{7}1
Ungefähr hundert Meter vom Haus entfernt, in südlicher Richtung, begann der Wald, in dem Luisa zufolge die Teufel hausten. Einige von ihnen waren in dem alten Brunnen eingeschlossen, der längst versalzt und unbrauchbar geworden war und den man mit einem Betonklotz abgedeckt hatte. Die anderen lebten in dem Swimmingpool, über den Bretter gelegt waren, damit sie nicht entfliehen konnten.
Jessie versuchte, einen Blick auf die Teufel zu erhaschen, indem sie sich bäuchlings auf die Holzplanken legte und durch ein Astloch spähte. Drinnen aber war alles schwarz und nur ein leise raschelndes Geräusch zu vernehmen.
»Ich glaube, ich höre was«, sagte Jessie.
»Das sind sie.« Luisa, die neben ihr auf den Planken saß, umschlang ihre Knie und wiegte sich in wilder Freude vor und zurück. »Wenn du nicht aufhörst, mich dauernd zu nerven und mir ständig nachzulaufen, lasse ich sie raus. Ich werd ihnen sagen, sie sollen sich in dein Zimmer schleichen, wenn du schläfst.«
»Das würdest du nicht wagen.« Aber Jessies Protest war schwach. Sie wußte sehr wohl, daß Luisa dazu imstande war. Sie hatte außerdem das unangenehme Gefühl, daß die Teufel, wenn es da im Wald wirklich welche gab, Luisa {8}gehörten und ihr auch gehorchen würden. Luisa war von einem Schleier des Geheimnisses umhüllt. Obwohl erst fünfzehn Jahre alt, war sie schon anders als andere Menschen, und Jessie respektierte diesen Unterschied und verachtete ihn und fürchtete sich auch ein klein wenig vor ihm. Luisa hatte wilde, dunkle Augen, die sie so weit nach oben verdrehen konnte, daß nur noch das Weiß der Pupillen sichtbar war, so daß sie wie geschälte Trauben aussahen. Sie konnte die Augenlider mit einem Druck ihrer Daumen umstülpen, und wenn sie sich in der Küche ihr langes schwarzes Haar kämmte, dann sprühten Funken daraus hervor und im Radio fing es an zu knistern und zu krachen. Auch Luisas Familie war ein bißchen geheimnisvoll. Ihre Mutter, Carmelita, sprach nur Spanisch – manchmal so schnell und laut, daß Jessie die Ohren schmerzten – und ihr Vater, Mr. Roma, hatte eine Haut, die so dunkel und faltig war wie eine Walnuß, und weißes, widerspenstiges Haar, das er mit einem Filzhut niederhielt, in dessen Hutband zwei Häherfedern steckten.
»Luisa, bist du eigentlich wirklich eine Mexikanerin?«
»Halb.«
»Und was ist die andere Hälfte?«
»Als wenn du das nicht wüßtest.«
»Ich weiß es nicht.«
»Für ein Kind von fast neun Jahren weißt du ziemlich wenig.« Luisa stand auf und streckte sich und gähnte mit allen Anzeichen des Gelangweiltseins, aber ihr Gesichtsausdruck verriet Jessie doch, daß sie schon wieder beleidigt war. »Es gibt noch andre grausige Dinge in dem Wald da, von denen du nichts weißt, Jessie Banner.«
»Das glaube ich nicht.«
»Du wohnst hier nicht so wie ich.«
{9}»Jetzt schon. Wir bleiben in Kalifornien, bis die Schule wieder anfängt und …«
»Trotzdem bist du immer noch nur ein Mieter. Ich wohne schon hier, seit das Haus gebaut wurde, und das war praktisch bevor du geboren wurdest. Ich weiß alles darüber und über Mrs. Wakefield.«
Jessie bewegte sich und seufzte. So machte Luisa das immer, wenn sie beleidigt war – sie verlockte einen dazu, Fragen zu stellen, und dann beantwortete sie diese Fragen nur halb oder auch gar nicht. Und sie mußte unbedingt nachfragen, denn die Verlockung war einfach zu groß. »Wer ist Mrs. Wakefield?«
»Das wirst du bald genug erfahren. Sie kommt her, um ein paar von ihren Sachen abzuholen, die sie dagelassen hat. Vielleicht heute, vielleicht auch erst morgen. Mein Vater hat einen Brief von ihr bekommen. Sie wird in Billys Zimmer wohnen.« Luisa stemmte mit übertriebener Geringschätzung die Fäuste in die Hüften. »Und jetzt, nehme ich an, willst du wissen, wer Billy ist.«
Jessie schüttelte den Kopf und versuchte, gänzlich desinteressiert auszusehen. »Ist mir doch egal. Du machst das ja sowieso mit Absicht.«
»Was mach ich, um Himmels willen?«
»Das. Ich kenne jede Menge Billys in der Schule, Dutzende.« Das stimmte. Da, wo sie zur Schule ging, nämlich in New York, war Billy ein sehr weitverbreiteter Name. Sie konnte aber nicht verstehen, warum er, wenn er aus Luisas Mund kam, so aufreizend klang. Wenn Luisa ihn aussprach, dann war er wie eines jener Wörter, welche auf den Toiletten oder auf dem Spielplatz zu einem geradezu explosionsartigen Gekicher führten.
Gleichgültigkeit vorspiegelnd, kletterte Jessie von den {10}Holzbrettern herab und fing an, den Schmutz von ihren aufgeriebenen Knien zu kratzen. In nur zwei Wochen hatte sie sich mehr Kratzer, Schnitte und blaue Flecken zugezogen als zu Hause in einem ganzen Jahr, und ihre Beine und Arme waren übersät mit roten, juckenden Flecken, von denen Mr. Roma behauptete, es seien Flohstiche. Das hatte Evelyn, ihre Mutter, ziemlich schockiert, und sie hatte darauf bestanden, daß es sich bloß um Mückenstiche handle, erschienen ihr die doch weitaus schicklicher. Nicht doch, meinte Mr. Roma, es habe wegen der Trockenheit schon seit drei Jahren keine Mücken mehr hier gegeben. Nur Flöhe, klein wie Stecknadelspitzen und genauso scharf und stark.
Jessie bearbeitete einen der Stiche mit ihren Fingernägeln, bis der Schmerz schließlich größer war als das Jucken. »Was sind das für grauslige Dinge da im Wald?«
»Du würdest zu Tode erschrecken, wenn du’s erfahren würdest, Jessie Banner.«
»Ich doch nicht.«
»Du darfst es keinem Menschen weitersagen, versprich mir’s beim Blute deines Bruders.«
»Ich versprech’s.«
»Also gut. Es ist ein toter Mann.«
»Wie, hier? Unter diesen … diesen Brettern?«
»Du bist wirklich blöde. Da würde er doch verwesen. Du gehst wohl doch besser nach Hause zu deiner Mutter und spielst mit deinen Puppen.«
»Ich hasse Puppen«, log Jessie voller Inbrunst. »Ich spiele nie mit Puppen. Wo ist der tote Mann?«
»Das würdest du gern wissen, was?« Luisa lief durch das raschelnde Laub davon und stieß dabei tiefe, unheimlich-stöhnende Laute aus.
{11}»Luisa, warte doch! Luisa?«
Aber Luisa versteckte sich hinter einem Baum und antwortete nicht auf Jessies Rufe.
Jessie sah sich sehr sorgfältig zwischen den Bäumen um und hoffte, hinter einem von ihnen ein Stückchen von Luisas Kleid entdecken zu können oder durch das plötzliche Gekreisch eines Hähers oder das Davonschießen der Eidechsen, die im Gebüsch Zuflucht suchten, einen Hinweis auf ihr Versteck zu erhalten.
Aber alle Bäume standen reglos da und verleugneten Luisas Gegenwart. In der Ferne murmelte das Meer, und unter den Planken, die das trockene Schwimmbecken bedeckten, kamen gedämpfte Geräusche hervor wie von kleinen, unbenennbaren Wesen, die da unten im Staube kicherten.
Sie hielt sich die Ohren zu und fing an zu laufen. Als sie den Rand der Klippe erreichte, war das Gemurmel des Meeres zu Gebrüll angeschwollen, das alle anderen Laute übertönte. Sie hielt an, rang nach Luft und hielt ihren Arm fest auf ihre stechende Seite gepreßt.
Von hier aus konnte sie das dünne graue Band des Rauchs sehen, der aus dem Küchenschornstein aufstieg, und auch die scheunenartige Garage, über der Luisa und ihre Eltern drei Zimmer bewohnten – sehr aufregend, nicht wie andere Menschen, die gezwungen waren, in ganz gewöhnlichen Häusern zu wohnen.
Aus der Ferne betrachtet hatte es den Anschein, als ob das große steinerne Haus wie durch ein Wunder direkt aus dem Felsen herausgewachsen sei. Natürlich wußte sie nur zu gut, daß es nicht gewachsen war. Es war erbaut worden, hatte Luisa ihr gesagt, und Mrs. Wakefield hatte dann darin mit jemandem namens Billy gewohnt, der keine {12}Ähnlichkeit mit den Billys hatte, die Jessie von der Schule her kannte.
Sie beugte sich vor und spähte über den Rand der Klippe, um die schwarzglänzenden Kormorane zu beobachten, wie sie von ihren Nestern in den Nischen der Felswand auf das Meer hinausflogen und nach Fischen tauchten. Aber plötzlich waren ihr diese großen und gefräßigen Vögel zuwider, und es erschien ihr überhaupt alles fremd und ungeheuerlich – das Meer und das graue Haus, die Flohstiche an ihren Beinen und der drohende Wald hinter ihr. Sie wünschte, sie wäre zu Hause und ginge mit einer ihrer Tanten im Central Park spazieren oder führe in der überfüllten Untergrundbahn, wo so viele Menschen so überaus lebendig waren, daß man sich Tote gar nicht vorstellen konnte. Ihr Gesicht verzog sich, als wolle es – ganz ohne sie um Erlaubnis zu bitten – zu weinen anfangen. Sie selbst weinte nie, vor allem dann nicht, wenn die Möglichkeit bestand, daß Luisa sie heimlich beobachtete.
Sie stand auf und strich sich ihr glattes blondes Haar aus der Stirn. Dann lief sie in Richtung auf das Haus los, wobei sie fröhlich und so laut, wie sie nur konnte, vor sich hinpfiff – für den Fall, daß sich Luisa in Hörweite befand.
{13}2
Die Staubkörner trafen Evelyns Gesicht wie Nadelstiche, und ihr braunes Haar, das ihr gegen den Hals geweht wurde, fühlte sich an wie Stroh.
»Das nächste Mal sollten Sie einen Hut aufsetzen«, sagte Mr. Roma. »Mrs. Wakefield trug immer einen, wenn sie in die Stadt fuhr, einen Strohhut mit Krempe. Sie hatte eine sehr helle Haut.«
Er wich schwungvoll einem Schlagloch aus, so daß die Kartons mit den Lebensmitteln über den Rücksitz rutschten und die in Eis eingepackten Milchkannen schepperten und gluckerten.
»Auf dieser Straße«, sagte er, »ist es wie in der Wüste. Man muß sich schützen.«
Trotz der Hitze trug er eine schwere, bis zum Hals zugeknöpfte karierte Wolljacke und einen tief in die Stirn gezogenen Filzhut, so daß nur im Nacken ein wenig von seinem weißen Haar sichtbar war. Er hatte Augen wie aus braunem Plüsch und einen vollen, sinnlichen Mund, der zitterte, wenn er von Gefühlen ergriffen wurde – aber es war in der Hauptsache das vorzeitig weiß gewordene Haar, dem Mr. Roma sein würdevolles Aussehen verdankte. Evelyn erschien er wie ein britischer Oberst, den eine tropische Sonne tief gebräunt hatte. Es hatte sie überrascht, als er ihr sagte, daß er Mulatte sei.
{14}»Vielleicht kann ich ja«, sagte Mr. Roma, »am nächsten Samstag dann allein zum Einkaufen fahren.«
»O nein, mir macht das Einkaufen wirklich Spaß.«
»Das ist nicht unbedingt eine Stadt, die was zu bieten hätte«, sagte er in einem halb entschuldigenden, halb hoffnungsvollen Ton. Marsalupe war die einzige Stadt, die er genau kannte, und obwohl er sich ihrer Beschränkungen sehr wohl bewußt war, lag ihm doch auch daran, daß sich andere Menschen anerkennend über sie äußerten, zumal wenn es sich um Fremde aus dem Osten handelte. »Es gibt keine Delikatessen.«
»Ich mag Delikatessen gar nicht so«, sagte Evelyn mit einem schwachen Lächeln.
»Sie können jederzeit Sachen aus Los Angeles kommen lassen. Mrs. Wakefield tat das manchmal. Einmal Palmherzen in der Dose. Mr. Wakefield hatte plötzlich Lust darauf. Das ist eine große Köstlichkeit. Verglichen mit Palmherzen ist Kaviar was ganz Ordinäres.« Nach einer kleinen Weile fügte er hinzu: »Von dieser Kurve hier sind’s nur noch anderthalb Meilen. Man kann das Meer schon riechen.«
Evelyn konnte das Meer noch nicht riechen, obwohl sie angestrengt Luft durch die Nase einsog, Mr. Roma zuliebe, der sich immer so äußerte, als verfüge er, was das Meer und das auf der Klippe darüber erbaute Haus anbetraf, über eine Mehrheitsbeteiligung, die ihm das Sagen sicherte.
»Riechen Sie’s nicht, Mrs. Banner?«
»Nein, noch nicht so richtig. Das ist eigentlich kein Geruch, eher so ein Gefühl auf meiner Haut.«
»Ich riech’s ganz deutlich.«
»Da. Ich glaube, jetzt ich auch. Ja, ganz sicher.«
{15}Evelyn mochte niemanden enttäuschen. Es war eben dieser Charakterzug, der einige ihrer Freunde denken ließ, sie sei willensschwach. Und einmal hatte ihr Mark anläßlich eines seiner Ausbrüche vorgehalten, sie sei schwächlich, sie habe eine schwächliche Persönlichkeit und einen schwächlichen Kopf. Manchmal – und vor allem, wenn sie morgens aufstand und noch nicht ganz wach war – fühlte sie sich in der Tat schwächlich, wie ein losgelöst dahinschwebender Nebelfleck. Wenn sie sich aber erst einmal den Schlaf aus den Augen gewaschen hatte, dann sah sie sich selbst durchaus als ein Wesen von einiger Substanz, und wenn sie dann in das angrenzende Schlafzimmer hinüberging, um Jessie beim Anziehen zu helfen, dann fühlte sie sich so klar und scharfkantig und hart wie ein Diamant.
Tatsache war, daß Evelyn – wie schon seit eh und je – auch mit ihren zweiunddreißig Jahren noch ein überaus praktisch denkendes Geschöpf war. Und es erwies sich eben oft als sehr praktisch, sich so zu verhalten, daß sich Leute wie Mark oder Mr. Roma gut fühlten. Deshalb roch sie jetzt das Meer und erklärte Mr. Roma, daß sie sich bereits ganz erfrischt fühle.
Mr. Roma war sehr angetan, daß die heilsamen Eigenschaften seines Ozeans anerkannt wurden, und er fuhr mit so schwungvoller Grandezza um die nächste Kurve, daß sich Evelyn mit beiden Händen an die Tür klammern mußte, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren, und die Lebensmittel, Milchkannen und Bücher für Mark in geräuschvoller Einigkeit zur anderen Seite des Jeeps hinüberrutschten.
Seit acht Jahren unternahm Mr. Roma nun schon diese samstäglichen Einkaufsfahrten nach Marsalupe. Es waren kaum neun Meilen, aber nur wenige Menschen benutzten {16}diese Straße, weshalb man sie in ihrem jämmerlichen Zustand beließ. Während der Regenzeit pflegte Mrs. Wakefields schwerer Lincoln bis zu den Radkappen im Schlamm zu versinken, während der Trockenzeit aber war die Straße staubig und voller Schlaglöcher, und es gab da eine abschüssige Strecke von etwa einer Meile, auf der unerwartet auftauchende Felsbrocken den Reifen des alten Lincoln zusetzten und seine alternden Federn marterten. Nach dem Krieg hatte Mrs. Wakefield dann einen gebrauchten Jeep gekauft, der über die Straße dahinjagte wie ein niemals ermüdendes oder kleinzukriegendes Kind. Als Mrs. Wakefield vor einem Jahr ganz plötzlich abgereist war, hatte sie Mr. Roma diesen Jeep hinterlassen.
Jeden Monat erhielt Mr. Roma einen Scheck von Mrs. Wakefields Bank, der sein Gehalt und notwendig werdende Reparaturen am Haus abdeckte. Er und Carmelita hatten zusammen das Haus für einen neuerlichen Bezug instandgehalten, erwarteten sie doch jederzeit eine Nachricht von Mrs. Wakefield, daß sie und Billy heimzukehren gedächten. Aber die einzigen Lebenszeichen, die er von ihr hatte, waren zwei Briefe, der erste von Billys Kinderschwester:
Lieber Mr. Roma,
Mrs. Wakefield schrieb mir und bat mich, das Haus einem Immobilienmakler hier in San Diego anzuvertrauen. Sie möchte, daß Sie bleiben, bis der Verkauf perfekt ist. Das kann nun sehr lange dauern, wegen der Trockenheit, die sich ja auf die Wasserversorgung auswirkt, aber auch, weil das Haus so abgelegen ist, müssen die meisten Menschen doch raus und sich ihren Lebensunterhalt {17}zusammenkratzen – gerade so wie ich! Mrs. Wakefield und Billy sind vor drei Monaten aus Port-au-Prince zurückgekommen, aber sofort wieder zu einer Kreuzfahrt die Küste hinunter aufgebrochen. (Ein komischer Zufall wollte, daß sie mit der Eleutheria fuhren, meines Wissens das letzte Schiff, das der arme Mr. Wakefield zu konstruieren half. Das Leben ist schon merkwürdig, nicht wahr?) Meine besten Wünsche für Sie und Carmelita, und sagen Sie Luisa, daß ich ihr für ihre Prüfungen alles nur erdenkliche Gute wünsche.
Norma Lewis
P.S. Ich habe gerade mit dem Immobilienmenschen gesprochen, und der meint, daß keinerlei Aussicht bestünde, das Haus zu verkaufen, bevor sich nicht etwas an der Wassersituation geändert habe – ich nehme an, daß er wohl Regen damit meint. In der Zwischenzeit aber hat er die Möglichkeit, es möbliert zu vermieten, nur über den Sommer, an irgendwelche Leute aus New York, Mann, Frau und schulpflichtiges Kind. Der Mann hat irgendwas mit dem Verlegen von Büchern zu tun, und die Bankauskünfte sind gut. Er ist bereit, für die Zeit bis zum 15. September 2000 Dollar zu zahlen (Sie und Carmelita natürlich eingeschlossen). Ich meine, daß das in Anbetracht der Nachteile des Hauses ein gutes Angebot ist. Jedenfalls habe ich dem Makler grünes Licht gegeben. Ich nehme an, daß das so in Ordnung geht, obwohl ich meine, daß es netter wäre, wenn Mrs. Wakefield engeren Kontakt zu mir hielte!
N.L.
{18}Eine Woche nach dem Einzug der Banners war der zweite Brief eingetroffen. Es handelte sich um eine kurze Notiz von Mrs. Wakefield selbst, die Mr. Roma mitteilte, daß er mit ihrer Rückkehr in ein oder zwei Wochen rechnen solle, und daß sie »einige Dinge zu klären« gedenke.
»Noch ein Hügel«, sagte Mr. Roma und schaltete in den zweiten Gang zurück. »Vielleicht möchten Sie anhalten und den Ausblick bewundern?«
»Einen Augenblick, ja.«
»Mrs. Wakefield ist schon überall gewesen, in fast allen Ländern, und sie sagt, daß man hier an dieser Stelle den wundervollsten Blick der Welt habe.«
Evelyn lächelte erneut. Sie konnte nicht anders als sich über Mr. Romas sanfte Eindringlichkeit zu amüsieren, über seinen Ausdruck unschuldigen Ernstes. »Vielleicht empfindet sie ja eine so große Liebe zu diesem Ort, weil sie hier zu Hause ist.«
Mr. Roma warf ihr einen durchdringenden Blick zu. »Von so einer Liebe kann gar keine Rede sein.«
»Dann muß sie außergewöhnlich sein.«
»Außergewöhnlich, o ja. Sie ist eine wirkliche … wirkliche Herrin.« Er ging unbeholfen mit dem Wort um, als sei ihm sehr wohl bewußt, daß es veraltet sei, er aber kein besseres finden würde, um es an seine Stelle zu setzen.
»Ist sie hübsch?«
»Manche Menschen sind dieser Auffassung. Das ist Ansichtssache. Sie hat schöne Augen und Haare – rotes Haar, ziemlich dunkel.«
Er hielt den Jeep oben auf dem Hügel an. Die Straße wand sich unter ihnen durch ein Gehölz riesiger Eukalyptusbäume. Jenseits der Bäume leuchtete die See blau und silbern, und die Klippen liefen im Zickzack die Küste {19}entlang. Diese Felsenklippen erstreckten sich, so weit das Auge reichte – eine steinerne Wildnis, nur hier und da ein Haus oder eine Rauchsäule, die auf ein Haus schließen ließ, das bewohnt war. Keine Menschenseele war zu sehen – überhaupt keinerlei Bewegung, das Meer ausgenommen. Aber aus dieser Höhe sah selbst die See schwerfällig aus, und die weißen Wellenkämme krochen träge am Strand dahin.
»Da draußen gibt es eine Insel«, sagte Mr. Roma, aufs Meer hinausdeutend. »Zwanzig Meilen oder so.«
»Ich kann sie nicht sehen.«
»Heute nicht, es ist zu dunstig. Aber an manchen Tagen kann man sie ganz deutlich erkennen.«
Sie dachte sofort an Jessie und wie sehr sie sich wünschen würde, diese Insel zu besuchen und zu erkunden.
»Das wäre ein großer Spaß, wenn man eines Tages da mal hinfahren könnte, sich in Marsalupe ein Boot leihen …«
»Dort gibt’s keine Landungsmöglichkeit.«
»Aber wie können die Menschen dann da leben?«
»Da lebt niemand. Es gibt keine Menschen auf der Insel, weil’s kein Wasser auf ihr gibt.«
»Wasser«, wiederholte Evelyn. Noch nie in ihrem Leben hatte sie anders an Wasser gedacht als an etwas, das höchst bereitwillig – kalt oder warm – aus einem Wasserhahn kam. Aber hier draußen war es ständiger Gesprächsstoff, und wohin sie auch blickte, wurde sie daran erinnert: Die außer Betrieb gesetzten Duschen; der große Bottich unter dem Ausguß in der Küche, in dem Carmelita das Spülwasser auffing, um es später als Gießwasser für das Gemüse zu benutzen, mit Spülmittel und allem; die umfriedeten Blumenbeete, leer und von der beständig {20}scheinenden Sonne zu hartem Ton gebrannt; und der Rasen, der so trocken und spröde war, daß er unter den Füßen knisterte. Wenn der Regen einsetzt, sagten die Leute, oder Wenn die Trockenzeit vorbei ist. Das Zeitmaß waren hier Becher und Gallonen.
Als sie durch das Eukalyptusgehölz kamen, wurde das Haus sichtbar. Es war ein geräumiges Haus, solide und wirtschaftlich aus Adobeziegeln und den Steinen dieser Gegend gebaut. Für Evelyn aber hatte es etwas merkwürdig Irreales an sich, als ob die Menschen, die dort gewohnt hatten, eine kleine, dichtgefügte Gruppe gebildet hätten, völlig unabhängig von der Außenwelt, der Tageszeitung, dem Radio und dem Briefträger. Natürlich kam die Tageszeitung – mit ein- bis zweitägiger Verspätung – wurde die Post gebracht, gab es ein Radio im Wohnzimmer. Aber trotzdem war der Eindruck der Isoliertheit so stark, daß Evelyn stets zögerte, bevor sie das Radio anstellte, und dann, wenn es angestellt war, schnell das Interesse verlor. »Wir werden noch zu Lotosessern werden«, hatte Mark gesagt, und es stimmte, daß sie tagaus, tagein gänzlich vom Haus, vom Meer und von den Wäldern in Anspruch genommen wurden. Jedes andere Leben erschien ihnen immer weiter entfernt.
Die wichtigsten Zimmer des Hauses lagen zum Meer hinaus, aber auf der Rückseite gab es eine riesige Küche, in der Carmelita kochte, die Romas ihre Mahlzeiten einnahmen und ihre freie Zeit verbrachten. Nach Norden zu lag der aus zwei Zimmern und Bad bestehende Anbau, der jetzt unbewohnt war. Dieser Flügel war ein wenig anders als der Rest des Hauses, und Evelyn bemerkte erst heute, als Mr. Roma den Jeep vor der Küchentür parkte, worin dieser Unterschied bestand.
{21}»Das ist ja komisch«, sagte sie. »Das ist mir noch nie aufgefallen.«
»Was?«
»Die Fenster erinnern mich an ein Gefängnis.«
Mr. Roma lächelte und meinte, das sähe wirklich so aus, bot aber von sich aus keine Erklärung an für den feinen Maschendraht, der ganz unauffällig vor allen Fenstern angebracht war.
Es gelang Evelyn, zugleich schwach und hartnäckig auszusehen. »Was mag wohl jemanden veranlassen, Fenster wie diese da in einem Haus einzubauen?«
»Es ist wegen Billy. Mrs. Wakefield hatte Angst, Billy könnte mal eine Fensterscheibe kaputt machen und sich verletzen.«
»Sie gehört wohl zu den überängstlichen Müttern.«
»Muß sie wohl.« Mr. Roma betätigte die Hupe, um Carmelita herbeizurufen, damit sie half, die Einkäufe ins Haus zu schaffen.
»Ich kann ja ein paar von den Sachen mit hineinnehmen«, sagte Evelyn.
»O nein, danke. Carmelita hilft mir immer dabei. Carmelita ist sehr kräftig.«
Der Hupe Folge leistend, trat Carmelita auf die rückwärtige Terrasse heraus. Sie war eine dicke, eigensinnige Frau mit den gleichen wilden schwarzen Augen wie Luisa. Sie trug offene Sandalen an den Füßen und hatte ein rotes Seidentuch um ihren Kopf gewickelt. Luisa bestand darauf, daß ihre Mutter sich ein bißchen modisch zurechtmachte, und hatte ihr beigebracht, wie man sich die Haare zu Locken aufdrehte. Carmelita wollte ihrem Wunsch entsprechen, und deshalb legte sie sich einmal wöchentlich die Haare ein und wand ein Tuch darum. Tuch und {22}Lockenwickel blieben dann eine Woche lang unangetastet. Das war Carmelitas Art und Weise, Luisa zu Gefallen zu sein, ohne sich selbst dabei allzu großen Mühen unterziehen zu müssen. Und niemand konnte behaupten, sie sähe nicht modisch aus – mit all diesen Locken!
Trotz ihres Gewichts hatte Carmelita einen stolzen, geschmeidigen Gang und trug das Haupt voller Geringschätzung hoch erhoben. Die Wahrheit war allerdings eher, daß sie sich vor Menschen fürchtete, die nicht ihre Sprache sprachen. Manchmal wurde ihr der Hals ganz steif vor Angst, aber sie erzählte nie jemandem davon.
»Carmelita ist stark wie ein Pferd«, sagte Mr. Roma voller Stolz. »Ist’s nicht so? He?«
Carmelita schenkte ihm ein kurzes, ungeduldiges Lächeln, hob zwei Milchkannen aus dem Jeep und schritt zurück in die Küche. Mr. Roma folgte ihr mit dem größeren der Kartons. Während Evelyn die Bücher vom Rücksitz sammelte, konnte sie hören, wie die beiden in einem abgehackten Spanisch miteinander sprachen. Eine Minute später kam Mr. Roma wieder heraus. Er hatte sich seine Brille aufgesetzt, die ihm Carmelita höchstselbst in dem Billigladen in Marsalupe ausgesucht hatte. Er sah Evelyn über den Rand der Brille hinweg an. »Ich habe einen Brief bekommen. Mrs. Wakefield kommt heute oder morgen.«
»Das ist schön.«
»Sie wird Sie nicht stören. Sie schrieb, ich sollte Ihnen das ausrichten.«
»Sie soll uns willkommen sein«, sagte Evelyn wahrheitsgetreu. »Bringt sie ihren kleinen Jungen mit?«
»Nein«, – Mr. Roma nahm den Hut ab und rieb sich den tiefroten Striemen auf seiner Stirn – »der kleine Junge ist tot.«
{23}Später, als alles verstaut war, als die Papiertüten zusammengefaltet und die Schnüre für eine spätere Wiederverwendung um einen Pappstreifen gewickelt waren, ließ sich Mr. Roma in dem Schaukelstuhl neben dem Küchenfenster nieder, las den Brief laut vor und übersetzte ihn für Carmelita.
Als Datum war Montag, der 14. Juni angegeben, und das waren drei Tage vor dem Datum des Poststempels – als ob Mrs. Wakefield, nachdem sie den Brief geschrieben hatte, gezögert hätte, ihn abzuschicken.
Lieber Mr. Roma,
ich dachte, daß es vielleicht besser wäre, noch etwas ausführlicher auf meine letzte Nachricht an Sie einzugehen. Als ich zurückkehrte und erfuhr, daß Mr. Hawkins das Haus vermietet hatte, war ich ziemlich verärgert. Aber was geschehen ist, ist geschehen, und ich nehme an, daß es auch nicht von Schaden sein kann, noch etwas Geld zu verdienen, während ich auf den Verkauf warte. Es beunruhigt mich, daß noch so viele Sachen von mir im Haus herumliegen und den Leuten im Weg sind, die wahrscheinlich ihre eigenen Bilder, Decken usw. mithaben …
»Haben sie nicht«, bemerkte Carmelita kurz. »Die haben nichts als Bücher mit. Bücher und Kleider.«
»Das weiß sie ja nicht.«
… Ich komme am Samstag oder am Sonntag mit dem Auto hinauf. Mr. Hawkins hat mir geraten, mir eine eigene Aufstellung des Inventars zu machen. Das scheint mir ein gräßlicher Umstand zu sein, aber ich muß in jedem Fall {24}einmal kommen, um ein paar meiner ganz persönlichen Besitztümer abzuholen, die ich im Haus zurückgelassen habe, zum Beispiel den Schrankkoffer mit den Spielsachen und Kleidern in Billys Zimmer, und das Kamelienbäumchen in dem Kübel (wenn es nach diesem schrecklichen Jahr überhaupt noch am Leben ist), und Dinge wie meine Schallplatten und die Noten in der Klavierbank …
»Alles Märsche«, sagte Carmelita. »Alles schnelle Eilmärsche.«
Mr. Roma nickte. Er kannte alle Märsche auswendig, die Mrs. Wakefield auf dem Klavier gespielt hatte. Sie spielte sie stets gekonnt und laut, während Billy am Boden neben ihr saß und Kopf und Arme in einer eigentümlich hilflosen Weise bewegte, als wollte er den Takt halten.
… Dieses Inventurgeschäft kann mich ein paar Tage kosten, vielleicht auch eine Woche. Wenn diese Leutchen nichts dagegen haben, daß ich in Billys altem Zimmer schlafe, dann kann ich mit Ihnen und Carmelita zusammen essen. Ich freue mich, Sie beide wiederzusehen, wenngleich das auch schmerzlich sein wird. Wir haben schon so viel zusammen durchgemacht. Vielleicht werden alle wahren Freundschaften von Tränen genährt, aber für die unsere gilt das wohl ganz besonders – Johns und Ihre und Carmelitas – Billy war der einzige von uns, der niemals weinte …
Carmelitas Unterlippe fing an zu zittern, und sie wandte sich ab und wischte sich die Augen mit dem Saum ihrer Schürze.
{25}… Ich wollte Ihnen das eigentlich nicht hier in meinem Brief mitteilen, aber ich nehme an, daß es gleichgültig ist, wie ich es Ihnen sage. Billy ist tot. Er starb ganz plötzlich vor drei Wochen. Er war neun Jahre und achtundzwanzig Tage alt. Ich weiß, daß er jetzt in besseren Händen ist, als meine es je sein konnten.
Janet Wakefield
Lange saß Mr. Roma mit dem Brief in der Hand da und starrte aus dem Fenster, während Carmelita in ihre Schürze weinte und in der Küche auf und ab, hin und her schlurfte.
»Ich mußte die Kamelie verbrennen, von der war ja nichts mehr übrig, nur noch kahle Ästchen«, sagte Mr. Roma schließlich. »Sie wird enttäuscht sein.«
Die Kamelie war gestorben – nicht plötzlich, sondern mit langsamer und gewisser Endgültigkeit. Die erschöpften Knospen fielen ab, verschrumpelten, bevor sie sich noch hatten öffnen können, und dann wurden die Blätter schwarz und fielen, eines nach dem anderen.
{26}3
Es gehörte zu einer der neueren Entwicklungen Jessies, daß sie, wenn sie sich fürchtete, nicht mehr zu ihrer Mutter oder ihrem Vater lief, um sich trösten zu lassen, sondern daß sie das selber tat. Wenn sie ganz große Angst hatte, schloß sie sich in ihrem Zimmer ein und weinte in ihr Kopfkissen. War die Angst nicht ganz so groß, dann ging sie in das Zimmer ihrer Mutter und zog sich deren Kleider an. Die Spuren der Tränen wurden mit Rouge zugedeckt, und über ihren kleinen Mund malte sie ein sinnliches und erfahrenes Lippenpaar.
Als Evelyn nach oben ging, traf sie im Flur auf Jessie, die dort in einem rosafarbenen Nachthemd aus Satin und in grünen, hochhackigen Sandaletten auf und ab stolzierte.
»Das ist mein bestes Nachthemd«, sagte Evelyn.
»Ich mach’s ja nicht kaputt.«
»Es schleift aber auf dem Boden. Der Saum ist schon ganz schmutzig. Sieh mal.«
»Das ist guter, sauberer Schmutz«, wandte Jessie ein. »Nicht wie Teer oder Farbe oder so was.«
»Nun, ich meine, du ziehst dich jetzt besser wieder um und wäscht dir das Gesicht, wenn du schon mal dabei bist.«
»Aber ich hatte ja noch nicht mal Zeit, mich selbst {27}anzugucken. Ich möchte doch wissen, ob ich wie achtzehn aussehe.«
»Na, dann los. Wir sehen uns das mal beide an.«
Sie ging voran in Jessies Zimmer, und Jessie, durch die hohen Absätze freiwillig verstümmelt, klapperte und schlurfte hinter ihr her.
An der Innenseite der Tür von Jessies Zimmer war ein großer Spiegel angebracht.
»Seh ich wie achtzehn aus?«
»Nicht ganz.«
»Siebzehn?«
»So knapp siebzehn, denke ich.«
»Jedenfalls älter als Luisa«, sagte Jessie in bitterem Triumph.
Sie hielt die Arme über den Kopf, und Evelyn zog ihr das Nachthemd aus Satin über den Kopf, so daß ihr verschmutzter wollener Spielanzug wieder darunter zum Vorschein kam.
Jessie bürstete sich die Astchen aus dem Haar. Alle ihre Bewegungen waren schnell und kraftvoll, ganz wie die Marks – sie fing überhaupt an, Mark von Tag zu Tag ähnlicher zu werden. Im vergangenen Jahr hatte ihr Gesicht die rundlichen, babyhaften Konturen verloren, und ihre Nase schien größer geworden zu sein. Das war nun nicht mehr ein unbestimmtes Kindernäschen, sondern diese Nase hatte jetzt eine klar erkennbare Form erhalten und sah aus wie eine Miniaturausgabe derjenigen ihres Vaters.
»Wenn ich groß werde«, sagte Jessie nachdenklich, »dann werde ich Luisa herumkommandieren und ihr Lügengeschichten erzählen.«
»Wir werden aber nicht mehr hier sein, wenn du erwachsen bist.«
{28}»Ich kann ja aber immer wieder herkommen. Ich werde heiraten und dann meinen Mann dazu überreden, mit mir herzufahren.«
Evelyn lächelte, ein wenig besorgt. »Warum möchtest du denn Menschen belügen?«
»Weil.«
Jessie legte die Bürste nieder und fing an, sich mit einem Papiertuch den Lippenstift abzurubbeln. Sie rubbelte nicht sehr kräftig. Es bestand immer eine, wenn auch nur geringe Chance, daß ihre Mutter sie eine Spur davon behalten lassen würde. Jessie wußte selbst nicht, warum ihr dieser große, reife Mund so wichtig war, aber er war es. Sie fühlte sich besser damit, sehr viel eher in der Lage, mit Luisa und den Geheimnissen im Wald fertig zu werden.
»Glaubst du an Teufel?«
Evelyn schüttelte heftig den Kopf. »Natürlich nicht.«
»Ich auch nicht«, sagte Jessie ohne Überzeugung.
»Du nimmst besser etwas Seife. Wer hat dir von Teufeln erzählt?«
»Niemand.«
»War es Luisa?«
Stumm und verstockt heftete Jessie ihren Blick auf eine Fliege, die auf dem Spiegel saß und ihre Beinchen putzte.
»Du hast meine Frage noch nicht beantwortet, Jessie.«
»Du fragst immer so viele Fragen. Ich kann nicht alle beantworten. Ich bin doch kein Genie.«
Evelyn stieß einen ärgerlichen Seufzer aus. »Du brauchst kein Genie zu sein, um ja oder nein zu sagen.«
Jessie bewegte den Kopf so, daß die Fliege auf dem Spiegel erstaunlicherweise plötzlich auf ihrem linken Auge zu sitzen schien. Dann probierte sie es mit der {29}Fliege auf ihrer Nase, auf ihrem rechten Auge, mitten auf ihrem Mund.
»Du wirst neuerdings so widerborstig«, sagte Evelyn. »Ich verstehe das nicht. Wenn Luisa dich erschreckt hat, dann will ich das wissen, denn dann kann ich dafür sorgen, daß sie damit aufhört. Schließlich ist sie erst fünfzehn und hat kaum mehr Vernunft als du.«
Mark kam vom Flur herein. Er hatte in der Sonne gesessen und gelesen. Er trug seine Khakishorts und ein Handtuch um die Schultern, an denen sich die Haut abzupellen begann. Er war ein großer, entschlossen wirkender Mann mit hübschen, aber leicht unregelmäßigen Gesichtszügen und einem Ausdruck beherrschter Ungeduld. Obwohl schon achtunddreißig Jahre alt, wirkte er jünger, und das nicht zuletzt deshalb, weil er einen Bürstenschnitt trug – als Erinnerung an die Zeit, die er während des Krieges bei der Marine verbracht hatte.
»Was ist jetzt wieder los?« fragte er. »Streitet ihr beiden Mädchen euch wieder?«
Jessie warf ihm einen kurzen, kalten Blick zu. Sie mochte ihren Vater nicht, wenn er in diesen Shorts im Hause herumlief, denn er hatte Haare auf der Brust, die zwar seidenweich aussahen, sich aber wie Draht anfühlten. Für Jessie war dieses Haar etwas ziemlich Wunderbares und Geheimnisvolles und sollte besser bedeckt bleiben, außer natürlich, wenn ihr Vater schwimmen ging. Luisa hatte gesagt, daß viele Männer Haare auf der Brust hätten und daß das ein Zeichen sei. Sie wollte Jessie aber nicht sagen, wofür das ein Zeichen war, ihr plötzlicher Ausbruch von albernem Gekicher verriet dieser jedoch, daß es etwas war, worüber kleine Mädchen nicht zu sprechen hatten.
{30}»Ich hab nicht gestritten«, sagte sie mit finsterer Miene. »Ich habe nur ein Geheimnis bewahrt.«
»Mein Himmel, noch eins.« Mark rieb sich die Augen und gähnte. »Hast du die Bücher, Evelyn?«
»Einige. Nicht die, die du haben wolltest. Marsalupe kann kaum als die größte Metropole der Gelehrsamkeit westlich des Mississippi angesehen werden. Du sparst viel Zeit, wenn du sie telegrafisch anforderst.«
Noch immer schmollend, erkundete Jessie mit ihren Zähnen den Niednagel an ihrem rechten Daumen. Sie war sich schon seit einiger Zeit klar darüber, daß sich das Interesse, kaum daß ihr Vater das Zimmer betrat, fast unmerklich verlagerte, und zwar weg von ihr. Es schien, daß Evelyn die Schuld an dieser Verlagerung trug, denn immer, wenn Mark anwesend war, sah sie ihn stetig und intensiv an, als sei er gerade von einer langen Reise zurückgekehrt und müsse sogleich wieder aufbrechen. Jessie, für die nur noch Seitenblicke übrigblieben, fühlte sich vernachlässigt. Um Evelyns Blicke wieder auf sich zu lenken, trat sie gegen das Bein des Toilettentischchens – allerdings nicht sehr fest.
»Laß das sein«, sagte Evelyn. »Also, wie oft soll ich dir noch sagen, daß das nicht unsere Möbel sind.«
»Es sind Luisas, und deshalb ist es mir egal.«
»Nein, das sind auch nicht Luisas. Mark, sag du’s ihr.«
»Was soll ich ihr sagen?«
»Daß sie nicht gegen die Möbel treten soll.«
»Okay. Tritt nicht gegen die Möbel, Jessie«, sagte Mark, ihrem Wunsch nachkommend. »Tritt Luisa, wenn du schon treten mußt.«
»Um Himmels willen, Mark, sag bloß so was nicht zu ihr.«
{31}»Verflixt, ich mein’s aber ernst. Dieses Mädchen macht mich noch verrückt. Sie verfolgt mich, sie kommt plötzlich hinter Bäumen vorgekrochen, sie …«
»Vielleicht ist sie ja in dich verknallt.«
»Ich bin so alt wie ihr Vater.«
»Trotzdem.«
Wiederum diese Verlagerung der Aufmerksamkeit, dieser unsichtbare Faden, der Mark und Evelyn verband und den sie zwar durcheinanderbringen, nicht aber zerreißen konnte.
»Sie würde mich wiedertreten«, sagte Jessie und tastete nach dem Faden, um ganz sachte daran zu ziehen. »Und wie. Ach, ich hasse Luisa!«
»Warum?« fragte Mark.
»Darf ich nicht sagen. Luisa hat gesagt, daß ich’s nicht sagen darf.«
»Na los doch, Baby.«
Jessie schwieg einen Augenblick. »Sie hat gesagt, da wären Teufel in dem Wald, unter den Brettern vom Swimmingpool.«
Marks schnelles Stirnrunzeln ging an Evelyns Adresse. »Dieses Gör wird zu einer verdammten Plage. Du mußt mal mit ihr reden.«
»Habe ich schon.«
»Dann warst du nicht entschieden genug.«
»Ich hab’s versucht«, sagte Evelyn und sah verwirrt aus. Sie war nicht entschieden gewesen, natürlich nicht, aber sie hatte mehrfach und auf verschiedenen Wegen versucht, mit Luisa Freundschaft zu schließen. Das Mädchen war darauf jedoch nicht eingegangen, und Evelyn hatte es bald unmöglich gefunden, mit ihr zu sprechen. Manchmal, wenn sie hinter Jessie her zum Strand hinuntertobte, um {32}