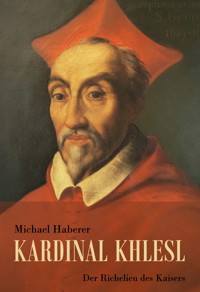
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Das Leben des Melchior Khlesl verläuft spektakulär. Geboren Mitte des 16. Jahrhunderts in Wien, bringt es der Sohn eines protestantischen Bäckermeisters zum katholischen Generalreformator in Österreich und wird Bischof von Wien. Später schafft er den Aufstieg zum Günstling-Minister des Kaisers und Kardinal. Der Emporkömmling wird zu einem gerissenen Staatsmann, der wie Richelieu für seinen Herrscher mit Vernunft und Intrige europaweit regiert. Die Herausforderungen sind gewaltig. Er streitet im Römisch-Deutschen Reich des Jahrzehnts vor dem Dreißigjährigen Krieg für Frieden und Verständigung der Glaubenslager. Zerstrittene Reichsstände, Ständeopposition in der Habsburgermonarchie, Türkenkrieg, Friauler Krieg, Jülicher Wirren, die Fehden der Habsburger untereinander, eine feindselige Machtelite und Attentate setzten ihm zu. Welche Chancen eröffneten sich Khlesl, um die Aufgaben zu meistern?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1182
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Einleitung
EIN GROSSER GESCHEITERTER
1.
AUFSTIEG ZUM HOFFNUNGSTRÄGER DES KAISERS
Zum blauen Esel
Wegweisende Wende
Paukenschlag in Wien
Der Plan Rudolphs II.
Hoffnungsträger des Kaisers
2.
AUFBRUCH UND WIDERSTAND
Die richtige Stelle
Die Religionsreformation
Trautsons Widerstand
Geistlose Schirmherren
Mangel und Psychologie
Geistliche Rivalen
Neue Erscheinungen
3.
GENERALREFORMATOR KHLESL
Der alte Harrach
Kirchliche Erneuerung
Im Namen des Kaisers
Weg der Mitte
Ohne ein Blutströpflein
4.
KAMPF UM DIE RELIGIONSREFORMATION
Das neue Joch am Hals
Versuche einer Wiederbelebung
Rom und Passau
Kleinkrieg und Pietas Austriaca
Gegenspieler Unverzagt
Krieg und Aufruhr
Ungeliebtes Bistum Wien
5.
STREBEN NACH POLITISCHEM EINFLUSS
Kampf um Passau
Gestaltungsmacht in Wien
Nominierung und Eklat
Höfische Machiavellisten
Ferdinands Triumph
Leopolds Zukunft
6.
KATHOLISCHES HOCH UND DYNASTISCHE TURBULENZEN
Katholischer Kampfgeist
Ende des Laienkelchs
Matthias’ Ambitionen
Historischer Bruderzwist
Ringen der Rivalen
Hofkirchens Schicksal
Eklat im Landhaus
Radikaler Ratschlag
7.
WEGE ZUM FAVORITEN
Chancen um Matthias
Heiratsmann Khlesl
Viktorien und Rollback
Gefährlicher Abstecher
Kaiserliches Donnerwetter
Falscher Appell
Rückkehr nach Wien
8.
FRIEDENSVERHANDLUNGEN UND STÖRMANÖVER
Standhaftigkeit und Realpolitik
Geheimvertrag der Erzherzöge
Spielraum für Interpretationen
Katholisches Bündnis
Verdächtige Ratgeber
Widersprochene Friedensverträge
9.
ZWEI WEGE
Kaiserliche Schikanen
Schauplatz Kaiserhof
Bayerische Windungen
Kriegsruhm und Kriegsnot
Kaiserlicher Anschlag
Katholische Stärkung
Auftakt zum Bruch
In der Höhle des Löwen
Ein Anflug von Bruderkrieg
10.
DURCHWACHSENE ERNTE
Triumph des Friedensfürsten
Hauskämpfe und Hofkräfte
Rettungsanker Bayern
Zahltage
Muskelspiel und Grabenkämpfe
Kapitulationsresolution
11.
GÜNSTLING-MINISTER KHLESL
Triumph der regen Geduld
Manöver der Rivalen
Weltliche Macht und göttliche Wunder
Kampfansage und Kapitulation
Abbitte der Erzherzöge
Leopolds Coup
Khlesls Einsicht
Vom Saulus zum Paulus
Beanspruchte Günstlingsmacht
12.
REICHSBÜHNE
Großer Auftritt in Nürnberg
Herrschertadel und Durchsetzungswille
Interregnum
Wahl zum Übergangskaiser
Arbeitseifer und Vorrangstreben
Spannungsfeld Regierung
13.
AMBITIONIERTE KAISERPOLITIK
Osmanische Karte
Diktat des religiösen Gewissens
Bund der Kaisertreuen
Kampfplatz der Böcke
Vergleichsversuche
14.
AUF DER SUCHE NACH STÄRKE
Orientierung in Linz
Finanzdschungel und Liebe zum Kaiser
Ausweg Türkenfrieden
Ringen um den Türkenfrieden
Friauler Krieg
15.
KOMPOSITION UND ZERWÜRFNIS
Geizkoflers Impulse und Khlesls Politik
Bischof Khlesl
Maximilians Zorn
Das Rotes Birett
Maximilians Wut
Khevenhüllers Mission
16.
KOMPLOTT
Widersacher Oñate
Königswahl in Prag
Tanz in Dresden
Unverständnis
Vorspiel zur Eskalation
Maximilians Teufel
Das große weite Meer
17.
STURZ UND HAFT
Anschläge und Sturz
Tage danach
Künste und Bubenstücke
Speisen auf Silber
Verospis Vorurteil
18.
GEFÄNGNIS UND ENDE
Benediktinerabtei St. Georgenberg
Stredeles Schrecken
Hoffnungszeichen aus Rom
Erfolg päpstlicher Diplomatie
Rom oder Wien?
Biblischer Josua und weltliche Sicherheit
Hoffnung auf Heimkehr
Augenmaß und Vernunft
Getrübte und glorreiche Erinnerungen
19.
MELCHIOR KHLESL STREITER UND TAKTIKER AUF VIELEN SCHAUPLÄTZEN
Der Richelieu des Kaisers
Der richtige junge Mann
Streben in die Politik
Zweischneidige Schläue
Familienkrise im Haus Österreich
Endlich Günstling-Minister
Vernunft und Kompromisspolitik
Individuelle Chancen
Hemmschuh Regierung
Feindselige Erzherzöge
Mord oder Gefangenschaft
Fordernde Machtelite
Imageprobleme
Ambitionierte Kaiserpolitik
Strategie, Taktik und Zufall
Siglen/Abkürzungen
Anmerkungen
Bibliografie
Namenregister
Einleitung
EIN GROSSER GESCHEITERTER
Das Leben des Melchior Khlesl verläuft spektakulär. Geboren in der Mitte des 16. Jahrhunderts in Wien, bringt es der Sohn eines protestantischen Bäckermeisters zum katholischen Generalreformator in Österreich unter der Enns und wird Bischof von Wien. Später schafft er den Aufstieg zum Geheimratsdirektor des Kaisers und Kardinal. Erst kämpft der Priester gegen den Protestantismus im eigenen Land. In den Jahren vor dem Dreißigjährigen Krieg streitet der Emporkömmling gegen den vorherrschenden Zug zur Gewalt zwischen Glaubenslagern und Potentaten für Frieden und Verständigung. Er wandelt sich angeblich vom „Ketzerhammer“ (Theodor Wiedemann) zum gerissenen „Machthandwerker“ (Golo Mann), also vom kompromisslosen Streiter für religiöse Werte zum intriganten Politiker ohne Werte. Er entkommt Attentaten, wird von Habsburgern entführt, in ein Tiroler Bergkloster gesteckt, nach Rom ausgeliefert, in der Engelsburg inhaftiert und vom Papst freigesprochen. Das Drama endet mit der Heimkehr eines um sein Andenken bemühten Kardinals.
An Khlesl scheiden sich die Geister. Er macht Karriere in einer sich aufheizenden politisch-religiösen Atmosphäre. Die Anstrengungen Rudolfs II., seine Länder seinem katholischen Glauben zu unterwerfen, eröffnen Khlesl die Gelegenheit für den Aufstieg. Seine Karriere steht im Zeichen zunehmender Konfrontation der Konfessionen. Das bietet viel Stoff, um geteilter Meinung über den Konvertiten Khlesl zu sein. Seine Zeit erlebt ihn einmal als Kopf der Katholisierung von landesherrlichen Städten und Märkten und dann als Realpolitiker, der einen Vergleich zwischen den konfessionellen Lagern im Römisch-Deutschen Reich sucht. Er regiert in einem der Zentren eines auf Krieg um Macht und Glauben zutreibenden Reichs. Die Spannungen in seinen Rollen an sich und in ihrer Kombination liefern viel Material für den Wunsch der Zeitgenossen und der Nachwelt, zu urteilen und zu verurteilen.
Als Erster in der Regierung von Kaiser Matthias dominiert er die Entscheidungen und die Regierungsarbeit des Kaisers weitgehend. Er regiert als einer der für die Höfe jener Zeit typischen Günstling-(Premier)Minister wie Lerma und Olivares in Spanien, Richelieu und Mazarin in Frankreich. In dieser Position muss er sowieso als Blitzableiter für den Unmut über Entscheidungen oder Unvermögen des Herrschers herhalten. Der Vorwurf des grenzenlosen Ehrgeizes ist eine Stereotype im Kampf gegen die Günstling-Minister. Khlesl bleibt davon nicht verschont.
Er gilt zudem als Strippenzieher im Bruderzwist zwischen Kaiser Rudolf II. und besonders Erzherzog Matthias. Im Finale, das teils zum Bruderkrieg wurde, lagen sich die Söhne Maximilians II. und ihre Vettern in Graz mehr oder weniger offen in den Haaren. Der österreichische Dramatiker Franz Grillparzer hat diesen Familienstreit der Habsburger Mitte des 19. Jahrhunderts in ein Trauerspiel gefasst. Der österreichische Nationaldichter weist Khlesl für seine Rolle in der dynastischen Krise eine wenig schmeichelhafte Rolle in seinem Theaterstück zu. Auch im wahren Leben erfährt Khlesl einen bühnenreifen Abgang. Seine Reichspolitik und seine Reaktion auf die Rebellion böhmischer, protestantischer Adeliger, auf den Fenstersturz in Prag passen einigen im Haus Österreich nicht. König Ferdinand II. und Erzherzog Maximilian lassen den Kardinal von der Bildfläche verschwinden.
Heinz Angermeier nannte Khlesl einen „großen Gescheiterten der Geschichte“. Angermeier beschäftigte sich Ende der 1990er-Jahre mit der Karriere Khlesls – insbesondere mit seinem Denken und Handeln als Reichspolitiker. Er suchte nach der Religiosität in Khlesls Politik und bemühte sich um eine Rehabilitierung des geschmähten Kardinals. Die Spielwiese für Angermeiers Gedanken hat zu einem guten Teil Joseph von Hammer-Purgstall geschaffen. Der Hofrat und Orientalist versuchte Mitte des 19. Jahrhunderts, dem Staatsmann Khlesl mit einer Biografie ein Denkmal zu setzen. In vier Bänden hat er Unmengen an Wissen, Interpretationen und Urteilen veröffentlicht. Gerade auf die Vielzahl von Originaldokumenten, die Hammer-Purgstall wiedergibt, stützen sich Angermeiers Gedankengänge.
Hammer-Purgstalls Interpretationen und Urteile boten Angermeier viele Reibungspunkte. Die erklärte Absicht des Orientalisten, den Staatsmann Khlesl zu glorifizieren, gerät im Zuge der biografischen Arbeit in einen abwertenden Strudel. Hammer-Purgstall war der Flut von Anfeindungen, Polemik und berechtigter Kritik an Khlesl nicht gewachsen. Andere Historiker nahmen den Stab auf. Die Kampfbegriffe aus höfischen Kleinkriegen und Glaubensstreit wurden zu Charakterzügen des historischen Khlesl. Er bekam das Image eines von niederen Motiven getriebenen Egomanen. „Herrschsucht“, „Habsucht“, „Rangsucht“, „Rachsucht“, maßloser Hass, überbordender Ehrgeiz, Geiz und Geldgier wurden zu den Triebkräften des verschlagenen Intriganten Khlesl erklärt. Angermeier bemühte sich zu Recht, die Verzeichnungen zu korrigieren.
Hammer-Purgstalls Urteile über Khlesl fanden bereits zeitnah eine biografische Reaktion. Anton Kerschbaumer, Theologieprofessor am Priesterseminar St. Pölten, fühlte sich getroffen und betroffen. Er glaubte, der „Karikatur“ des Orientalisten ein angemessenes Bild des „Restaurators des Katholizismus in Österreich“ entgegensetzen zu müssen. Schon mit der Schreibart des Namens – in der ersten Ausgabe Klesel, in der zweiten Klesl – distanzierte er sich von Hammer-Purgstall, der sich an die in den deutschsprachigen Quellen übliche Schreibweise Khlesl hielt. Kerschbaumer suchte, was für den idealen Erneuerer seiner Kirche sprach, und fand dafür andere Quellenpassagen als Hammer-Purgstall. Er schuf ein verklärendes Denkmal für einen vorbildlichen Kardinal. Die Biografien von Hammer-Purgstall und Kerschbaumer aus dem 19. Jahrhundert sind bislang die einzigen umfassenden Versuche, Persönlichkeit und Geschichte Khlesls zu fassen. Es folgten Dissertationen, Studien zu Aspekten seiner Laufbahn, Passagen in Werken zur Landes- und Reichspolitik wie auch Kurzbiografien.
In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg plante der Wiener Geschichtsprofessor Paul Müller eine Khlesl-Biografie. Müller hatte sich mit dem Jesuitenprediger Georg Scherer beschäftigt. Müller kannte Khlesls Zwist mit Jesuiten. Er wusste, dass Khlesls Handeln nicht jedem kritischen römisch-katholischen Blick standhält. Er motivierte einige seiner Studenten, über Khlesl zu promovieren. Einer von ihnen, Alois Eder, zog 1950 – nach Müllers Tod – eine Bilanz: Der Heilige, zu dem Kerschbaumer ihn habe machen wollen, sei Khlesl nicht gewesen – aber ein Großer. Ferdinand Krones reihte ihn Anfang der 1960er-Jahre als herausragenden Bischof in die Reihe der bedeutenden „Gestalter der Geschicke Österreichs“ ein. Der Neustart Österreichs nach dem Zweiten Weltkrieg verlangte nach positiven katholischen Größen. Die Rückbesinnung auf Religion und christliche Werte nach dem globalen Krieg war kein bloß katholisches und österreichisches Phänomen. Konfessionsübergreifend erfuhr das Kirchenleben in der westlichen, nicht kommunistischen Welt einen Aufschwung. Die Erinnerung an einen Kirchenmann wie Khlesl machte auch nicht an Österreichs Grenzen Halt. In München wurde 1947 eine Siegererstraße in Kleselstraße, nach dem Wiener Kardinal, umbenannt. Khlesl hatte in der bayerischen Hauptstadt gepredigt.
Der österreichische, katholische Historiker Johann Rainer konnte freilich nicht viel von Größe in Khlesls Karriere erkennen. Rainer arbeitete in den 1960er-Jahren mit den Quellen der römischen Kurie. Die römischen Botschafter am Kaiserhof, die Nuntien, und der Kardinalnepot in Rom beurteilten den Günstling-Minister Khlesl und seine Reichspolitik skeptisch bis ablehnend. Die Haltung der römischen Kurie beeinflusste bereits das Bild Khlesls in der Papstgeschichte Ludwigs von Pastor. Die Sicht Roms nährte Rainers Zweifel am Kirchenmann Khlesl. Die dokumentierten Untersuchungsergebnisse eines Sondernuntius zum Prozess gegen den gestürzten Günstling-Minister bestätigten ihn darin. Rainers Studie war allerdings für ein kleineres Fachpublikum gedacht.
Khlesls Reichspolitik trug viel zu seinem Bild in der Geschichtsschreibung über Österreich hinaus bei. Zwar krankt dieses Bild am Fehlen einer tiefer gehenden, wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Khlesls Handeln und Motiven. Trotzdem kommt kaum eine Arbeit über die Reichspolitik im Jahrzehnt vor dem Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges ohne teils bemerkenswert pointierte Urteile über seine Politik und seine Beweggründe aus. Khlesls Bemühungen um einen Ausgleich der konfessionellen Lager wurden wahrgenommen. Doch der Staatsmann Khlesl scheiterte. Damit spricht kein Erfolg für ihn. Dank seines Erfolges als französischer Staatsmann verfügt Richelieu bei aller Zwielichtigkeit und Unmoral über eine starke Lobby in seiner Nachwelt. Khlesl fehlt weitgehend dieses Publikum, das in unzähligen mehr oder weniger wissenschaftlichen Beiträgen, Studien und biografischen Büchern den Spuren des erfolgreichen Großen folgt. Zudem wirkte das Image des machtbesessenen Intriganten und gierigen Egomanen. Somit gerieten die Motive für seine Ausgleichspolitik in ein schlechtes Licht. Eine Friedenspolitik zu Khlesls Zeit als Günstling-Minister sorgte schon an sich für viele Beweggründe, den Politiker zu verteufeln. „Der Weg vom Friedenspolitiker und Vermittler zum vermeintlichen Verräter war oft kurz“, schreibt Ronald G. Asch zu Akteuren wie Khlesl. Gleichzeitig kann auch Asch sich nicht gänzlich der Interpretationen von Khlesls Politik, die in Verdächtigung und Denunziation gründen, verwehren.
Besonders an der Vielzahl an Urteilen über den schlechten und großen Khlesl arbeitete sich Angermeier ab. Allerdings fehlte dem Historiker ein belastbarer Überblick, wann Khlesl was in seiner Karriere getan hat und warum er im Konkreten sprach und schrieb, wie er es tat. Denn die Lust am Urteilen über Khlesl, dessen negative oder positive Strahlkraft haben nicht nur sein Image geprägt. Sie beeinflusste auch stark, wo und wann ihn die Historiker auf den unterschiedlichen Schauplätzen seiner Karriere ausgemacht haben. Gleichzeitig – und das vorweg – sind viele Äußerungen Khlesls kaum ohne sein jeweiliges Nahziel verständlich. Das verbindet Khlesl und Richelieu: Sie wählten ihre Worte nach Zweck und Adressat. Die Praxis, aus einzelnen Passagen seiner Schriftstücke ein umfassendes Verständnis seiner politischen Haltung und Religiosität zu entwickeln, ist damit höchst problematisch.
Die allgemein bekannten Stationen der Karriere Khlesls als Politiker hat Hammer-Purgstall entworfen. Doch der Orientalist war in seiner Forschung fixiert auf den Favoriten Khlesl, der für Kaiser Matthias regierte. Hammer-Purgstall suchte nach frühesten Zeugnissen für Khlesls bestimmenden Einfluss auf den Erzherzog. Entsprechend zielgerichtet interpretierte er Indizien. Er schuf damit die Voraussetzungen für einen Khlesl, der über 20 Jahre das Denken und Handeln des Gubernators, Königs und Kaisers Matthias bestimmte. Gerade die politische Geschichte folgte Hammer-Purgstall in diesem Punkt. Für die Zeit um die Jahrhundertwende entstand ein dominierender politischer Akteur Khlesl, den Zeitgenossen und Historiker sehen wollten oder der ihren Interpretationen der Entwicklungen in der Habsburgermonarchie um 1600 gelegen kam.
Viele Werke zu Rudolf II., Matthias und dem Bruderzwist leiden unter der zentralen Rolle, die Khlesl darin zugewiesen bekommt. Der Faden wurde von Kultur- und Kirchengeschichte weitergesponnen. Die Suche nach dem humanistischen Wissenschaftsfreund Rudolf II. und das Interesse an den altkirchlichen Selbstheilungskräften profitierten von der Figur Khlesl als umtriebiger Gegner Rudolfs II. und Gesicht der Katholisierung in Österreich. Robert Evans erklärte Khlesl zum „selbsternannten Erneuerer“ des Katholizismus in Niederösterreich. Doch ohne den Willen und die Macht Rudolfs II., ohne das kaiserliche Interesse an der Katholisierung seines Adels und seiner Untertanen hätte es keinen Generalreformator Khlesl gegeben. Wie der Kaiser und seine Berater als treibende Kräfte die kirchliche Karriere Khlesls ermöglichten, konnte ich bereits in meiner Arbeit zu Leonhard IV. von Harrach, der in den 1580er-Jahren bestimmende Minister (Geheimer Rat) des Kaisers in Wien, zeigen.
Eine distanzierte Erzählung der Karriereschritte Khlesls muss die Grundlage für Interpretationen und Urteile über Khlesl schaffen. Gedrucktes Quellenmaterial dazu ist genug vorhanden. Schon die schlichte und belegte Feststellung, wo Khlesl wann was getan, wann er welche Ämter bekleidet hat, führt recht schnell zu einer teils grundlegend anderen als üblichen Lesart seines Wirkens. Einzelne Aspekte in einem zeittypischen Zusammenhang darzustellen, eröffnet darüber hinaus der Wahrnehmung und Interpretation seines Denkens und Handelns neue Perspektiven. Aus dem Reigen der moralisierenden Urteile und Interpretationen möchte ich mich weitgehend heraushalten. Auf die einzelnen Irrtümer und Fehler in der Literatur soll nicht besonders eingegangen werden.
1. AUFSTIEG ZUM HOFFNUNGSTRÄGER DES KAISERS
Zum blauen Esel
„Ist eines Burgers Sohn allhie, sein Vater ist abgestorben, hat Melchior Khlesl geheissen.“ Melchior Khlesl
Melchior, Sohn des Wiener Bürgers Melchior Khlesl, verfasst im Jahr 1580 eine kurze Autobiografie1. Anlass ist sein Aufstieg zum Dompropst in Wien. Besondere Fähigkeiten, Ehrgeiz, die Aufmerksamkeit des Kaisers und ein Glaubenswandel haben den 27-jährigen Bäckersohn nach oben gebracht.
Sohn Melchior wurde in eine weitgehend evangelische Welt hineingeboren2. Als er am 19. Februar 1552 in Wien das Licht der Welt erblickte3, glaubten die meisten Städter in Österreich mehr oder weniger an die Lehren Luthers. Gerade jene, die etwas auf sich hielten, schworen auf den evangelischen Glauben. Vater Melchior, Bäckermeister und Wiener Bürger, wie auch seine Gattin Margarethe hingen dem neuen Glauben an. Ihre Söhne wuchsen darin auf. Er habe seine Eltern bekehrt, hält Dompropst Melchior in seiner Vita fest. Vater und Mutter auf den religiös rechten, nämlich römischkatholischen Weg gebracht zu haben, empfindet er als Teil seiner Erfolgsgeschichte.
Melchior hatte einen jüngeren Bruder namens Andreas. Von ihm sind nur wenige Spuren erhalten geblieben. Wahrscheinlich hatte Melchiors Überzeugungsgabe auch bei Andreas gewirkt. Im Jahr 1582 stand er im Dienst des Bischofs von Freising, Ernst von Bayern. Dompropst Khlesl setzte sich bei den Wittelsbachern für ihn ein4. Andreas soll sich erhängt haben5. Allerdings stammt diese Information von einem bissigen Protestanten aus einer Zeit, als sich der Günstling-Minister Khlesl reichsweit zum roten Tuch für Strenggläubige jeder Couleur aufgeschwungen hatte.
Familie Khlesl wohnte in der Kärntner Straße. Ihr Haus, das sie 1557 kauften, trug den Namen „Zum blauen Esel“6. Ein Khlesl aus einem Haus mit dem Namen Esel lud natürlich geradezu ein zum Spott. 1598 tauchte der Name „Allwo der Esel in der Wiege liegt“ auf. Zu diesem Zeitpunkt hat Khlesl sich als katholischer Generalreformator bereits einen Namen gemacht. Im Bild der Eselswiege könnte der Hohn seiner Glaubensgegner stecken. Von Khlesls Geburtshaus ist heute nichts mehr zu sehen.
Das Einmaleins übte der Bäckersohn in der Bürgerschule zu St. Stephan. Hier hat er bei dem Schulmeister Georg Muschler „seine principia gelernet“. Professor Muschler lehrte Dialektik an der Universität Wien und unterrichtete den Nachwuchs der Wiener Bürger. Der Professor führt uns mitten hinein in die humanistisch-religiöse Welt im Zentrum der Habsburgermonarchie. Die kulturelle Atmosphäre wogte zwischen angespannt und tolerant. Professor Muschler lebte von der geistigen Offenheit im Wien der Renaissance. In der Hofburg residierte Ferdinand I., Begründer der deutschen Linie des Hauses Österreich. Ferdinand I. war in einer katholisch-mediterranen Welt aufgewachsen. Er zeigte sich wenig empfänglich für den neuen Glauben mit deutschnationalen Zügen. Ferdinand I. trug 1552 den Titel eines Königs des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation, des Römisch-Deutschen Reichs und regierte als Herrscher der Habsburgermonarchie die habsburgischen Erbländer sowie die Königreiche Böhmen und Ungarn. Sein Bruder Karl V. herrschte als Kaiser und als König von Spanien über ein Weltreich.
Ferdinand I. war ein frommer Katholik. Er schätzte den Glauben seiner ruhmreichen Ahnen. Immerhin waren die Habsburger, das Haus Österreich oder die Casa de Austria in diesem katholischen Glauben zum mächtigsten Fürstenhaus der Christenheit aufgestiegen. Ferdinands herrschaftlicher Anspruch wie auch sein religiöses Selbstverständnis forderten, seine Untertanen vor dem eingerissenen Irrglauben zu bewahren. Trotzdem verfolgte er als römisch-deutscher König Mitte des Jahrhunderts eine Ausgleichspolitik. Er wollte die Protestanten gütlich in die alte Kirche zurückholen und damit die Einheit des Reiches erhalten. Karl V. war ebenfalls kein Glaubenskrieger. Er war in einem humanistischen und undogmatischen Katholizismus erzogen worden. Um ihn tummelten sich radikal Altgläubige, Humanisten wie auch reine Machttechniker. Der Kaiser praktizierte eine mehrgleisige Politik zwischen konfessioneller Härte und Entgegenkommen.
Wie wenig für Kaiser und König mit Gewalt zu erreichen war, erfuhren die Habsburger im Aufstand der protestantischen Reichsfürsten. Die bewaffnete Reaktion auf Karls katholische Machtpolitik nötigte den Kaiser zur Flucht und brachte seinem Bruder die Rolle des Vermittlers ein. Unter ihm gelang im Jahr 1555 der Augsburger Religionsfriede. Er sollte ein Schritt auf dem Weg zu einer neuen christlichen Einheit sein. Geregelt wurde erst einmal, wie man die Krise politisch in den Griff zu bekommen gedachte. Diese politische Ordnung sollte Luft verschaffen, um das konfessionelle Auseinanderdriften des Reiches zu stoppen. Am Königshof hoffte man auf eine Via regia, einen versöhnlichen Königsweg, auf dem die Christen im Reich wieder zusammenfinden könnten. „Christliche Vergleichung“ hieß die irenische Zauberformel dafür.
Ferdinand I. regierte als Landesherr unter etwas anderen Voraussetzungen. In den habsburgischen Erbländern von der Steiermark bis in den Sundgau besaß er mehr Macht, Recht und religiöse Pflicht, die Untertanen bei seinem Glauben zu halten. Er sprach immer wieder Verweise gegen die protestantischen Ambitionen seiner Edelmänner und Bürger aus. Viel mehr passierte aber nicht. Ferdinand I., seit 1558 auch Kaiser, zeigte sich gnädig. Seinem Sohn Maximilian ging dieses Entgegenkommen aber nicht weit genug. Der Thronfolger sympathisierte offen mit dem neuen Glauben. Maximilian II. suchte im protestantisch-humanistischen Milieu nach Lehrern für seine Söhne und legte deren Erziehung zum Leidwesen seines Vaters in die Hände von eben jenem Georg Muschler. Dieser Professor galt als „sektisch“7. Professor Muschler prägte die ersten schulischen Schritte Melchiors. Dann schickten ihn die Eltern nach Wels im österreichischen Land ob der Enns (heute Oberösterreich).
In Wels besuchte Melchior den Unterricht des Prädikanten Melchior Walther. Dieser war wohl der Erste seines Zeichens in Wels und hat laut Khlesl die ganze Stadt lutherisch gemacht8. Der Bäckersohn kam bei einem Gutsverwalter namens Michael unter. Melchior stand in Michaels Diensten und betete täglich in der Schlosskapelle9. Michael war für die Güter des Andreas von Polheim, Schlossherr in Wels, verantwortlich. Freiherr Andreas stammte aus einem alten Adel, der als Fundament des politischen Landes, der Landschaft galt. Die Polheim bewegten sich im Spannungsfeld von treuer Gefolgschaft gegenüber dem Haus Österreich und Selbstbewusstsein altadeliger Landleute. Andreas war wie sein Bruder Paul Martin im neuen Glauben aufgewachsen. Aber Andreas diente den Habsburgern als Rat und Kriegsmann. Er war seinem König und Patron Ferdinand I. besonders verpflichtet. Paul Martin dagegen trieben lutherisches Gewissen und adelige Selbstbestimmung an die Seite der Gegner der Habsburger im Schmalkaldischen Krieg. In der Schlacht von Mühlberg wurde er 1547 von Kaiserlichen gefangen genommen und musste Abbitte leisten.
Die beiden Polheim werfen ein kleines Schlaglicht auf das Miteinander von höchsten landesherrlichen Ämtern und neuem Glauben im landsässigen Adel. Ihr Großvater Martin hatte äußerst prominente Stellen am Hof Maximilians I. bekleidet und sich in der internationalen Welt der Höfe bewegt. Vater Cyriak Polheim von Wartenburg amtierte als Obersthofmeister Ferdinands I. und als Landeshauptmann. Cyriak entdeckte den neuen Glauben für sich. Dessen mächtigsten Förderer kamen meist aus dem landsässigen Adel und gingen am Hof in Wien ein und aus. Sie besaßen einflussreiche Posten in Regierung und Verwaltung der Habsburgermonarchie. Sie gehörten zur Machtelite. Diese Adeligen hatten oft viel von Europa gesehen, hatten im Reich und Italien die Universitäten besucht. Wenn sie im Dienst des Landesherrn oder der Stände in die Residenzstädte kamen, wohnten sie in ihren Stadtpalais. Sie hörten das Wort Gottes von eigenen protestantischen Predigern, die sich auch der Bevölkerung annahmen. Damit beeinflusste sie den Glauben der Städter ungemein. Wie die Habsburger schwelgten sie im humanistisch-italienischen Glanz und bauten Schlösser im Stil der Renaissance. Manche von ihnen waren dank habsburgischer Gunst auf dem Weg zu schwerreichen Aristokraten. Offenheit für den neuen Glauben und Mitglied eines nach dem erklärten Willen des Herrschers katholischen Hofes schuf ein besonderes religiöses Klima in ihren Reihen. Die neugläubigen Würdenträger und Ratgeber versuchten meist, so reibungslos wie möglich mit ihren katholischen Kollegen auszukommen. Sie heirateten ihre Töchter und lebten das altkirchliche Protokoll der Zeremonien und Feste am Hof. Viele von ihnen, wie auch ihre katholischen Kollegen, Verwandte und Freunde sahen in der Glaubenshaltung eine Privatsache, die das Miteinander nicht belasten musste.
Das neue Bekenntnis oder die „Augsburgische Konfession“ ließ den Gläubigen in Wien viele Freiheiten. Die einfachen Menschen nahmen hauptsächlich den Laienkelch – den Wein für die Laien im Abendmahl – und die deutsche Sprache im Gottesdienst wahr. Die Grenzen zum alten Glauben waren fließend. Eine religiös liberale Atmosphäre lockte viele Freigeister nach Wien und machte die Residenzstadt zum Tummelplatz ganz unterschiedlicher Spielarten des neuen Glaubens. Die in der Freiheit florierende Vielfalt amüsierte und grauste den radikalen Katholiken Georg Eder, Reichshofrat und Rechtsgelehrter an der Universität Wien. Jeder evangelische Prediger mache seine eigene Religion, spottete Eder10.
Wegweisende Wende
„Allda er bei der löblichen Universität Lectiones gehört, sich daneben beflissen, wo er konnte, die katholische Religion und derselben Anhänger zu verunglimpfen und zuverfolgen, auch ihnen allerlei Spott zuzufügen.“ Melchior Khlesl
Pennäler Melchior spottet und lästert nach Herzenslust über die Katholiken. Diese Jugendsünde hält Dompropst Melchior in seiner Vita fest. Wahrscheinlich ziehen die meisten seiner protestantischen Mitschüler im Hochgefühl ihres angesagten neuen Glaubens über die zurückgebliebenen Altkirchler her. Schüler demonstrieren damit wohl auch die sozialen Unterschiede. Es sind oft die Ärmeren, die beim alten Glauben bleiben.
Mit 14 kehrte Melchior heim und besuchte die Oberstufe in der Bürgerschule St. Stephan. Er habe vor allem Diesseitiges im Kopf und bald keine Lust mehr auf Schule gehabt, erinnerte er sich. Im Alter von etwa 17 Jahren erlebte Melchior eine wegweisende Wende. Er entdeckte den römisch-katholischen Glauben für sich. Der neue religiöse Geist in seinem Leben wuchs in einer Zeit, als sein Vater starb oder im Sterben lag. Khlesl brachte den Kurswechsel mit einer schicksalhaften Begegnung in Verbindung. Er hatte die Jesuiten erlebt. Die Protestanten interpretierten dagegen seine Konversion ganz profan und verächtlich. Die Backstube sei Khlesl zu wenig gewesen, lästerten sie später. Wegen der ersehnten Karriere sei er vom wahren Glauben abgefallen.
Einige Väter des jungen jesuitischen Ordens waren im Jahr 1551 nach Wien gekommen11. Sie folgten dem Ruf Ferdinands I. in seine vielleicht 25.000 Einwohner zählende Residenzstadt. Der König setzte große Hoffnungen in die Gesellschaft Jesu. Er brauchte sie, um der katholischen Lehre an der Universität und dem altgläubigen Schulunterricht wieder auf die Beine zu helfen. Die Elementar- und Lateinschule der Jesuitenväter bestach durch die Qualität des kostenlosen Unterrichts und erfreute sich schnell großer Beliebtheit – auch bei protestantischen Familien. Ferdinand I. lag eine gute Lehre für die kommenden Priester am Herzen. Denn der Verfall der katholischen Geistlichkeit war in seinen Augen der wesentliche Grund für den Zulauf, den der neue Glaube erfuhr. Freilich leistete der König mit dem Ruf nach den „Soldaten Christi“ jener konfessionellen Konfrontation Vorschub, die er eigentlich vermeiden wollte. Die Jesuiten verkörperten zunehmend den Kampf der Papstkirche gegen den neuen Glauben. Einige Jesuiten sogen ihre Kraft aus dem rücksichtslosen religiösen Streit. Je mehr die unversöhnliche Atmosphäre um sich griff, desto wirkmächtiger wurde diese Seite ihres Wesens. Ferdinand I. schuf mit seiner Innovation für Erziehung und Bildung einen Sargnagel für seine Versöhnungspolitik.
Khlesl konvertierte unter dem Eindruck der streitbaren Brüder. Ihre religiöse Disziplin dürfte den hochgewachsenen, schlanken jungen Mann angezogen haben. Wahrscheinlich beeindruckte ihn die Eindeutigkeit ihres Glaubens. Die religiöse Vielfalt auf protestantischer Seite hatte ihre Schattenseiten. Die neugläubigen Geistlichen stritten heftig um das richtige Verständnis von Evangelium und Religion. Dem setzte das Auftreten der Gesellschaft Jesu ein klares Profil entgegen. Reichshofrat Eder fand, ein Jesuit sei wie der andere. Die klare religiöse Linie der Jesuiten und ihre Zuversicht, in Gottes Namen den Sieg davonzutragen, boten Khlesl eine Perspektive und gaben seinem Lebenskompass eine Richtung. Er gewann wieder Lust am Lernen. Im Jahr 1570 schrieb er sich an der philosophischen Fakultät der Universität Wien ein. Ein Jahr später begab er sich auf Studienreise zu den Jesuiten in Ingolstadt. Der Lehrbetrieb an der katholischen Kaderschmiede der Herzöge von Bayern machte Eindruck auf ihn.
Während der ersten Monate 1574 trat Studiosus Khlesl in das neu gegründete päpstliche Alumnat in Wien ein. Die römische Kurie hatte den Wert gut ausgebildeter Priester erkannt. Mit dem heruntergekommenen Klerus nördlich der Alpen war kaum ein kirchlicher Aufbruch hinzugekommen. Deshalb gründete der Papst das Collegium Germanicum in Rom, wo die Jesuiten vor allem das geistliche Personal für Bischofsstühle und Domstifte ausbildeten. Für die einfachen Pfarrer und die Stellen, die vornehmlich mit Nichtadeligen besetzt wurden, schuf die Kurie Alumnate wie das in Wien. Dieses wurde im Schulkonvikt der Jesuiten eingerichtet. Die Alumnen trugen allerdings eine eigene Tracht. Die Bevölkerung sollte sehen, wie der Papst sich um den Klerusnachwuchs kümmert.
Khlesl gehörte zu den ersten Alumnen dieser für die Ausbildung von erbländischen Priestern wichtigen Stiftung. Im Konviktleben habe er sehr auf Ordnung geachtet und die geistliche Berufung betont, hält Rektor Lorenzo Magio im April 1579 fest. Geistliche Gelehrsamkeit habe er angestrebt und häusliche Disziplin sei ihm ein großes Anliegen gewesen12. Magio erwähnt Khlesls innigen Wunsch, an der Reform der katholischen Kirche mitzuwirken. Für die kirchliche Erneuerung würde er auf ein bequemes Leben verzichten, habe Khlesl erklärt.
Die ersehnte „Reformation“ und Herausforderung bedeutete auch, die Gläubigen zu gewinnen. Um die richtige Überzeugungskraft für seine Mission zu entwickeln, steckte Khlesl viel Zeit in die Kunst zu predigen. Er hatte Talent. Der virtuose sprachliche Umgang mit geistlichen Gedanken und Bibelzitaten wie auch das Spiel mit der Aufmerksamkeit des Publikums lagen ihm. Er brachte es schnell zu einer wahren Meisterschaft. Oft reichte der Platz in der Kirche nicht aus, so groß war später der Andrang bei seinen Predigten. Reichshofrat Johann Hegenmüller berichtet dazu etwas Wesentliches: Der Stephansdom war voll von „Lutherischen und Pabstischen“13. Khlesl stand nicht auf der Kanzel und zog über die Andersgläubigen her. Im Wettstreit der Bekenntnisse setzte er nicht auf eine aggressive Sprache gegen die Protestanten. Er predigte nicht „kontrovers“. Er hielt seine Kanzelreden in einem traditionellen Stil14. Trotzdem vermochte er, seinen Zeitgenossen eine ansprechende geistliche Botschaft zu vermitteln. Die Kunst, die Worte kreativ und überzeugend einzusetzen, und die Aufmerksamkeit, die er damit erregte, waren wichtige Bausteine seiner Karriere. Erzherzog Maximilian III., einer der Söhne von Kaiser Maximilian II., schalt ihn später einen „Linguisten“. Die Wortwahl des Habsburgers lässt die andere Seite seiner Rednergabe erahnen. Ordnung, Disziplin und das Verlangen nach mehr als dem einfachen Priesterdasein leiteten Khlesl. Er suchte nicht die schnelle Befriedigung im theologischen Streit. Erfolgsüberzeugung, wie auch das Streben nach Aufmerksamkeit und Kontrolle waren starke Antriebskräfte in seinem Leben. Sie gaben ihm Motivation und Sicherheit für ein vorausschauendes Handeln. Der Erfolg oder psychologisch gesprochen die Belohnung konnten in der Ferne liegen.
Alumnus Khlesl wollte führend teilhaben, wenn sein Heimatland für die Papstkirche wiedergewonnen wird. Khlesl war zuversichtlich, dass dies mit ihm gelingt. Die Aussicht auf Erfolg dank eigener Fähigkeit und kalkulierbarer Umstände wurde ein wesentlicher Faktor für sein Urteil und sein Handeln. Sein Gottvertrauen hatte in seinem Selbstvertrauen einen starken Partner und Konkurrenten. Die protestantische Kritik an der Konversion wegen seines Ehrgeizes hatte wohl etwas Wahres. Wahrscheinlich lag das Motiv für den Glaubenswechsel aber nicht in einer konkreten Aufstiegschance. Der Eindruck, dieser neue Katholizismus werde siegen, dürfte den Ausschlag gegeben haben. Aber wie kam Alumnus Khlesl auf den Gedanken, Österreich könne für den alten Glauben zurückerobert werden? Das Auftreten der Jesuiten mag Khlesl imponiert haben. Aber das protestantische Bekenntnis war allgegenwärtig und der altkirchliche Klerus hatte geistlich nicht viel zu bieten. In den 1570er-Jahren brach allerdings für die konfessionelle und damit auch politische Zukunft der Habsburgermonarchie eine Zeitenwende an.
Paukenschlag in Wien
„Darauff er [Josua Opitz] zwischen 4 und 5 uhr mit 5 Gutschien in aller Teufel Namen zuem Thor ausgefarn und ain gross Volckh vor und nach geloffen, welliches mit solleher Ungestuem wider zuem Thor mit Hauffen herain komen, das es ainen schrockhen gemacht und iederman angefangen, sich anhaims werhaft zue machen.“ Georg Eder15
Am 22. Juni 1578 triumphiert Georg Eder, der sich als „lateinischen Kriegsmann“ versteht. Am Tag zuvor hat der protestantische Landhausprediger Josua Opitz in aufgeregter Atmosphäre die Stadt verlassen. Er folgte einem Befehl des Kaisers. Der Auszug aus dem Landhaus – Symbol ständischer Macht und neuen Glaubens – sorgt für großen Wirbel. Man befürchtet bereits einen Aufstand der Wiener und greift zu den Waffen.
Rudolf II. hat den Landhausprediger Josua Opitz ausgewiesen. Das war ein Paukenschlag im Kampf gegen den protestantischen Glauben in Wien. Der neue Landesherr demonstrierte damit eine bis dahin undenkbare Entschlossenheit. Er hatte offensichtlich ein anderes Verständnis von Glauben und religiösem Gehorsam seiner Untertanen als sein Vater und Großvater. Im Herbst 1575 hatten die Kurfürsten Rudolf II., ältester Sohn Maximilians II., zum römisch-deutschen König gewählt. Böhmen und Ungarn hatten ihn bereits als König angenommen. Maximilian II. starb im Oktober 1576 und Rudolf II. übernahm das Zepter. Mit ihm zog ein anderer Geist in den Kaiserhof und die politische Kultur der Habsburgermonarchie ein.
Rudolf II. war wie sein Bruder Ernst am Hof in Madrid erzogen worden16. Der spanische Hof als prägende Schule des dynastischen Nachwuchses war der Familienräson einer katholischen Casa de Austria geschuldet. Sie stellte einen weiteren Sargnagel für die Politik der Versöhnung von Ferdinand I. und Maximilian II. dar. Das Spanien ihres Verwandten Philipp II. war der Hort eines aggressiven Katholizismus. Der spanische König, Sohn Karls V., forderte von seinen deutschen Verwandten ein klares Bekenntnis zum alten Glauben ihres Hauses und verlangte einen harten Kurs gegen die Protestanten.
Die Habsburger in Wien konnten das Mahnen aus Madrid nicht einfach ignorieren. Im Fall der Fälle wollte man die andere Linie beerben und würde über ein riesiges katholisches Reich herrschen. Außerdem standen die Türken bewaffnet im Königreich Ungarn. Die deutschen Habsburger hielten die „Vormauer der Christenheit“ gegen das Osmanische Reich. Sie kamen nicht ohne die finanzielle und militärische Hilfe des großen Bruders in Spanien aus. Den vorteilhaften Perspektiven und Abhängigkeiten musste Maximilian II. Tribut zollen. Er stimmte zu, den Thronfolger und seinen Bruder Ernst dem fordernden katholisch-spanischen Klima in Madrid auszusetzen.
Maximilian II. übernahm nach dem Tod seines Vaters im Jahr 1564 die Regierung in Wien. Seine protestantischen Ambitionen gab er auf. Er regierte als Kaiser und Landesherr konziliant katholisch. An der Hoffnung auf einen Königsweg zu einem wieder vereinten Römisch-Deutschen Reich hielt er fest17. Gleichzeitig bahnte sich in Madrid die Wende in der kaiserlichen Religionspolitik an. Vom spanischen Hof brachte Thronfolger Rudolf eine betonte Grandezza und ein streng katholisches Glaubensverständnis mit nach Hause.
Der Kaiser war entsetzt über das Auftreten seines Sohnes. Ihm war offenbar nicht bewusst, welche Kräfte auf seine Söhne am spanischen Hof einwirkten. Erzherzog Ernst dachte nicht weniger streng katholisch. Doch er trat zurückhaltender auf. Rudolf II. musste die Autorität eines Thronfolgers und Monarchen leben. Sein Obersthofmeister Adam von Dietrichstein hatte den Geist und die Formen des spanischen Hofes ebenfalls verinnerlicht. Er heiratete die katalanische Fürstentochter Margareta Folch de Cardona y Requesens und pflegte enge Beziehungen zum Adel am spanischen Hof. Philipp II. förderte Dietrichstein. Am Kaiserhof galt er als „spaniolisiert“.
Ein spanisch-katholisch gesinnter Kaiser, mit einem ähnlich denkenden Bruder und einem ebenso eingestellten Chef des Hofes an seiner Seite versprachen nichts Gutes für den Königsweg im Glaubensstreit. Außerdem stärkten mächtige katholische Verbündete den jungen Habsburgern den Rücken. Die Brüder ihres Vaters unterstützten sie. Kaiser Ferdinand I. hatte die Habsburgermonarchie nicht im Ganzen an seinen ältesten Sohn weitergegeben. Dessen Brüder Ferdinand und Karl waren ebenfalls bedacht worden. Erzherzog Ferdinand II. herrschte in Tirol und den Vorlanden. Ferdinand von Tirol hatte die Ansätze des neuen Glaubens bald unterdrückt oder in den Untergrund gedrängt.
Onkel Ferdinand in Innsbruck plädierte im Glaubensstreit für eine harte Haltung seiner Neffen in Wien. Onkel Karl in Graz bestärkte zwar seine Neffen. Der Landesherr von Innerösterreich musste sich allerdings selbst ohne viel Erfolg mit den Forderungen seines protestantischen Adels herumschlagen. Herzog Albrecht in München ermutigte Rudolf II. Der Wittelsbacher, Schwiegervater von Erzherzog Karl, hatte seinen Ständen die protestantischen Gedanken ausgetrieben.
Die Schärfe im Glaubensstreit zog nicht nur auf der Seite der Habsburger ein. Josua Opitz war ein Symptom für den wachsenden Einfluss radikaler Kräfte18. Opitz wetterte im Landhaus gegen Andersgläubige und die kaiserliche Regierung. Er durfte in der Versammlungsstätte der Stände predigen, weil Maximilian II. seinem Adel ein gewisses Maß an religiöser Freiheit eingeräumt hatte. Der größte Teil des Adels in den Erbländern unter und ob der Enns hing dem neuen Glauben an. Der Kaiser gestand ihnen eine Religionskonzession, eine vorläufige und begrenzte Glaubensfreiheit zu19. Das Zugeständnis sollte die Situation beruhigen, bis die deutschen Christen sich in den Glaubensfragen wieder geeinigt hätten.
Doch das adelige Privileg stärkte die immer mächtiger werdenden Tendenzen zur Spaltung. Zudem setzten die protestantischen Prediger im Landhaus und in den Adelspalais einprägsame religiöse Akzente für die Bevölkerung. Maximilian II. hatte den Einwohnern seiner erbländischen Städte und Märkte, dem Vierten Stand, den evangelischen Gottesdienst eigentlich untersagt. Aber außer einiger Mandate und Verbote wurde kaum etwas gegen den florierenden Protestantismus unternommen. Es herrschte praktisch Religionsfreiheit und damit der neue Glaube.
Im Landhaus wurde protestantischer Gottesdienst für alle gehalten. Adelige und nicht adelige Kinder wurden evangelisch unterrichtet. Schulunterricht und Seelsorge im Landhaus waren nach dem Willen von Kaiser Maximilian II. dem Adel und seinem Gesinde vorbehalten. Doch im Laufe der Jahre entwickelte sich das Landhaus immer mehr zum evangelischen Zentrum Wiens. Die Landhausprediger hielten es für unvereinbar mit ihrem Glauben, die Wiener von ihrer Seelsorge auszuschließen. Das Wirken der Landhausprediger untergrub nicht nur den Willen des Kaisers. Offensiv eingestellte Adelige im neugläubigen Lager drückten der protestantischen Bewegung ihren Stempel auf.
Die Adelsstände beriefen für den neuen Glauben zuständige Delegierte, sogenannte Religionsdeputierte. Diese versuchten, den Siegeszug des neuen Glaubens zu steuern, und intervenierten gegen katholische Vorstöße des Landesherrn. Sie erhoben sich zu Schirmherren der bürgerlichen Glaubensfreiheit. Der evangelische Glaubenseifer ließ nicht nur den Gedanken an eine Versöhnung von altem und neuem Glauben zunehmend als unzeitgemäß erscheinen. Er verstärkte auch die Streitereien zwischen den neugläubigen Lagern. Die Lutheraner kamen sich zunehmend untereinander in die Haare. Zudem machten Anhänger der helvetischen Reformatoren Jean Calvin oder Ulrich Zwingli langsam von sich reden.
Der immer dogmatischer ausgetragene Streit zwischen den sich herausbildenden Konfessionen und ihren Strömungen ließ den Cocktail religiöser Ideen in Österreich zunehmend giftiger werden. Im Jahr 1574 setzten einige streitbare Adelige um den Landmarschall, kaiserlichen Rat und Religionsdeputierten Johann Wilhelm von Roggendorf den radikalen Lutheraner Opitz als Landhausprediger durch. Dies verschärfte nicht nur den Konflikt mit dem Kaiser, sondern heizte auch den internen Zwist des protestantischen Ständeadels über die Richtung ihres neuen Glaubens an. Denn der kämpferische Opitz war Flacianer. Diese Spielart der Lutheraner lag mit den Anhängern des Luthergefährten Melanchthon über Kreuz. Sie konnten trefflich darüber streiten, ob die Erbsünde in der Natur des Menschen liege oder dessen Anhängsel sei. Die Religionskonzession war den Landedelleute allerdings unter einer Auflage gewährt worden. Sie sollten für Ruhe in den eigenen Reihen sorgen. Opitz war aber die personifizierte Unruhe.
Spaltende Dynamik entwickelte auch die alte Kirche. Im Dezember 1563 war das Konzil von Trient geschlossen worden. Ferdinand I. hatte sich von dem mehr als 20 Jahre dauernden Tridentinum Brücken zu den Protestanten erhofft. Doch das Gegenteil war der Fall. Der neue Glaube wurde als Irrlehre verdammt und die Christen verpflichtet, ihm in aller Öffentlichkeit abzuschwören. Immerhin hatten sich die Konzilsväter Gedanken über eine Kirchenreform gemacht. Der erklärte Feind setzte Kräfte in der Papstkirche frei, die lange beklagten Übel anzugehen. Kirchendisziplin sollte im Klerus herrschen. Der Papst forderte außerdem unbedingten Gehorsam von den Bischöfen. Der kämpferische Katholizismus des Tridentinums hatte in den Jesuiten bereits einen Stützpunkt in Wien. Zudem warben die Botschafter der römischen Kurie am Hof, die Nuntien, für ein rigoroses Vorgehen gegen die Ketzer. Der neue Geist in der alten Kirche befeuerte die Zuversicht des Alumnen Khlesl, im Wettstreit der Bekenntnisse zu siegen.
Der römische Phönix brachte die Furcht vor katholischer Gewalt nach Wien. Die Bartholomäusnacht spukte in den Köpfen der Protestanten herum. Das Massaker an den französischen Hugenotten stimulierte die Kollektivfantasie. Im Jahr 1573 wurde bekannt, Papst Gregor XIII. wolle sich stärker der Kirche im Reich zuwenden. Umgehend breiteten sich in Wien Gerüchte aus, Rom plane eine Bartholomäusnacht für die Protestanten im Römisch-Deutschen Reich. Die Angst vor Gewalttaten der Katholiken löste bei der Beerdigung Maximilians II. eine Panik aus. Die zunehmende Furcht vor Ausschreitungen der anderen Seite bedurfte kaum ernsthafter Anstöße, um außer Rand und Band zu geraten. Im Jahr 1579 schlossen sich die Wiener Protestanten in ihren Häusern ein, weil sie glaubten, die Katholiken würden über sie herfallen.
Der Plan Rudolphs II.
„Damit also das Religionswesen, dieweil dasselb jetzo nit gar ad catholicismum zu richten, jedoch zum wenigsten ad terminos weiland Kaiser Maximilians Concession redigiert und über dieselb das wenigste nit geduldet werde.“ Herzog Albrecht V.20
Daran, Österreich jetzt zu katholisieren, sei nicht zu denken, glaubt Bayernherzog Albrecht. Aber Rudolf II. solle das abstellen, was nicht durch die Zugeständnisse Maximilians II. gedeckt sei. Albrecht reagiert mit diesem Ratschlag auf die Pläne Rudolfs II. und seiner engsten Berater. Diese machen sich Gedanken, wie der junge Kaiser in seinen Erbländern die Herrschaft über den Glauben seiner Untertanen erlangen könne.
Rudolf II. wollte die Herrschaft seines Glaubens in seinen Erbländern durchsetzen. Deshalb schmiedeten seine Berater eine „Katholische Agenda“ – erst einmal für sein Erbland unter der Enns (heute weitgehend Wien und Niederösterreich) und die kaiserlichen Amtsträger21. Den entscheidenden Impuls für die Reform der Kirche und die Katholisierung22 der Österreicher musste die Dynastie geben. Ohne den Willen des Landesherrn war eine Restauration der alten Kirche im Land nicht möglich. Ferdinand I. hatte mit dem Ruf nach der Gesellschaft Jesu einen ersten Schritt getan. Nun sah sich Rudolf II. gefordert. Er musste die Voraussetzung schaffen, damit seine religiöse Autorität und die Vorgaben des Tridentinums in die Tat umgesetzt werden konnten. Allerdings war seine Macht in dieser Sache sehr begrenzt – wie der Bayernherzog betonte. Mitte 1577 lag ein erster Plan vor.
Rudolf II. musste sich und seine religionspolitischen Ambitionen allerdings einer kämpferischen Adelsopposition stellen. Diese wollte ihre Glaubensfreiheiten, die sie gegen den Willen Maximilians II. erobert hatten, zementiert sehen. Die Feuerprobe für die Haltbarkeit der Positionen von Landesherrn und Adelsständen war die Huldigung im Oktober 1577 in Wien. In diesem Herrschaftsakt versicherten sich beide Seiten ihre Loyalität. Die Erbländer, wie der Name schon sagt, waren zwar erblich. Trotzdem begriffen insbesondere die beiden Adelsstände die Konditionen der erblichen Herrschaft als verhandelbar. Der politische Spielraum mobilisierte die Opposition im Land. Sie forderte von Rudolf II. die Religionsfreiheit als allgemeines ständisches Privileg. Dies hätte jedoch auch Maximilian II. abgelehnt. Denn damit wäre die konfessionelle Teilung festgeschrieben. Der junge Herrscher stemmte sich gegen die adeligen Ansprüche. Sie liefen seinem Selbstverständnis als katholischer Landesherr und seiner kaiserlichen Hoheit zuwider. Er sollte die herrschende Religionsfreiheit selbst für seinen engsten Herrschaftsbereich, seine Städte und Märkte, sanktionieren. Dies konnte er nicht mit seiner landesherrlichen Autorität vereinbaren. Die fordernde Adelsmacht wirkte gewaltig. Doch der Kaiser überstand die Huldigung ohne große Blessuren. Nach zähen Verhandlungen verfügte er im April 1578, die Landhausschule sei zu schließen. Die Landhausprediger hatten aus dem Land zu verschwinden. Nach dem Bescheid wurde aber erst einmal wieder verhandelt. Die Atmosphäre in der Stadt blieb gespannt.
Eine eindrucksvolle Prozession sollte das neue katholische Selbstbewusstsein demonstrieren. Der weihevolle Zug durch die Straßen war ein bedeutendes Instrument für die aufstrebenden Katholiken, um Flagge zu zeigen. Das weitgehend protestantische Wien hatte seit geraumer Zeit keine Fronleichnamsprozession mehr erlebt. Opitz zog heftig gegen diese Form von Abgötterei vom Leder. Der Bischof von Wien, Johann Kaspar Neubeck, gründete dagegen extra eine Fronleichnamsbruderschaft. Der Brauch sollte als Manifestation einer erstarkenden Papstkirche eine Renaissance erleben. Nun war es so weit. Nicht nur mit Pracht, auch mit dynastischer Glorie sollte die Prozession glänzen. Der Kaiser, seine Brüder Ernst und Maximilian wie auch der bayerische Herzog Ferdinand mit ihren Gefolgsleuten nahmen teil23. Eders Herz schlug höher. Der Teufel sei sehr verdrossen, weil man das schon lange nicht mehr gesehen habe, jubelte er. Doch die Kundgebung katholisch-dynastischer Größe mutierte zur Posse. Sie scheiterte am profanen protestantischen Alltag. Die Prozession zog andachtsvoll an Marktständen vorbei. Da kippten einige Milchkannen um. Die Bäuerinnen fingen ein großes Geschrei an. Die Katholiken glaubten, die Protestanten fielen über sie her. Die hohen Herren und die spanischen Adeligen griffen zur Wehr oder zogen die Degen. Der Klerus und viele Gesandten rannten in panischer Angst davon. Das erniedrigende Spektakel bekam den spöttischen Namen „Milchkrieg“. Eders Stimmung war am Boden. Der Kaiser könnte sich das ehrenrührige Debakel zu Herzen nehmen und die Protestanten würden noch frecher werden, befürchtete er.
Am 21. Juni reagierte der Kaiser offiziell auf Gesichtsverlust und Ungehorsam. Morgens um sieben Uhr bekamen die Adelsstände eine Resolution überreicht. Danach hatten ihre Prediger und Schullehrer „bei scheinender Sonne“ Wien zu verlassen. Am späten Nachmittag fuhren Opitz und seine Kollegen begleitet von Hartschieren und einer großen Menschenmenge aus der Stadt. Im Ringen um das Landhausministerium als Hochburg des protestantischen öffentlichen Gottesdienstes zeigte Rudolf II. Muskeln. Khlesl sprach von der „Opitianische Exekution“24. Diese erregte Aufsehen und machte den kämpferischen Katholiken Mut. Das Haus Österreich beabsichtigte offensichtlich, im Glaubensstreit Terrain zurückzugewinnen. Doch die Religionspolitik, die Rudolf II. und sein Bruder im Land unter der Enns in den nächsten Jahren betrieben, war ein Arrangement. Politik, Interessen, Personal und Abhängigkeiten schränkten die politische Gestaltungsmacht des Kaisers auch im eigenen Erbland stark ein.
Der Kompromiss begann im Geheimen Rat, eine Art Kabinett, in dem die Regierungsentscheidungen getroffen wurden. Maximilian II. hatte seinem Sohn seine engsten Ratgeber hinterlassen. Auf diese erfahrenen Minister wollte Rudolf II. nicht verzichten. So regierte er zusammen mit altgedienten Männern, die an Ausgleich und Frieden hingen. Geheime Räte wie Hanns Trautson und Leonhard IV. von Harrach waren zwar katholisch. Doch kämpferischen Katholiken wie Eder galten sie als „kalt“ oder „lauwarm“25. Eder beschimpfte sie als „Hofchristen“. In seinen Augen lavierten sie um des lieben Friedens und ihres Vorteils willen in den Glaubensfragen und verrieten damit die katholische Kirche. Trautson und Harrach waren eng verwandt mit protestantischen Adeligen, die oft ebenfalls höchste Regierungsämter bekleideten.
Freiherr von Trautson aus Tirol stand seit fast 20 Jahren an der Spitze des Geheimen Rats. Er hatte mit Ferdinand I. und Maximilian II. eine Kaiserpolitik betrieben, die der Einigkeit und Versöhnung verpflichtet war. Die Rolle eines Moderators und Richters über den konfessionellen Lagern war in den Augen Trautsons die einzig richtige für den Kaiser. Er war überzeugt, Rudolf II. dürfe diese Position nicht aufgeben. Ähnlich dachte der österreichische Freiherr Harrach, der fast ebenso lange im Geheimen Rat mitregierte. Er hoffte lange auf eine Rückkehr zur religiösen Einheit unter dem Dach einer konziliant reformierten Papstkirche. Khlesls jesuitischer Lehrer Magio zählte die beiden altgedienten Minister zu den Feinden des Kaisers26. Für Magio huldigten sie einem religiösen Irrweg, den es auszumerzen galt.
Die alten Räte dominierten die ersten 13 Jahre rudolfinische Regierung. Zu den Gründen gehörte die komplizierte Interessenlage des Kaisers. Einmal galt es, in der Reichspolitik den richtigen Ton zu treffen. Die Erfahrung, wie der Kaiser Diplomatie und Politik für seine Ziele einsetzen konnte, besaßen besonders die Altgedienten. Rudolf II. hatte im Oktober 1576 auf dem Reichstag in Regensburg das Kaisertum übernommen. Er versicherte den Reichsständen, die ausgleichende Politik seines Vaters fortzusetzen. Die Reichsstände bewilligten dem neuen Kaiser im Gegenzug viel Geld für den Kampf gegen einen gemeinsamen Feind – das Osmanische Reich. Der Reichstag gab ihm quasi eine Botschaft mit auf den Regierungsweg. Sie lautete, die Einigkeit des Reiches sei von großem Wert.
Die Habsburger hielten im Osten das Bollwerk gegen die andrängenden Osmanen27. Diesen war es zwar im Jahr 1529 nicht gelungen, Wien zu erobern. Doch sie brachten den größten Teil des Königreichs Ungarn unter ihre Herrschaft und in Ofen (Buda, Ungarn) residierte ein türkischer Pascha. Angesichts der osmanischen Macht musste der Kaiser schmerzliche Demut zeigen und leistete jährlich Tribut an die Hohe Pforte, die Regierung in Konstantinopel. Die Drohkulisse an der Militärgrenze durch Kroatien und Ungarn konnte schnell von kriegerischem Stillhalten mit üblichen Scharmützeln zum offenen Krieg kippen. Das verschlang hohe Summen. Die kaiserlichen Kassen waren aber notorisch klamm. Deshalb glaubte man am Kaiserhof, nicht ohne die finanzielle Rückendeckung der Reichsfürsten auszukommen. Somit brauchte der Kaiser auch protestantische Verbündete. Bislang konnten sich die Habsburger auf die Loyalität des lutherischen Kursachsen verlassen. Für Krieg und Abwehr benötigte der Kaiser freilich auch die Finanzhilfen seiner weitgehend protestantischen Landstände.
Rudolfs II. besonderer Sinn für kaiserliche Hoheit bremste ebenfalls. Eine harte Restauration der Papstkirche ließ sich damit nur begrenzt vereinbaren. Er konnte sich nicht einfach im Namen des Papstes aufmachen, um wieder mit Macht römisch-katholischen Boden in seinem Reich zurückzugewinnen. Als Herrscher konkurrierte er mit dem Herrschaftsanspruch des Papstes. Rudolf II. verweigerte wie sein Vorgänger den vom Papst geforderten Gehorsamseid. Die päpstliche Bulle, die ihm die Wahl zum römischdeutschen König bestätigte, nahm Rudolf II. gar nicht erst an. Die Beschlüsse des Tridentinums, die sehr stark auf die Hoheit des Papstes zugeschnitten waren, durften bis auf einen in den Ländern Rudolfs II. nicht veröffentlicht werden. Sein Onkel Philipp II. hatte die Beschlüsse zugelassen, soweit sie seinen Rechten keinen Abbruch taten. Der spanische König besaß allerdings einen politischen Spielraum, von dem ein römisch-deutscher Kaiser höchstens träumen konnte. Vorrechte und Macht der „Allerkatholischsten Majestät“ in Europa setzten dem päpstlichen Einfluss in den spanischen Ländern enge Grenzen. Gleichzeitig ließ Rudolf II. das Unvermögen des mächtigen Onkels in Madrid vor einer harten Gangart zurückschrecken. Er sah die Ohnmacht des Herrschers über ein Weltreich, den Aufstand der protestantischen Niederlande mit militärischer Gewalt in den Griff zu bekommen. Gerade während der ersten Regierungsjahre Rudolfs II. sagten sich die nördlichen Provinzen los und gründeten die Vereinigten Niederlande (Generalstaaten).
Während des dreijährigen politischen Kampfes um die Glaubenshoheit in Wien entstand die Katholische Agenda Rudolfs II. Sie sah eine „ernstliche steife Visitation aller Gotteshäuser, Klöster, Stiftungen und Pfarren“ und anschließend deren „Reformation“ mithilfe der Bischöfe und Prälaten vor. Um die alte Kirche wieder in Schwung zu bringen, waren gut ausgebildete und motivierte katholische Geistliche gefragt. Davon gab es aber wenige in den Erbländern des Kaisers. Abhilfe schaffen sollte ein landesherrliches Priesterseminar. Rudolf II. wollte zudem in der Religion Herr über seinen Herrschaftsapparat werden. Seine „Diener“ mussten zum Glauben ihres Herrn gebracht werden. Anfangen wollte man mit den weitgehend protestantischen Amtsträgern auf den landesherrlichen Gütern. Diese Ämter sollten künftig Katholiken vorbehalten sein. Außerdem hatte in den landesherrlichen Städten und Märkten der Glaube ihres Landesherrn wieder einzukehren. Zuerst dachten der Kaiser und seine Berater nur daran, verstärkt Katholiken zu den Rats- und Stadtämtern zu befördern. Nach und nach entwickelten sie eine Kampagne namens „Religionsreformation“, um die Städte und Märkte zu katholisieren.
Die Katholische Agenda war ein Kompromiss. Eine Offensive gegen die konfessionellen Privilegien des Adels kam nicht infrage. Die Landleute waren einfach zu mächtig. Außerdem schauten die protestantischen Reichsfürsten zu. Damit war jedes Vorgehen gegen lutherische Untertanen, gerade wenn es gegen geltende Rechte verstieß, brisante Reichspolitik. Der Augsburger Religionsfrieden hatte den Fürsten in Sachen Glauben ihrer eigenen Bevölkerung zwar Machtoptionen eröffnet. Doch diese zählten nur bedingt. Minister wie Harrach und Trautson hingen einer Lesart des Vertragswerks an, welche die Frieden stiftende Wirkung betonte. Das fürstliche Zwangsrecht, das in der Mitte der 1580er-Jahre erfundenen Formel cuius regio, eius religio steckt, widerstrebte ihnen. Die gespannte Atmosphäre erfüllte sie mit Sorge. Die alten Politiker bevorzugten ein „leyses procediern“28. Sie wollten kein Öl ins Feuer gießen. Der offene Religionsstreit barg in ihren Augen die Gefahr der Eskalation.
Herzog Albrecht regte an, alle Andersgläubigen aus dem kaiserlichen Dienst zu entfernen. Die Tragweite dieses Vorschlags zeigt sich am Protestantenführer Helmhard Jörger. Sein Einfluss gründete auf seiner Position in der Verwaltung. Der schwerreiche Freiherr besorgte als Präsident der Niederösterreichischen Kammer dem Kaiser viele Gelder, um zu regieren. Ohne Jörgers Bonität ging oftmals wenig am Hof in Wien. Gerade in Sachen Finanzen und Kriegswesen des Kaisers lagen Kapital und Kompetenzen bei neugläubigen erbländischen Adeligen. Sie konnten dem Kaiser drohen, ihren Dienst zu quittieren, falls er ihre religiösen Ansprüche bekämpfte. Rudolf II. hätte gerne so machtvoll reagiert, wie der Bayernherzog es forderte. Aber stattdessen musste er die Protestanten sogar in der Verwaltung halten. Dem Herrschaftsapparat drohte sonst der Stillstand.
Einerseits war der Kaiser auf die protestantischen Räte angewiesen. Andererseits wünsche er sich, sie loszuwerden oder zur dynastischkatholischen Räson zu bringen. Das erforderten von ihm und seinem engsten Beraterstab einen stetigen Spagat. Man traute sich vorerst höchstens an die dritte oder vierte Reihe der kaiserlichen Amtsträger und Bediensteten heran. Die Waffe der Wahl war das Zuckerbrot, nicht die Peitsche. Die Katholiken bekamen die Vorteile von religiöser Loyalität durch Ämter und Förderung zu spüren. Diese Strategie verhalf dem dynastischen Katholizismus zum Sieg. Sie bewährte sich selbst im Königreich Böhmen, wo die Macht des Kaisers noch stärker beschränkt war. Allerdings brauchte es gerade für diesen Teil der Agenda einen langen Atem.
Hoffnungsträger des Kaisers
„Mäniglich fürcht die Reformation und haben gemeint, das sei schon der Anfang.“ Melchior Khlesl29
Die Reform der alten Kirche beginnt mit dem Alumnus Khlesl. Etwa so empfindet er seine Leistung, als er den Bericht über seine Mission in die Herrschaft Mollenburg fertigstellt. Leicht habe er den „fleischhackerisch“ auftretenden protestantischen Pfarrer des Marktes Marbach abgekanzelt. Sein Widersacher habe von der Lehre nicht mehr gewusst als „jeder Schütz in der Schul“. Dieses Überlegenheitsgefühl wird Khlesl auf seiner Karriere begleiten. Der Triumph stärkt sein Selbstbewusstsein mächtig und nährt seinen Glauben an den Erfolg der „Reformation“ – mit ihm an der Spitze.
Die „Reformation“ sollte ohne lautstarken Streit und in Zusammenarbeit mit dem Bischof von Passau realisiert werden. Eine ausgesprochen landesherrliche Aktion erschien den Beratern des Kaisers zu riskant. Die erklärte Vorsicht machte Khlesl zum Hoffnungsträger. Die Konstrukteure der Katholischen Agenda wurden wohl Mitte des Jahres 1577 auf den talentierten Prediger aufmerksam. Den Anstoß gab wahrscheinlich Kaspar Christiani, Wiener Domdechant und angehender Propst des Augustinerstifts Klosterneuburg. Diesem waren die besonderen Fähigkeiten des 25-jährigen Alumnus zu Ohren gekommen. Seine außerordentliche Überzeugungskraft gegenüber Andersgläubigen versprach eine erfolgreiche und leise Mission.
Einen Geistlichen mit Khlesls Begabungen konnte Christiani in seiner neuen Position gut gebrauchen. Er war dem Stift von Rudolf II. verordnet worden. Der Kaiser hatte es den Augustinern nicht überlassen, sich einen eigenen Propst zu wählen. Denn von einer wohlgeordneten monastischen Gemeinschaft im Stift konnte nicht die Rede sein. Im Jahr 1563 hatte eine Kommission im Kloster sieben Chorherren, sieben Konkubinen, drei Eheweiber und 14 Kinder festgestellt30. Der neue Glaube herrschte im Stift wie in der ganzen landesherrlichen Stadt Klosterneuburg. Außerdem scheint der Saufteufel im Kloster noch stärker grassiert zu haben als zu jener Zeit üblich. Weil in diesem Konvent niemand zum Prälaten tauglich erschien, setzte der Kaiser den Augustiner-Chorherren mit Christiani einen Geistlichen aus Norddeutschland vor die Nase. Das mochten sich die Kanoniker nicht gefallen lassen. Sie beharrten auf ihr freies Wahlrecht. Doch nach einigem Hin und Her machte der Papst mit einem Breve den kirchlichen Weg frei und er neue Propst konnte sein Amt antreten.
Christiani beabsichtigte, ein katholisches Zeichen zu setzen. Im protestantischen Korneuburg auf der anderen Seite der Donau wollte er für die Papstkirche wieder Boden gutmachen. Christiani fragte bei den Jesuiten an, ob sie dafür ihren vielversprechenden Schützling Khlesl schicken könnten. Im Sommer 1577 zog Khlesl nach Korneuburg, um mit seinen Predigten dem evangelischen Prädikanten Paroli zu bieten31. Er muss seine Aufgabe mit Erfolg bewältigt haben. Wenig später meldete sich der kaiserliche Rat und Wiener Stadtanwalt Kaspar Lindegg von Lisana bei den Jesuiten. Lindegg wünschte ebenfalls eine Probe von Khlesls Können. Er bat die Patres, ihn in seine vor Kurzem erworbene Herrschaft Mollenburg zu senden. Die Aufgabe lautete, die Menschen für den alten Glauben zu gewinnen.
Ende 1577 traf Khlesl in Mollenburg ein. Im Gespräch mit Lindegg machte dieser deutlich, worauf er Wert legte. Die Untertanen sollten „mit Bescheidenheit“ in die alte Kirche zurückgeholt werden. Khlesl hielt seinen Erfolg in einem Abschlussbericht fest. Es sei ihm gelungen, die Bevölkerung ohne viel Aufhebens für das katholische Exerzitium zu gewinnen. Außerdem habe er den evangelischen Prediger gleich mit dazu gebracht, von der Irrlehre abzuschwören, versichert er. Lindegg war an den Planungen der Katholischen Agenda des Kaisers beteiligt. Er berichtete Khlesl bestimmt von diesem Vorhaben. Wahrscheinlich fanden erste Gespräche statt, wie der aufstrebende Kleriker im Sinne des Landesherrn eingesetzt werden könne oder welche Aussichten der Kaiserhof ihm biete. Seine großspurig anmutende Bilanz vom Beginn der „Reformation“ deutet darauf hin. Er hat damit seine Ambitionen, das große Vorhaben zum Erfolg zu führen, bekräftigt. Mit ihm würde Rudolf II. auf den Richtigen setzen, gab er zu verstehen.
Khlesl hatte seine besondere Gabe unter Beweis gestellt. Deshalb waren Rudolf II. und seine Berater bemüht, sich den jungen angehenden Priester für die kaiserlichen Interessen zu sichern. Der begabte Alumnus zog bereits die Blicke der Konkurrenz auf sich. Der Kaiser bewies ihm seine Gnade, indem er ihn und seinen Bruder Andreas Ende Dezember in den Ritterstand erhob32. Im September 1577 erhielt er den ersten wirtschaftlichen Segen aus Rom. Der Papst gewährte ihm ein Kanonikat in Breslau. Doch diese Kirchenpfründe verlangte einen akademischen Grad. Die Jesuiten in Wien konnten diesen nicht erteilen. Ihr gespanntes Verhältnis zur Universität ließ dies nicht zu. Die akademischen Weihen holte sich Khlesl in Ingolstadt. Bevor er dahin reiste, um zu promovieren, meldete sich Erzherzog Ernst, der als Gubernator des Kaisers in Wien regierte. Er wies Khlesl an, ohne Einverständnis des Kaisers keine Stelle anzunehmen. Denn Rudolf II. gedenke, ihn „solchen condition gnädigst […] zu versehen, daran er wohl würde zufrieden sein“33.
Auf Wunsch Rudolfs II. empfahl ihn der Bayernherzog Albrecht seiner Universität, weil „er zu sonderbarem der Khay. Mayt. Wolgefallen ein guete zeit her für die Catholische Religion wider die in Osterreich eingerissne Irrthumb, für andere vleis unnd eyfer gebraucht hatt.“34 Fähige Geistliche suchten aber auch die Wittelsbacher. Da wirkte die Bitte des Verwandten auf dem Kaiserthron eher wie ein Stimulans. Der Bayernherzog versuchte umgehend, den Alumnen mit einem lukrativen Angebot abzuwerben35. Der Kaiser hatte zu diesem Zeitpunkt nichts Vergleichbares zu bieten. Am Kaiserhof wurde befürchtet, Khlesl könne für die landesherrliche Agenda verloren gehen. Im Rückblick nach seiner Zeit als Offizial des Bistums Passau schreibt Khlesl, Trautson und Harrach hätten bei ihm persönlich interveniert und ihm Besseres in Aussicht gestellt36. Khlesl lehnte die bayerische Offerte ab. Trotzdem bekam er zügig seinen akademischen Abschluss als Doktor der freien Künste und der Philosophie sowie als Lizenziat der Theologie.
Ende Juni 1579 kehrte Khlesl aus Bayern zurück. Die Gunst des Kaisers ließ nicht lange auf sich warten. Rudolf II. ernannte ihn zum Dompropst von St. Stephan und damit Kanzler der Universität Wien. Am 30. August wurde Khlesl zum Priester geweiht. Einige Tage danach gab Erzherzog Ernst die Ernennung zum Dompropst offiziell bekannt. Doch dieses Amt war wenig lukrativ und bei den katholischen Geistlichen nicht sehr geschätzt. Immerhin galt es als Sprungbrett für das Amt des Hofpredigers und vielleicht für ein Bistum. Es war jedenfalls nicht die Stelle, um sich in der Katholischen Agenda einen Namen zu machen. Als Dompropst konnte der Hoffnungsträger „wider die in Osterreich eingerissne Irrthumb“ wenig bewegen.
2. AUFBRUCH UND WIDERSTAND
Die richtige Stelle
„Die Warhait zue bekhennen ist er nicht sonders gelert, und auff E.f.G. geliebten Herrn Vaters säligen [Albrecht V.] furschrifft per saltus zue Ingolstat promoviert worden, aber listig, beredt und aines grossen Gemüets, dadurch er vil Ding gericht, die sonst kainem geraten wären.“ Reichshofrat Georg Eder1
Willensstark, redegewandt und listig – diese Eigenschaften zeichnen den jungen Dompropst Khlesl aus. Damit gelängen ihm Dinge, an denen andere scheitern, berichtet Eder. Seine besonderen Fähigkeiten erlauben es Khlesl, die Katholische Agenda wie kein anderer voranzubringen. Er ist wie gemacht für die konfessionelle und kirchliche Neuorientierung der Monarchie im Schwanken zwischen forderndem Handeln und ängstlicher Zurückhaltung.
Der Reformer Khlesl brauchte als neuer Besen in der alten Kirche einen geeigneten Wirkungskreis. Den bot das Offizialat des Bischofs von Passau in Wien. Denn die geistliche Gerichtsbarkeit über den Klerus in den Ländern unter und ob der Enns lag weitgehend bei Passau. Reichshofrat Eder schilderte vor Khlesls Ernennung zum Dompropst eindrücklich die Aufgaben für einen Reformer: „Daran [am erbärmlichen Zustand des Klerus] in hochster warhait merern tails die ordinarii und sonderlich Passau schuldig, welliche inen die arme religion so gar nichts lassen angelegen sein. Da wirt kaine visitation gehalten, da werden die besten pfarren durch den officialen wissenlich ketzern verliehen, wer nur mer gubt, also das der von Passau [Fürstbischof Urban von Trenbach], so in diesem landt inn die 1200 pfarren zu versehen, bschwerlich zwelff catholische priester wurde furstellen künden, die dennoch nit allain beweibt, sonder auch sonst umbhangen. Seiner lieb official [Thomas Raidel] sitzt alhie in publico concubinatu, hat alle jar ain kindt und stet darauf, er werde dombrobst.“2
Die Blicke richteten sich auf Dompropst Khlesl. Die Reformpartei am Kaiserhof sah in ihm den fähigen Geistlichen, der Verwaltung und Erneuerung des Passauer Pfarrwesens im Land unter der Enns in die Hand nehmen sollte. In die Frage, ob das Offizialat richtig besetzt sei, kam Bewegung. Das Thema wurde Mitte des Jahres 1579 angeheizt. Da drohte der Konflikt mit der Ständeopposition in Wien zu eskalieren und der Kaiser suchte nach passenden Reaktionen. Lindegg wurde an den verbündeten Höfen vorstellig. Der Kaiser wollte sich vergewissern, wie sein Programm zur Katholisierung anzugehen sei. Herzog Albrecht drängte auf ein Gipfeltreffen der vier katholischen Landesherren mit dem Erzbischof von Salzburg. Eine konzertierte Aktion der geistlichen und weltlichen Häupter sollte den Widerstand brechen. Mit Entgegenkommen sei nichts zu gewinnen, argumentierte der Bayernherzog.
Khlesl führt gerade in jenen Tagen in München ein intensives Gespräch mit Fürstbischof Trenbach. Thema ist das Religionswesen im Land unter der Enns. Khlesl bringt von seinem Treffen einen Brief des Fürstbischofs an Eder mit. Darin fragt Trenbach den Reichshofrat, wie das Offizialat richtig zu besetzen sei. Eder erklärt Khlesl zum passenden Kandidaten. Darauf schweigt Trenbach erst einmal. Der Wille zur Reform des Klerus am Kaiserhof zeigt indes Wirkung. Trenbach verspürt einen bis dahin nicht gekannten Druck, sich wegen seines Offizials in Wien zu rechtfertigen. Mitte Juli schickt er Eder die Bitte, ihn gegen seine Kritiker zu verteidigen. Man werfe ihm vor, er akzeptiere das liederliche Leben seines Offizials und dulde, dass seine Pfarreien mit sektischen Geistlichen besetzt werden, beklagt er sich3. Dies sei ihm in München vermittelt worden. Er habe nichts von der verwerflichen Praxis gewusst, beteuert Trenbach.
Ganz so unwissend kann er jedoch nicht gewesen sein. Denn im Dezember 1577 berichtet Eder von einem Zusammentreffen mit dem Fürstbischof. Er habe „mit weinenden Augen“ die Missstände geschildert. Trenbach habe ihm nur die kalte Schulter gezeigt, hält Eder fest4





























