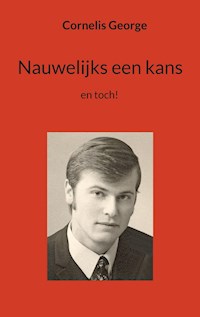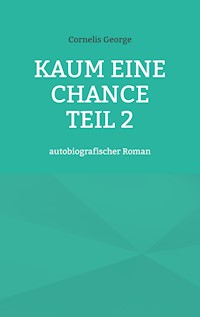
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Kaum eine Chance
- Sprache: Deutsch
Mein Platz ist jetzt das Waisenhaus Martha Stichting, in Alphen aan der Rijn. Ich bin sieben Jahre alt, und die Eisengitterpforten haben sich hinter mir geschlossen. Das Leben hier läuft in geordneten Bahnen. Es gibt genug zu essen und ich muss nicht mehr frieren. Ich gehe jetzt auch jeden Tag in der Schule. Meine große Schwester Coby fehlt mir über die Maßen. Den altersbedingten Wechseln in den unterschiedlichen Unterkünften bereiten mir kleinere Probleme. Der stetige Wechsel des Erziehungspersonals dagegen sorgt für immer mehr Unruhe. Erzieher mit pädophilen Neigungen verkürzen meinen Aufenthalt im Waisenhaus. Wieder in Amsterdam angekommen, lebe ich bei mehreren Pflegeeltern, bis ich endlich bei meiner Schwester Coby wohnen darf. Mein Leben geht jetzt voll in die richtige Richtung. Als Soldat in Deutschland finde ich die Frau meines Lebens und alles ist gut.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Verdammt nicht gleich den andern. Übet Milde. Verzeiht. Entschuldigt. Denkt an eigne Schuld. Wenn jeder alles von dem andern wüsste, es würde jeder gern und leicht vergeben. Es gäbe keinen Stolz mehr, keinen Hochmut.
Hâfis
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Die Martha Stichting
Winter 1954
Vorführung
Christa in der Martha Stichting
Pavillon 3
Herr Haakstra
1955/1956
Weihnachten 1956
Pavillon zwei
1957/1958
Coby
Aufklärung
Der Küchenchef
Kirche
Der Neue
Es wird wieder einsam
Kinderwunsch
Vermittlung
Es ist immer jemand beleidigt
Nikolausabend
1960
Technische Schule
Schulalltag
Aufdringlich
Anpassung
Ter Aar
Immer wieder
Hände weg
Danach
Überraschung
Wochenende
Bei Coby
Neue Pflegeeltern
Die Schulzeit ist zu Ende
Kosthuis-familie
Ersten Arbeitgeber
Pete
Coby zieht um
Schiphol
Tante Tilly
Christas Hochzeit
Mutter in Amsterdam
Begegnung
Greetje
Groningen, der Umzug
Tante Wil
Tony und Rosi
Wervershoof
Andijk
Alles Gut
Nachwort
Vorwort
Die in diesem Buch, von mir beschriebenen Erlebnisse sind selbstverständlich sinngemäß, also nicht wortwörtlich, aus dem Gedächtnis dreier Menschen niedergeschrieben. Sonst wären meine Schwestern und ich Gedächtnisphänomene. Es ist daher auch als einer autobiografischer Roman zu verstehen.
Nicht alle Personen, die meinen Lebensweg gekreuzt haben, möchten namentlich genannt werden. Coby war damals sieben Jahre alt und Christa vier. Mein Name ist Cees und ich bin 1946 auf dieser Welt angekommen. Meine Schwester Coby weiß erstaunlicherweise viele Einzelheiten, Christa hatte auch so einiges auf Lager, und ich kann mich, an für mich wichtige Ereignisse auch noch optimal erinnern. Die Erinnerungen von uns dreien habe ich schließlich wieder zusammen gesetzt und sinngemäß hier zu Papier gebracht. Der Volksmund behauptet ja, dass die Menschen die schlechten Erlebnisse im Leben irgendwann vergessen werden und dass nur die guten Erlebnisse auf Dauer im Gedächtnis bewahrt bleiben. Auf mich trifft das jedoch so nicht zu, denn ich habe die Schmerzen an Körper und Seele nie vergessen können. Sie quälen mich bis zum heutigen Tag. Sie letztlich, auf Anraten meine Ehefrau, aufzuschreiben stellte sich gleichzeitig als Therapie heraus, der ich mich damals, in der Martha Stichting nicht gestellt hatte. Sich mit seinen bösen Erinnerungen zu versöhnen kostet Kraft und Mut, aber es lohnt sich allemal. Dies alles niederzuschreiben hat mir bei der Bewältigung der Vergangenheit sehr geholfen. Ich habe mich mit meinen Erinnerungen versöhnt, dennoch, wenn meine Ehefrau nicht so geduldig gewesen wäre und auch heute noch ist, wäre es erheblich schwerer gewesen.
Die Martha Stichting
1953
Auf dem Giebelstein am Juliana Kinderheim stand „God heeft met ieder een plan“, übersetzt heißt das, “Gott hat mit jedem einen Plan“, und ich glaube das. Heute bin ich mir fast sicher, dass das zutreffend ist. In der Martha Stichting mussten wir jeden Sonntag zur Kirche.
Der Pastor hatte uns immer etwas mitzuteilen über das, was Gott denkt und was Gott uns sagen möchte. Gewundert hatte ich mich eigentlich darüber, woher der Pastor das alles wusste. Redete Gott mit ihm, bevor wir in die Kirche kamen? Und warum sprach Gott dann nicht direkt zu uns?
Ich beobachtete manch einen Erwachsenen, der während der Predigt ein Schläfchen machte. Darüber wunderte ich mich nicht, denn die wussten bestimmt auch, was Gott uns so alles am Sonntag wissen lassen wollte.
Im Laufe der Zeit lernte ich, dass ich nur richtig zuhören musste, um die Zusammenhänge zu verstehen. Der Begriff “Gottesfurcht“ wurde gezielt eingesetzt, um den Pastoren und Priestern Respekt zu verschaffen und die Furcht vor ihnen zu schüren. So war meine Einschätzung jedenfalls.
Ich sollte dann eines Tages zum Kennenlernen Gespräch zu dem damaligen Leiter der Martha Stichting antreten. Vorher musste ich unter die Dusche, dann wurden meine Haare geschnitten, ebenso wie meine Nägel, und auch saubere Kleidung wurde hervorgezaubert. Dieses Aufhebens hätte allein bestimmt ausgereicht, um ein Kind noch untertäniger zu machen, als es schon war. Ich sollte aber auch vorgeführt werden als gepflegtes und gehorsames Anstaltskind. Das war der Gedanke hinter dieser Aktion. Deshalb der ganze Aufwand.
An der Hand einer Aufsichtsperson ging es dann vom “Kinderheim“ an dem “Mädchenheim“ vorbei. An der linken Seite war das Wirtschaftsgebäude der “Martha Stichting“. Die Großküche hatte hier in der Mitte des Gebäudes ihren Platz. An der rechten hinteren Seite waren die Gemeinschaftsdusche und die Wäschekammer. An der Kopfseite rechts war der Lebensmittelladen für die einzelnen Gruppen.
Die leitenden Erzieher oder Erzieherinnen hatten einen wöchentlichen Etat, womit sie alle Lebensmittel außer den Hauptbestandteilen wie das warme Mittagsessen und das Brot finanzieren mussten. Aufschnitt einkaufen mussten sie mit dem eigenen Stichtingsgeld, spöttisch auch der Martha Gulden genannt.
Weiter geradeaus durch den vom Bäumen umsäumten Kiesweg liefen wir auf den großen schwarzen Zaun zu, und auf meinem ganzen Körper hatte ich plötzlich eine Gänsehaut. Unvermittelt kamen mir die Tränen.
In diesem Moment erlebte ich erneut den schrecklichen Tag, an dem ich hierher gebracht worden war. Ich wollte nicht weiterlaufen, wurde jedoch ohne Wenn und Aber mitgezogen. „Lauf zu Junge, der Dominee (wie ein Pastor in den Niederlanden genannt wird) wartet nicht gerne. Und vor allem, hör auf zu heulen, das kann er schon gar nicht ertragen! Du weißt doch selbst, dass es dir hier gut geht, vergiss das bloß nicht.“
Sie zog mich an Arm und Ohr den Weg hinauf und erzählte mir andauernd, wie gut es mir doch ginge. Doch ich sah nur diesen Zaun, diesen widerlichen schwarzen Zaun!
Der Dominee bewohnte eine schöne, große Villa aus dem neunzehnten Jahrhundert mit einem großzügig angelegten Garten, wirklich herrschaftlich. Also wohl geeignet für den Leiter der Martha Stichting. Ein Dominee musste schließlich auch standesgemäß untergebracht werden, und nicht in einem Stall. Das fanden sie selbst jedenfalls.
Die Stufen dieses herrlichen Gebäudes hochzusteigen, verbrauchte dann aber schon meine gesamte Kraft. Als meine Begleiterin klingelte, wurden meine Knie immer weicher. Ein Mädchen in schwarzer Kleidung und mit einer weißen Kopfbedeckung öffnete die Tür, sah uns freundlich an und bedeutete uns hereinzukommen.
Wie ich mit solch weichen Knien die Stufen geschafft hatte, weiß ich heute nicht mehr, aber auf einmal stand ich vor einem großen Schreibtisch, hinter dem ein älterer schwarz gekleideter Herr saß.
Mit einem strengen Blick sah er mich an. Ich drehte mich nach meiner Begleiterin um und bemerkte, dass ich allein mit diesem Mann in seinem Büro war. Erinnerungen an dieses Gespräch habe ich nicht mehr, nur daran, dass ich mir ein paar Ohrfeigen einhandelte. Meine Begleiterin meinte damals, ich hätte mich für den mir zugestandenen Platz in der Martha Stichting nicht dankbar genug gezeigt.
Sie meinte aber auch, das Gefühl der Dankbarkeit würde später sicherlich noch kommen. Da war sie sich sicher. Na klar würde das noch kommen, sicher doch!
Aus Langeweile hatte ich irgendwann angefangen, die Bibel zu lesen, jedenfalls Teile davon, bis mir von einem Pastor gesagt wurde: „Die Bibel wird immer wieder umgeschrieben, ungefähr alle vierzig Jahre. Sie wird an die Zeit angepasst, damit sie immer und für alle Menschen verständlich bleibt.“
Wer für diese Aufgabe des Umschreibens zuständig war, wollte ich noch gerne wissen. „Der Vatikan, also die Kirche in Rom, mit dem Papst und seinen Kardinälen“, sagte er mir dann.
„Und die schreiben so, dass wir es auch immer verstehen?“ fragte ich dann.
„Jawohl, Cees, genau so ist das gemeint. Wir wollen, dass auch du das verstehst.“
Wenn das so ist, kann Rom sich in Zukunft die Mühe sparen, denn Coby hatte mir eindeutig erklärt
„Gott ist Liebe. Jeder, der zu lieben fähig ist, hat Gott in sich, ob er will oder nicht.“ Das sollte doch wohl ausreichen, um an unseren Schöpfer zu glauben.
Wir müssten in diesem Leben an etwas glauben, sonst ginge alles den Bach hinunter, da war sich Coby sicher.
So hatte ich das auch verstanden, nur hatte unser Schöpfer es mir nicht leicht gemacht, im Glauben standhaft zu bleiben.
In der Martha Stichting waren so viele Kinder, die auf ein bisschen Liebe warteten. Wer war hier denn bloß dafür zuständig? Keiner fühlte sich meiner Meinung nach dazu aufgerufen, uns ein wenig Liebe zu schenken. Hier wurde für ein geregeltes Leben gesorgt, hier wurde ernährt und erzogen. Das war schon mehr, als ich in den letzten zwei Jahren hatte erleben dürfen.
Erziehung mit allen ihren Hilfsmitteln und Sichtweisen war mit vollem Magen gut auszuhalten. Wenn man dazu auch noch saubere Kleidung und ein warmes Bett hatte, sollte es mir recht sein. Was hätte ich auch schon daran ändern können? Coby war nicht mehr bei mir, also musste ich meinen Weg im Alleingang finden.
Aber genau das war das Problem. Coby fehlte mir so sehr, ihre einfühlsamen Worte, wenn es mir schlecht ging, oder die Streicheleinheiten, wenn ich mal wieder von Marie geschlagen worden war.
In meiner Anfangszeit in der Martha Stichting fehlte mir die Nähe zu meiner großen Schwester sehr. Nicht zu wissen, warum sie mir nicht hatte helfen können, warum sie mich allein lassen musste, machte mich depressiv, denn sie hatte mir immer wieder versprochen:
„Ich lasse dich nicht allein, Cees. Das verspreche ich dir. Ich werde immer für dich da sein.“ Warum war sie denn immer noch nicht hier? Ich brauchte Coby so dringend, was sollte denn jetzt aus mir werden? Die Erzieherinnen in der Martha Stichting konnten sich natürlich nicht mit jedem Kind und seine Probleme auseinandersetzen, doch anscheinend war ich eine Ausnahme, ein Problemfall eben. Mal wieder. Am Fenster sitzend, wartete ich eigentlich den ganzen Tag nur auf Coby.
Das Essen war eine Unterbrechung dieser nicht sehr sinnvollen Beschäftigung, aber ich wollte nichts anderes. Ich wollte hier nicht sein, und freiwillig hergekommen war ich auch nicht, also sollten die mich doch wieder zur Oma Enzering schicken.
Durch meine Grübelei genervt oder auch besorgt, brachten sie mich in das Stichtingseigene Krankenhaus. Man sagte mir, ich sei krank, nicht am Körper, sondern an meiner Seele.
Die liebe Krankenschwester Katrien hatte das wohlverstanden. Sie war der festen Überzeugung, dass ich Sehnsucht nach meiner Schwester Coby hatte, die Trennung von ihr nicht bewältigen konnte. Sie war sehr bemüht, sich mit mir zu unterhalten. Wohl auch um herauszufinden, was mich außerdem noch so sehr bedrückte. Nach ein paar Tagen in diesem Krankenhaus wusste Schwester Katrien, was mit mir tatsächlich los war. Sie erklärte mir das folgendermaßen:
„Du leidest unter übertriebenem Selbstmitleid, und bist nicht fähig, die Sache selbst in die Hand zu nehmen.“
Also ich war sieben Jahre und ein paar Monate alt, und sollte die Sache selbst in die Hand nehmen! Das war doch mal eine Diagnose, womit ein Kind etwas anfangen konnte. Sie sagte mir sinngemäß: „Vergiss deine Schwester Coby, vergiss auch deine Schwester Christa und denke auch nicht mehr an deine restliche Familie in Amsterdam.“ Na ja, Christa und den Rest der Familie in Amsterdam zu vergessen sollte für mich nicht allzu schwer sein. Aber Coby zu vergessen, wer denkt sich denn so etwas aus?
Anscheinend war diese Ansprache eine Standardmedizin gegen Gefühle der Verlassenheit.
Die Schwester Katrien war die Tage so lieb zu mir gewesen, dass ich sie nicht enttäuschen wollte. Es arbeitete in mir. Ich wollte kein Mitleid mehr mit mir haben. Ich wollte so sein, wie Schwester Katrien mich haben wollte. Aber Coby vergessen? Nie in Leben!
Vielmehr dachte ich darüber nach, warum Coby nicht zu mir gekommen war, nachdem Tante Tilly mich in dieses Heim gebracht hatte.
Wurde Coby vielleicht an einem unbekannten Ort festgehalten? Hatte man sie nicht informiert, was mit mir geschehen sollte? Jawohl, so musste es gewesen sein. Sie hätte mir bestimmt geholfen, aber sie konnte es nicht, weil sie es nicht wusste.
Dieser Gedanke wurde mein Rettungsanker. Je öfter ich darüber nachdachte, umso mehr gefiel mir dieser Gedanke. Meine Stimmung besserte sich zusehends.
Leider kam ich dadurch auch immer mehr zu der Überzeugung, dass jeder in meiner jetzigen Umgebung dafür gesorgt hatte, dass Coby nicht informiert worden war. Auch, dass Coby nicht darüber aufgeklärt werden sollte, wo ich mich momentan aufhielt. Dies trug sicherlich mit dazu bei, dass ich mich wieder der Außenwelt verschloss.Der Versuch, alles und jeden zu vergessen, und nur das Heute zu erleben, meine Gedanken nicht mit anderen teilen zu wollen, oder vielleicht auch teilen zu können, machte aus mir ein verschlossenes Kind. So erklärte man es mir später jedenfalls.
Einmal aus dem Krankenhaus entlassen, begann für mich das neue Leben. Oder auch das wirkliche Leben, wie Frau Carla es später benannte. Schwester Katrien hatte mich ordentlich geknuddelt, was sie eigentlich nicht durfte. Das war zu intim, wurde gesagt. Es sollte immer die Distanz gewahrt werden.
In der Gruppe, in der ich jetzt leben und wohnen sollte, fühlte ich mich dann nicht wirklich wohl. Die Erzieherinnen waren begierig zu erfahren, was die Krankenschwestern und der Arzt so alles mit mir angestellt hatten und was mir überhaupt gefehlt hatte. Sie bekamen alle die gleiche Antwort.
„Danke, mir geht es gut, ich weiß nicht, was die alles mit mir gemacht haben, denn die meiste Zeit habe ich geschlafen.“
„Aber du freust dich doch, wieder hier zu sein, nicht war, Cees?“ Na klar, ich freute mich wahnsinnig wieder hier sein zu dürfen, was glaubten die denn noch alles!
Ich vermute aber, dass ich nur mit dem Kopf genickt habe, denn ich wollte nicht reden. An meine Schwester Coby denken wollte ich auch nicht, denn dann kamen mir wieder die Tränen – aus Selbstmitleid natürlich! Also setzte ich mich hin und wartete auf das, was kommen sollte. Das sollte sowieso meine Standardbeschäftigung werden, hatte ich mir vorgenommen.
Das Abwarten war endgültig vorbei, als für mich die Schule anfing. Die Einteilung der Schulklassen war nicht sehr aufregend. Jungen auf die linke Seite und die Mädchen auf die rechte.
Der Lehrer war ein älterer Herr, der hinter seinem Schreibtisch thronte, Zigarren und Pfeife rauchte und dabei alle halbe Stunde einen Hustenanfall zu überstehen hatte.
Wenn er gute Laune hatte, rauchte er einen süßlich gewürzten Pfeifentabak, Karamell nannte man das wohl. Seine Zigarren waren mehr die preiswerte Sorte, denn der Geruch war schwer zu ertragen, ebenso wie der Mann selbst.
Der gute Mann saß auf seinen Stuhl und hatte auch nicht vor, diesen während des Unterrichts zu verlassen. Von ihm drohte also keine Gefahr, er stand nicht stiekum hinter mir, um mir bei passender Gelegenheit einen Schlag auf den Kopf zu versetzen. Das war beruhigend zu wissen.
Aufstehen wollte er nicht. Aber derjenige, auf den er es abgesehen hatte, sollte gefälligst herkommen, um sich dann einen Schlag mit seinem Lineal auf die Finger abzuholen. Den Arm ausgestreckt, alle Finger schön gerade, und dann schlug er drauf.
Voll auf die Finger mit seinem Lineal! Es war nicht sehr schmerzhaft, aber wir passten tatsächlich besser auf im Unterricht. Vielleicht sollte man an den Schulen wieder Lineale verteilen!
Anders sah das beim Religionsunterricht aus. Der Religionslehrer war ein kräftig gebauter Mann mit strengem Äußeren und der Bereitschaft, Gottes Wort in uns hineinzuprügeln, wenn wir nicht aufmerksam waren.
Aufmerksam natürlich nach seiner Auffassung. Das hieß, die Augen auf ihn gerichtet, zuhören und sich nicht ablenken lassen von irgendwelchen anderen Sachen. Wir Jungen saßen nämlich am Fenster und wenn etwas vorbeigeflogen kam, schaute man ungewollt dahin. Aber nicht bei ihm! Man schaute immer zu Herrn De Groot.
Seinen Leitspruch „Wer nicht hören will, muss fühlen“, kannte ich schon nach einer Stunde Unterricht auswendig.
Die Flugzeuge, die nach Amsterdam-Schiphol flogen, kamen bei günstigem Wind über Alphen aan de Rijn, also über die Martha Stichting, und ich sah dann ohne es zu wollen aus dem Fenster.
Nach der ersten Ohrfeige von Herrn de Groot, die ich ohne Kommentar einkassierte, hatte er sich wohl auf mich konzentriert. Zwei weitere sollte ich noch abbekommen, bis er die Frage stellte: „Wer ist Gott?“. Also er fragte in die Klasse hinein, sah aber mich dabei an, und ich sah ihn an. Sollte ich ihm jetzt erklären, wer Gott war? Oder wie meinte er das?
Er sah mir jetzt direkt in die Augen.
„Du hast mich doch wohlverstanden, Junge, also: Wer ist Gott?“ Ich starrte ihn an. Er meinte doch wohl nicht, dass er Gott war in dieser Schulklasse, oder womöglich doch?
An meiner linken Seite saß Willem G. Ein netter Schulfreund, der jedoch nicht in einem der Pavillons wohnte, sondern in der Arendshorst. Das war ein etwas abseits gelegenes Haus mit zwanzig Jungen im Alter von acht bis sechzehn Jahren.
Während des Unterrichts hatte Willem immer Zeit für irgendwelche Dummheiten.
„Cees, er meint bestimmt, dass er der Herrgott ist! Pass bloß auf, was du jetzt sagst. Ein falsches Wort und du landest in der Hölle, du arme Socke!“
Er lachte dabei leise, aber so ansteckend, dass ich mitlachen musste, ich konnte es nicht unterdrücken. Diese Aktion stieß bei Herrn de Groot nicht auf Gegenliebe.
Den Versuch, die Situation zu retten und übertrieben laut meine Nase zu putzen, hätte ich auch lieber lassen sollen.
Er stand neben mir. Meine Schultern hochziehend, schaute ich ihn abwehrend an.
„Sie haben mich jetzt dreimal geschlagen. Finden sie nicht, dass das reicht? Wie soll ich Ihnen erklären, wer Gott ist? Und bevor Sie mich jetzt wieder schlagen, sage ich Ihnen, dass ich das nicht erklären kann.“
„Dreimal“, sagte er, „dreimal hast du nicht geheult und bist immer noch frech, ich werde mir das merken, Junge!“
Er verpasste mir noch eine Ohrfeige. „So, wenn jetzt die Tränen kommen, kannst du noch mal ordentlich deine Nase putzen, einen Grund hast du dann wenigstens dazu.“
Es läutete im Flur, was gleichbedeutend war mit meiner Errettung vor Herrn de Groot.
Es wunderte mich damals, dass die “Neuen“ die erste Zeit nicht mit ihren Namen angesprochen wurden, sondern immer nur mit “Junge“, oder „Mädchen“. Aber das lag wohl daran, dass keiner wusste, wie lange der jeweilige “Neue“ in der “Martha Stichting“ verbleiben würde. Denn manch ein “Neuer“ kam nach kurzer Zeit zu Pflegeeltern. Aber immer wieder kehrten auch “Neue“ nach einiger Zeit wieder in die Martha Stichting zurück.
So einfach war es dann doch nicht, Pflegekindern ein Zuhause zu geben.
Die Unterrichtsstunde war dann auch beendet und wir hatten schulfrei, denn es war Mittwoch. Die Schulzeiten wurden hier genauso gehandhabt wie außerhalb der Martha Stichting, und bekanntlich haben in den Niederlanden alle Schulen am Mittwochnachmittag geschlossen.
Zurück in meiner Abteilung gab es wie jeden Tag ein warmes Essen. Dieses Essen war für mich eine Wohltat! Die Erzieherinnen wussten selbstverständlich, dass ich unterernährt war, und das war mir auch wohl deutlich anzusehen.
Wir hatten jeden Tag der Woche etwas anderes auf dem Teller, und dazu noch eine Nachspeise. Jeden Tag wieder konnte ich mich richtig satt essen. Das war für mich immer wieder ein Wunder!
Der Tag fing schon früh an. Um sechs Uhr wurden wir geweckt, dann ab in den Waschraum und zur Toilette. Nicht jeder benötigte die Toilette am Morgen, denn es gab mehrere Bettnässer. Ihre Betten standen zusammengestellt unter einem großen Fenster. Die Matratzen waren mit einer Gummiunterlage abgedeckt, damit sie nicht gänzlich durchweichten.
Jeden Tag bekamen die Bettnässer saubere Bettlaken für oben und für über die Matratze. In den Niederlanden gab es zu der Zeit keine Daunendecken, die in einen Bettbezug gesteckt wurden.
Wir „Nicht-Bettnässer“ sollten nun den anderen helfen, ihre Betten abzuziehen und anschließend neu zu beziehen. Ich wollte das auf keinen Fall tun.
Die Erzieherinnen redeten mit Engelszungen auf mich ein, aber da war nichts zu machen, ich wollte das nicht. Schließlich hatte ich nicht ins Bett gepinkelt. „Sollen die sich doch gegenseitig helfen. Die sind ja an den Geruch gewöhnt, sie haben ja die ganze Nacht darin gelegen“, war mein Argument.
Mehrmals wurde ich gemaßregelt, leise wurde geschimpft, manchmal am Ohr gezupft. Aber ich war bockig, fanden die Damen Erzieherinnen. Im Waschraum standen wir reichlich dicht aufeinander. Zähne putzen, Gesicht und Oberkörper waschen, und wenn ich mich dann so umsah, überkam mich bisweilen die Angst, dass ich krank war.
Bei keinem dieser anderen Jungen waren die Rippen so deutlich zu sehen, wie bei mir. Meine Gelenke waren dicker als meine Arme und Beine. Das war nicht in Ordnung, dachte ich.
Eine meiner Erzieherinnen, Juf Anne, sprach ich darauf an. Sie meinte schlichtweg, „Du warst am Verhungern. Hier bekommst du zu essen, aber du weigerst dich den anderen zu helfen.“ Sie drehte sich um und ließ mich stehen. Was nun das eine mit dem anderen zu tun hatte, leuchtete mir nicht ein. Ich konnte jedoch auch niemanden danach fragen. Nun, dann sollte das so sein, aber in die vollgepissten Betten wollte ich trotzdem nicht hineingreifen.
Befürchtet hatte ich, dass mein Teller nicht mehr so voll sein würde in der kommenden Zeit. Aber das war ein Irrtum. Keine der Erzieherinnen ließ sich etwas anmerken. Ich jedoch auch nicht, mein Essen war mir sicher, das war mir das wichtigste.
Das „Juliana Kinderhuis“ war umgeben von hohen Bäumen. Es gab Eichen, Buchen, vereinzelt auch Kastanien, viele Sträucher und vor allem Rhododendron. Die Verbindungswege waren nicht gepflastert, sondern mit Kies gestreut. Nur um das Wirtschaftsgebäude herum waren drei oder vielleicht vier Reihen Pflastersteine verlegt.
Auf dem Gelände befanden sich mehrere Teiche, die untereinander wieder durch Flüsschen verbunden waren. Zum Überqueren dieser Flüsschen gab es drei Holzbrücken, die im Winter mit einer Sand- und Salzmischung gestreut wurden. Auch von dem „Juliana Kinderhuis“ zur Schule gab es eine Holzbrücke und einen Kiesweg.
Winter 1954
Es war mein erster Winter in der Martha Stichting. Zu der damaligen Zeit waren die Winter noch ordentlich kalt und die Gewässer froren immer zu. Manchmal konnte man sogar zu Fuß oder mit dem Wagen von Amsterdam über das IJsselmeer hinüber nach Friesland gelangen.
Unsere Winterkleidung war nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Ich kam damit jedoch gut zurecht. Meine alte Mütze hatte ich noch und aus der Kleiderkammer hatte ich mir eine Hose abholen dürfen.
Sie schlotterte um meinen Hintern, die Länge war ein Ratespiel, denn als ich die Hose angezogen hatte, ging das Raten los. Hatte ich jetzt eine lange zu kurze Hose oder eine kurze zu lange Hose an? Darüber wurden wir uns nicht einig, aber mir war das auch egal. Die Hose war richtig warm, das war doch die Hauptsache!
An das Gelächter der Jungen aus meiner Gruppe hatte ich mich schon gewöhnt. Die Sachen, die ich in die Martha Stichting mitgebracht hatte, konnte ich nicht mehr anziehen. Die fielen vor Altersschwäche fast auseinander. Meine Schuhe hatte ich schon zeitig gegen Klompen eintauschen müssen. Demzufolge war ich, äußerlich zumindest, ein richtiges Martha Stichting Kind.
Die Haare wurden nach altbewährtem Muster geschnitten: rundum kurz, und weit über den Ohren alles frei. Bei uns Jungen war dieser Haarschnitt nicht unbeliebt, eigentlich war es uns egal, wie wir ausschauten. Hauptsache wir mussten nicht frieren.
In der Schule galten Regeln. Den gepflasterten Bereich des Schulhofs in den Unterrichtspausen zu verlassen, war strengstens untersagt. Dass wir uns an dieses Verbot auch hielten, wurde ständig von dem Schulpersonal kontrolliert. Wie es jedoch immer so ist, wenn Kinder im Schnee spielen und auch Schneeballschlachten machen, brauchten sie dafür große Mengen Schnee. Der lag aber meistens da, den noch niemand betreten hatte. Das war in diesem Fall nun einmal neben dem gepflasterten Schulhof.
Auch ich hielt mich, natürlich versehentlich, nicht an diese Regel. Die Mädchen fingen zu schreien an, und ich wusste sofort, was los war.
Eine Aufsichtsperson kam über die glatte Schneefläche angeschliddert, rutschte aus und landete schimpfend und fluchend auf seinem Hintern. Wir Jungen nahmen unsere Klompen in die Hand und rannten zurück zum gepflasterten Teil des Schulhofs. Bevor der schimpfende Lehrer wieder auf den Beinen war, waren wir schon in der Menge der Kinder verschwunden. Auf Socken kann man bekanntlich auf schneebedeckten Flächen schneller laufen, als auf Schuhen mit Ledersohlen.
Aber es nutzte nichts, wir waren erkannt worden oder es hatte jemand gepetzt. Zur Strafe durften wir nachmittags nicht draußen spielen.
Der Schulleiter meinte, wir wären mit nassen Socken schon genug bestraft. Der Unterricht dauerte nämlich noch zwei Stunden und die Zeit, mit kalten Füssen still sitzen zu müssen, war ein ausreichender Denkzettel. Das war doch keine Strafe! Keine Schläge, kein Essensentzug, es waren richtig gute Zeiten für mich!
Der Sinn dieses Verbotes, den Schulhof während der Unterrichtspausen zu verlassen, sollte uns aber noch vor Augen geführt werden.
Alle Teiche und deren Zuläufe waren zugefroren. Es würde uns jetzt auch strengstens untersagt, über das Eis zulaufen, bis das freigegeben würde.
Aber wie, das so ist, wir mussten natürlich erst mal ausprobieren, ob das Eis schon stark genug war. Es war stark genug, wir hatten es herausgefunden. Klompen ausziehen, dann Anlauf nehmen und mit höchstens zwei Berührungen der Eisfläche auf der anderen Seite ankommen, ohne auszurutschen.
Das war ein Spaß! Erwischt wurden wir dabei auch nicht, also alles bestens.
Als dann endlich die Eisflächen landesweit freigegeben wurden, machte es nur noch halb so viel Spaß über das Eis zu rennen. Wir machten uns jetzt eine Rutschbahn mit unseren Klompen. Das funktionierte bestens!
Erst nur ein paar Meter, aber die Rutschbahn wurde immer länger und die „Fallzahlen“ erhöhten sich dementsprechend. Auch Kinder aus anderen Gruppen machten bei uns mit. Das war ein Riesenspaß.
Die Frostperiode endete nach ein paar Wochen. Wir wurden davor gewarnt, das Eis zu betreten und jetzt wurde das Eislaufen auch wieder spannend. Die Rutschbahn war vergessen, Eislaufen war angesagt. Ich war gerade bei den Hühnern und wollte nachsehen, ob die Viecher trockenes Stroh hatten, als ich lautes Geschrei hörte.
Vor dem Flüsschen sammelten sich mehrere Kinder und die schrien aus Leibeskräften. Bei dieser Gruppe angekommen, das dauerte keine zehn Sekunden, sah ich, dass das Eis gebrochen war. Nur noch Eisschollen, richtig kaputt, es war jemand eingebrochen!
Eine Erzieherin stand vor den Kindern und eine männliche Person stand bis zum Bauch im eiskalten Wasser und versuchte an den Jungen heranzukommen. Schweigend stand ich am Rand dieser Gruppe. Es graute mir vor dem, was kommen sollte. Wegschauen konnte ich aber auch nicht.
Andere Erzieherinnen kamen mit Decken in den Armen angerannt. Sie wollten auch helfen, aber das hatte keinen Zweck mehr.
Sie zogen den Jungen aus dem eiskalten Wasser, deckten ihn mit den mitgebrachten Wolldecken zu, versuchten ihn zu beatmen. Damit hatten sie aber leider keinen Erfolg. Fräulein Bettie bat unsere Gruppe hereinzukommen.
Wir liefen, ohne einen Ton von uns zu geben, hinter ihr her. Mir war richtig schlecht. Noch nie hatte ich einen toten Menschen gesehen. Dieser Junge sah so anders aus als sonst!
Es war unfassbar, dass der Tod so nah an uns herangekommen war. Am nächsten Tag wurde ein Gottesdienst abgehalten. Der Dominee donnerte vom obersten Stehplatz, denn es gab keine Kanzel: „Ihr sollt gehorsam sein. Wir haben jetzt erlebt, was geschieht, wenn Kinder nicht gehorsam sind.“ „Und auch was passiert, wenn das Eis zu dünn ist“, dachte ich, sagte aber lieber nichts.
Nachdem er seine Strafpredigt beendet hatte, durften wir wieder in die einzelnen Gruppen zurück, und es wurde nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht mehr über die Eisschollen zur anderen Uferseite zu laufen.
Wir durften trotzdem noch gerne draußen spielen. „Aber vergesst nicht, brav zu sein.“ Diesen Hinweis hätte es wirklich nicht mehr gebraucht! So weit wie möglich weg vom Wasser war jetzt die Devise. Wir trauten uns nicht einmal zum Wasser hinzusehen.
Die Tage gingen dahin, ohne dass sie spektakuläre Eindrücke hinterließen, denn mir fällt nichts ein, was sich in meinen Erinnerungen abgespeichert hätte. Mein Leben plätscherte so dahin. Frühstück, Schule, Mittagessen und wieder Schulunterricht, ein bisschen herumrennen bis zum Abendbrot und ab ins Bett.
Dass ich dreimal am Tag mein Essen zu mir nehmen konnte, war mir anscheinend schon zur Gewohnheit geworden.
Darüber nachzudenken brauchte ich nicht mehr. Ich bekam mein Essen jeden Tag. Dass es mir nicht immer schmeckte, hatte mehr mit mir zu tun, als mit der Zubereitung. Das Ziel war auch nicht, einen kulinarischen Hochgenuss zu präsentieren, sondern bei der Nahrungsaufnahme sollten wir satt werden können.
Vorführung
Eine Besuchsregelung ermöglichte es den Familien, die Kinder in der Martha Stichting zu besuchen. Die Besuchsgenehmigung musste jedoch mindestens sechs Wochen vorher beantragt werden und konnte ohne Begründung verweigert werden.
Den betreffenden Kindern wurde mitgeteilt, dass sie am Sonntag vielleicht Besuch bekämen, und daher nicht draußen spielen durften, damit sie auch schön gepflegt und sauber ihren Besuch empfangen konnten.
Die Tage, an denen unsere ganze Gruppe sauber und gepflegt dastehen sollte, waren auch die Schautage für angehende Pflegeeltern, wie ich später herausfand.
Aufgereiht, brav die Hände auf dem Rücken, sollten wir freundlich und lieb die Menschen anschauen und uns auch nicht kratzen. Wir sollten aber den Erwachsenen auch nicht zu lange direkt in die Augen schauen, sondern zwischendurch immer wieder auf den Boden, sonst wirkte das nicht bescheiden genug. Bescheidene Kinder waren damals sehr beliebt. Zumindest war, dass die Devise wie ich sie verstanden hatte.
Auf meine Frage, was denn genau Pflegeeltern wären, hörte sich die Antwort etwa folgendermaßen an. Erstens: Pflegeeltern sind unter anderem Erwachsene, die gerne noch zusätzlich ein oder auch mehrere Kinder im Haus haben wollten. Sie liebten es, viele Kinder um sich zu haben.
Zweitens: Es war jedoch auch möglich, dass Pflegeeltern Heimkinder aufnehmen wollten, weil sie noch keine eigenen Kinder hatten.
Diese Auskunft hatte es aber in sich. Die erste Sorte Pflegeeltern hörte sich an, wie das Zuhause in der "Rudolf Stichting". Nein danke, das hatte ich bereits hinter mir!
Die Zweite wollte vielleicht ausprobieren, ob sie überhaupt Kinder haben wollten. Was würden sie dann mit dem Pflegekind machen, wenn sie eigene Kinder in die Welt setzen würden?
Meine Erlebnisse der vergangenen Jahre machten mich nicht zu einem enthusiastischen Anhänger der Idee, mich als Pflegekind bei irgendwelchen Pflegeeltern zu bewerben.
Fräulein Bettie war überzeugt, ich sollte immer freundlich lächeln, nicht sprechen und ruhig stehen bleiben.
Daraufhin übte ich einen bösen Gesichtsausdruck, hauptsächlich nicht zu lächeln und mich dauernd zu kratzen. Und wenn mir trotzdem jemand zu nahe kommen sollte, hatte ich mir vorgenommen zu schreien.
So ein entspanntes Leben hier in der Martha Stichting würde ich mit Gewissheit nicht eintauschen für einen unsicheren Platz in einer Pflegefamilie! Wir standen in einer Reihe vor der Eingangstür des Kinderhauses, und warteten auf das, was möglicherweise geschehen würde. Piet van Z. konnte vor Nervosität sein Wasser mal wieder nicht halten, mochte aber die Reihe auch nicht verlassen. Dann tat er, was er immer tat, er machte sich in die Hose. Fräulein Bettie schickte ihn hinauf in unseren Aufenthaltsraum und so waren wir nur noch sieben Kinder.
„Cees, du sollst lächeln und kratze dich nicht andauernd. So wirst du noch in zehn Jahren hier sein.“
Jetzt musste ich wirklich lächeln, allein der Gedanke hier noch eine Weile bleiben zu dürfen, machte mich glücklich und zufrieden. Wusste Fräulein Bettie denn nicht, wie es außerhalb der Martha Stichting zugeht? Hatte sie wirklich nie davon gehört, wie Erwachsene oft mit kleinen Kindern umgingen?
Solche Nachmittage waren aber auch irgendwann vorbei. Einige Kinder, die auf Besuch gehofft hatten, waren enttäuscht, weil keiner gekommen war.
Andere wiederum waren traurig, weil sie in der Martha Stichting bleiben sollten, obwohl sie darauf gehofft hatten, wieder mit nach Hause zu dürfen.
Ich war meistens der Glücklichste. Nicht dazu verdonnert worden zu sein, überhaupt Pflegeeltern ausgeliefert zu werden, sondern stattdessen ohne Angst und Hunger mein Leben hier verbringen zu können, machte mich sehr zufrieden.
Richtig gemein wurde es, wenn Pflegeeltern ihr auserwähltes Pflegekind nach einiger Zeit wieder in die Martha Stichting zurückbrachten. Wir anderen waren froh, das bekannte Gesicht wieder mit am Tisch zu sehen. Doch derjenige, dem das widerfahren war, benötigte schon seine Zeit, sich abermals einzuleben. Es waren auch Kinder dabei, die gehofft hatten in eine Pflegefamilie aufgenommen zu werden. Wenn diese dann nicht dafür infrage kam, fühlten sie sich wohl abgewiesen und heulten den ganzen Abend.
Christa in der Martha Stichting
Eines Tages, kurz vor dem Abendbrot, kam Fräulein Bettie zu mir. „Cees, kommst du bitte mit mir nach draußen, es wartet jemand auf dich.“
Jeder sah mich an, mein Herz raste in meiner Brust. Wer konnte das sein? Coby, aber natürlich, Coby war gekommen! Sie wollte wissen, wie es mir ging. Ich sprang hoch, rannte zur Tür und holte mir eine Beule am Kopf. Ja klar, um diese Zeit war die Tür doch immer verschlossen, das hatte ich in meiner Eile vergessen.
Fräulein Bettie schloss auf, ich rannte die Treppe hinunter und musste an der Außentür wieder warten, denn auch diese war verschlossen.
Als Fräulein Bettie die Tür dann endlich geöffnet hatte, rannte ich raus. Mein innigster Wunsch war es, dass Coby mich jetzt in ihre Arme nehmen würde, das wäre Balsam für meine Seele gewesen. Was ich jetzt jedoch sah, haute mich fast um. Was war das denn?
Auf den Stufen der Eingangstreppe saßen mein Vater und Christa.
Die Enttäuschung verschlug mir die Sprache. Wieso denn Vater und Christa, war die Marie vielleicht auch noch dabei? Hätte sie auch noch zufälligerweise um die Ecke geschaut, wäre ich umgehend wieder im Haus verschwunden.
Wenn ich etwas nicht mehr sehen oder auch nur hören wollte, war das mit Sicherheit die Marie. Schon bei dem Gedanken an diese Marie bekam ich einen Schweißausbruch.
Mein Vater sah mich an, als ob ich ein Geist wäre.
„Cees, mein Junge, du hast dich mächtig verändert. Wie groß du geworden bist, und du hast enorm zugelegt. Ich bin richtig stolz auf dich.“
Mir stockte der Atem, wieso war er stolz auf mich? Was hatte er dazu beigetragen, dass er ein berechtigter Anspruch hatte, stolz auf mich zu sein? Am liebsten hätte ich ihn gefragt: „Hast du denn gedacht, ich würde hier genauso schäbig behandelt wie bei dir Zuhause? Und dass ich hier auch mehr Prügel als zu essen bekomme, während du immer wegsiehst?“ Es war mir jedoch nicht möglich, überhaupt ein Wort herauszubekommen.
Wir standen nur da und sahen uns an. Christa starrte nur auf den Boden und fummelte an ihrem Kleidchen herum, sagte jedoch kein Wort.
Was wollten die beiden bloß hier? Fräulein Bettie wollte jetzt die Situation retten: „Freust du dich denn nicht, Cees? Jetzt siehst du endlich deinen Vater und deine Schwester mal wieder, ist doch schön, oder nicht?“
Da brach es aus mir heraus:
„Was soll denn daran so schön sein? Ich habe doch nicht darum gebeten, dass die beiden mich besuchen. Ohne sie bin ich hier bestens klargekommen. Christa hatte sich sogar mit ihrer neuen Mutter gegen mich verbündet. Die Frau, die mich immer wieder geschlagen und sogar gebissen hat! Und ich soll mich jetzt freuen, sie wiederzusehen? Wie geht denn so was? Wenn ich Christa und meinen Vater nur anschaue, denke ich sofort wieder an die fürchterliche Zeit damals in Amsterdam!“
Mir waren die Tränen gekommen. Es brach aus mir heraus, ich konnte sie nicht zurückhalten. Es waren Tränen der Wut, und es waren Tränen aus Enttäuschung und Verzweiflung. Was so lange Zeit in meinen Erinnerungen versteckt gewesen war, kam wieder hervor. Der Hunger, die Schläge, die Herzlosigkeit meines Vaters immer wieder wegzusehen, wenn ich ihn am meisten gebraucht hätte!
Ja, ich spürte jetzt einen abgrundtiefen Hass auf diese Marie. Weil mir das Leben hier so leicht gemacht wurde, wusste ich erst, was ich während jener Zeit bei dieser Person aushalten musste. Und dieser Hass richtete sich nicht nur gegen diese Marie, sondern auch gegen meine Schwester Christa, die sich mit Marie zusammengetan hatte, wann immer es ihr passte.
Und das auch nur zu ihrem Vorteil und gegen mich! Als ich sie damals gebraucht hätte, waren sie nicht für mich da gewesen, und jetzt brauchte ich sie auch nicht mehr.
Ich konnte sie einfach nicht mehr sehen. Meine Beine zitterten vor Aufregung und mir wurde schlecht.
„Fräulein Bettie, ich möchte bitte wieder nach oben, mein Abendbrot wartet auf mich.“ Fräulein Bettie war vollkommen durcheinander, sie weinte mit mir. Sie legte ihren Arm auf meine Schulter und nahm mich mit nach oben.
Ich war mir so sicher gewesen, dass Coby mich gefunden hätte! Umso größer war jetzt meine Enttäuschung, als nur mein Vater und Christa auf einmal vor mir auf der Treppe saßen.
Seit sechzehn Monaten hatte ich hier in der Martha Stichting meine Ruhe gehabt. Diese Zeit hatte mir so gutgetan, das bemerkte ich jetzt sehr deutlich.
In der Nacht hatte ich manchmal Alpträume. Fräulein Bettie saß an meinem Bett und redete auf mich ein, streichelte mich. Die anderen Jungen erzählten mir aber, ich hätte immer nur geschrien.
Am nächsten Tag brauchte ich nicht zur Schule. Fräulein Bettie begleitete mich zum Wirtschaftsgebäude, denn hier hatte eine Psychologin ihr Büro. Die Psychologin, Frau Carla, wollte sich unbedingt mit mir unterhalten, sagte Fräulein Bettie. Und wenn Fräulein Bettie das sagte, musste ich hingehen. So war das nun mal.
Mit feuchten Händen und etwas ängstlich stand ich vor der Tür und wollte anklopfen. Bevor ich jedoch die Tür berührte, wurde ich schon hereingebeten. In einem großen Ledersessel sollte ich mich setzen.
Ich befolgte die Anweisung und versank fast in diesem Sessel. Meine Beine reichten nicht mehr bis an den Fußboden, also konnte ich mich auch nicht mehr richtig in den Ledersessel hineindrücken. Das Ganze sah sicher ein wenig hilflos aus, aber es ging nicht anders. Die Psychologin sah mich nur an, sie sagte keinen Ton, sie lächelte nicht, schaute mich aber auch nicht genervt an. Genau so hatte ich mir die Geschichte von dem Kaninchen und der Schlange vorgestellt.
Auf einmal lächelte sie mich freundlich an. „Ich heiße Frau Carla, und du nennst mich bitte auch so. Hast du Angst vor mir, Cees? Brauchst du aber nicht, wir wollen nur miteinander reden.“
Sie wollte also mit mir reden und ich sollte brav zuhören, das war für mich kein Problem. Und dann legte sie los.
„Wie ich gehört habe, Cees, hast du einen Vaterkomplex. Du liebst deinen Vater nicht mehr. Und die Frau deines Vaters liebst du auch nicht.
Dazu magst du auch deine Schwester Christa nicht mehr. Aber deine Schwester Coby ist dein Ein und Alles. Ich frage mich jetzt, wie kann das angehen? Der Mensch sollte seinen Vater und seine Mutter ehren und lieben! Das Gleiche gilt aber auch für Geschwister. Was geht bloß in deinem Kopf vor? Du bist zwar ein kleiner Mensch, aber immerhin ein Mensch. Meine Sorge ist, dass du mehrere soziale Dysfunktionen hast!“
Da war ich aber platt. Was konnte das wohl sein, und wieso hatte ich das selbst nie bemerkt? Immerhin, ich war ein Mensch, hatte Frau Carla gesagt, das war schon mal ein Vorteil für mich.
Sie redete aber immer noch weiter, und sagte eigentlich immer dasselbe. Ich glaube, sie wollte mir verdeutlichen, dass ich einen sozialen Defekt hatte. Aber eigentlich hatte sie ein Problem, sie kannte die Frau meines Vaters nicht, und meinen Vater kannte sie auch nicht! Und das war auch gut so, denn mit meinem Vater hatten sich schon ganz andere Frauen auf Dauer nicht verstehen können! Die Bekanntschaft mit Marie sollte sie jedoch unbedingt nachholen, denn da hätte sie bestimmt ein lohnendes Studienobjekt!
Auf einmal war Frau Carla still und sah mich wieder nur an, ohne etwas zu sagen.
„Hörst du mir eigentlich zu, Cees? Ich glaube, deine Gedanken sind nicht in diesem Raum, sondern woanders. Du solltest mir jetzt deine Version geben, von dem, was gestern geschehen ist.“
So, jetzt war ich also dran. Was wollte sie denn hören, oder sollte ich sagen, was ich denke?
„Es ist nichts geschehen, außer dass mein Vater und Christa mich besucht haben, und ich das nicht wollte. Ich will die nicht mehr sehen, das ist alles.“
„Ach Cees, mein lieber Junge, du bist nicht im Bilde darüber, was tatsächlich los ist, höre ich. Was ich dir jetzt sagen werde, wird dich bestimmt erfreuen.
Dein Vater und deine Schwester haben dich nicht nur besuchen wollen, sondern deine Schwester Christa lebt seit gestern auch in der Martha Stichting. Man hat deinem Vater erzählt, dass es dir hier so gut gefällt, dass du sogar jeden Tag gerne zur Schule gehst und auch ein gutes Zeugnis bekommen hast. Zusammen mit dem Jugendschutz haben sie dann vereinbart, dass Christa auch in der Martha Stichting wohnen soll. Sie waren überzeugt, was für dich gut ist, kann für auch Christa nicht schlecht sein. Dein Vater hat Christa nur begleitet, und bevor er wieder ging, wollten die beiden dir nur guten Tag sagen.“
„Dein Vater war sehr traurig, Cees. Er sagte zu Fräulein Bettie: „Sie schauen mich so kritisch an, aber so ist das mit Kindern. Wenn sie klein sind, treten sie auf den Schoß, und wenn sie groß sind auf dein Herz. Da werde ich wohl mit leben müssen.“
Da war ich wirklich einmal sprachlos. Das hat er sich getraut zu sagen? Unfassbar!
Das war dann doch etwas viel auf einmal. Christas Ankunft hier in der Martha Stichting begeisterte mich ganz und gar nicht! Mich interessierte jedoch etwas ganz anderes.
„Frau Carla, ich würde mich freuen, wenn Sie mir sagen könnten, wo meine Schwester Coby wohnt. Oder kommt sie auch bald zu mir in die Martha Stichting?“ Ich war so gespannt auf ihre Antwort. Meine Hände zitterten dermaßen, dass Frau Carla aufstand und auf mich zukam. Sie nahm meine Hände in die ihren und sagte:
„Nein, Cees, das kann ich dir leider nicht sagen. Aus deinen Unterlagen geht nicht hervor, wo Coby sich gegenwärtig aufhält. Du musst nicht traurig sein, ich werde nachfragen, wo Coby wohnt und dich umgehend darüber informieren. Dennoch, Cees, jetzt sage mir doch mal, wie findest du es, dass du und Christa jetzt zusammen in der Martha Stichting seid? “
„Frau Carla, ich könnte mir da schon etwas Besseres vorstellen. Meine Schwester Christa möchte ich nicht mehr um mich haben. Die Zeit hier in der Martha Stichting war wirklich schön im Vergleich zu der Zeit bei meinem Vater und seiner Frau. Jetzt wird alles wieder so wie damals. Immer Streit mit Christa. Sie will stets, dass ich das mache, was sie sagt. Sie wird sich wieder überall einschleimen und mich nur schlecht machen. Es war so schön hier, und jetzt wird sie alles zerstören.“Das musste ich unbedingt loswerden.
„Cees, darüber brauchst du dir wirklich keine Sorgen zu machen. So wie du im Kinderhaus wohnst, ist Christa ins Mädchenhaus eingezogen. Sie kann gar nicht zu dir kommen, das ist verboten. Du darfst doch euer Gelände auch nicht verlassen, oder doch?
Nur während der Schulpausen könntet ihr euch sehen, und das auch nur, wenn du das möchtest. Mache dir deshalb keine Sorgen, du kannst so weiter leben wie bisher, es wird dich keiner belästigen, versprochen Cees. Darüber hinaus, was deinen Vater und deine Stiefmutter betrifft, ist auch alles geregelt. Deinem Vater ist das Sorgerecht für dich entzogen worden. Ein Sorgerecht, das deine Stiefmutter übrigens nie hatte. Das Gleiche gilt auch für deine leibliche Mutter. Schon bald wirst du deine Voogdes (Erziehungsberechtigte oder Vormund) kennenlernen. Mit dieser Frau kannst du alles klären, was deine Eltern betrifft. Ungeachtet dessen, wenn dir etwas Sorgen bereitet, kannst du auch immer zu mir kommen. Wir setzen uns dann zusammen und besprechen das.“
„Frau Carla, darf Marie mich hier besuchen? Hoffentlich nicht! Und wenn sie es vorhätte, würdest du das verhindern, bitte?“ „Darüber brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Dieser Frau ist es vom Gericht verboten worden, dich zu besuchen. Sie darf unter keiner Bedingung Kontakt mit dir aufnehmen. Das wird sie auch mit Sicherheit nicht wollen, Cees, sie wollte dich unter keine Umstände in ihrer Nähe haben. Sie war wohl so bösartig, weil du nicht gefügig warst. Bei deiner Schwester Christa war es nicht ganz so schlimm, sie hatte sich der Frau deines Vaters wohl mehr untergeordnet.
Was auch immer gewesen ist, Cees, du solltest versuchen, die schlimme Zeit zu vergessen. Jetzt geht es dir doch gut, oder?
Ich habe die Vermerke in deiner Akte alle gelesen, ich weiß daher wie es dir ergangen ist. Wir in der Martha Stichting, werden dafür sorgen, dass dir so etwas nie wieder passiert. Ich danke dir für das Gespräch, Cees. Fräulein Bettie wartet draußen auf dich. Wir sehen uns bestimmt bald wieder.
Ach so, bevor ich das vergesse, Cees, ich soll dich ganz herzlich grüßen von Frau Schonewille. Sie hat dich wirklich lieb gewonnen und dich auch nicht vergessen.“
Das war nun doch zu viel für mich. Die Frau Schonewille hatte ich schon vollkommen vergessen. Ich wollte auch nicht mehr an die Zeit und an die Menschen erinnert werden. Ihre lieben Worte jedes Mal, wenn es mir schlecht ging, und das war oft genug. Ich wollte alles vergessen, denn die Erinnerungen an Frau Schonewille bezogen sich auch immer auf die fürchterliche Zeit mit Marie. Sie waren untrennbar miteinander verbunden.
Wenn ich alle beteiligten Personen und meine Erinnerungen an sie verdrängen konnte, wäre ich mit Sicherheit besser dran. Nur, wie ich das bewerkstelligen sollte, war mir ein Rätsel. Hoffentlich würde die Zeit meine Verbündete sein.
Mit gemischten Gefühlen gab ich Frau Carla die Hand. Sie lächelte mir aufmunternd zu. „Bleibe so ein aufgeweckter Bursche, und lass dich nicht unterkriegen“, sagte sie zum Abschied.
‚Lass dich nicht unterkriegen', das waren die Zauberworte, die ich nicht vergessen würde.
Pavillon 3
Ein paar Wochen später sprach Fräulein Bettie mich an. „Cees, du bist jetzt so ein großer Junge, du bist eigentlich zu alt für dieses Kinderhaus.“ Mein Herz rutsche mir in die Hose, was sollte jetzt wohl kommen. „Du und Piet van Z. ziehen nächste Woche um. Ihr werdet dann in Paviljoen drei wohnen.
Die Bezeichnung „Paviljoen“ ist zu übersetzen mit „Pavillon“. Es handelt sich schlicht um die Bezeichnung für einen Gebäudekomplex mit drei Flachdachhäusern, die untereinander mit überdachten Gängen verbunden waren.
Jeder Verbindungsgang war an beiden Seiten in der oberen Hälfte verglast. Auch jeder einzelne Pavillon war lichtdurchflutet, weil die Westseite voll verglast war. Eine große Glastür führte zu der Terrasse. Von dieser Terrasse aus führte eine breite vierstufige Treppe zu einem Innenhof.
Der maß bestimmt fünfzig Meter mal dreißig Meter. Die Pavillons mit ihren Verbindungsgängen formten eine Barriere zur Ostseite. Die Nordseite wurde durch einen hohen Zaun von einem zur Martha Stichting gehörenden Werkstattgelände abgegrenzt.
Hier waren auch die Gebäude der Pfadfindergruppen. Auf der Westseite strömte ein kleiner Bach, der selbstverständlich auch eingezäunt war.
Der Innenhof war zu achtzig Prozent gepflastert. Die restliche Fläche war nochmals aufgeteilt. Ein Teil war bestückt mit einem Klettergerüst nebst Sandkasten, ein Teil der Fläche war mit Bäumen bewachsen und ein Teil war ein kleiner Kinderbauernhof.
Hier hausten auch zwei Puten, ein Ziegenbock und mehrere Kaninchen. Irgendwann entstand da auch eine Tauben-Voliere. Mehrere Brieftauben fanden hier, ihren Platz und, wurden, ebenso wie die Kaninchen, mit viel Liebe versorgt.
Der Ausdruck Pavillon hörte sich zwar gut an, dass ich jedoch umziehen sollte, machte mich nicht wirklich glücklich. Es brachte mich aber auch nicht aus dem Gleichgewicht.
Es war nicht möglich auf Dauer in der gewohnten Umgebung zu verbleiben. Der Wechsel musste sein, denn größere Kinder mussten ihren Platz frei machen für jüngere Kinder, die einen Heimplatz dringend nötig hatten. Und dabei handelte es sich um sehr viele Kinder, die einen Platz benötigten. Die Einsicht hatte ich damals natürlich nicht, es wurde logischerweise nicht darüber diskutiert.
Viel zu tragen hatte ich nicht, mein Köfferchen mit ein paar Wäschestücken, und mein Blechauto, das wunderbare Geschenk von Hans. Am darauffolgenden Samstag sollte der Umzug stattfinden.
Selbstverständlich hatte ich in der Nacht nicht besonders gut geschlafen. Piet van Z. hatte vor Aufregung bestimmt zweimal ins Bett gepinkelt.