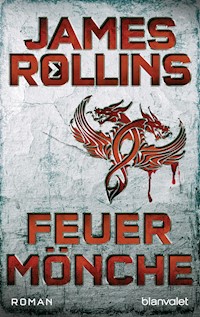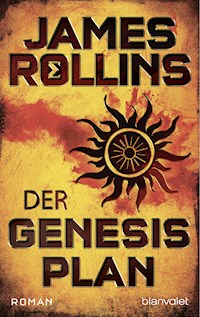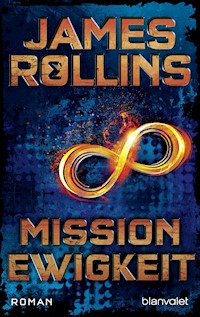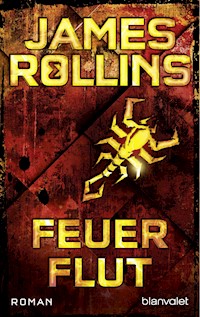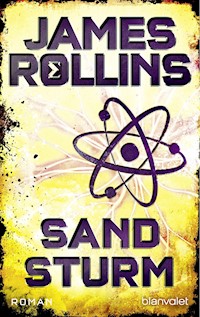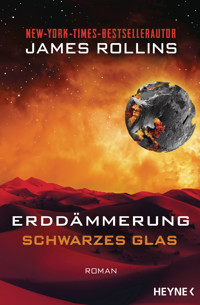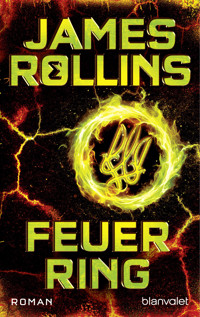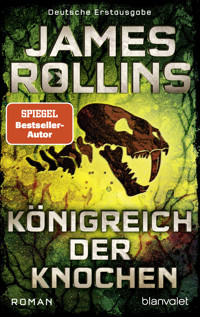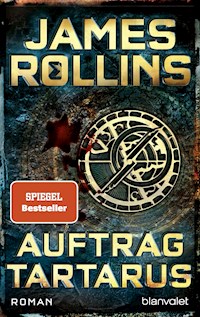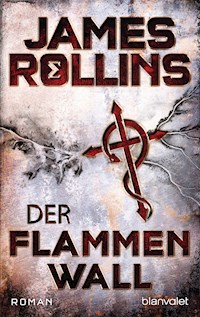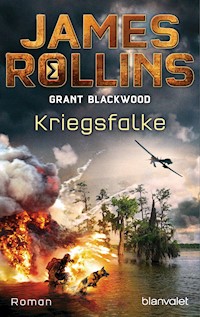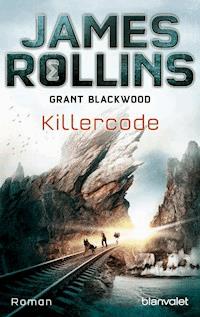
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: SIGMA Force - Tucker Wayne
- Sprache: Deutsch
Eigentlich ist es nur ein einfacher Auftrag als Leibwächter, den Tucker Wayne mit seinem Militärhund Kane von der Sigma Force akzeptiert. Doch der Pharmazeut Bukolow hat weder der Sigma Force noch Wayne die ganze Wahrheit erzählt. Denn er ist der größten medizinischen Entdeckung der Neuzeit auf der Spur. Ein Milliardengeschäft, das zusätzlich noch die Leben von Millionen retten würde. Allerdings lässt sich Bukolows Entdeckung auch als Waffe missbrauchen. Plötzlich ist Tucker Wayne der Einzige, der zwischen einem skupellosen General und der Vernichtung der Menschheit steht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 599
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Autor
Der New-York-Times-Bestsellerautor James Rollins hat einen Doktorgrad in Tiermedizin. Als begeisterter Höhlenforscher und ebenso eifriger Taucher ist er häufig unter Wasser oder unter der Erde anzutreffen. Er wohnt in den Bergen der Sierra Nevada in Kalifornien, USA.
Von James Rollins bei Blanvalet erschienen:
Sigma-Force:
Der Genesis-Plan, Feuermönche, Sandsturm, Der Judas-Code, Das Messias-Gen, Feuerflut, Mission Ewigkeit, Das Auge Gottes
Die Tucker-Wayne-Romane:
Killercode
Die Bruderschaft der Christuskrieger:
Das Evangelium des Blutes, Das Blut des Verräters, Die Apokalypse des Blutes
Außerdem:
Sub Terra, Im Dreieck des Drachen, Das Flammenzeichen, Operation Amazonas, Das Blut des Teufels
Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels (37092)
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
James Rollins
Grant Blackwood
Killercode
Roman
Aus dem Englischen von Norbert Stöbe
Für alle vierbeinigen Krieger dort draußen …Und für die, welche an ihrer Seite dienen.
Frühling 1900Betschuanaland, Afrika
Doktor Paulos de Klerk verstaute die letzten medizinischen Vorräte und schloss die drei Messingschließen der Holztruhe, wobei er vor sich hin murmelte: »Amat … victoria … curam.« Wie ein Mantra.
Der Sieg liebt die Vorbereitung.
Es war eine Art Gebet.
»Nun, mein lieber Doktor, was machen die Vorbereitungen?«, dröhnte General Manie Roosas Stimme vom Wachturm des Forts herab.
De Klerk schirmte die Augen gegen die blendende Sonne ab und schaute zu dem bärtigen Mann hoch, der sich mit breitem Grinsen übers Geländer lehnte. Roosa war keine sonderlich imposante Erscheinung, wirkte aufgrund seiner Ausstrahlung aber über zwei Meter groß. Seine Größe lag im Blick des Betrachters. Der General machte den Eindruck, er sei jederzeit bereit zum Kampf.
Wenn die Nachrichten aus dem Norden stimmten, würde es bald dazu kommen.
»Sind wir bereit?«, setzte Roosa nach.
De Klerk wandte seine Aufmerksamkeit den anderen Truhen, Kisten und Jutesäcken zu. Zwar hatte die Bemerkung des Generals wie eine Frage geklungen, doch er wusste, dass sie nicht so gemeint war. Ihr Anführer hatte die »Frage« an diesem Tag schon mehrfach an nahezu jeden Burensoldaten gestellt, der seinem Befehl unterstand. Sie alle wuselten geschäftig um das Plateau mit dem Fort herum, reinigten Waffen, zählten Munition und bereiteten sich ganz allgemein auf den bevorstehenden Marsch vor.
Mit einem übertriebenen Seufzer antwortete de Klerk: »Wie immer werde ich fünf Minuten vor Ihnen zum Aufbruch bereit sein, mein General.«
Roosa lachte dröhnend und klatschte die Hand aufs Holzgeländer. »Sie machen mir Spaß, Doktor. Wären Sie nicht so tüchtig, wäre ich versucht, Sie hier in der Sicherheit des Forts zurückzulassen.«
De Klerk schaute sich im geschäftigen Fort um. Er ging nur ungern von hier fort, doch er wusste, wo er am dringendsten gebraucht wurde. So primitiv die Anlage auch war, hatte sie mit ihren Palisaden und Blockhäusern doch zahllosen Angriffen der Briten widerstanden und war den Burenkämpfern eine Zuflucht gewesen. Dass sie die schützenden Mauern verlassen mussten, bedeutete vermutlich, dass er und seine Helfer in den kommenden Tagen eine Menge zu tun bekommen würden.
Nicht dass er an die Gräuel des Kriegs nicht gewöhnt gewesen wäre.
De Klerk war erst zweiunddreißig, doch dies war für ihn bereits das fünfte Kriegsjahr binnen einer Dekade. Der erste Krieg, der Vryheidsoorloë oder Befreiungskrieg, war 1880 ausgetragen worden, hatte gnädigerweise nur ein Jahr gedauert und war für die Boers – wie man die Farmer auf Holländisch und Afrikaans nannte – gut ausgegangen, denn sie hatten sich von der britischen Herrschaft in Transvaal befreit. Acht Jahre später begann der zweite Vryheidsoorloë, der auch auf den angrenzenden Oranjefreistaat übergriff.
Gleicher Anlass, mehr Soldaten, dachte er mürrisch.
Die Briten wollten die Buren wieder ihrem Kolonialregime einverleiben, doch das gefiel denen gar nicht. De Klerks Vorfahren waren in die Savannen und Berge Afrikas ausgewandert, um frei zu sein, und jetzt wollten ihnen die Engelse das wegnehmen. Anders als im ersten Vryheidsoorloë zog sich dieser Krieg hin, und die Briten verfolgten eine Politik der verbrannten Erde. Wenngleich weder de Klerk noch seine Kameraden es aussprachen, wussten sie, dass ihre Niederlage unausweichlich war. Der Einzige, der sich gegen diese Einsicht sträubte, war General Roosa; wenn es um Kriegsführung ging, war der Mann ein unverbesserlicher Optimist.
Roosa drückte sich vom Geländer ab, stieg die primitive Holzleiter herunter und ging zu de Klerk hinüber. Der General straffte seine Kakiuniform mit ein paar eingeübten Handgriffen. Er war etwa so groß wie der Arzt, jedoch stämmiger gebaut und hatte einen buschigen Bart. Aus Hygienegründen rasierte de Klerk sich regelmäßig und verlangte dies auch von seinen Hilfskräften.
»Wie ich sehe, packen Sie eine Menge Verbandszeug ein«, sagte Roosa. »Haben Sie so wenig Vertrauen in meine Führungsqualitäten, Doktor? Oder haben Sie eine zu hohe Meinung von den Engelse-Soldaten?«
»Letzteres gewiss nicht, mein General. Aber ich weiß, dass ich schon bald zahlreiche gegnerische Gefangene mit Schussverletzungen werde behandeln müssen.«
Roosa runzelte die Stirn und strich sich den Bart. »Also, was das betrifft, Doktor … Beistand für den Gegner, meine ich …«
Darüber waren sie sich uneins, doch de Klerk weigerte sich nachzugeben. »Wir sind Christen, oder etwa nicht? Es ist unsere Pflicht, Menschen in Not zu helfen. Aber mir ist auch klar, dass unsere Leute Vorrang haben. Ich werde den britischen Soldaten gerade so viel Hilfe zukommen lassen, dass sie so lange überleben, bis sich ihre eigenen Ärzte ihrer annehmen können. Wenn wir das nicht tun, sind wir nicht besser als der Gegner.«
Roosa klopfte ihm auf die Schulter. Er war zwar nicht seiner Meinung, respektierte aber seine Einstellung.
Aus Gründen, die er nicht ganz nachvollziehen konnte, hatte Roosa ihn zu seinem Vertrauten auserkoren. Der Kommandant besprach häufig Dinge mit de Klerk, die nichts mit seinen medizinischen Aufgaben zu tun hatten – ganz so, als betrachte der General ihn als sein Gewissen.
Doch es gab noch einen anderen Grund, weshalb Roosa ein so großes Interesse an seinen Vorbereitungen zeigte. Die dem General unterstehenden Männer waren seine Familie, ein Ersatz für seine Frau, seine drei Töchter und zwei Söhne, die zwei Jahre zuvor den Pocken erlegen waren. Dieser Verlust hatte Roosa beinahe zerstört und dauerhafte Narben in ihm hinterlassen. Wenn es um Schuss- oder Bajonettverletzungen ging, war der General phlegmatisch und optimistisch; bei Krankheiten zeigte er sich überängstlich.
Roosa wechselte das heikle Thema und deutete auf das ledergebundene Tagebuch, das sich stets in de Klerks Nähe befand. »Wie ich sehe, haben Sie vor, weitere Pflanzen zu katalogisieren.«
Liebevoll und beschützend berührte der Mediziner den abgenutzten Einband. »Ja, so die Vorsehung es zulässt. Wenn wir in die Richtung ziehen, die ich vermute, werde ich auf viele unbekannte Arten stoßen.«
»Wir ziehen in der Tat nach Norden, in die Karasberge. Die Kundschafter haben gemeldet, eine Brigade feindlicher Soldaten halte sich westlich von Kimberley auf, befehligt von einem neuen Kommandanten – einem Colonel, der erst kürzlich aus London eingetroffen ist.«
»Und der es gar nicht erwarten kann, sich zu beweisen.«
»Wollen wir das nicht alle? Wenn wir morgen aufbrechen, werden uns ihre Voraustrupps bis zum frühen Abend entdeckt haben.«
Dann wäre die Jagd eröffnet. De Klerk war zwar kein Militärstratege, begleitete General Roosa aber schon so lange, dass er dessen Lieblingstaktik kannte: Er wollte sich von den britischen Kundschaftern entdecken lassen und den Gegner dann in die Karasberge und in einen Hinterhalt locken.
Die Briten kämpften lieber in der Savanne, wo ihre überlegene Feuerkraft zum Tragen kam. Die gegnerischen Kommandanten mochten die Hügel, Berge und Schluchten nicht, und es störte sie gewaltig, dass Roosa und dessen hinterwäldlerische Farmer sich weigerten, zu ihren Bedingungen zu kämpfen. Mit dieser Strategie hatte Roosa die Briten schon häufig in arge Bedrängnis gebracht. Trotzdem lernte der Gegner nicht hinzu.
Wie lange aber würde diese Überheblichkeit Bestand haben?
Ein kalter Schauder durchrieselte de Klerk, als er sein Reisetagebuch einpackte.
Die Soldaten standen vor Morgengrauen auf und brachen unbehelligt in nördlicher Richtung auf. Gegen Mittag traf auf einem schweißnassen, schnaufenden Pferd ein Kundschafter aus dem Süden ein. Er trabte an die Spitze der Kolonne zu Roosa.
De Klerk konnte sich denken, was er zu berichten hatte: Der Gegner hatte sie entdeckt.
Als der Kundschafter davonritt, ließ sich der General zum Sanitätswagen zurückfallen. »Die Briten werden bald die Verfolgung aufnehmen, Doktor. Es könnte sein, dass Ihr bequemer Wagen ein paar Erschütterungen abbekommt.«
»Ich mache mir weniger Sorgen um den Wagen als um meine empfindlichen inneren Organe. Wie immer werde ich’s wohl überleben.«
»Sie sind ein Mann von echtem Schrot und Korn, Doktor.«
Die Minuten dehnten sich zu Stunden, während der General ihre Einheit nach Norden zum Karasgebirge führte, dessen vorgelagerte Hügel bereits am Horizont sichtbar wurden, flirrend in der heißen Luft, die von der Savanne aufstieg.
Zwei Stunden vor der Abenddämmerung tauchte ein weiterer Kundschafter auf. Als er an de Klerk vorbeiritt, entnahm der Arzt seiner Haltung und seinem Gesichtsausdruck, dass etwas schiefgegangen war. Nach kurzer Unterredung verschwand der Kundschafter wieder.
Roosa wendete sein Pferd und rief den Offizieren zu: »Wagen bereit machen für schnelle Fahrt! In fünf Minuten!« Dann ritt er zu de Klerk zurück. »Der neue Colonel der Engelse ist ein scharfer Hund. Er hat die Größe seiner Brigade verborgen, indem er sie geteilt hat – die eine Hälfte ist der Hammer, die andere der Amboss.«
»Und wir sind das Roheisen in der Mitte.«
»Das hoffen sie jedenfalls«, erwiderte Roosa und grinste breit. »Aber Hoffnung verblasst bei Tageslicht. Zumal wenn wir sie vorher ins Karasgebirge locken.« Er winkte schneidig, riss sein Pferd herum und ritt davon.
Ein paar Minuten später dröhnte die Stimme des Generals über die Burenformation hinweg. »Eilfahrt … los!«
De Klerks Kutscher klatschte mit den Zügeln und rief: »Hüh … hüh!«
Die Pferde bockten, dann galoppierten sie los. De Klerk hielt sich am Bord fest, den Blick auf die fernen Groot Karasberge gerichtet.
Zu weit, dachte er grimmig. DieEntfernung ist zu groß, und wir haben zu wenig Zeit.
Eine Stunde später bewahrheiteten sich seine Befürchtungen.
Eine Staubwolke kündigte die Rückkehr der beiden Reiter an, die Roosa vorausgeschickt hatte, doch als der Staub sich legte, stellte sich heraus, dass nur ein Reiter zurückgekehrt war. Er hing schief im Sattel und kippte vom Pferd, als er die Kolonne erreichte, denn er hatte zwei Schussverletzungen davongetragen.
Roosa ließ den Trupp anhalten, dann winkte er de Klerk zu sich. Mit der Medizintasche eilte er zu dem gestürzten Mann und kniete neben ihm nieder. Beide Kugeln hatten lebenswichtige Organe verletzt und waren an der Brust des jungen Mannes ausgetreten.
»Kollabierte Lunge«, sagte er zu Roosa, der den Kopf des Mannes stützte.
Der achtzehnjährige Kundschafter hieß Meer. Er krampfte die Hand um Roosas Ärmel und versuchte zu sprechen, hustete aber erst einmal blutigen Schaum.
»Mein General«, krächzte der Junge, »ein Engelse-Bataillon … nördlich von uns. Schwere Kavallerie … mit Kanonen auf schnellen Munitionswagen.«
»Wie weit entfernt, mein Sohn?«
»Zwölf Kilometer.«
Meer hustete schwer. Ein Blutschwall kam aus seinem Mund. Er krümmte sich, wehrte sich gegen das Unvermeidliche und erschlaffte.
De Klerk untersuchte ihn rasch, dann schüttelte er den Kopf.
Roosa schloss dem Jungen die Augen und streichelte ihm übers Haar, dann richtete er sich auf. Zwei Soldaten schleppten Meers Leichnam fort.
De Klerk ging zum Kommandanten.
»Mein ganzes Gerede über den Hochmut der Engelse … ich war überheblich. Der neue britische Colonel versucht, uns vor Erreichen des Gebirges zu stoppen. Wenn sie uns hier auf offenem Gelände stellen … also, mein lieber Doktor, dann werden Sie mehr Arbeit bekommen, als Sie in Ihrem ganzen Leben bewältigen können.«
Er gab keine Antwort, doch Roosa bemerkte, dass er blass geworden war.
Der General packte de Klerk bei der Schulter. »Der Engelse-Colonel ist schlau, aber seine Zange ist so weit gespreizt, dass wir entkommen können. Bald wird uns die Nacht verschlucken.«
Eine Stunde später beobachtete de Klerk von der Rückseite des schaukelnden Wagens aus, wie die Sonne hinter dem Horizont versank. Es war fast schon Nacht, doch im Osten nahm eine rotgolden leuchtende Staubwolke ein Viertel des Himmels ein. Er versuchte, die Zahl der Pferde zu schätzen, die nötig waren, um so viel Staub aufzuwirbeln.
Zweihundert Reiter mindestens.
Und hinter ihnen Plan- und Munitionswagen mit Kanonen.
Gott steh uns bei …!
Wenigstens hatten sie unbehelligt das Vorgebirge erreicht und waren dem Zangengriff des Gegners vorerst entwischt. Der Wagen rumpelte in eine dunkle Schlucht hinein, die Staubwolke verschwand.
Er drehte sich um und musterte die unwirtliche Umgebung, ein Labyrinth von Hügeln, ausgetrockneten Wasserrinnen und Höhlen. Roosa hatte schon mehrfach die »Taschenforts« in den Bergen gerühmt, Befestigungen der Buren, in denen sie die britische Belagerung würden aussitzen können.
Jedenfalls hofften sie das.
Die Zeit wurde langsam unter den Wagenrädern und den Pferdehufen zermahlen. Schließlich kehrte einer der Kundschaftertrupps zurück, die Roosa nach Süden geschickt hatte. Nach kurzer Unterredung ritten die Männer wieder davon, und Roosa befahl, langsamer weiterzufahren.
Der General ritt zu de Klerks Wagen.
»Wir haben uns ein wenig Zeit erkauft, Doktor. Aber der Colonel ist nicht nur auf Zack, sondern auch stur. Seine Leute setzen die Verfolgung fort.«
»Was heißt das für uns?«
Roosa seufzte. Er zog ein Tuch aus der Tasche und wischte sich den Staub aus dem Gesicht. »Um Shakespeares Falstaff zu zitieren: Der Klügere gibt nach. Es wird Zeit, dass wir uns einigeln. Eins unserer Taschenforts liegt ganz in der Nähe. Gut versteckt, aber leicht zu verteidigen. Dorthin ziehen wir uns zurück, warten ab, bis die Engelse des Karasgebirges überdrüssig sind, und wenn sie abziehen, greifen wir sie von hinten an. Sie leiden doch nicht etwa an … wie nennt man das noch gleich? Angst vor engen Orten?«
»Klaustrophobie. Nein, daran leide ich nicht.«
»Freut mich zu hören, Doktor. Hoffentlich sind die anderen ebenso tapfer wie Sie.«
Eine halbe Stunde lang führte Roosa sie noch tiefer ins Gebirge hinein, dann bog er in eine schmale Schlucht ab und hielt vor einem großen Höhleneingang an.
An der Höhlenmündung gesellte de Klerk sich zu Roosa. »Was ist mit den Pferden und den Wagen?«
»Die nehmen wir mit in die Höhle. Wir müssen die Wagen teilweise auseinandernehmen, aber der Platz reicht aus für eine kleine Pferdekoppel.«
»Und die Vorräte?«
Roosa lächelte zuversichtlich. »Ich habe die Vorräte in der Höhle vor einiger Zeit aufgestockt, Doktor, außerdem habe ich noch ein paar Asse im Ärmel. Wenn der Colonel nicht monatelang im Gebirge verweilen will, haben wir nichts zu befürchten. Und jetzt, Doktor, sollten Sie sich zwei Männer nehmen und Ihre Sachen in die Höhle bringen lassen. Ich möchte, dass wir in einer Stunde fertig sind.«
Wie gewöhnlich bekam Roosa seinen Willen. Während die letzten Vorräte im flackernden Laternenschein in die Höhle getragen wurden, beaufsichtigte der General die Männer, welche die Schwarzpulverladungen am Höhleneingang anbrachten. De Klerk, der in einer Nebenhöhle eine Sanitätsstation eingerichtet hatte, ging zu ihnen und schaute zu.
»Gut, gut!«, rief Roosa einem der Pioniere zu. »Bring die Ladung links einen Meter höher an. Ja, genau da!« Der General wandte sich zum Arzt um. »Ah, Doktor, haben Sie sich eingerichtet?«
»Ja, General. Aber dürfte ich mich erkundigen … ist das klug? Uns hier drinnen einzusperren?«
»Es wäre sogar ausgesprochen unklug, Doktor, wenn dies der einzige Zugang wäre. Aber das ist ein ausgedehntes Höhlensystem mit vielen kleinen, gut versteckten Ausgängen. Ich habe mir das Vorgehen gut überlegt.«
»Das sehe ich.«
Vor dem Eingang ertönte Hufgetrappel. Nacheinander kamen die Scharfschützen, die den Auftrag gehabt hatten, die Briten zu drangsalieren, in die Höhle; jeder führte ein schnaufendes Pferd am Zügel mit sich. Der letzte Reiter hielt bei Roosa an.
»Wir haben ihren Vormarsch beträchtlich verlangsamt, General, aber ihre Kundschafter sind weniger als eine Stunde hinter uns. Ich schätze die gegnerischen Kräfte auf dreihundert Berittene, zweihundert Fußsoldaten und vierzig Zwölf-Pfund-Kanonen.«
Roosa rieb sich nachdenklich das Kinn. »Eine beeindruckende Streitmacht. Offenbar haben die Briten ein hohes Kopfgeld ausgesetzt. Nun, selbst wenn sie uns aufspüren, werden wir zu unseren eigenen Bedingungen kämpfen. Und dann, Kameraden, werden wir sehen, wie gut sich die Engelse auf das Ausheben von Gräbern verstehen.«
Nachdem der Höhleneingang gesprengt worden war, verstrich die Nacht ereignislos – ebenso der nächste Tag und die darauffolgenden sechs Tage. Die meisten Buren richteten sich in ihrer neuen Festung ein und machten sich daran, das Höhlensystem ein wenig behaglicher zu gestalten und für die Verteidigung vorzubereiten.
Währenddessen schlüpften Roosas Kundschafter im Schutz der Dunkelheit durch die geheimen Ausgänge nach draußen und kehrten stets mit dem gleichen Bericht zurück: Die britischen Bataillone waren in der Nähe und suchten anscheinend angestrengt, hatten die verborgene Festung aber noch nicht gefunden.
Nach einer Woche kehrte im Morgengrauen ein einzelner Kundschafter zurück. Der General saß gerade in der Offiziersmesse, einer kleinen Höhle, in der man aus einem zerlegten Wagen einen Tisch mit Bänken angefertigt hatte. Roosa und de Klerk hockten an dem einen Tischende und gingen im Schein der von der Decke hängenden Laterne den Krankenbericht durch.
Der erschöpfte, verdreckte Kundschafter trat vor Roosa hin. Der General erhob sich, rief nach einem Wasserschlauch, drückte den Kundschafter auf die Bank und wartete, während der Mann seinen Durst löschte.
»Hunde«, sagte der Kundschafter. »Bluthunde. Sie sind hierher unterwegs.«
»Sind Sie sicher?«, fragte Roosa.
»Ja, mein General. Ich habe ihr Gebell gehört, keine zwei Meilen entfernt. Ich glaube, sie nähern sich unserem Versteck.«
»Könnte es sich nicht um Schakale gehandelt haben?«, meinte de Klerk. »Oder um Wildhunde?«
»Nein, Doktor. Mein Vater hatte Bluthunde, als ich noch ein Kind war. Ich weiß, wie sie sich anhören. Ich habe keine Ahnung, wie sie …«
»Sie haben drei unserer Leute gefangen genommen«, erklärte Roosa, als hätte er mit dieser Nachricht gerechnet. »An denen haben sie Witterung aufgenommen. Und da wir in dieser verdammten Höhle festsitzen, werden sie uns auch finden …« Der General verstummte. Er musterte die besorgten Gesichter seiner Truppführer. »Meine Herren, wir sollten die Befestigungen bemannen, insofern man davon überhaupt sprechen kann. Offenbar werden die Engelse zum Tee hier sein.«
Der erste Geheimeingang, den die Briten entdeckten, lag an der Südseite des Höhlensystems – ein Loch, das hinter einem Felswirrwarr verborgen war.
Und so fing es an.
De Klerk traf Roosa vor einer Sandsackbarriere kniend an, zusammen mit einem seiner Truppführer, einem Mann namens Vos. Hinter den Sandsäcken senkte sich die Höhlendecke auf Schulterhöhe ab; an der anderen Seite, etwa fünfzehn Meter entfernt, führte ein horizontaler Schacht zum Geheimausgang. Ein Dutzend Soldaten waren am Höhlenboden postiert; sie knieten hinter Stalagmiten, das Gewehr in der Hand.
Während sie warteten, blickte de Klerk nach oben. Fingerbreite Risse durchzogen die Höhlendecke, und helle Sonnenstrahlen fielen auf den Boden.
Roosa drehte sich um, legte den Zeigefinger an die Lippen und deutete auf sein Ohr.
De Klerk nickte und schwieg. In der Stille der Höhle spitzte er die Ohren. In der Ferne vernahm er das leise Gebell der Bluthunde. Nach einigen Minuten verstummte es.
Alle hielten den Atem an. Ein Soldat hinter einem der vorderen Stalagmiten machte ein Zeichen.
Roosa nickte. »Er hört Stimmen. Mehrere Männer nähern sich durch den Schacht. Vos, Sie wissen, was zu tun ist.«
»Ja, mein General.«
Vos kratzte mit dem Bajonett über den Felsboden, worauf die Männer hinter den Stalagmiten sich zu ihm umdrehten. Vos machte ihnen Handzeichen. De Klerk wusste, was bevorstand, und fürchtete sich davor.
Der erste britische Soldat tauchte mit einer Laterne im Schacht auf. Er kroch heraus, dann trat er nach links, um dem nachfolgenden Platz zu machen. Insgesamt sechs britische Kundschafter krochen nacheinander aus dem Tunnel und hockten sich an der anderen Seite der Höhle nieder. Sie leuchteten Wände, Decke und Stalagmiten ab.
De Klerk beobachtete sie mit angehaltenem Atem.
Da sie glaubten, die Höhle sei leer, befestigten die Eindringlinge ihre Laternen am Gürtel und rückten mit angelegtem Gewehr vor.
Vos ließ sie bis auf sieben Meter herankommen – dann rammte er zwei Mal das Bajonett auf den Boden. Seine Männer sprangen aus ihrem Versteck hervor und eröffneten das Feuer. Es dauerte nur ein paar Sekunden, dann waren die britischen Kundschafter bis auf einen tot. Stöhnend kroch der Verletzte zum Schacht und ließ eine Blutspur hinter sich zurück.
De Klerk packte seine Medizintasche und richtete sich auf. Roosa fasste ihn beim Unterarm und schüttelte den Kopf.
»Aber General, er ist …«
»Ich sage nein, Doktor. Je furchterregender wir auf die Engelse wirken, desto eher kommen wir hier weg. Vos, übernehmen Sie das.«
Vos setzte über die Sandsäcke hinweg, zog das Messer und ging zu dem verwundeten Soldaten. Er kniete nieder und schnitt ihm die Kehle durch.
»Es tut mir leid, Doktor«, sagte Roosa. »Ich gebe einen solchen Befehl nur ungern, aber wenn wir überleben wollen, müssen wir brutal vorgehen.«
Das Abschlachten des Soldaten lag de Klerk wie ein kalter Stein in der Brust. Er wandte sich beklommen ab. Eines war sicher: Dem strafenden Blick des Herrn entging keine Sünde.
Die Tage verstrichen, und die Briten griffen unermüdlich an. Inzwischen kannte der Gegner alle Nebeneingänge bis auf einen. An den Befestigungen, wie Roosa die Eingänge nannte, fanden kleine, aber heftige Gefechte statt. Der britische Colonel war nicht nur entschlossen, seine Leute in Roosas Fleischwolf hineinzuschicken, sondern nahm auch furchtbare Opferzahlen in Kauf – fünf, sechs oder sieben seiner Soldaten für jeden verwundeten oder getöteten Buren.
De Klerk bemühte sich nach Kräften, den Verletzten und Sterbenden beizustehen, doch als die Tage sich zu Wochen dehnten, stiegen die Opferzahlen – zunächst aufgrund der britischen Kugeln, dann wegen Krankheit. Der erste kranke Soldat, der die Sanitätsstation aufsuchte, klagte über heftige Magenkrämpfe. Die Sanitäter behandelten ihn mit Kräutern, doch nach einigen Stunden bekam der Mann Fieber und krümmte sich vor Schmerzen. Am nächsten Tag tauchten zwei weitere Männer mit den gleichen Symptomen auf; am darauffolgenden Tag waren es vier.
Die Krankenstation verwandelte sich in ein Irrenhaus mit schreienden, sich krümmenden Patienten. Am vierundzwanzigsten Tag der Belagerung kam Roosa, um wie jeden Morgen nach den Verwundeten zu sehen. De Klerk schilderte ihm die ernste Lage.
Als er geendet hatte, runzelte Roosa die Stirn. »Zeigen Sie’s mir.«
De Klerk nahm eine Laterne und führte Roosa in den Winkel der Höhle, wo abgesondert die Kranken lagen. Sie knieten neben dem ersten Patienten mit den charakteristischen Symptomen nieder, einem blonden jungen Mann namens Linden. Er warf sich auf der Pritsche hin und her und war leichenblass. Die Arme hatte man ihm mit Lederriemen festgebunden.
»Ist das wirklich nötig?«, fragte Roosa.
»Ein neues Symptom«, antwortete de Klerk und zeigte dem General, was er meinte.
Er zog das dünne Baumwollhemd hoch und entblößte den Oberkörper des Mannes. Sein Bauch war mit warzenartigen Knoten bedeckt, doch es hatte den Anschein, als wären sie von innen nach außen gewachsen.
»Mein Gott. Was ist das?«
De Klerk schüttelte den Kopf. »Ich weiß es nicht, General. Ohne die Fesseln hätte er sich den Bauch längst aufgekratzt. Schauen Sie.«
Sie beugten sich über den Körper des Jungen. Mit der Spitze eines Skalpells deutete der Arzt auf einen erbsengroßen Knoten. »Sehen Sie die milchig-grüne Verfärbung unter der Haut?«
»Ich sehe sie. Als ob etwas in ihm wachsen würde.«
»Nicht als ob, General. Da wächst tatsächlich etwas. In allen. Und was immer das ist, es will heraus. Alle Kranken haben dieses Symptom. Schauen Sie!«
Roosa zog eine Laterne heran. Der erbsengroße Knoten wand sich unter der Haut wie ein Wurm. Vor ihren Augen entwickelte sich am Rand des Knotens eine rote Blase, die rasch auf die Größe einer reifen Pflaume anschwoll.
»Was zum Teufel …?«, flüsterte Roosa.
»Treten Sie zurück.«
Der Arzt schnappte sich ein Tuch und legte es auf den Knoten. Das Tuch beulte sich einen Moment lang aus – dann ploppte es vernehmlich. Ein rötlicher Fleck mit gelbem Rand breitete sich auf dem Tuch aus. Der Patient bäumte sich auf, die Pritschenbeine knallten auf den Boden.
Einer der Sanitäter eilte herbei und drückte Linden aufs Lager nieder. Der Junge bäumte sich noch immer auf, den Kopf ins Kissen gedrückt. Plötzlich bildeten sich am Hals und auf dem Bauch des Kranken Dutzende Knoten, und die Blasen schwollen zusehends an.
»Zurück, zurück!«, rief de Klerk, worauf er, der General und der Sanitäter sich von der Pritsche entfernten.
Entsetzt beobachteten sie, wie die Blasen eine nach der anderen platzten. Im flackernden Laternenschein zeichnete sich ein gelblicher Nebel ab, der sich langsam auf den Körper des Jungen absenkte.
Mit leerem Blick bäumte Linden sich ein letztes Mal auf, sodass er nur noch mit Fersen und Hinterkopf die Pritsche berührte, dann erschlaffte er und rührte sich nicht mehr.
De Klerk verzichtete auf eine nähere Untersuchung, und Roosa stellte auch keine Fragen. Linden war tot. Der Sanitäter deckte den Leichnam zu.
»Wie viele sind bislang erkrankt?«, fragte Roosa mit brüchiger Stimme.
»Sieben.«
»Und wie lautet die Prognose?«
»Wenn ich die Ursache nicht herausbekomme und kein Gegenmittel finde, werden alle sterben, fürchte ich. Wie dieser Junge. Aber das ist nicht die schlimmste Neuigkeit.«
Roosa wandte den Blick von der zugedeckten Leiche ab.
»Das ist erst der Anfang. Es werden noch mehr erkranken.«
»Sie befürchten eine Ansteckung.«
»Davon muss ich ausgehen. Sie haben den Nebel gesehen, den die Blasen freigesetzt haben. Das ist irgendein Mechanismus – so breitet sich die Krankheit aus.«
»Was glauben Sie, wie viele sich bereits angesteckt haben?«, fragte Roosa.
»Etwas Derartiges habe ich noch nie gesehen und auch nichts darüber gelesen, das müssen Sie verstehen. Vor drei Tagen war der Junge noch kreuzfidel. Jetzt ist er tot.«
»Wie viele?«, setzte Roosa nach. »Wie viele werden erkranken?«
De Klerk sah dem Kommandanten offen in die Augen. »Alle. Jeder Einzelne hier in der Höhle.« Er packte Roosa beim Handgelenk. »Was auch immer diese Männer umbringt, es ist äußerst ansteckend. Und es ist hier bei uns.«
Teil 1 Ein einfaches Angebot
1
4. März, 7:42Wladiwostok, Russland
Seine Aufgabe war es, das Schlimmste zu verhüten.
Nicht unbedingt die vornehmste Beschäftigung, doch sie zahlte sich aus.
Tucker Wayne hockte am Rand des russischen Hafens und spürte, wie sich die Bürde der Verantwortung auf ihn legte. Der eiskalte Wind und der heftige Schneeregen traten langsam in den Hintergrund, als er sich auf die dunkle, stille Landschaft der Kräne, der scheinbar planlos gestapelten Schiffscontainer und der schemenhaft erkennbaren Schiffe am Pier konzentrierte. In der Ferne tönte ein Nebelhorn. Die Taue knarrten und ächzten.
Tucker hatte als Ranger der U.S. Army reichlich Erfahrung gesammelt, doch an diesem Morgen war es besonders wichtig, dass er darauf zurückgreifen konnte. Sie ermöglichte es ihm, sich auf zwei wichtige Dinge gleichzeitig zu konzentrieren.
Erstens auf den Hafen von Wladiwostok, der nach der Wüste des vom Krieg zerrissenen Afghanistan einen gewaltigen Fortschritt darstellte – auch wenn er diesen kalten Ort niemals für seinen Ruhestand in Erwägung gezogen hätte.
Zweitens auf die Einschätzung des Bedrohungspotenzials und speziell darauf, wer heute versuchen könnte, seinen Auftraggeber zu ermorden, wo der Gegner sich verstecken mochte und wie er vorgehen würde.
Bevor er vor drei Wochen den Job übernommen hatte, hatte es bereits zwei Anschläge auf den russischen Industriellen gegeben, und sein Bauchgefühl sagte Tucker, dass der dritte Anschlag in Kürze stattfinden würde.
Er musste sich bereithalten – und das galt auch für seinen Partner.
Er streckte die Hand aus und streichelte seinen Gefährten. Durch das schneebedeckte Fell hindurch spürte er die angespannten Muskeln des kleinen Belgischen Schäferhunds. Kane war ein militärischer Arbeitshund, den Tucker vor Jahren in Afghanistan übernommen hatte. Beim Ausscheiden aus dem Dienst hatte er Kane mitgenommen. Sie waren enger miteinander verbunden als durch eine Leine. Sie verstanden einander, und ihre Kommunikation ging weit über irgendwelche Befehle oder Handzeichen hinaus.
Kane saß ruhig neben ihm, die Ohren aufgestellt und mit seinen dunklen Augen aufmerksam beobachtend, scheinbar unbeeindruckt vom Schnee, der einen Teil seines schwarz-braunen Fells bedeckte. Der Rest seines kompakten Körpers steckte unter einer Kampfweste vom Typ K9 Storm, farblich an sein Fell angepasst, wasserdicht und mit Kevlar verstärkt. In Kanes Halsband war ein daumennagelgroßer Sender mit Nachtsichtkamera eingebaut, damit sie optisch und akustisch stets Kontakt halten konnten.
Tucker richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf die Umgebung.
Es war noch früh am Morgen in Wladiwostok und deshalb ruhig im Hafen. Nur hin und wieder stapfte ein Arbeiter durch die Dämmerung. Trotzdem bemühte sich Tucker, mit dem Hintergrund zu verschmelzen: ein ganz gewöhnlicher Arbeiter.
Zumindest hoffe ich, dass ich so aussehe.
Er war Ende zwanzig, größer als der Durchschnitt und hatte struppiges blondes Haar. Sein kräftiger Körper war unter einer dicken Wolljacke verborgen und sein harter Blick unter der pelzverbrämten Krempe einer russischen Ushanka, eines Trapperhuts.
Er streichelte Kane mit dem Daumen am Kopf. Der Hund wedelte mit dem Schwanz.
Ganz schön weit von zu Hause, was, Kane?
Andererseits, wenn man vom Meer absah, war Wladiwostok der Kleinstadt Rolla, North Dakota, gelegen an der Grenze zu Kanada, wo er die ersten siebzehn Lebensjahre verbracht hatte, gar nicht so unähnlich. Wenn ein Ort in den Vereinigten Staaten es mit Sibirien aufnehmen konnte, dann diese Gegend.
Als Kind war er im Sommer auf dem Willow Lake Kanu gefahren und in den North Woods gewandert. Im Winter hatte er sich mit Skilanglauf, Schneeschuhwandern und Eisfischen beschäftigt. Allerdings war sein Leben keine Postkartenidylle gewesen. Seine Eltern – beide Lehrer – waren von einem betrunkenen Fahrer getötet worden. Anschließend hatte ihn sein Großvater väterlicherseits aufgenommen, der in einem harten Winter beim Schneeschippen einem Herzanfall erlegen war. Da er keine weiteren nahen Verwandten hatte, war Tucker danach bei einer Pflegefamilie untergekommen, hatte schließlich vorzeitig die Volljährigkeit beantragt und war mit siebzehn in die Army eingetreten.
Er verdrängte die Erinnerung an jene dunklen Jahre.
Kein Wunder, dass ich Hunde lieber mag als Menschen.
Er konzentrierte sich auf die Aufgabe, die vor ihm lag. In diesem Fall: das drohende Attentat.
Er musterte die Hafenanlagen.
Von wo aus würde der Angriff erfolgen? Und auf welche Weise?
Sein Auftraggeber, der russische Milliardär und Industrielle Bogdan Fedoseew, hatte diesen frühen Besuch im Hafen gegen seinen Rat angesetzt. Seit Wochen wurde gemunkelt, die Hafenarbeiter wollten sich gewerkschaftlich organisieren, und Fedoseew hatte sich zu einem Treffen mit den Anführern bereit erklärt, weil er hoffte, seine Arbeiter zum Nachgeben bewegen zu können. Das war an und für sich schon bedrohlich genug, doch Tucker befürchtete zudem, dass eine ziemlich große Anzahl der Arbeiter den Wladikawkas-Separatisten angehörte, einer politischen Terrororganisation, deren Opfer zumeist prominente Kapitalisten im russischen Fernen Osten waren, was Bogdan Fedoseew zu einem lohnenden Ziel machte.
Tucker scherte sich wenig um Politik, doch es gehörte zu seinem Job, sich einen Überblick über das soziale Umfeld zu verschaffen – und das galt auch für die örtlichen Gegebenheiten.
Er sah auf die Uhr. Fedoseew würde in knapp drei Stunden eintreffen. Bis dahin musste sich Tucker mit jedem Winkel und jeder Ritze der Umgebung vertraut machen.
Er blickte auf Kane. »Was meinst du, Kumpel? Bist du einsatzbereit?«
Kane erhob sich und schüttelte sich. Schnee stob von seinem Fell, der Wind trug ihn fort. Tucker setzte sich in Bewegung, und Kane trottete neben ihm her.
9:54
Tucker hatte sechs der acht Arbeiter lokalisiert, die er als Mitglieder von Wladikawkas verdächtigte. Die anderen beiden hatten sich heute Morgen krankgemeldet, was sie bisher noch nie getan hatten.
Er stand im Eingang eines Lagerhauses und beobachtete die Docks. Der Hafen war inzwischen zum Leben erwacht. Gabelstapler fuhren umher, Kräne beförderten Container auf Schiffe, und dies alles wurde untermalt von einer Kakofonie aus Hämmern, Schleifgeräuschen und lauten Rufen.
Tucker holte das Handy aus der Tasche und scrollte durch die Liste der PDF-Dossiers, bis er die beiden Männer gefunden hatte, die sich krankgemeldet hatten. Es waren ehemalige Soldaten, die als Unteroffiziere in der russischen Marineinfanterie gedient hatten. Schlimmer noch, beide waren ausgebildete Scharfschützen.
Zwei plus zwei ergibt eine ernst zu nehmende Bedrohung.
Er prägte sich die Gesichter der Männer ein.
Sein erster Impuls war, Yuri anzurufen, den Chef von Fedoseews Personenschützern, doch das würde nichts nützen. Ich laufe nicht weg, hatte Fedoseew mehrfach erklärt. Obendrein war Tucker ein Eindringling, ein Amerikaner, den die Personenschützer nicht hier haben wollten.
Tucker stellte sich Fedoseews Weg durch den Hafen vor. Er musterte die Fenster, berechnete den möglichen Schusswinkel, hielt Ausschau nach einem günstigen Versteck für die Scharfschützen. Ein halbes Dutzend Stellen kamen infrage.
Er schaute zum Himmel hoch. Inzwischen war die Sonne aufgegangen, eine stumpfweiße Scheibe über dem Horizont. Der Wind hatte sich gelegt, der Regen dicken weißen Schneeflocken Platz gemacht.
Gar nicht gut. Jetzt waren die Bedingungen für einen Fernschuss viel besser als zuvor.
Tucker sah erneut auf Kane nieder. Sie durften nicht tatenlos abwarten.
»Na los, suchen wir die bösen Buben.«
10:07
Die sechs potenziellen Scharfschützennester waren über das ganze Gelände verteilt, eine Fläche von rund achtzigtausend Quadratmetern mit Lagerhäusern, schmalen Gassen und Kränen. Tucker und Kane suchten das Gebiet ab, ohne gehetzt zu wirken, benutzten Abkürzungen, wenn es welche gab, und fixierten keine Stelle zu lang.
Als sie an einem Lagerhaus vorbeikamen, knurrte Kane leise. Tucker duckte sich und spannte sich an. Kane war stehen geblieben und blickte in eine Gasse zwischen zwei Containerstapeln.
Tucker machte aus den Augenwinkeln eine Gestalt aus, die gleich wieder verschwand. Das musste nichts bedeuten, doch er kannte seinen Hund. Die Körpersprache oder der Geruch des Mannes musste Kanes Interesse geweckt haben: Anzeichen vonStress, Haltung, verstohlene Bewegungen. Nach mehreren gefahrvollen Jahren in Afghanistan waren Kanes Instinkte aufs Äußerste geschärft.
Tucker rief sich die Karte des Hafengeländes in Erinnerung, die er sich eingeprägt hatte, überlegte einen Moment und klappte dann Kanes Halsbandkamera hoch.
»Kundschaften«, befahl er knapp.
Er zeigte nach vorn und bedeutete Kane, die Container an der anderen Seite zu umgehen.
Sein Partner trottete los.
Tucker beobachtete, wie er verschwand, dann wandte er sich um und trabte zwischen die riesigen Containerstapel, hinter denen die Zielperson verschwunden war.
An der ersten Kreuzung hielt er kurz an und spähte um die Ecke eines Containers.
Eine weitere Gasse.
Menschenleer.
Er lief weiter bis zur nächsten Kreuzung, diesmal verzweigte sich die Gasse nach rechts und links. Das Ganze war ein verdammtes Labyrinth.
Da kann man sich leicht verlaufen, dachte er. Und noch leichter das Ziel aus den Augen verlieren.
Er stellte sich vor, wie Kane an der anderen Seite geduckt den Containerstapel beobachtete. Er war auf die Augen seines Partners angewiesen, wenn er in dem Labyrinth jagte.
Tucker schaltete Kanes Videofeed auf sein modifiziertes Satellitentelefon. Das kleine Display zeigte das flackernde digitale Livebild von Kanes Kamera.
Plötzlich lief jemand zwischen den Containern hervor, in östliche Richtung.
Das reicht.
Tucker rannte los. Auf dem Display sah er, dass Kane das Gleiche tat. Er verfolgte den Mann, befolgte nach wie vor seine Anweisungen.
Beide waren sie jetzt auf der Jagd – genau das, was Army Ranger gemeinhin taten. Abgesehen von seltenen Ausnahmen gingen Ranger nicht auf Patrouille oder leisteten humanitäre Hilfe. Sie hatten ein einziges Ziel: den Gegner aufspüren und vernichten.
Tucker hatte die simple Prämisse gemocht.
Es klang brutal, war auf eine ursprüngliche Weise aber auch lauter.
Als er zwischen den Containern hervorkam, war er auf einer Höhe mit Kane. Er winkte den Schäferhund zu sich. Kane kam herüber und setzte sich neben ihm auf die Hinterbeine, mit heraushängender Zunge und funkelnden Augen.
Sie befanden sich an der Ostseite des Hafens. Unmittelbar vor ihnen verliefen hinter einem Kiesparkplatz Bahngleise, auf denen verrostete Güterwaggons abgestellt waren. Dazwischen war die Zielperson verschwunden.
Hinter dem Betriebshof ragte ein hoher Stacheldrahtzaun auf. Dahinter lag dichter Kiefernwald.
Abgesehen vom gedämpften Hafenlärm in der Ferne war es still.
Plötzlich ruckte Kanes Kopf nach rechts. Ein Teil des Zauns erbebte heftig. Vor seinem geistigen Auge sah Tucker, wie eine zweite Zielperson im Schutz des Walds durch ein Loch im Zaun aufs Hafengelände kroch.
Warum?
Er blickte nach links und bemerkte einen hohen Kran, mit dem die Güterwaggons früher beladen worden waren. Der Kran war eine von sechs Positionen, die für einen Scharfschützenangriff infrage kamen.
Tucker sah auf die Uhr. Fedoseew würde in sechs Minuten eintreffen. Er zog ein kleines Fernglas aus der Jackentasche und richtete es auf die Spitze des Krans. Zunächst konnte er im Schneetreiben nur das schemenhafte Krangerüst erkennen. Dann tauchte eine schattenhafte Gestalt auf, die langsam zum Steuerhaus hochkletterte.
Das ist der Mann, der eben durch den Zaun gekrochen ist – aber wo steckt der Kerl, dem ich hinterher war?
Er überlegte, ob er Yuri den Abbruchcode senden sollte, doch selbst wenn die Nachricht zu ihm durchdrang, würde sich sein draufgängerischer Boss kaum davon beeindrucken lassen. Fedoseew würde vor der Bedrohung nicht zurückweichen. Bevor der Industrielle an Rückzug dachte, mussten schon Kugeln durch die Luft fliegen.
Das war die russische Art.
Tucker legte sich auf den Bauch und blickte unter den Güterwaggons hindurch. Ein Beinpaar bewegte sich nach rechts und verschwand für Augenblicke hinter den Stahlrädern. Ob das sein Mann war, wusste er nicht, doch es war durchaus wahrscheinlich.
Er zog die Makarow aus dem Holster, das an seinem Hosenbund befestigt war. Eine ordentliche Pistole, aber nicht unbedingt erste Wahl.
Bist du in Rom …
Er blickte Kane an, der neben ihm auf dem Bauch lag. Er fixierte den Mann, der an den Gleisen entlanglief, weg von dem Unbekannten, der auf den Kran kletterte. Er zeigte auf das Bodenziel.
»Verfolgen.«
Kane lief lautlos dem Mann hinterher.
Tucker wandte sich nach links und hielt auf den Kran zu.
Geduckt lief er über den Parkplatz, erreichte den Betriebshof und kroch unter einen Güterwagen und über die Böschung in den dahinter liegenden Entwässerungsgraben. Aus der kümmerlichen Deckung hervor sah er die Lücke im Zaun; die Umgrenzung war glattrandig, das Loch erst kürzlich ausgeschnitten worden.
Zu seiner Linken, in rund hundert Metern Entfernung, ragte der Kran auf. Er wälzte sich auf die Seite, zoomte mit dem Fernglas und schwenkte es nach oben, bis er die Zielperson ausgemacht hatte. Der Mann stand auf einer Leiter, etwa einen Meter unterhalb des verglasten Steuerhauses. Mit behandschuhter Hand griff er nach dem Lukenhebel.
Tucker überlegte, ob er ihn erschießen sollte, entschied sich aber dagegen. Mit einem Gewehr wäre es vielleicht gegangen, nicht aber mit der Makarow. Die Entfernung und das Gitterwerk machten einen sicheren Schuss nahezu unmöglich. Außerdem war der Schneefall dichter geworden und erschwerte die Sicht.
Er sah auf die Uhr. Noch drei Minuten, bis Fedoseews Limousine das Haupttor erreicht. Flüchtig fragte er sich, wo Kane steckte, dann konzentrierte er sich wieder auf die naheliegende Aufgabe.
Kane musste allein klarkommen.
Kane läuft geduckt, mit aufgestellten Ohren, und hört das Knirschen von Stiefeln im verharschten Schnee. Den Befehl hat er sich eingeprägt.
Verfolgen.
Er hält sich im Schatten der verrosteten Waggons, folgt der dunklen Gestalt durchs Weiß, das immer dichter wird. Doch er ist nicht allein aufs Sehen beschränkt. Das ist der schwächste seiner Sinne, nur ein Schatten der umfassenderen Realität.
Er hält einen Moment an und beschnüffelt einen Fußabdruck, riecht Gummi, Dreck und Leder. Er richtet sich auf und wittert den flüchtigen Geruch nasser Wolle, Zigarettenrauch und Schweiß. Er riecht die Angst im salzigen Hautgeruch des Mannes und hört sein leises Keuchen.
Im Laufen nimmt er die Umgebung in sich auf, liest Vergangenheit und Gegenwart aus dem Strom alter und neuer Spuren heraus. Mit den Ohren registriert er jeden fernen Ruf, jedes Motorbrummen, das Wellenrauschen des Meeres. Am Gaumen schmeckt er Frost und Winter.
Eine Spur aber überstrahlt alle anderen und führt ihn zur Beute.
Er fliegt dahin, ein Gespenst, das einer heißen Spur folgt.
10:18
Aus dem Entwässerungsgraben beobachtete Tucker, wie seine Beute ins Steuerhaus kletterte und die Luke mit einem gedämpften Scheppern hinter sich schloss.
Da keine Entdeckungsgefahr mehr bestand, richtete Tucker sich auf, lief zum Kran und schob die Makarow ins Holster. Er verzichtete auf alle Heimlichtuerei, sprang auf die dritte Leitersprosse und kletterte nach oben. Die Sprossen waren spiegelglatt von Schnee und Eis. Er rutschte mehrfach mit dem Stiefel ab, kam aber voran. Zwei Sprossen unterhalb der Luke hielt er inne. Das Vorhängeschloss fehlte.
Mit angehaltenem Atem zog er die Makarow heraus und drückte den Lauf behutsam an die Luke. Sie gab ein wenig nach.
Tucker nahm sich keine Zeit, darüber nachzudenken, ob sein nächster Schritt vielleicht leichtsinnig war. Ein Zögern konnte ebenso tödlich sein wie Draufgängertum.
Wenn ich schon sterben muss, dann solange ich in Bewegung bin.
In der Vergangenheit war er in zahllosen afghanischen Dörfern und Bunkern durch Hunderte von Türen gestürmt. Dahinter hatte stets jemand gewartet, der ihn töten wollte.
Hier war es nicht anders.
Er drückte die Klappe hoch, schwenkte die Waffe nach links und nach rechts. Der Attentäter kniete einen halben Meter neben ihm und hatte sich über einen offenen Gewehrkoffer gebeugt. Hinter ihm stand eins der Schiebefenster offen, Schnee wehte in die Kabine.
Der Mann fuhr zu Tucker herum. Die Überraschung in seinem Gesicht währte nur einen Sekundenbruchteil – dann griff er an.
Tucker drückte ab. Das Neun-Millimeter-Hohlspitzgeschoss trat über dem Nasenrücken des Mannes ein und tötete ihn auf der Stelle. Er kippte zur Seite und rührte sich nicht mehr.
Einer wäre erledigt …
Tucker bedauerte nicht, was er getan hatte, doch er verspürte ein gewisses Unbehagen. Er war zwar kein religiöser Mensch, fühlte sich aber zur buddhistischen Philosophie hingezogen – leben und leben lassen war seine Devise. In diesem Fall war Letzteres allerdings keine Option gewesen. Es war merkwürdig, dass er es vertretbar fand, einem Menschen das Leben zu nehmen, während er es nicht über sich brachte, ein Tier zu töten. Der Widerspruch lag auf der Hand, doch damit musste er sich später befassen.
Er schob die Makarow ins Holster, kletterte ins Steuerhaus und suchte nach einem Handy oder Funkgerät, konnte aber nichts finden. Wenn der Mann einen Partner hatte, gingen sie unabhängig voneinander zu Werke – vermutlich hatten sie verabredet, dass der zuerst schoss, dem sich die Gelegenheit bot.
Zeitcheck: Noch sechzig Sekunden.
Fedoseew würde pünktlich sein. Das war er immer.
Jetzt galt es, den Russen aus der Todeszone herauszuhalten.
Er wandte sich dem Gewehr zu, einem SV-98 aus russischer Produktion. Er nahm es aus dem Koffer, untersuchte es und stellte fest, dass es feuerbereit war.
Danke, Kamerad, dachte er, als er über den Toten hinweg ans offene Fenster trat.
Er zog das Zweibein aus, stellte es auf den Sims und richtete den Lauf über das Meer der Schiffscontainer hinweg aufs Haupttor. Die Wange an den kalten Schaft gelegt, spähte er durchs Zielfernrohr und den wirbelnden Schnee.
»Wo steckst du, Fedoseew?«, murmelte Tucker. »Komm schon …«
Dann sah er den schwarzen Schemen, der durchs Schneetreiben fuhr. Die Limousine war noch zehn Meter vom Haupttor entfernt und wurde vor dem Wachhäuschen langsamer. Tucker konzentrierte sich auf die Windschutzscheibe und spannte den Zeigefinger am Abzug an. Er zögerte einen Moment, dann rief er sich die Spezifikationen der SV-98 in Erinnerung. Die Waffe hatte nicht genug Durchschlagskraft, um das Panzerglas der Limousine zu durchdringen – jedenfalls hoffte er das.
Er drückte ab, der Schuss hallte ohrenbetäubend laut in der engen Krankabine wider. Die Kugel Kaliber 7,62 Millimeter traf die Windschutzscheibe unmittelbar vor dem Fahrersitz. Tucker schwenkte den Lauf ein wenig und schoss erneut. Diesmal zerschmetterte er den Seitenspiegel. Der Fahrer reagierte augenblicklich und richtig; er legte den Rückwärtsgang ein, beschleunigte etwa fünfzehn Meter weit und riss den Wagen dann herum.
In Sekundenschnelle hatte sich das Fahrzeug hundert Meter entfernt und verschwand im Schneetreiben.
Zufrieden senkte Tucker das Gewehr. Fedoseew befand sich einstweilen in Sicherheit, doch jemand hatte versucht, seinen Auftraggeber umzubringen. Er wollte verdammt sein, wenn er den zweiten Attentäter entkommen ließ und ihm Gelegenheit gab, es ein zweites Mal zu versuchen.
Tucker warf das Kastenmagazin aus und steckte es ein, dann holte er das Satellitentelefon hervor. Er rief den Videofeed von Kanes Kamera auf, doch die nasse Linse lieferte nur ein verschwommenes Bild.
Seufzend öffnete er eine weitere App. Eine Karte des Hafengeländes wurde angezeigt. Westlich von Tuckers Position, etwa vierhundert Meter entfernt, pulsierte ein grüner Punkt. Das war Kanes GPS-Signal, erzeugt von einem zwischen den Schulterblättern implantierten Mikrochip.
Der Punkt war stationär, was darauf hindeutete, dass Kane sich an seine Anweisung hielt. Der Schäferhund war der Zielperson gefolgt und beobachtete sie jetzt aus dem Verborgenen.
Plötzlich bewegte sich der Punkt, ein kleiner Ruck, der anzeigte, dass Kane die Position verändert hatte, vermutlich um die Zielperson im Blick zu behalten. Dann bewegte sich der Punkt erneut, diesmal in östliche Richtung. Allmählich wurde er schneller.
Das konnte nur eines bedeuten: Der zweite Attentäter lief in Tuckers Richtung.
Er kletterte eilig die Leiter hinunter, die meiste Zeit rutschend. Als er wieder festen Boden unter den Füßen hatte, stapfte er mit vorgehaltener Makarow an den Gleisen entlang durch den immer dichter fallenden Schnee. Er war noch keine zehn Meter weit gekommen, als er eine schemenhafte Gestalt wahrnahm, die gerade neben dem Loch im Zaun in die Hocke ging. Die Zielperson kroch durch die Lücke und rannte in den Wald.
Verdammt.
Zwei Sekunden später tauchte Kane auf, bereit, die Verfolgung aufzunehmen. Als der Schäferhund jedoch Tucker bemerkte, hielt er an und wartete mit gespitzten Ohren auf weitere Anweisungen.
Tucker spannte ihn nicht auf die Folter.
»Fass!«
Jetzt wurde es ernst.
Kane sprang durch die Lücke im Zaun und nahm die Verfolgung auf.
Obwohl der Schäferhund jetzt im Angriffsmodus war, vergrößerte sich der Abstand zu Tucker kaum. Kane suchte sich einen Weg durchs Unterholz und setzte mühelos über umgestürzte Bäume hinweg, wobei er seinen Partner und die Zielperson gleichzeitig im Blick behielt.
Im Wald waren die Geräusche des Hafens nicht mehr zu hören. Mit einem leisen Knispeln fiel Schnee durchs Geäst. Irgendwo knackte ein Ast. Tucker hielt an und duckte sich. Kane war zu seiner Rechten in rund fünfzehn Metern Abstand ebenfalls erstarrt. Er hockte auf einem umgestürzten Baum und blickte starr in den Wald.
Die Zielperson hatte anscheinend angehalten.
Tucker holte das Telefon hervor und warf einen Blick auf die Karte.
In zweihundert Metern Entfernung durchschnitt ein Kanal den Wald, ein Teil der alten Hafenanlage, die der russischen Marine gehört hatte. Der Mann war ein ehemaliger Marineinfanterist, und ihm war durchaus zuzutrauen, dass er den Rückzug übers Wasser eingeplant hatte.
Aber war das wirklich sein Plan?
Der Karte zufolge verlief hinter dem Kanal eine größere Straße.
Was, wenn der Mann dort ein Fahrzeug abgestellt hat?
Entscheide dich, Tucker.
Würde die Zielperson über Land oder übers Wasser fliehen?
Er erzeugte einen Zischlaut, und Kane schaute ihn an. Tucker hob die zur Faust geschlossene Hand, dann spreizte er die Finger: Such.
Kane wandte sich nach Süden.
Tucker schlug die südöstliche Richtung ein, um die Zielperson zu umgehen und ihr notfalls den Weg abzuschneiden.
Im Laufen behielt er Kanes GPS-Position im Auge. Sein Partner erreichte den Kanal und hielt an. Der blinkende Punkt verharrte einen Moment, dann bewegte er sich parallel zum Kanal und wurde rasch schneller.
Das konnte nur eines bedeuten: Die Zielperson hatte ein Boot.
Tucker rannte los und duckte sich unter den Ästen hinweg. Er stürmte aus dem Wald hervor auf ein offenes Feld. Eine hohe Erhebung verdeckte ihm die Sicht auf den Kanal. Von rechts hörte er das Grummeln eines Bootsmotors. Er hielt darauf zu, während Kane auf der Erhebung entlanglief.
Tucker wusste, dass er mit dem Hund nicht Schritt halten konnte. Der Karte zufolge war der Kanal schmal, gerade mal drei Meter breit.
Machbar, dachte Tucker.
»Fass! Entwaffnen!«, rief er.
Der Schäferhund senkte den Kopf und setzte zum Spurt an, dann sprang er von der Erhebung ab und verschwand hinter der Böschung.
Kane fliegt, erregt vom Luftzug, der über sein Fell streicht. Dafür lebt er, das ist seinem Wesen ebenso eingeschrieben wie sein Herzschlag.
Jagen und Beute machen.
Mit den Vorderpfoten berührt er das Holzdeck, doch er bewegt sich bereits weiter, verlagert das Hinterteil, bringt die Hinterbeine in Position. Er katapultiert sich dem Steuerhaus entgegen.
Mit seinen scharfen Sinnen nimmt er alle Details auf.
Den Gestank nach verbranntem Öl …
Den Harzduft des polierten Holzes …
Den Geruch von Salz und Angst, der aus der offenen Tür strömt …
Er folgt dem Geruch, angetrieben vom Befehl und seinem Instinkt.
Er stürmt durch die Tür, sieht, wie der Mann zu ihm herumfährt, sieht ihn erbleichen und hört ihn aufkeuchen vor Überraschung.
Ein Arm hebt sich, kein Abwehrreflex, sondern das Anlegen einer Waffe.
Damit kennt Kane sich aus.
Es knallt ohrenbetäubend laut, als er springt.
10:33
Der Schuss hallte in dem Moment übers Wasser, als Tucker die Böschung erklommen hatte. Das Herz krampfte sich ihm zusammen. Fünfzig Meter weiter trieb ein krängendes Boot mit Steuerhaus dem Ufer entgegen.
Tucker rannte los, die Sorge um Kane verlieh ihm ungeahnte Kräfte. Als er das Boot erreichte, sprang er ab. Er landete auf dem Achterdeck und prallte gegen das Dollbord. Er sah Sterne, rollte sich seitlich ab, richtete sich auf die Knie auf und zog die Makarow.
Durch die offene Tür sah er einen am Boden liegenden Mann, der um sich schlug und mit den Beinen zuckte. Kane hielt seinen rechten Unterarm gepackt. Der kräftige Schäferhund schüttelte ihn wie eine Stoffpuppe.
Der Russe schrie. Tucker verstand nur wenig Russisch, doch der Tonfall sagte eigentlich alles.
Lass mich los! Bitte!
Die Waffe auf die Brust des Mannes gerichtet, trat Tucker in die Kabine. Mit ruhiger Stimme sagte er: »Loslassen.«
Kane gehorchte unverzüglich und wich zurück, mit zurückgezogenen Lefzen.
Der Russe drückte sich den verletzten Arm an die Brust, seine Augen waren geweitet und vom Schmerz getrübt. Offenbar war die Elle gebrochen, vielleicht auch die Speiche.
Tucker empfand kein Mitleid.
Der Dreckskerl hätte um ein Haar seinen Partner erschossen.
Neben dem Mann lag ein rauchender Revolver.
Tucker trat vor und sah auf den Mann nieder. »Sprechen Sie Englisch?«
»Englisch … ja, ich spreche ein bisschen Englisch.«
»Sie sind festgenommen.«
»Was? Ich …«
Tucker holte mit dem rechten Fuß aus und versetzte dem Mann einen Tritt gegen die Stirn, der ihm das Bewusstsein raubte.
»Sozusagen«, setzte er hinzu.
2
4. März, 12:44Wladiwostok, Russland
»Sie schulden mir eine neue Windschutzscheibe«, dröhnte Bogdan Fedoseew und reichte Tucker ein Schnapsglas mit eiskaltem Wodka.
Tucker nahm es entgegen und stellte es auf den Beistelltisch neben dem Sofa. Er machte sich nichts aus Wodka, vor allem aber misstraute er im Moment seinen Händen. Nach der Schießerei im Hafen war er voller Adrenalin gewesen, kein unbekannter und auch kein unangenehmer Zustand für ihn. Allerdings fragte er sich, ob das Hochgefühl nicht eher von PTBS herrührte – der posttraumatischen Belastungsstörung, die häufig nach einer Granatexplosion oder durch Überforderung im Kampf auftrat und an der viele Soldaten litten, die im Irak oder in Afghanistan gekämpft hatten.
Verglichen mit den meisten solchen Fällen war Tuckers Zustand nicht besonders schwer, stellte aber eine Konstante in seinem Leben dar. Er kam gut damit zurecht, spürte jedoch, dass das Trauma in ihm lauerte wie ein Monster, das nach einer Lücke in seiner mentalen Rüstung suchte. Tucker fand diese Metapher seltsamerweise beruhigend. Auf Wachsamkeit verstand er sich. Gleichwohl wollte der Buddhist in ihm ihn dazu bewegen, den Panzer abzulegen.
Mach dich frei davon!
Wenn du dich daran klammerst, wird es nur stärker.
Du wirst, was du denkst.
Tucker wusste nicht genau, wann und wo er sich diese Philosophie angeeignet hatte. Sie hatte sich an ihn angeschlichen. Er hatte ein paar Lehrer gehabt – darunter einen besonders wichtigen –, doch er vermutete, dass er diese Weltsicht bei seinen Wanderungen mit Kane entwickelt hatte. Bei seinen Begegnungen mit allen möglichen Menschen hatte er gelernt, sie vorurteilsfrei so zu nehmen, wie sie waren. Die Ähnlichkeiten zwischen den Menschen überwogen die Unterschiede. Jeder versuchte auf seine Weise, glücklich zu sein und ein erfülltes Leben zu führen. Die Wege waren höchst unterschiedlich, doch das Ziel blieb das Gleiche.
Es reicht, dachte Tucker. Kontemplation war eine gute Sache, doch er war zu dem Schluss gelangt, dass sie eine Gemeinsamkeit mit dem Tequila hatte – man genoss sie am besten nur in kleinen Dosen.
Kane saß zu seinen Füßen, sein Blick aber war klar und wachsam. Dem Schäferhund entging nichts: Haltung, Gestik, Augenbewegungen, Atemfrequenz, Transpiration. Dies alles ergab für seinen Partner ein Gesamtbild. Es war nicht überraschend, dass Kane die angespannte Atmosphäre aufgefallen war.
Tucker nahm sie ebenfalls wahr.
Einer der Gründe, weshalb er mit Kane zusammen ein Team gebildet hatte, war sein ungewöhnlich stark ausgeprägtes Einfühlungsvermögen gewesen. Militärische Hundeführer hatten eine Redewendung – Die Leine ist der Leiter –, welchedie enge Verbindung zwischen Mensch und Hund beschrieb. Auf diese Weise vermochte Kane, Menschen zu lesen, und nahm Nuancen der Körpersprache und des Gesichtsausdrucks wahr, die anderen entgingen.
So wie jetzt.
»Und den Seitenspiegel der Limousine«, setzte Fedoseew mit angestrengtem Grinsen hinzu. »Sie haben die Windschutzscheibe und den Spiegel beschädigt. Sehr teuer. Am schlimmsten aber ist, dass Sie Pytor, meinen Fahrer, getötet haben.«
Tucker machte keinen Rückzieher, denn das wäre als Zeichen von Schwäche ausgelegt worden. »Auf die Entfernung und bei dem Schusswinkel hatte die Kugel nicht genug Durchschlagskraft, um das Panzerglas der Limousine zu durchdringen. Pytor hätte vielleicht dann Anlass zur Sorge gehabt, wenn ich direkt vor der Motorhaube gestanden hätte.«
Fedoseew runzelte die Stirn. »Trotzdem, teure Reparaturen, ja?«
»Die können Sie von meiner Prämie abziehen«, entgegnete Tucker.
»Prämie! Welche Prämie?«
»Dafür, dass ich Ihnen das Leben gerettet habe.«
Yuri, der hinter Fedoseew stand, sagte: »Wir wären damit auch allein …«
Fedoseew hieß seinen Untergebenen mit erhobener Hand schweigen. Yuri lief rot an im Gesicht. Die beiden Bodyguards an der Tür traten von einem Fuß auf den anderen, den Blick gesenkt.
Tucker war klar, was Yuri und dessen Sicherheitsleute dachten. Wäre und hätte zählten nicht, wenn es um Personenschutz ging. Tatsache war, dass dieser Außenseiter – der Amerikaner mit seinem Hund – ihrem Boss das Leben gerettet hatte. Trotzdem hatte Yuri sich bei der Polizei für Tucker eingesetzt und verhindert, dass es wegen des getöteten Attentäters Schwierigkeiten gab. Wenn russische Bodyguards einen Attentäter erschossen, war das eine Sache; wenn ein ehemaliger U.S. Ranger das tat, eine andere.
Neunzig Minuten, nachdem er den zweiten Mann festgenommen hatte, der sich jetzt in Polizeigewahrsam befand, hatte Tucker sich mit Fedoseew und dessen Begleitung im Meridian Hotel getroffen, wo der Russe eine Etage mit VIP-Suiten gemietet hatte. Ausstattung und Mobiliar waren komfortabel, aber protzig – schäbiger Sowjetchic. Draußen schneite es noch immer, die beeindruckende Aussicht auf die Peter-der-Große-Bucht und das Festland wurde verdeckt.
»Ich weiß was Besseres«, sagte Fedoseew. »Sie schließen sich meinem Team an. Auf Dauer. Ich bin großzügig. Ihr Hund wird jeden Abend Steak fressen. Das würde ihm gefallen, ja?«
»Fragen Sie ihn doch selbst.«
Fedoseew blickte den Hund an, dann lächelte er und drohte Tucker mit dem Zeigefinger. »Sehr komisch.« Er änderte die Taktik. »Die beiden suka hatten womöglich einen Helfer. Wenn er sich noch in der Gegend herumtreibt …«
Suka war eines von Fedoseews Lieblingsworten. Höflich ausgedrückt, bedeutete es Drecksack.
Tucker unterbrach ihn. »Sollten Sie recht haben, wird Yuri die übrigen Beteiligten sicherlich aufspüren.«
Zumal sich einer der Attentäter in Gewahrsam befand.
Folter war hier ebenso alltäglich wie das Essen mit Messer und Gabel.
Fedoseew seufzte. »Dann lautet Ihre Antwort wie?«
»Ich weiß das Angebot zu schätzen«, sagte er, »aber mein Vertrag läuft in zwei Tagen aus. Anschließend habe ich andere Verpflichtungen.«
Das war gelogen, doch das konnte Fedoseew nicht wissen.
In Wahrheit hatte er gar nichts vor, und das war ihm im Moment ganz recht. Außerdem waren die Angehörigen des Sicherheitsteams ausnahmslos ehemalige Militärs; das zeigte sich in allem, was sie sagten und taten. Davon hatte er genug. Tucker hatte seinen Militärdienst absolviert, und der Abschied war alles andere als einvernehmlich verlaufen.
Zu Anfang hatte es ihm bei der Army sogar gefallen, und er hatte erwogen, eine Militärlaufbahn einzuschlagen.
Bis zu Anakonda.
Als ihn die unerwünschten Erinnerungen überfielen, griff er nach dem Wodkaglas. Das Geräusch, mit dem die Eiswürfel ans Glas stießen, war ihm zuwider. PTBS. Er betrachtete sie als psychisches Schrapnell, das in der Nähe seines Herzens saß.
Er nippte am Wodka, gab sich den Erinnerungen hin.
Er hatte keine andere Wahl.
Tucker nahm das Knacken in den Ohren beim Abheben des Rettungshubschraubers wahr, spürte den warmen Wind.
Er schloss die Augen und wanderte in Gedanken zurück zu jenem Tag und dem Feuergefecht. Er hatte Soldaten der Zehnten Gebirgsdivision dabei geholfen, eine Reihe von Bunkern in der Halfpipe der Hölle zu sichern. An diesem Tag hatten ihm zwei Partner zur Seite gestanden: Kane und sein Wurfgeschwister Abel. Wenn Kane Tuckers rechter Arm gewesen war, dann war Abel sein linker. Er hatte beide Hunde ausgebildet.
Dann empfing das Team einen Notruf. Ein Chinook-Heli mit einem Team Navy SEALs war auf einem Gipfel mit dem Namen Takur Ghar von Panzerbüchsen abgeschossen worden. Tucker und seine Gruppe wurden nach Osten losgeschickt und begannen den beschwerlichen Aufstieg zum Takur Ghar, als sie in einer Schlucht in einen Hinterhalt gerieten. Zwei Sprengvorrichtungen explodierten, töteten die meisten Angehörigen von Tuckers Team und verletzten die übrigen, darunter auch Abel, dessen linkes Vorderbein bis zum Gelenk abgerissen wurde.
In Sekundenschnelle stürmten Talibankämpfer aus ihren Verstecken hervor. Tucker gelang es, sich zusammen mit einer Handvoll Soldaten zu einer Verteidigungsposition zurückzuziehen, wo sie bis zum Eintreffen eines Evakuierungshubschraubers ausharrten. Als Kane und seine Kameraden an Bord waren, wollte er abspringen und Abel holen, doch ein Besatzungsmitglied hielt ihn zurück, sodass er nur tatenlos zuschauen konnte.
Als der Heli abhob, näherten sich zwei Taliban dem Hund, der zur aufsteigenden Maschine humpelte, blutend und den gequälten Blick auf Tucker gerichtet.
Tucker kroch zur Kabinentür, wurde jedoch erneut zurückgezerrt.
Dann hatten die Talibankämpfer Abel erreicht. Diese letzten Erinnerungen unterdrückte er wie immer, nicht aber die deprimierte Stimme in seinem Hinterkopf: Hättest du dich mehr bemüht, hättest du ihn erreichen können.
In diesem Fall wäre auch er getötet worden, aber wenigstens wäre Abel nicht allein gewesen. Allein – mit der Frage, weshalb Tucker ihn im Stich gelassen hatte …
Wieder in die Gegenwart zurückgekehrt, öffnete er die Augen und kippte den Rest des Wodkas in sich hinein, ließ den alten Schmerz wegbrennen.
»Mr. Wayne …« Bogdan Fedoseew neigte sich mit besorgter Miene vor. »Fühlen Sie sich nicht gut? Sie sind leichenblass geworden, mein Freund.«
Tucker räusperte sich und schüttelte den Kopf. Er spürte, dass Kane ihn ansah. Er streckte die Hand aus und drückte den Schäferhund beruhigend am Hals.
»Alles in Ordnung. Worüber haben wir gleich noch geredet?«
Fedoseew lehnte sich zurück. »Ob Sie und Ihr Hund sich uns anschließen.«
Tucker konzentrierte sich auf Fedoseew und die Gegenwart. »Nein, wie ich schon sagte, es tut mir leid. Ich habe Verpflichtungen.«
Das war gelogen, er wollte weiterziehen, er musste weiterziehen.
Die Frage aber blieb bestehen: Was sollte er tun?
Fedoseew seufzte vernehmlich. »Na schön. Aber geben Sie mir Bescheid, falls Sie Ihre Haltung ändern sollten. Heute übernachten Sie in einer unserer Suiten. Ich lasse Ihnen zwei Steaks bringen. Eins für Sie, eins für Ihren Hund.«
Tucker nickte, erhob sich und schüttelte Fedoseew die Hand.
Das war im Moment Zukunftsplanung genug.
23:56
Das Zirpen des Satellitentelefons weckte Tucker.
Er tastete danach und sah auf die Uhr.
Kurz vor Mitternacht.
Wer mochte das sein? Da Fedoseew an diesem Abend nichts vorhatte, hatten er und Kane frei. War etwas passiert? Yuri hatte ihn bereits informiert, dass der in Haft befindliche Wladikawkas-Separatist gebrochen sei und alles ausgeplaudert habe.
Deshalb hatte Tucker mit einer ruhigen Nacht gerechnet.
Er nahm das Telefon in die Hand und sah aufs Display, doch der Anrufer hatte seine Nummer unterdrückt. Das hatte selten etwas Gutes zu bedeuten.
Kane hatte sich neben dem Bett aufgesetzt und beobachtete Tucker.
Er nahm das Gespräch an. »Hallo?«
Pieps- und Summlaute deuteten darauf hin, dass das Signal mehrere digitale Verschlüsselungsgeräte durchlief.
Schließlich meldete sich der Anrufer. »Captain Wayne, ich bin froh, dass ich Sie erreichen konnte.«
Tucker entspannte sich – jedoch nicht vollständig. Die Stimme rief Misstrauen bei ihm wach. Es war Painter Crowe, der Direktor der Sigma Force, der Mann, der versucht hatte, ihn kurz nach dem letzten Einsatz anzuwerben. Die Stellung von Sigma im Geflecht der amerikanischen Geheimdienste war ihm noch immer nicht klar, doch eines wusste er: Sigma war der ultrageheimen DARPA unterstellt – der Defense Advanced Research Projects Agency, die im Auftrag des Verteidigungsministeriums forschte.