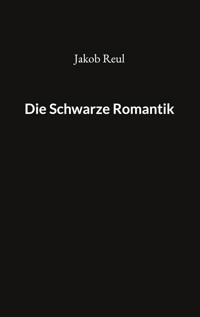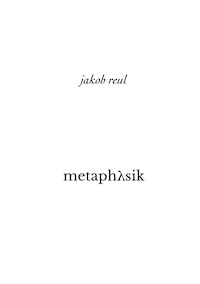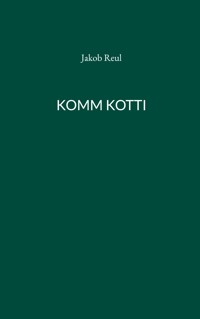
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Eine Arbeit über Kreuzberg und Berlin. 222 Seiten.
Das E-Book Komm Kotti wird angeboten von BoD - Books on Demand und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Berlin,Kreuzberg,Kotti,Kottbusser Tor,Berliner
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Komm Kotti
Kotti
Republik
Gestalten
Gräfe
Behörde
Anonymität
Am Wasser
Geld
Mosaik
Parallelgesellschaft
Kessel
Späti
Kälte
Maschine
Exzentrik
Armut
Feiern
Geist
1. Mai
Bildung
Bezirke
Ungeduld
Einsamkeit
Orania
Zeit
Hertha
Leitkultur
Junkies
Asphalt
Museum
U-Bahn
Kunst
Streit
Älterwerden
Wandel
Kotti
Der Kotti ist die Hauptstadt von Kreuzberg. Jeder kennt ihn. Jeder liebt ihn. Drei Sätze und schon die erste Lüge. Die Wenigsten lieben ihn. Aber jeder kennt ihn. Wer hier lebt, der sieht ihn täglich. Viele Wege führen zum Kotti und fast alle an ihm vorbei. Manche vergleichen ihn schon mit dem Place Charles de Gaulle in Paris und die Adalbertstraße mit dem Champs Elysees, aber das würde zu weit führen. Dann schon eher der Große Stern mit der Siegessäule. Beide Plätze sind glorreich und luxuriös. Beide Plätze haben eine Siegessäule im Zentrum. Am Kotti ist das die große Uhr. Ansonsten trifft der Vergleich mit Paris aber zu. Denn Kreuzberg ist so paradiesisch wie parisisch. Vom Porte de Kottbus geht man den Champs Adalbert hoch zur Rue Oranien, mitten hinein ins Kreuzberger Leben. Der Kotti ist ein Kreisverkehr; ein Platz, der nicht wirklich ein Platz ist. Auf Wikipedia wird er eine „platzartige Straßenkreuzung“ genannt. Damit ist ausgedrückt, was der Kotti ist: kein Platz, keine Straße und keine Kreuzung. Der Kotti ist ein Ort. Dieser Ort hat platzartige Elemente, straßenartige, und kreuzungsartige. U-Bahn-artige, busartige, restaurantartige, supermarktartige und so weiter. Der Kotti ist kein Ort, an dem man sich aufhält, eher einer, an dem man sich trifft. Auch wenn es am Kotti keinen echten Treffpunkt gibt. Man trifft sich vorm Rewe, aber das ist neu, früher war das anders. Früher hat man sich vorm Kaisers getroffen.
Der Kotti heißt nicht wirklich Kotti, das ist nur sein Spitzname. Sein bürgerlicher Name: Kottbusser Tor. Mit dem Kotti ist man immer per Du. Man geht direkt über das förmliche „Kottbusser Tor“ hinaus zum formlosen „Kotti“. Wenn jemand Kottbusser Tor sagt, dann hat der Kotti wieder Mist gebaut. Das ist wie, wenn die Eltern einen früher mit Namen angesprochen haben. Wenn man „Kottbusser Tor“ hört, dann weiß man, es wurde wieder eine Mülltonne angezündet oder ein Polizeieinsatz ist eskaliert. Auf das verbale „Kottbusser Tor“ folgen nie gute Nachrichten. „Am Kottbusser Tor ist heute ein Sonnenblümchen gewachsen“. „Kottbusser Tor, das deutsche Woodstock“. „Kottbusser Tor — Love, Peace and Happiness“. Darum freut man sich fast, wenn man „Kotti“ hört. „Kotti“ ist immer liebevoll. Niemand sagt: „Am Kotti kam es heute zu einer Schlägerei“. Als Kreuzberger ist man am Tag ungefähr zehn Mal hier. Die anderen U-Bahnhöfe der U8 liegen so abgelegen, dass man sich eigentlich nie dort aufhält. Wenn man zum U-Bhf Schönleinstraße geht, dann ist man gefühlt schon in Neukölln. Wenn man zum U-Bhf Moritzplatz geht, dann nur weil man sich verlaufen hat. Kreuzberg hat nur eine Station auf der U8. Ansonsten wäre da noch die U1. Schlesi, Görli, Kotti, Prinzenbad. Das sind die vier U1-Stationen in Kreuzberg. Dort steigt man ein, und wenn man Glück hat, steigt die Musik gleich mit ein. Früher gab es da so ein ungeschriebenes Gesetz, das den Straßenmusikern eine Station eingeräumt hat. Heute hält sich keiner mehr an dieses Gesetz. Da wird stationenlang musiziert, ohne Aussicht auf Erlösung. Wer Pech hat, der muss sich vier Stationen lang eine Puccini-Arie anhören, und wenn er noch mehr Pech hat, dann steigt der gleiche Sänger auf der Rückfahrt wieder ein.
Der Kotti lässt sich als Ort nicht so richtig einfangen. Ein ständiger Durchlauf, und dieser Durchlauf ist die Konstante. Man ist nie weit weg vom Kotti, das ist eine dieser Kreuzberger Tatsachen. Egal wo man sich aufhält, der Kotti ist der nächstgelegene Ort. Am Kotti kann man gut essen. Restaurants sind es nicht, es sind Foodspots. Der Berliner isst, wie er lebt, von der Hand in den Mund*. Haute Cuisine ist es nicht. Aber schnell, und ehrlich. Wenn die Luftballons hängen, dann weil wieder ein Pizza Pasta Burger Laden eröffnet hat. Am Kotti kriegt man alles, vor allem Döner. Die Kreuzberger essen Döner zu allen Uhrzeiten. Zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen. Kreuzberg hat die besten Foodspots und die schlechtesten Feierspots. Hotspots hat Kreuzberg überhaupt nicht. In Kreuzberg gibt es kein Internet. Aber das sind Kinderkrankheiten. Der Wandel hat längst begonnen. Kreuzberg erlebt die Modernisierung, und das ist immer das Komische. Da eröffnet eine neue Asian Fusion Kitchen auf der Oranienstraße, direkt neben dem türkischen Bäcker, der dort schon seit 25 Jahren zuhause ist. Das eine bleibt ewig gleich, das andere verändert sich pausenlos, und man ist verwirrt: Verändert sich hier alles — oder verändert sich nichts? Moderne und Tradition verlaufen in Kreuzberg direkt nebeneinander, aber so wirklich in Verbindung treten sie nicht.
Also steht man am Kotti und beobachtet die Szene. Jemand brüllt. Am Kotti brüllt immer gerade jemand. Ein Polizist hält einen Fahrradfahrer an. Es fallen die Worte: ‚Komm se ma ran uff’n Meter‘. Ali fährt seinen geleasten BMW zum dritten Mal hintereinander über den Kotti. Hätte Ali sich den Fünfer zulegen sollen? Darüber streiten die Gelehrten. Aber ja, irgendwann und irgendwie wird er die 60.000 € schon abbezahlen. Blick nach oben. Der Himmel ist grau. Berlin ist trist. Auf den Treppenstufen sitzen verlorene Seelen. Alle sind wieder einmal unterwegs. Teresa und Mareike laufen an mir vorbei. Große Entscheidungen stehen an. Mareike hat Lust auf Falafel, aber Teresa wollte „unbedingt mal den Georgier ausprobieren“. Endlich ist Kreuzberg komplett, endlich die Lücke in unserem Herzen geschlossen. Was war Kreuzberg ohne Teresa aus Oldenburg? Das muss diese Diversity sein, von der überall gesprochen wird. Hier am Kotti bildet jeder Mensch seine eigene Kultur. Ali fährt mit seinem BMW über den Kotti, das ist eine Kultur. Teresa und Mareike aus der Hinterhof-Agentur stapfen zum Georgier. Eine andere Kultur. Karl-Heinz brüllt, weil Karl-Heinz genug hat, wieder eine andere Kultur. Berlin ist voller Gestalten. Das ist ein Klischee, aber es ist auch die Wahrheit. Kennedy hat sich selbst einen Berliner genannt. In Wahrheit ist niemand weiter davon entfernt gewesen, Berliner zu sein als Kennedy. Kennedy war der Anti-Berliner. Ein Berliner hat keine Ambitionen, und er trägt auch keine Anzüge.
Der Kotti ist echt. Man kann jederzeit herkommen und das echte Leben inhalieren. Am Besten inhaliert man dabei nicht, denn die Gerüche am Kotti sind vielfältig. Am Kotti ist man euphorisch, am Kotti ist man depressiv. Man kommt nachts nach Hause und der Kotti ist wie leer gefegt. „Der“ Kotti, das fühlt sich falsch an, das sagen eigentlich nur die Zugezogenen. Kotti, das ist ein Wort ohne Artikel. „Am“ Kotti, sagen wir nicht, „zum“ Kotti auch nicht. „Kotti“ beinhaltet den Artikel. Man sagt: Ich bin Kotti. Lass Kotti treffen. Komm Kotti. Der Tip schreibt: „Wenn man Berlin wirklich verstehen möchte, gehört es definitiv dazu, hier einmal mit dem Fahrrad im Kreisverkehr zu fahren.“ Als Kreuzberger kann man das weder bestätigen noch empfehlen. Mit dem Fahrrad im Kreisverkehr um den Kotti zu fahren, klingt eher nach mental breakdown, oder nach praktischer Prüfung im Straßenabitur. Was in Kreuzberg ebenfalls eine gewichtige Rolle spielt, das sind die Internet-Cafés. Mert, 16 Jahre, schickt seine Bewerbung fürs Schülerpraktikum ab, mit 35 Rechtschreibfehlern auf 34 Wörter. Irgendein Verstrahlter spielt morgens um 9 Uhr Candy Crush, er ist schon seit 8 Uhr hier, und damit ist nicht 8 Uhr morgens gemeint. Im Internetcafé bekommt man alles, und vorne holt man sich seine Fanta Exotic. Ohne Fanta Exotic geht in Kreuzberg überhaupt nichts. Auch wenn der Eistee das Hauptgetränk der Kreuzberger bleibt. Die Kreuzberger lieben diese Getränke. Süß, künstlich, und günstig, das ist sozusagen das Gold, Myrrhe und Weihrauch der Kreuzberger. Die Kreuzberger lieben Caprisonne, Durstlöscher, Bumbum-Eis und Centershock. Ein Kreuzberger kauft kein Ben & Jerries, schon aus finanziellen Gründen nicht. Ben & Jerries ist für die Anderen, für die Neuen. In Kreuzberg wird man vom Kiosk sozialisiert. Die Kioske sind die kleinen Schaltzentralen und Mikrozentren, hier laufen die Welten zusammen.
Kotti, du Sehnsuchtsort. Also wenn die Sehnsucht eine Ernüchterung ist, dann. Der Kotti ist nicht schön, aber atmosphärisch. Wenn es dunkel wird, und die Lichter verwischen mit der Nacht in diesem Großstadtambiente, dann übt der Kotti seine eigene Faszination aus. Der Kotti hat Flair, das kann man ihm nicht nehmen. Abends beleuchtet das Licht der Imbisse den Kotti nur schwach, während von oben, von der U1, so eine Art Tageslicht herunterscheint. Das rote, grüne Licht der Ampeln neben dem blauen Licht des Höllentors: „U Kottbusser Tor“. Vielleicht ist das die wahre Sehenswürdigkeit am Kotti. Weiß auf Blau: U-Bhf Kottbusser Tor. Am Abend entfaltet der Kotti seinen ganzen Flair. Der Ort ist immer noch dreckig, aber man sieht das alles nicht mehr so gut. Am Kotti wird es einem bewusst, wie seltsam es ist, hier in der Stadt zu leben. Man kann hier wunderbar vereinsamen. Am meisten, und am besten, unter Menschen. Wer die Einsamkeit sucht, der suche sich einen vollen U-Bahnhof. Berlin schließt keinen aus, aber das ist nur die positive Seite, denn Berlin schließt auch niemanden ein. Das Berliner Gefühl. Tristesse, Depression, Dunkelheit, aber auch Ehrlichkeit, Spontanität. Wenn der Kreuzberger einsam wird, dann holt er sich einen Hund. In dieser Hinsicht sind die Kreuzberger wie alle anderen.
Der Kotti ist das Wohnzimmer der Kreuzberger. Man verbindet wirklich heimische Gefühle mit diesem Ort, der so lebensfeindlich wirkt. Kein Kreuzberger fürchtet sich vorm Kotti, der zur Familie gehört. All die Horrorgeschichten hört man erst später, nachdem man schon Jahre hier verbracht hat. Man erinnert sich, als man klein war, wie die Welt auf einen wirkte. Der Kotti war wirklich das Zentrum unserer Welt. Die Frage, ob die Zeit schnell oder langsam vergeht, lässt sich hier gar nicht beantworten. Beides. Die Vergangenheit ist lange her, aber sie ist einem noch präsent. Das hat nichts mit dem Kotti zu tun, sondern mit Heimat. Dort, wo man aufwächst, fühlt man sich so: Gegenwärtig in der Vergangenheit. Man erinnert sich an die Vergangenheit, aber diese Erinnerung erlebt man in der Gegenwart.
* Der Einfachheit halber „der Berliner“. Gemeint ist damit natürlich „die Berlinerin“ so sehr wie „der Berliner“.
Republik
Berlin ist eine Stadt ohne Zentrum. Wenn man einem Berliner sagt, lass uns im Zentrum treffen, dann bedeutet das für ihn überhaupt nichts. Es gibt kein Berliner Zentrum. Der Hauptbahnhof drückt es in Perfektion aus. Da bauen sie eine U-Bahnstation, die Straßenbahn fährt jetzt dorthin, und trotzdem ist es alles, nur kein Zentrum. Wer aus dem Hauptbahnhof auf die Straße tritt, der befindet sich erstmal im Nirgendwo. Im Winter wird auf den Straßen nicht gestreut, zur Begrüßung rutscht man in Berlin aus. Der Wind begrüßt einen mit der Berliner Eiseskälte. Man sieht nach Norden und Süden wie auf eine Prärie. Der Hauptbahnhof drückt das dezentrale Berlin in Perfektion aus. Berlin ist provinziell. Was komisch ist, weil Berlin eine Großstadt ist. Trotzdem fühlt sich Berlin eher an wie ein großes Neuruppin. Oder ein Neuruppin mit Problembezirken. Woran liegt das? Man könnte historisch argumentieren, mit dem Ursprung der Stadt. Berlin, das war im Mittelalter diese „Zweistromstadt“, gelegen nicht zwischen Euphrat und Tigris, sondern zwischen Spree und Havel — damals vor allem an der Spree. Zwei Städte, Berlin und Cölln, das war die Mittelalterstadt, und in der Folge bildeten sich die Bezirke um dieses Zentrum herum. Ursprünglich waren das aber Vororte, die gar nicht zur Stadt gehörten. So erklärt sich die innere Struktur der Stadt, die gefühlt aus vielen kleinen Städten besteht. Zwischen Alt-Kölln und Alt-Berlin verläuft die Spree. Heute ist das die Gegend rund um den Molkenmarkt. Berlin ist um dieses Zentrum herum gewachsen, und die Stadtgrenzen haben sich immer weiter verschoben. Das erkennt man noch heute, wenn man sich vergegenwärtigt, dass das Kottbusser Tor mal aus der Stadt hinausgeführt hat. Die Museumsinsel ist das alte Kölln, und alles ostwärts, bis zum S-Bahn-Ring, das alte Berlin. Mit der Zeit wurden die Vororte zu Bezirken, aber innerlich sind sie immer Vororte geblieben. Und so wirken die Berliner Bezirke bis heute — wie Orte, die mit Berlin zusammenhängen, aber trotzdem nicht wirklich zur Stadt gehören.
Berlin ist so groß, dass kaum einer vollumfänglich über die Stadt schreiben kann. Man schreibt immer mit dem Schwerpunkt auf dem eigenen Berlin. Kulturell, aber auch räumlich. Wer in Kreuzberg aufwächst, der hat in der Regel nur wenige Überschneidungen mit Bezirken wie Reinickendorf oder Wilmersdorf. Das sind dann wirklich andere Städte. Und weil Berlin überall Berlin ist, braucht man nicht zu pendeln. In Berlin gibt es das gesamte Berliner Angebot in jedem Bezirk. Man kann überall türkisch essen, in Kreuzberg natürlich besser als in Marienfelde. In Berlin fühlen sich die anderen Bezirke immer an wie Geschwister, die man länger nicht gesehen hat. Man hat erstaunlich wenige Bekannte in den anderen Bezirken. Eigentlich nur die Leute, die man von früher kennt. Das heißt selbst die Leute aus den anderen Bezirken kennt man nur aus dem eigenen Bezirk. Dann fährt man als Kreuzberger an die Seestraße und ist verwirrt: Das ist ja wie der Kottbusser Damm hier, nur in Wedding. Das ist auch alles Berlin, aber ein Berlin, mit dem wir nichts zu tun haben. In Berlin hat man diese Erlebnisse ständig. Wenn man als Kreuzberger zum Kudamm fährt, dann fühlt man sich wie auf Klassenfahrt. Gedächtniskirche, Europa-Center, Wittenbergplatz, schwer zu glauben, dass das auch alles Berlin ist. In Berlin gibt es immer so viel Berlin, mit dem man nie in Berührung kommt. Man läuft in Grunewald an den Villen entlang, nur um festzustellen: auch das ist alles Berlin. Die Leute, die hier leben, sind auch alle Berliner wie wir, dabei hat das alles gar nichts damit zu tun, was man sich selbst unter Berlin vorstellt. In Berlin ist die Sicht auf die Stadt nochmal regionaler. Es gibt keine Berliner Sicht, sondern eine Kreuzberger Sicht, eine Neuköllner Sicht, eine Charlottenburger Sicht. Die Perspektiven ähneln einander, aber sie unterscheiden sich doch. Dass die Stadt mehr zu bieten hat, vergisst man schnell, weil man ständig von seinem eigenen Bezirk auf die ganze Stadt schließt. Man sagt dann, Berlin ist kaputt und traurig, aber damit meint man eher Kreuzberg als Berlin. In Grunewald sieht die Welt schon wieder anders aus.
Jeder Bezirk ist vor allem der jeweilige Bezirk, und erst dann Berlin. Wilmersdorf ist Wilmersdorf, Steglitz ist Steglitz, Reinickendorf ist Reinickendorf. Die Bezirke sind die Mosaiksteine, die das Berliner Mosaik zusammensetzen. Berlin ist wie ein Puzzle, aber die Stücke gehören alle zu unterschiedlichen Puzzelspielen. Als Kreuzberger hat man nur sporadische Überschneidungen mit den anderen Bezirken. Mit Moabit zum Beispiel. Das ist ein Bezirk, der gewisse Ähnlichkeiten mit Kreuzberg hat, dann aber wieder ganz anders ist und mehr an Wedding erinnert. Einerseits ist das Berlin, andererseits ist das ja nicht unser Berlin, sondern dieses andere Berlin, mit dem wir überhaupt nichts zu tun haben. Aber den anderen geht es genauso, wenn sie nach Kreuzberg kommen. Berlin ist so groß, dass man ständig im Berliner Ausland unterwegs ist, mit diesem seltsamen Gefühl, nicht zu wissen, ob man noch zuhause ist oder schon in der Fremde. Man ist eine halbe Ewigkeit mit der U-Bahn unterwegs, nur um festzustellen, dass man immer noch in Berlin ist. Die Stadt ist zu groß für ein einheitliches Stadtgefühl, und das hat zur Folge, dass sich das Stadtgefühl in die Bezirke verlagert. Jeder Bezirk repräsentiert die Stadt, und trotzdem, das ist das Seltsame, repräsentiert eigentlich keiner die Stadt, sondern jeder nur sich selbst. Von außen betrachtet, für Besucher und Touristen, ist das alles Berlin. Aber für die Berliner ist nichts davon Berlin, sondern Steglitz, Charlottenburg, Tempelhof. Tempelhof, das ist auch so ein Kandidat. Als Kreuzberger wohnt man direkt um die Ecke, und trotzdem fährt man nie hin. Wenn man mal dort ist, stellt man fest, das ist ja wie das alte Kreuzberg hier, aber dann wundert man sich wieder, was ist das hier für eine Berliner Parallelgesellschaft, die wenige Kilometer von uns entfernt und trotzdem völlig an uns vorbei existiert? Man staunt über dieses nahe ferne Land, mit dem man vorher so wenig zu tun hatte und auch nachher nichts mehr zu tun haben wird. Berlin ist wie ein gesprungener Spiegel, der aus tausend kleinen Scherben besteht, und diese Scherben sind wie Schollen, zwischen denen man hin und her springt.
Jeder Bezirk ist eigen, sodass man sich ständig in einem anderen Berlin aufhält. Die Berliner Bezirke berühren einander nicht, oder sie überschneiden sich nicht. Man geht fließend zwischen ihnen hin und her, und trotzdem fühlt es sich an, als wären die Grenzen abrupt. Wie Ländergrenzen, geradlinig gezogen, als ob man ins Ausland fährt, ins Berlinerische. Und dann gibt es ja noch ganz andere Bezirke. Zum Beispiel das Spandauer Berlin, mit dem man als Kreuzberger nun wirklich überhaupt nichts zu tun hat. Als Kreuzberger ist auch die Chance hoch, dass man noch nie im Märkischen Viertel war, oder in der Gropius-Stadt, das ist einfach alles viel zu weit weg. Man hat nur wenige Berührungspunkte mit den anderen Bezirken, weil man alles vor der eigenen Haustür hat. Es gibt in jedem Bezirk Restaurants, Geschäfte, es gibt das überall, wenn man nicht gerade am Stadtrand wohnt. Die Berliner Bezirke sind die Berliner Städte, und die Stadt Berlin ist die Berliner Republik. Auf dem Papier wohnt man in Berlin, aber eigentlich nur in seinem Bezirk. Deshalb sind ein Charlottenburger und ein Kreuzberger, wenn sie aufeinandertreffen, auch nicht zwei Menschen aus derselben Stadt. Aus derselben Stadt kommen sie nur, wenn sie beide Charlottenburger oder Kreuzberger sind. Ansonsten stammen sie aus der gleichen Region und sind nur über ihre Angehörigkeit zum Land Berlin miteinander verbunden. Darum das Bild, das sich ergibt. Berlin als Mosaik, dessen Teile die Bezirke sind. Die Bezirke sind die Berliner Städte, und ihre Gemeinsamkeit besteht in der Zugehörigkeit zum Land Berlin.
Gestalten
Der Berliner lebt auf einem Planeten namens Berlin. Auf diesem Planeten spielt sich seine ganze Welt ab. Ein Berliner sieht alles Berlinerisch. Was da draußen passiert, das sieht er durch die Augen der Stadt. Berlin hat ein Talent, Gestalten hervorzubringen. Unikate, Exzentriker. Eine charakterliche Schrägheit. Es sind keine schrägen Ansichten, die die Berliner vertreten. Die Berliner sind keine Schwurbler, oder Weltverschwörer, all das passt überhaupt nicht zur Stadt. Ein Berliner ist eine Gestalt, die schräg aussieht und sich schräg verhält, mit der man sich aber erstaunlich gut unterhalten kann. Hier passt das eine nicht zum anderen. Der Berliner ist gleichzeitig surreal und zugänglich, weltnah und weltfremd. Im ersten Moment glaubt man, es handle sich um einen Verrückten, aber wenn man erstmal ins Gespräch kommt, dann entsteht eine ganz normale Situation. Immer noch unter schrägen Voraussetzungen, aber es funktioniert.
Der Berliner ist qua Herkunft ein Original. Seine Schrägheit ist das Produkt seines eigenen Charakters und der schrägen Stadt, die ihre Spuren in ihm hinterlässt. Der Berliner schleift seinen Charakter, wie man etwa ein Messer schleift. Jeden Tag ist er unterwegs im Berliner Dschungel, ständig kommt es zur Begegnung mit den anderen Stadttieren. Der Berliner besitzt keine Tugenden, mit denen er nicht schon irgendwie geboren wurde. Nichts prägt den Berliner stärker als die Stadt, in der er lebt. Berlin schärft seine Sinne und seinen Verstand. Vor allem seine Worte. Ein Berliner spricht immer scharf, und immer drauf los. Er lernt früh, seinen Charakter wie eine Waffe einzusetzen. Auch wie seinen Schild. Der Berliner hat nicht viel, sein Charakter gehört zu seinem wenigen Besitz. Der Berliner spricht immer aus seinem Charakter heraus. Es gibt keine höfliche Ebene mit ihm, der Berliner wird direkt persönlich. Er spricht auch in ganz unpassenden Momenten immer noch persönlich. Das ist sein Geburtsfehler, er kann sich einfach nicht anpassen. Der Berliner ist direkt, mal angenehm direkt, mal unangenehm direkt. Man muss sich daran gewöhnen, und manchmal denkt man sich im Stillen: ein bisschen weniger direkt hätte es auch getan. Trotzdem lernt man diese Direktheit zu lieben. Man fühlt sich befreit von sinnlosen Konventionen. Ein Berliner nimmt sich selbst nicht zu ernst, und er ist uneitel. In der U7 ist dein Sitznachbar entweder Professor für Volkswirtschaft an der HU oder auf dem Weg zum Arbeitsamt, man kann es von außen einfach nicht sagen.
Ein Berliner versucht nicht den großen Wurf, er versucht den kleinen Wurf, und selbst dieser misslingt ihm. Niemand ist besser darin, tragisch zu scheitern als er. Ein Berliner braucht Dostojewski nicht zu lesen, er muss sich nur mit seinem Nachbarn unterhalten. Er hat keinen Sinn für alles, was keinen Zweck erfüllt. Er fragt immer nur: wat soll dit? Ein Berliner versteht keine Mehrdeutigkeit, man kann nicht subtil mit ihm reden. Diese Wienerische Art, dieser Schmäh, überhaupt Österreich — als Land und Kultur — ist zutiefst unberlinerisch. Ein Wiener in Berlin muss sich seiner ganzen Kultur beraubt fühlen, wie ein Tänzer unter Plattfüßen. Ein Berliner Dichter ist zum Beispiel eine Vorstellung, die so komisch ist, dass man wirklich laut darüber lachen muss. Also die Vorstellung, ein Berliner Poet betritt die Bühne und dichtet, das ist wirklich undenkbar. Das Höchste, was dabei herauskäme, wäre Cabaret. Ein Berliner hat diese gedanklichen Fallstricke einfacher Geister. Etwas, das für ihn total logisch ist (aber in Wahrheit komplizierter) wird von ihm verkündet, laut und bestimmt, wie der Berliner nun einmal ist, und dann muss man darüber lachen, weil es natürlich nicht so einfach ist, aber die Art und Weise, wie er es mit voller Überzeugung ausspricht, ist lustig. Ein Berliner hat die Wahrheit nicht gepachtet, aber er hat einen direkten Draht zu ihr. Niemand ist besser darin, gleichzeitig Recht und Unrecht zu haben als der Berliner.
In Berlin gibt es keinen vorherrschenden Charaktertyp. Dadurch wird der Berliner früh damit vertraut, dass er sich nicht anpassen muss. Der Berliner hat charakterlich immer etwas Kindliches, in der Art und Weise, wie unmittelbar er sein eigenes Befinden kundtut. Es fehlt das gesellschaftliche Element in seinem Charakter. Der Berliner wird in keine Gesellschaft eingegliedert, sein Charakter bleibt roh und ursprünglich. Und dann wächst er auf in dieser Stadt, in der jeden Tag die wildesten Dinge passieren. Der Berliner saugt die Geschehnisse auf, das Wilde und Ursprüngliche resoniert und klappert in seinem wilden, ursprünglichen Charakter. Es kommt zur Steigerung seines existierenden Charakters, und zur Bildung neuer Facetten. In seinen ursprünglichen Charakter hinein bilden sich zunehmend die Exzentriken, die ihn später auszeichnen werden. Was der Berliner erlebt, das dringt in seine Seele ein, und dort klingt es von den Wänden, wie Echo in Tropfsteinhöhlen. Der Berliner erlebt die Stadt nicht wie einen Ort, an dem er lebt, sondern wie dieses wilde, ursprüngliche Wesen, das in ihm rumort. Er muss sich nicht anpassen, um in der Stadt zu bestehen. Das hat seine guten Seiten, und seine schlechten Seiten. Die guten Seiten bestehen darin, dass der Berliner authentisch ist. Ein Berliner kann sich nicht verstellen, er weiß gar nicht, wie das geht. Der Berliner behält seinen ursprünglichen Charakter, den er der ganzen Welt präsentiert. Gefragt und ungefragt, und dort beginnen dann auch die schlechten Seiten. Ein Berliner kann nicht mit sich haushalten. Es gibt ihn nur ganz oder gar nicht. Die einzige Art, wie sich ein Berliner zurückhalten kann, ist, wenn er gar nichts sagt. Sobald er spricht, feuert er die ganze Salve seines Charakters. Wenn er sich der Situation anpassen muss, dann hat er immer etwas Tragisches. Er will professionell klingen, aber das macht ihn eigentlich nur tragischer. Wenn die Situation eine andere Verhaltensweise verlangt, dann scheitert der Berliner an ihr, und zwar mit wehenden Fahnen. Er versucht es, aber schon nach wenigen Worten wird deutlich, das wird hier heute nichts.
Der Berliner ist ein Meister darin, unangenehme Situationen zu erzeugen, die er selbst nicht als unangenehm erkennt. Es fällt ihm nicht einmal auf, weil er nicht dazu in der Lage ist, die Situation neutral zu betrachten. Ein Berliner abstrahiert nicht, am wenigsten von sich selbst. Man muss die Berliner Gesprächssituation annehmen. Diese ist persönlich und ehrlich, aber immer ein bisschen hemdsärmelig. Der Berliner versteht nicht, dass unterschiedliche Situationen unterschiedliche Verhaltensweisen verlangen. Genau genommen hat er ja recht, eigentlich sollte es nicht so sein, aber es ist nun mal so, man spricht auf der Behörde nicht wie am Kiosk. Der Berliner schon. Der Berliner spricht immer gleich. Mit einem Berliner gibt es kein Abtasten, man steigt direkt thematisch ein. Was der Berliner gerade denkt, das verrät er dir. Was er von deiner Antwort hält, das verrät er dir als nächstes. Mit einem Berliner muss man alle Konventionen der Gesprächskultur vergessen. Er beginnt jedes Gespräch mit einem Fazit. Der Berliner ist immer der Elefant im Raum. Er ist der Einzige, der das Unangenehme der Situation nicht versteht. Tragisch ist das, weil er selbst die unangenehme Situation erzeugt. Also ist er nicht nur der Elefant im Raum, sondern auch noch der Elefant im Porzellanladen. Er verwendet im professionellen Gespräch kindlich naive Floskeln. Er spricht in der Ich-Form, wo es sich überhaupt nicht gehört („Ich sag’ mal so…“). Die Vokabeln, die er verwendet, sind sympathisch, aber nicht wirklich der Situation angemessen. Ein Berliner spricht immer gleich, in der U-Bahn wie beim Bewerbungsgespräch.
Alle Berliner teilen den Berlinerischen Charakter, aber jeder Berliner interpretiert ihn auf seine Weise. Der Berliner weiß: Charakter hat man nicht, Charakter ist man. Der Charakter wird in Berlin weniger geschliffen und geformt. Im Grunde wird er überhaupt nicht geschliffen und allenfalls verformt. Die Stadt lässt die Berliner sein, wie sie sind, nicht weil sie sie liebt, sondern weil sie sich gar nicht für sie interessiert. Berlin ist eine Narzisstin, das ist das Urproblem der Stadt. Die Stadt liebt sich selbst zu sehr, sie hat keine Liebe übrig für ihre Bewohner. In anderen Städten kommt es zu einer stärkeren Einflussnahme auf den Charakter jedes Einzelnen. In Berlin darf man tun, was man will. Man freut sich darüber, bis man die Kehrseite kennenlernt. Nämlich dass jeder tut, was er will. Die Stadt wirkt nur indirekt auf den Charakter ihrer Bewohner ein. Sie ist wie ein spezielles Gewürz, das man einem Gericht hinzufügt, wie Koriander. Wenn man Koriander schmeckt, dann weiß man, aha, asiatische Küche. Ähnlich ist es mit dem Berliner Charakter. Man schmeckt das Berlin immer heraus. Aus jedem Satz, und jedem Wort. Aus der bloßen Tatsache, dass gesprochen wird, wo andere schweigen. Nirgends trifft der Spruch mehr zu: Man kriegt das Kind aus Berlin, aber nicht Berlin aus dem Kind. Ein Berliner erhält immer lebenslänglich. Die Stadt hat ihm ihren Stempel aufgedrückt. Zum rohen Charakter des Berliners gesellt sich der rohe Charakter der Stadt. Ein Unglück kommt selten allein. Aber das hat zur Folge, dass sich extreme Eigenschaften weiter verzerren. Berlin hat so ein Talent zur Eskalation. Egal wie schlimm es kommt, die Stadt macht es schlimmer. Sie schlichtet nicht, sondern sie ergötzt sich am Feuer. Sie liebt es, wenn die Berliner sich wieder aufeinander stürzen. In Zuneigung wie in Ablehnung. Auch das weiß der Berliner: Man liebt, wie man hasst. Beim Berliner immer mit der Seele.
Jeder Berliner zeigt explizite Spuren der Stadt Berlin. Diese Verbindung ist an wenigen Orten so prägnant wie in Berlin. Die Stadt formt ihre Bewohner nicht, denn es gibt keine Form, oder Norm, der sich der Berliner anpassen muss. Gleich ist man in seiner Andersartigkeit. Es gibt keinen kollektiven Geist in Berlin, es gibt überhaupt keinen Geist in Berlin. In Berlin hat jeder seinen eigenen Geist. Aber dieser Geist ist wiederum stark Berlinerisch, und er erreicht seinen Horizont kurz hinter Spandau. Berlin kümmert sich um alle Berliner gleichzeitig, aber um niemanden im Speziellen. Man wird von der Stadt gleichzeitig geliebt und ignoriert. Diese eigenartige Verbindung sorgt dafür, dass man fast schon ein Stockholm-Syndrom zur Stadt entwickelt. Jeder echte Berliner empfindet eine Hassliebe für die Stadt. Er liebt sie aufrichtig, und er hasst sie aufrichtig. Nichts macht der Berliner lieber, als darüber zu sinnieren, warum er noch in der Stadt lebt — nur um danach nichts, aber überhaupt nichts an seiner Lage zu verändern. Die Stadt hat ein seltsames Verhältnis zu ihren Bewohnern, die sie einerseits stark prägt, für die sie sich andererseits überhaupt nicht interessiert. Berlin steht in keiner persönlichen Verbindung zu den Berlinern, die Verbindung ist eher kollektiver Natur. Das ist das Kuriose. Individuell sind wir alle anders, aber im Kollektiv ähneln wir uns in unserer Berliner Art. Äußere Einflüsse existieren überall, aber in Berlin fühlt es sich an, als wäre der Spagat größer. Einerseits völlige Indifferenz der Stadt uns als Individuen gegenüber. Andererseits starker Einfluss der Stadt auf alle Berliner im Kollektiv. Daraus ergibt sich die charakteristische Verbindung aus Unterschiedlichkeit und Ähnlichkeit der Berliner. Die Berliner sind einzigartig, aber in ihrer Einzigartigkeit einander ähnlich.
Gräfe
Mitten in Kreuzberg hat sich eine Parallelgesellschaft gebildet. Die Menschen, die hier leben, kommen nicht von hier. Sie passen sich nicht an, sie verkehren in ihren eigenen Zirkeln. So sieht es also aus, wenn Integration nicht gelingt. Die hiesige Bevölkerung hat sich völlig abgekoppelt von den Werten des Bezirks. Auf den Straßen herrscht pure Anarchie. Annika fährt mit ihrem Holzdreirad ins neu gepflanzte Blumenbeet. Brennpunkt Gräfestraße. Hier leben sie. Die Gutbürgerlichen. Oder wie man sie liebevoll nennt: die Yuppies. Die Yuppies fühlen sich schon wie richtige Kreuzberger. Die Frage muss erlaubt sein: was darf Satire? Die Gräfestraße ist die Enklave des deutschen Auslands in Kreuzberg. Hier hört man, was man woanders in Kreuzberg nahezu nie hört: deutsche Dialekte. Aber an Orten wie diesen sieht man eben, was passiert, wenn man die echten Berliner aus der Stadt verdrängt. Man verdrängt die Berliner Kultur. Diese Entwicklung kann man überall in Berlin nachvollziehen. Mitte war mal anders, und das Gleiche gilt für Prenzlauer Berg. Prenzlauer Berg, das war früher mal ein Berliner Bezirk. Heute ist das nur noch ein Bezirk in Berlin. Vielleicht sind es am Ende doch die Berliner, die ihre Bezirke machen. Wenn man nach Kreuzberg zieht und sich integriert, dann spricht überhaupt nichts dagegen. Aber die Yuppies tun das nicht. Man kann darüber lachen, aber es ist wirklich so. Die Yuppies integrieren sich nicht.
Wenn die Yuppies nach Kreuzberg ziehen, dann hat es immer etwas von Katastrophen-Tourismus. Es fehlt eigentlich nur die Warnweste. Die Yuppies stampfen in Berlin ihre bürgerliche Kultur aus dem Boden, und diese verdrängt die echte Berliner Kultur an die Stadtränder. Nirgends ist das auffälliger als in Mitte und Prenzlauer Berg. Dort fühlt es sich wirklich an, als wäre eine ganze Generation echter Berliner verschwunden, und mit ihnen das echte Berlin. Berliner ist man, wenn man sich Berlin anpasst, nicht wenn man Berlin sich anpasst. Die Yuppies wollen ein bürgerliches Leben führen, aber sie wollen es am Kotti führen. Das ist der Vorwurf. Nicht dass sie herkommen, sondern dass sie ihr Dorf mitbringen. Mit welchem Geltungsdrang entscheidet man sich eigentlich, ein spießbürgerliches Leben am Kotti zu führen? Die Yuppies ziehen nach Kreuzberg, weil Kreuzberg cool ist, und sie erhoffen sich davon, cooler zu werden. Das ist natürlich eine Milchmädchenrechnung, denn die Yuppies bleiben langweilig, und das Einzige, was sich verändert, ist, dass der Bezirk langweiliger wird. Die wahre Gefahr ist nicht, dass Kreuzberg ein rechtsfreier Raum wird, sondern dass Kreuzberg ein langweiliger Raum wird. Die Yuppies sind die Fahnenträger dieser Entwicklung. Die Gefahr ist, kulturell gesprochen, dass Kreuzberg irgendwann ein bürgerlicher Bezirk wird. Diese Befürchtung ist nicht irrational, denn man kann sie überall in Berlin nachvollziehen. Die Entwicklung Kreuzbergs, weg von dem, was Kreuzberg ist, hin zu einem bürgerlich-langweiligen Bezirk, geschieht heimlich, schleichend, eine Mietpartei nach der anderen.
Kultur ist in einer Gesellschaft immer ein gegenseitiger Prozess. Die Kultur inspiriert die Menschen, und die Menschen schaffen Kultur. Dieser zweite Schritt bleibt bei den Yuppies aus. Der neue Typus zehrt die Berliner Kultur nur auf, ohne etwas zu ihr beizutragen. Hier entsteht keine neue Kultur, es wird nur die existierende Kultur zum Gegenstand der eigenen Unterhaltung gemacht. Aber eine Kultur stirbt, wenn die Menschen sie nicht mehr aktiv betreiben, wenn sie nur noch ein Ding ist, das man konsumiert. Die Berliner Kultur sieht sich heute immer häufiger mit ihrer absoluten Umkehrung konfrontiert, einer in Wahrheit völlig unberlinerischen Kultur. Berlin ist zum Beispiel eine klassenlose Gesellschaft, und das ist eine der Besonderheiten der Stadt. Die neue bürgerliche Kultur ist alles, nur keine klassenlose. Hier gibt es, ganz klassisch, die etablierten Schichten, die man aus dem deutschen Ausland kennt. Es gibt Oben, es gibt die Mitte, und es gibt Unten. Bürgerlich-akademisch, gesellschaftlich-mittelschichtig, und protelarisch-arm. Mit den Yuppies entstehen Schichten in Berlin, die es hier nie gegeben hat. Das ist ein Verlust der Berliner Kultur, deren ausdrückliche Stärke darin besteht, dass sie Unterschiede aufhebt und die Menschen in einer klassenlosen Gesellschaft vereint. Berlin ist auch geprägt von der Vielfalt der Kulturen. Aber die internationale Kultur ist schon darauf angewiesen, dass die Menschen aus diesen Kulturen in der Stadt leben können. Die neue Kultur, die hier entsteht, ist fast ausschließlich gutbürgerlich-deutsch. Sie ist nicht vielfältig, sondern einfältig. Das Internationale rückt an die Ränder, erst an die Ränder der Stadt, dann an die Ränder der Kultur. Die kulturelle Vielfalt reduziert sich dann darauf, dass die Spätis von Türken betrieben werden und dass man an der Ecke mexikanisch essen gehen kann. Aber das ist keine kulturelle Vermischung, es ist das Gegenteil. Es ist eine Segregation. Das Yuppies schaffen sich in Berlin eine Insel bürgerlich-deutscher Unterhaltungskultur, und das Internationale verkommt zum Vehikel dieser bürgerlichen Unkultur. Es ist keine Begegnung auf Augenhöhe, sondern eine Dienstleistungskultur. Denn das ist der Unterschied: der Späti ist noch da, aber der Inhaber wohnt nicht mehr im vierten Stock desselben Hauses, sondern in Wittenau. Im vierten Stock wohnt jetzt das gutbürgerliche Pärchen, das abends zum Mexikaner geht, aber wie zu einem Dienstleister. Es macht eigentlich eine Karikatur aus der internationalen Berliner Kultur. Darum ist es ambivalent, wenn die Yuppies von der Internationalität der Stadt schwärmen, die durch ihre eigene Anwesenheit ausgetrocknet wird. Kultur wird dann zu einem bloßen Konsumprodukt einer sich amüsierenden Bourgeoisie. Dann kann man sagen, dass es gar nicht wahr ist, dass das neue Publikum die Internationalität nur ausnutzt, schließlich hat unser bürgerliches Pärchen eine freundschaftliche Beziehung zu Luis, dem mexikanischen Koch von der Ecke. Aber diese Beziehung ist natürlich keine auf Augenhöhe, es ist eine Käufer-Verkäufer-Beziehung. Luis ist Dienstleister, und das bürgerliche Pärchen nimmt eine Leistung in Anspruch. So wird aus Kultur Konsum, und so stirbt eine Kultur. Jede Kultur stirbt so, indem das, was sie auszeichnet, nicht mehr atmen kann, weil die Kultur nur noch eingeatmet wird, von Bürgerlichen, die keine Kultur ausatmen. Das Internationale verkommt zu einer Attraktion, aber es schafft keine neuen Reize mehr, während es zunehmend zur reinen Konsumsache degradiert wird. Berlin wird zum Produkt, und das darf natürlich niemals passieren. Weil Berlin alles ist, aber kein Produkt. Berlin ist eine der reichsten und tiefsten Stadtkulturen der Welt. Jeder kennt Berlin. Jeder schwärmt von Berlin (mit Ausnahme der Deutschen). Wenn Berlin zu einem Produkt wird, dann verliert die Stadt ihren Charakter, und darum ist der Kulturkampf in Berlin eine reale Angelegenheit.