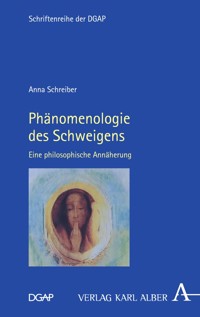Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Versus
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: allerArt / Ein Imprint im Versus Verlag
- Sprache: Deutsch
"Mein erster Kunde: ein Mann um die vierzig. Mein letzter Kunde: ein Monteur im Hinterzimmer eines Striplokals. Dazwischen: zwei lange Jahre als Hure, Hunderte 'Kunden' - Extremerlebnisse. Ich habe in manchen Phasen meines Lebens weder gewusst, ob ich aus der 'Nummer' lebend herauskommen kann, noch es für möglich gehalten. Diese Erinnerung ist in mir stets wach und lebendig. Sie wirkt in mir wie ein Mahnmal, denn es hätte alles auch anders kommen können." Dreißig Jahre später, als Psychotherapeutin, blickt Anna Schreiber zurück auf Not und Schicksal in der Prostitution - auf ihr eigenes Leben. Mit ihrer Erfahrung und ihrem Wissen gelingt es ihr, die verborgene Dynamik des käuflichen Sex aus der Sicht der Prostituierten wie auch des Freiers deutlich werden zu lassen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 319
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anna Schreiber
Körper sucht Seele
Anna Schreiber
Körper sucht Seele
Eine Psychotherapeutin blickt zurückauf ihre Zeit als Prostituierte
Mit einem Geleitwortvon Eugen Drewermann
Inhaltsverzeichnis
Geleitwort von Eugen Drewermann
Vorwort
Wie alles begann
Zeitsprung
Innensicht
Es fängt arglos an
Überschreiten ihrer eigenen Grenzen
Das Gefühl „falsch“
Heutige Sicht
Das Erleben des Getrennt-Seins
Die Trennung ist eine Illusion
DER ERSTE FREIER
Zeitsprung
Außensicht
In roten Stiefeln in die Hände fremder Männer
„Geschäftstreffen“ zum Sex gegen Geld
Innensicht
Der männliche Blick auf „käufliche“ Frauen
Ausgleich durch Geld
Das erste Mal – eine unheilvolle Initiation
Geld für „verrichtete“ Sexualität
Heutige Sicht
Die unheilvolle Verbindung von Sex und Geld
Sexualität: Dienst am Leben versus Ort der Grausamkeit
DIE AGENTUR
Zeitsprung
Außensicht
Im idyllischen Dorf
Ein verklemmter Mann und der neue Ton
Eine gewisse Alltagsroutine
Innensicht
Prostitutionsname
Die Bordellbetreiberin
Bezahlt wird das Sich-auf-den-Mann-Einstellen
Der Mythos der Freiwilligkeit
Der Mann sagt, was er „will“ – die Prostituierte gibt, was er „braucht“ – zwei Beispiele
Die Erregung des Mannes am Widerstand der Frau
Fragen nach dem Privatleben
Dissoziation
Der Prostitutionsverdienst – zwischen Stolz und Scham
Loyalität der Frauen untereinander
Alkohol
Verachtung
Heutige Sicht
Die Sehnsucht des Mannes und Pornografie
Pornokonsum und seine Auswirkungen
ESCORTSERVICE UND HAUSBESUCHE
Zeitsprung
Außensicht
Escortservice
Hausbesuche
Fürst Metternich
Der Flugmodellkonstrukteur
Begleitung in Clubs
Paar ordert Paar
Innensicht
Warum ein Callgirl in der ehelichen Wohnung
Wie Prostitution die Ehe erhält
Warum Kontakt gefährlich ist
Die Frau als schmückende Beilage – der Hedonist
Ein geliebter Mensch darf keinen Sex gegen Geld machen
Heutige Sicht
Männer machen Prostituierte
Die Not der Männer, ein Tabu: Um Not zu lindern, müssen wir die Not derer verstehen, die sie verursachen
Die unerfüllte Sehnsucht des Mannes nach der Frau
Sehnsucht und Liebe
Intuition und intersubjektive Wahrnehmung
Paardynamik der Abweisung
Wenn der eigene Mann zu einer Prostituierten geht
Weibliche Selbstabwertung und Fehlannahmen
GEFAHR UND RETTUNGSVERSUCHE
Zeitsprung
Außensicht
Wohnwagen
Devot
Ich finde meinen Körper nicht mehr
Eine Lösung muss her: Telefonsex
Eine Lösung muss her: Strip, Bar und Séparée
Eine Lösung muss her: Anspruchsvoller Club
Das letzte Mal
Innensicht
Devote Szenerie
Harmlose Unterhaltung in harmlosen Etablissements?
Heutige Sicht
Prostitution: ein Beruf wie jeder andere?
Wenn äußere Verurteilung verinnerlicht wird
Innere Unvereinbarkeit – am Beispiel der On-off-Beziehung
DIE DOMINA
Zeitsprung
Außensicht
Outfit einer Domina
Ich lerne schnell
So kann es nicht weitergehen
Nie wieder Geld für Sex – es hört auf
Innensicht
Definitionen
Aktuelle Mediendarstellung
Wirkung der medialen Darstellungen
Der zahlende Mann bestimmt – auch hier
Was sucht ein Mann bei einer Domina?
Macht und Unterwerfung
Domina – auch ein Faszinosum für Frauen
Heutige Sicht
Begriffsklärungen
Nicht unsere Schwäche fürchten wir, sondern unsere Kraft
Unsere weibliche Göttinnennatur
In der Sexualität dem Mann als Göttin begegnen
DER WEG DES HEILENS
Zeitsprung
Die Heilung
Heilung geht den Weg über Verletzung
Nichtverurteilen heilt
Meine Heilungsräume und -wege
Heilungsraum: Klarheit
Heilungsraum: Liebesbegegnungen
Heilungsraum: Öffentlichkeit
DAS GUTE, DAS IST
Die Prostituierte als Lehrende
Die Prostituierte ist stolz
Die Prostituierte ist mutig
Die Prostituierte ist außergewöhnlich
Die Prostituierte weiß sich begehrt
Die Prostituierte verfügt über Wissen
Die Prostituierte kennt ihren Wert
Die Prostituierte zeigt sich
Die Prostituierte kennt Lösungen
Was mich die Prostitution gelehrt hat
Lust und Leid fließen ineinander
Dankbarkeit
Wie kostbar ist das Leben
Ich verneige mich tief vor dem Leid der Menschen
Die Tiefe männlicher Liebe
Ich achte die Weiblichkeit in ihrer Fülle
Wir sind lebenslang Lernende, Übende, Erforschende
Wir sind im Liebesdienst
Gewahr werden – manchmal bleibt nur das
Unser Körper als Eintrittspforte
Dank
Nachweis der Quellen
„Stark wie der Tod ist die Liebe,
die Leidenschaft ist hart wie die Unterwelt.
Ihre Gluten sind Feuergluten,
gewaltige Flammen.
Auch mächtige Wasser
können die Liebe nicht löschen,
auch Ströme schwemmen sie nicht weg.“
(Hoheslied 8,6–7)
Geleitwort von Eugen Drewermann
Wenn eine ehemalige Prostituierte beschreibt, was sie erlebt hat, erwartet man Erregendes, Aufregendes, Enthüllendes – die Fortsetzung erlittenen Leids durch Selbstveröffentlichung. Dies Buch ist anders. Es glaubt an die Liebe; und es findet sie selbst noch in den bizarrsten Formen des Begehrens, des Entbehrens, des Entehrens wieder.
Was sucht denn jemand wirklich, der „es“ sich für Geld besorgen lässt? Anerkennung sucht er, Gemochtsein sucht er, Bestätigtwerden sucht er – und verhindert es, indem er, was ihm als Person so wichtig ist, in eine käufliche Ware verwandelt. Er bestätigt das Gefühl des eigenen Unwerts, indem er seinen Wert abhängig macht von der Entwertung eines anderen.
Damit, ob er es weiß oder nicht, wird er selber ein Abhängiger. Er bekommt nie, was er sucht. Er wird ein Süchtiger. Er betrügt sich selbst. Er glaubt, seine Freiheit und Macht zu genießen, während er in Wahrheit ein Getriebener ist, ohnmächtig ausgeliefert dem Verlangen nach einer Erfüllung, die ihn immer mehr entleert. Was er als Liebe kauft, ist eine Hülle ohne Inhalt, ein kurzzeitiges Illusionstheater, das vielleicht ein wenig seine Sinne, niemals seine Seele zu befriedigen vermag. Und er bezahlt nicht nur mit Geld, er zahlt auch ein mit Schuld- und Schamgefühl und nicht zuletzt mit Einsamkeit und Selbstentfremdung. Die Rechnung, die da aufläuft, wird mit der Zeit schier unbezahlbar.
Was aber macht es mit der Frau, die für Geld „sowas“ mit sich machen lässt? Davon vor allem erzählt dieses Buch, aus persönlicher Erfahrung, in Beobachtungen, wenn „es“ geschieht, in Reflexionen über die Bedeutung des Geschehenen, in Rückblicken auf das, was damals war, und im Hinblick auf das, was es in der Gegenwart an Spuren hinterlassen hat.
In der Gegenwart ist die Autorin Psychotherapeutin, und um sich dahin zu entwickeln, musste sie die Zeit als Prostituierte einer ehrlichen Analyse unterziehen. Wie wird jemand eine „Käufliche“? – Nein, nicht in Selbstbestimmung und in freier Berufswahl. Sie hat keine Wahl. Sie hat einen Mann, den sie für ihren Retter hält und wirklich liebt und der sie doch nur schamlos ausnutzt, sie hat ein Kind, für das sie sorgen muss und dem sie niemals sagen kann, womit sie ihren Unterhalt verdient. Auch sie betrügt sich selbst. Auch sie ist eine innerlich wie äußerlich Getriebene. Wie hält sie durch, wenn sie sich hinhält?
Sie muss ihre Gefühle abspalten, sie muss darstellen und sein, was sie weder empfindet noch ist, sie muss ihre Seele aus dem Körper zurückziehen, bis er nur noch seelenlos bedienbar und bespielbar wird. In einer Berufsausübung ohne Berufung, in der ständig von Liebe die Rede ist, darf die Berufsausübende keinerlei Liebe mehr verspüren – es brächte sie um; denn es holte ihre Seele zurück, es brächte ihre Persönlichkeit wieder zum Vorschein. Das darf nicht sein, wenn es weitergehen soll. Nur: es geht nicht weiter.
Irgendwann wird der Ekel vor der Berührung, die keine ist, nur eine mit Geld kaschierte Gewalt, bis in die Symptombildungen des Körpers hinein unüberwindbar. Anna Schreiber hat dieses Gefühl immer höher getrieben und immer mehr an den Rand; um nicht mehr angefasst zu werden, floh sie als „Tänzerin“ auf die Bühne und als „Unterhalterin“ ins Séparée; schließlich wurde sie „Domina“, um Menschen zu beherrschen, die sie zur Sklavin der eigenen Selbstversklavung machten.
Es ist, als wenn die Wände der Seele durch den Druck ständiger Dissoziationen immer weiter auseinandergepresst würden und dazwischen ein Vakuum sich bildete, das keine Luft zum Atmen mehr enthält. Was rettet vor dem langsamen Ersticken?
Eigentlich nur dies: die Wahrheit und die Liebe. Doch wie kann man sie glauben in einer Welt der Lüge und Lieblosigkeit?
Was dieses Buch so faszinierend und in eigentlichem Wortsinne notwendig macht, ist das Verstehen, das es als Leitmotiv durchzieht. All das als unheilvoll Erlebte fügt sich zusammen, heilt und reift hindurch zu seiner Schönheit, Selbstachtung und Güte, weil es in allem und trotz allem niemals auch nur im Ansatz darum geht, in Klagen und Anklagen zu versinken. Es geht um Begreifen und Durcharbeiten, nicht um Urteilen und Verurteilen, um Wertungen und Abwertungen, um Anwürfe und Vorwürfe. Wohl: „Männer machen Prostituierte“, doch was machen Frauen mit Männern?
Statt zum „Kampf der Geschlechter“ aufzurufen, bestimmt dieses Buch die Einsicht, dass Männer und Frauen gerade infolge ihrer Unterschiedenheit einander brauchen, um sich zu ihrer Einheit zu ergänzen. Nicht von Schuld ist die Rede, sondern von Not, von Ausweglosigkeit, von Tragik und Verzweiflung. Es ist eine Ebene der Betrachtung, die das moralisierende Naserümpfen ebenso hinter sich lässt wie die gesellschaftliche Heuchelei mit ihrem Bestreben, die Urstromtäler der Liebe in ein gesetzlich geregeltes Kanalsystem für leistungsüberfrachtete Lastkähne zu verwandeln. Heilung ist nur möglich durch vorurteilsfreies Akzeptieren. Wer wüsste, wer benötigte das nicht so sehr wie jemand, der vollkommen draußen steht – außerhalb seiner selbst, außerhalb der Gesellschaft, außerhalb der Gemeinsamkeit, die er, wie jeder, braucht zum Leben?
Mit Absicht führt das Buch hin zu der Szene im Johannesevangelium, da die Schriftgelehrten eine Ehebrecherin zu Jesus bringen, die sie auf frischer Tat ertappt haben – ihre Schuld ist erwiesen, und nach Maßgabe des Gesetzes gehört sie dafür getötet durch Steinigung. So soll denn doch derart verfahren, meint Jesus, wer selber ohne Schuld erfunden wird. Wir alle leben nur, weil uns vergeben wird, doch selber können wir nur vergeben, wenn wir beginnen zu verstehen.
Dafür wirbt nicht dieses Buch, davon ist es überzeugt und davon überzeugt es jeden, der es liest. Man kann nur wünschen, dass es viele sind. Denn es umgeht die falschen politischen Fragestellungen: Soll man Prostitution als ein normales Gewerbe freigeben oder als Straftat kriminalisieren? Wer begreift, wovon er beim Wort Prostitution spricht, kann nur wünschen zu helfen, und Gesetze können nicht heilen, Verordnungen nicht das Herz eines Menschen ordnen; helfend und heilend ist einzig die Liebe.
Weil es eine Hymne ist auf die Liebe, gehört dieses Buch in die Hand so mancher Frau, die sich von ihrem Mann betrogen sieht, so manchen Mannes, der sich mit seiner Frau nicht mehr versteht, so manchen Mädchens, das inmitten seines Elternhauses sich verwaist und heimatlos vorkommt, so manches Jungen, der in den Pornodarstellungen auf seinem Handy Lust und Befriedigung zu finden hofft.
Es ist ein Buch, ergreifend subjektiv geschrieben, und doch gerade deshalb allgemeingültig in seiner objektiven Wahrheit. Es destilliert aus einem Meer von Leid das Heilmittel der Liebe, und das in einer feinen, scharfsinnigen, nie sentimentalen, doch emotional dichten Sprache. In den „Sachbüchern“ sonst läse man Auswertungen von Statistiken des Sexualverhaltens bei Menschen und Primaten, erführe etwas vom neuesten Stand der neurobiologischen Forschungen über die Ausschüttungen von Hormonen und die Wirkungsweise bestimmter Hirnareale – man lernte da manches; hier von alledem nichts. Hier lernt man der Sehnsucht zu folgen. Hier lernt man dem eigenen Herzen zu glauben. Hier lernt man zu lieben. Es ist kein Sachbuch. Denn Menschen, Gott sei Dank, sind nicht mehr länger Sachen.
Dr. Eugen Drewermann
Theologe und PsychotherapeutPaderborn, im Juni 2018
Vorwort
Es gibt immer ein Vorher.Vor dem Anfang gibt es ein Vorher.Jede Geschichte hat ein Davor.
Keine Frau kommt als Prostituierte auf die Welt.
In diesem Buch berichte ich über eine Zeit vor mehr als drei Jahrzehnten, in der ich als Prostituierte gearbeitet habe, und darüber, wie ich heute – im Alter von siebenundfünfzig Jahren – diese Zeit sehe. Ich beschreibe, wie ich sie im Inneren und im Äußeren erlebt habe. Ich versuche die Mechanismen und verdeckten Dynamiken der Prostitution verständlich zu machen, nicht nur theoretisch, sondern an einem konkreten – an meinem – Leben.
Jede Prostituierte hat eine Geschichte, wie sie zur Prostitution gekommen ist. Bei vielen Frauen gibt es eine direkte, unmittelbar der Prostitution vorausgehende Gewalt: Die Frau wird vergewaltigt und danach zur Prostitution gezwungen. Hier scheint es auf den ersten Blick klar, dass Männer Prostituierte „machen“, denn die Gewalt und der Zwang sind offensichtlich. Anders ist es bei Frauen, die sich vermeintlich freiwillig prostituieren. Hier ist kein Mann sichtbar, der sie zwingt, keiner hat ihnen die Ausweispapiere weggenommen. Sie könnten einfach weggehen, könnten jederzeit aufhören. Wie kommt eine solche Frau also dazu, sich zu prostituieren?
Prostitution ist Not und Schicksal.
Prostituierte werden „gemacht“ – durch Männer. Wenn wir die Not der Prostituierten lindern wollen, müssen wir uns auch mit der Not derer befassen, die diese Not verursachen: mit der Not der Männer.
Heute arbeite ich als Psychologische Psychotherapeutin in eigener Praxis, bin glücklich verheiratet, vielfache Großmutter, die beiden zauberhaften Töchter erwachsen. Seit Jahren erlebe ich bei meinen Klientinnen und Klienten so oft, wie weit verzweigt die Wirkungen und Auswirkungen von Prostitution reichen können. Dass es mir nach meiner Zeit in diesem Gewerbe vergönnt war, einen neuen Weg einzuschlagen, hätte ich mir in der Prostitutionszeit nicht mal wünschen können. Damals sah ich eine Zukunft, in der ich spätestens Mitte dreißig auf einem Bahnhofsklo krepiere.
Mein Weg nach der Prostitution führte mich, mit Umwegen und langer eigener Therapie, schließlich zum Psychologiestudium mit akademischem Abschluss. Viele Jahre habe ich als systemische Paartherapeutin gearbeitet, nach einem weiteren Studium wurde mir die ärztliche Approbation verliehen. Seit langem ist mein Lebensrhythmus geprägt von täglicher Zen-Praxis.
Wie alles begann
„Und glaube nicht, du kannst den Lauf der Liebe lenken, denn die Liebe, wenn sie dich für würdig hält, lenkt deinen Lauf.“
Khalil Gibran
Ich wurde mir fremd. Ich wurde mir neu. Ich wurde mir unwirklich. Es war zu spät. Ich gab die Anzeige auf: „Langhaarige Studentin, 20, sucht solventen Herrn.“ Der letzte Schritt vor dem Rubikon. Dass ich mich auch noch zwei Jahre jünger gemacht hatte, spielte jetzt keine Rolle mehr. In den letzten Tagen war mir immer mulmiger geworden. Vor meiner eigenen Courage war ich erschreckt. Jetzt noch einen geordneten Rückzug zu wagen, bevor es zu spät sein könnte, rückte in immer unwirklichere Ferne.
Mein erster Kunde: ein Mann um die vierzig.
Mein letzter Kunde: ein Monteur im Hinterzimmer eines Striplokals.
Dazwischen: zwei lange Jahre als Hure, Hunderte „Kunden“ – Extremerlebnisse.
Das Elend von Verstrickung, irrigen Vorstellungen über Liebe und Körperlichkeit, das sich schon in der Kindheit seine ersten Linien bahnte, ist Vergangenheit.
Dieses Buch ist im Grunde ein unvollständiges Buch. Vieles, was ich niedergeschrieben hatte, habe ich schlussendlich wieder gelöscht – zum Schutz von und aus Achtung vor mir nahestehenden Menschen. So sind zum Beispiel die symbiotischen Verstrickungen einer destruktiven und gewalttätigen Beziehungsdynamik nur noch angedeutet.
Es ist meine Geschichte. Ich glaube aber, es ist mehr als nur meine Geschichte. Prostitution ereignet sich nicht einfach so: weder aus Geldgier noch aus Geilheit noch aus Perversion. In all den langen Jahren meiner Praxis als Therapeutin habe ich immer wieder von meinen Klienten gehört, wie verschlungen und verdeckt die Pfade sein können, die sie bis hin zum bezahlten Sex in das Elend der käuflichen „Liebe“ gezogen haben. Wie viele dieser Wege bin ich mit ihnen zusammen gegangen! Oft habe ich in Gedanken meinen eigenen Weg noch einmal durchschritten.
Dieser Weg beginnt Anfang der 1960er-Jahre in gutem katholischem Hause in einer deutschen Kleinstadt. Ein wohlerzogenes Kind. Klavier- und Geigenunterricht, Gymnasium, brav und schön. Das Motto zuhause: „Halte dich immer bedeckt. Zeige dich nicht.“ Möglichst unsichtbar sein. Ich hab’s versucht. Bloß nicht stören. Die Eltern, sie waren mit sich und ihrem beruflichen Fortkommen beschäftigt, sie haben mich übersehen. Ich habe sie nicht stören wollen. Auch nicht, als mich im Kinderzimmer ein Verwandter missbraucht – jahrelang. Meine Tränen, mein verzweifeltes Flehen nach den Eltern waren stumm. Die Tür blieb geschlossen. Keiner hat hingeschaut und hingehört, als Musiklehrer, Nachhilfelehrer und sogar der Religionslehrer dem Weg meines Verwandten folgten. Das Kind war folgsam, stumm – und verzweifelt.
Der Weg in die Prostitution beginnt nie mit einem Schritt über den Rubikon. Aber nach dem Schritt über den Rubikon wieder ein selbstbestimmtes Leben in Glück und Gesundheit zu erlangen, ist ein seltenes Geschenk. Sexuelle Gewalt oder auch emotionale Vernachlässigung werden sehr oft zunächst von der Familie nicht bemerkt, manchmal sogar geduldet, meistens negiert. Der Beginn – und das ist die bittere Erkenntnis meiner langen therapeutischen Praxis – liegt fast immer in der Kindheit. Die Sehnsucht nach Liebe, Zugehörigkeit, Zärtlichkeit, Nähe wird nicht erfüllt und öffnet damit die Einfallstore für sexuellen oder emotionalen Missbrauch, manchmal für Gewalt, oft für Abhängigkeit.
Ich bin vierzehn, im Tanzkurs, verliebe mich. Ein Junge, drei Jahre älter. Ich weiß nichts von seiner Kindheit. Ich weiß nichts von Kindheitstraumata und ihren Folgen. Ich weiß nichts davon, dass sich sexuelle und emotionelle Gewalt häufig fortsetzen. Mein Retter – glaube ich zumindest.
Mit sechzehn sitze ich bei meinem Retter auf dem Rücksitz seines Mopeds. An der Ampel dreht er sich zu mir um und sagt: „Übrigens, ich habe mit deiner Freundin geschlafen.“ Was macht ein braves Kind? Was hat es von den Eltern gelernt? „Zeige dich nicht. Halte dich bedeckt.“ Das sind die Mechanismen. Das sind die Weichen, die immer weiter zum Rubikon führen. Ich heirate meinen Retter mit gerade zwanzig Jahren. Das Abitur in der Tasche, keine Ausbildung, kein Einkommen, aber das Glück eines Kindes. Bei der Heirat bin ich im fünften Monat. Die Ehe bringt meinem Mann deutliche Vorteile: Damals mussten junge Männer noch zum Militärdienst, waren sie verheiratet, wurden sie manchmal nicht einberufen. Mit jedem Schwangerschaftsmonat entfernt er sich weiter von mir und meiner Hoffnung, wie Partnerschaft, Liebe und Wertschätzung zwischen Mann und Frau aussehen könnten.
Die Botschaft aus der Kindheit wirkt übermächtig: Du musst mit deinem Mann zusammenbleiben, bis dass der Tod euch scheidet. Egal, was geschieht, egal, was er tut, er ist dein Mann, der Vater deines Kindes.
Solche zementierten, einengenden Glaubenssätze verunmöglichen jungen Menschen oft situationsadäquate Handlungsweisen. Sie lassen sie immer tiefer in ihr Elend treiben. Belastende Kindheits- und Jugenderfahrungen, die wichtige Entwicklungsschritte verhinderten, sind der weitere Treibsand.
Ich muss alleine für unser Kind sorgen. Von der Caritas ein Jahr lang alimentiert. Meine Eltern, mein Mann, sie lassen mich im Stich. Und trotzdem halte ich zu ihm. Fühle mich ihm zugehörig und verbunden. Ich versuche es parallel zu Uniseminaren und Vorlesungen mit dem Verkauf von geklauten Äpfeln, suche irgendwelche Quellen, um das Nötigste für mein Kind und mich zu beschaffen. Irgendwann lande ich mit Kind im Tragetuch auf der Polizeiwache: im Supermarkt ein Pfund Käse gestohlen. Ich habe Glück. Es gibt keine Anzeige. Aber eine junge Polizistin. Sie fragt mich: „Was soll denn dein Kind mal von dir lernen? Dass man klaut?“ Da weiß ich, so geht es nicht weiter. Mein Vater versagt mir seine finanzielle Unterstützung: „Ich zahle doch nicht für das Kind, während dein Mann durch fremde Betten turnt!“
Freie Ehe, Gruppensex, mein Retter war fasziniert von dem, was er als Revolte gegen verkrustete Konventionen verstand. „Zeige dich nicht. Halte dich bedeckt. Gehorche deinem Mann.“ Sex als Konsum. Immer mehr. Immer neue Reize. „Gehorche deinem Mann.“ Sexualität und Geld. Ich brauche Geld. Den Job nachts als Bedienung kann ich nicht durchhalten. Eine Idee, eine Zeitungsanzeige. Der letzte Schritt vor dem Rubikon.
Zeitsprung
Im Haus meiner Eltern hingen im Treppenhaus viele Fotos, schon in meiner Kindheit. Meines Vaters Leidenschaft war das Fotografieren. Vielleicht, weil er ganz dabei sein konnte und zugleich verschwunden, nicht sichtbar. Im Keller hatte er ein Schwarz-Weiß-Labor eingerichtet. Damals wurde noch analog auf Film fotografiert. Wenn die rote Lampe an der Kellertür leuchtete, war das Eintreten streng verboten. Er entwickelte. Alle hielten sich daran. Er war ganz dabei und zugleich verschwunden. Zutritt verboten.
Mein Vater starb vor einigen Jahren. Eine dicke Staubschicht legte sich auf die großen schwarzen Geräte, und als meine Mutter aus dem Haus auszog, blieben einige der Schwarz-Weiß-Fotos hängen. Ich ging noch einmal durch das Haus. Nah und gleichzeitig fremd, weit weg.
Die Schwarz-Weiß-Fotos im Treppenhaus. Sie waren mir auf eigentümliche Weise so vertraut, dass ich sie wie mit dem Treppenhaus verwachsen und nicht mehr als Aufnahmen aus einer anderen Zeit wahrnahm. Plötzlich, wie ich das Mädchen mit ihren ernsten Augen, mit ihrer Weichheit hinter den ernsten Augen ansah, sah ich auch wieder auf die Fotos. Ich sah auf dem Foto eine junge Frau, die auf ihr Kind sieht. Ihr Kopf ist leicht schräg, die langen Haare fallen ihr ins Gesicht, sie hält ihr Kind auf dem Arm, lächelt ihr Kind an, ein kleines Baby, sie stützt den kleinen Rücken mit ihrer Hand, es kann noch nicht alleine sitzen, hält sich schon aufrecht und sieht ins Gesicht der Mutter. Ich erkenne mich. Ich bin die junge Frau. Die Mutter. Wie weich ihre Gesichtszüge sind. Wie kindlich ihr Gesicht. Wie liebevoll sie auf ihr Kind blickt. Ich erkenne mich und falle im selben Moment aus der Zeit – in die Zeit vor der Prostitution.
Ich falle in meine Erinnerung. Ich falle in meine Weichheit. Wie jung ich war. Voller Zuversicht und Zartheit. Unberührt in eigentümlicher Weise. Die Mutter und ihr Kind. Das Motiv der Madonna mit ihrem Kind. Geschützt und zugleich schützend. Geborgen und zugleich bergend. Es ist ein so langer Weg von mir heute bis zurück, bis hin zu dieser weichen, unberührten Zuversicht. Und doch ist der Weg da. Ist das Früher und das Heute in mir verbunden. Wie dankbar ich bin.
Die Augen der jungen Frau sind eine Spur zu ernst, finde ich. Vielleicht ist das aber auch nur meine Fantasie, weil ich um das Kommende weiß. Wie auch immer. Tief berührt hänge ich das Bild ab und trage es nach Hause. Vorsichtig. Wie wenn ihm nichts geschehen dürfte. Wie wenn die junge Mutter mit ihrem Kind mit behutsamen Händen und mit noch behutsamerem Herzen getragen werden müsste.
Der Abzug löst sich etwas ab von der Sperrholzplatte, auf die mein Vater ihn geleimt hat. Vorsichtig entstaube ich die junge Mutter mit ihrem Kind. Vorsichtig befestige ich den Abzug wieder auf seinem Untergrund. Ich mache das Bild langsam mit meiner jetzigen Wohnung vertraut. Ich lasse beide sich langsam kennenlernen. Ich lasse das Bild einen guten Platz suchen. Das dauert. Im Laufe der letzten Monate hat es schon mehrere Plätze gefunden. Es wandert durch meine Wohnung, bewohnt viele verschiedene Plätze, entfaltet verschiedene Wirkungen in meiner Wohnung – so, wie die Verbindung zu meiner Weichheit durch mich hindurchwandert – bis heute. Ich hätte es früher nicht für möglich gehalten, doch ich entdecke immer wieder aufs Neue und immer wieder staunend, wie empfindlich ich doch bin, wie weich, wie unberührt in gewisser Weise, wie kindlich.
Ich bin meinem Vater dankbar für diese Aufnahme von mir mit meiner ersten Tochter. Ich verstehe bis heute nicht, wie er so ganz dabei hat sein können und zugleich so unsichtbar, so nichtsehend. Wie konnte er nicht sehen, was mit seiner Tochter geschah in den kommenden Jahren? Ich kann ihn nicht mehr fragen. Wäre er noch am Leben, ich glaube nicht, dass er mir antworten könnte. Mein Vater hat auch in den folgenden Jahren einige Fotos von mir gemacht. Es gibt wenige, doch es gibt Aufnahmen aus meiner Prostitutionszeit. Die junge Frau bei Familienfeiern, an Weihnachten bei den Eltern. Wenn mir diese Fotos in die Hände geraten, bin ich jedes Mal aufs Neue erschreckt. Wieso hat das denn keiner gesehen? Es ist doch so offensichtlich! Schau doch bitte mal jemand in die Augen dieser jungen Frau! Tief traurig, tief dunkel, tief verletzt und weit entfernt. Schau doch bitte mal jemand auf die Art, wie sie sich kleidet unter dem Tannenbaum! Als wenn sie durch ihre Kleidung hätte sehen lassen wollen, was sie nicht auszusprechen in der Lage war. Sieht denn da keiner hin? Sind denn hier alle nicht anwesend? Ist denn hier überhaupt noch jemand daheim?
Doch kein Bild hat eine annähernd gleich starke Wirkung auf mich wie die Aufnahme der jungen Mutter, die sich über ihr Kind beugt, es liebevoll hält und anblickt. Sehe ich dieses Bild, dann schaue ich gleichsam auf mich selbst, weich und liebevoll, auf die junge Frau, die junge Mutter, auf ihre Zuversicht und ihr Gottvertrauen, auf die Liebe zu ihrem Kind. Ich bin tief dankbar für diese Liebe, die mich getragen hat, die meine Tochter getragen hat, die alles durchwirkt, die bleibt. Die Liebe, die ist.
Innensicht
Es fängt arglos an
Wie lässt sich rückblickend erklären, was von außen so unverständlich ist? Wie konnte die junge Frau – eine junge Frau wie jede andere, und doch nicht wie jede andere – das tun? Wieso hat sie niemand aufgehalten?
Eine junge Frau ist in einer Bedrängnis. Das ist das Gemeinsame vieler Lebensgeschichten von Frauen, die irgendwann einmal als Prostituierte gearbeitet haben. Die Situation ist meist sowohl emotional als auch finanziell bedrängend. Ohne finanzielle Not kommt äußerst selten eine Frau zur Prostitution. Ohne innere emotionale Not auch nicht. Bei mir kam beides zusammen. Ich hatte kein Geld. Ich fühlte mich emotional abhängig von meinem Mann. Er sagte, wo es langgeht, ohne Rücksicht auf Verluste, auf meine Verluste. Ein Leben ohne ihn konnte ich mir nicht vorstellen, nicht denken, nicht fühlen. Die Gründe für diese Abhängigkeit liegen in meiner Biografie. Das verstand ich erst später. In der damaligen Situation hielt ich diese Abhängigkeit für Liebe. So war für mich die folgerichtige Konsequenz, dass ich alles, was mir irgendwie möglich war, tun wollte, um in dieser Beziehung zu bleiben. Was für mich einen Wert hatte, was Treue zu mir war, war mir nicht nur völlig unwichtig, sondern auch unbekannt. Es galt, die Werte meines Mannes zu beachten. Es galt, in innerer Treue zu ihm zu stehen. Natürlich forderte er das auch ein. Natürlich gefiel es ihm auch, doch diese Einstellung brachte ich auch mit. Die mir heute selbstverständliche Klarheit, sich zuvörderst selbst treu zu sein, die eigenen Werte hochzuachten, die hatte ich damals nicht.
Dazu kam meine Sprachlosigkeit, mein Schweigen. Ich war gewohnt, das, was in mir war, für mich und bei mir zu behalten. Alles Innere, so ich es denn zu erfassen vermochte, machte ich „mit mir alleine aus“. Bei aller inneren Not in meiner Kindheit und als heranwachsendes Mädchen war ich bei allen Entwurzelungen und sexualisierter Gewalt in meiner Einsamkeit und Verwirrung allein geblieben. Es war mir so von Kindheit an vertraut, dass erstens das, was in mir ist, völlig abgetrennt und losgelöst von anderen Menschen ist, zweitens niemand es sieht oder versteht und ich drittens Unverständnis und gar Ablehnung erfahre, wenn ich mein Inneres mitteile. Ich war es gewohnt, eine Fassade zu zeigen. Gewünschtes war mir Befehl. Wie die Außenwelt, die wesentlichen Bezugspersonen, mich haben wollten, so verhielt ich mich. Mich über die Maßen anzustrengen und zu verbiegen, um zu gefallen, um dabeibleiben zu dürfen, um zugehörig zu sein, das war mein Normalzustand.
Überschreiten ihrer eigenen Grenzen
Die junge Frau überschreitet ihre eigenen Grenzen. Es fühlt sich für sie stimmig an, ihrem obersten Ziel verpflichtet: die Beziehung zu ihrem Mann um jeden Preis zu erhalten. Doch sie erkennt ihre Zielsetzung nicht als das, was sie ist: eine hochverstrickte, symbiotische Abhängigkeit. Die junge Frau übersieht, sie „überfühlt“ ihren emotionalen Schmerz, ihre innere Not, ihre innere Ausweglosigkeit. Sie verkauft sich ihr eigenes Verhalten als selbstgewählt, selbstbestimmt. Nach außen antwortet sie auf die Frage, wie sie denn damit leben könne, dass ihr Mann andere Frauen habe, mit denen er Tisch und Bett teile, und wie sie selbst mit diesen Frauen gemeinsam in einem Haus leben könne: „Ganz einfach, ist doch nichts dabei.“ Mit dieser Antwort auf eine Frage, die Verstehen sucht, bewirkt sie eine Vergrößerung des Nichtverstehens. Ihr Verhalten ist unverständlich. Ihre Antwort auch. Eine Antwort, die ihr Verhalten verständlicher machen könnte, müsste lauten: „Ich kann nicht anders. Ich weiß es nicht anders.“ Diese Antwort wäre einer Kapitulation gleichgekommen – davon abgesehen, dass die junge Frau diese Antwort nicht in ihrem Bewusstsein hatte, denn sie war dem bewussten Verstehen entzogen, ins Nichtbewusste verdrängt worden.
Mir wurde mit einer Mischung aus Fassungslosigkeit und Bewunderung begegnet. Das gefiel mir. Was mir nicht gefiel, war das, was mein Mann tat, seine anderen Frauen. Es tat mir weh. Ich fühlte mich minderwertig. Ich kam mir als Frau ungenügend vor. Das durfte ich ihm nicht zeigen, denn dann hätte er sich von mir abgewandt. Das durfte ich andere Menschen nicht wissen lassen, denn damit hätte ich meine Abhängigkeit und Ohnmacht eingestanden. Das durfte ich selbst nicht fühlen, denn ich hätte dem Ausmaß meines inneren Ausgeliefertseins nicht standhalten können. So war ich mit meinem Schmerz allein. Meine Angst, Zugehörigkeit und Zuwendung zu verspielen, wenn ich meine Gefühle zeigte oder darüber spräche, war zu groß.
So überschritt ich meine eigenen Grenzen, die Grenzen, die mich hätten schützen sollen. Ich überschritt sie Mal um Mal. Ich war das Überschreiten gewohnt. Von Mal zu Mal nahm ich es weniger wahr. Ich nahm mich immer weniger wahr. Ich verlor meine eigene Wahrheit. Nach innen unerkannt. Nach außen unerkannt. Nach innen als selbstbestimmte Autonomie verkauft, nach außen als selbstbestimmte Autonomie verkauft. Ich verkaufte mich mir. Ich verkaufte mich anderen. Ich verkaufte mich.
Meine Ehe musste ich um jeden Preis aufrechterhalten. Das entsprach meiner familiären und religiösen Sozialisation. Ehebruch ist Sünde. Das galt in meiner Familientradition als in Stein gemeißelt. Ehebruch, so verdreht es klingen mag, bedeutete für mich „tun, was mein Mann nicht will“. So fühlte es sich an in meinem Gewissen. Der Ehemann definiert, was Ehebruch ist und was nicht. Mit dem erklärten Einverständnis meines Tuns durch meinen Ehemann fühlte sich meine „außereheliche“ Sexualität nicht wie Ehebruch an. Ehebruch hätte für mich bedeutet, Intimität mit einem anderen Mann zu leben, heimlich oder gegen den Willen meines Ehemannes. Mit seinem Einverständnis jedoch war mein Tun „ehelich“, damit nicht „sündig“. Aus heutiger Sicht wirkt es für mich völlig abwegig. Doch damals war mein inneres Erleben genau so und in dieser Weise stimmig.
Solch eine unheilvolle Verirrung, dem Willen des Gegenübers statt dem eigenen Gewissen zu folgen, habe ich in den Jahren danach bei den Therapien mit meinen Klienten bei vielen Paaren erlebt. Hat zum Beispiel ein Mann eine Außenbeziehung, unter der seine Frau leidet, so kommt manch einer auf die vordergründig absurde Idee, seiner Frau einen Liebhaber vorzuschlagen. Das eigene schlechte Gewissen soll damit entlastet werden. Angenommen, seine Frau lässt sich darauf ein – denn sie möchte sowohl ihren Mann nicht verlieren als auch ihren eigenen Schmerz beenden –, findet einen Liebhaber und beginnt ein Verhältnis. Der Ehemann ist zunächst erleichtert. Sein „schlechtes Gewissen“, weil er seine Frau betrügt, ist kleiner, denn seine Frau tut ja nun dasselbe. Der Frau geht es zunächst auch besser. Sie erfährt von dem anderen Mann Bestätigung, fühlt sich gewollt, attraktiv und ist darüber hinaus emotional abgelenkt. So weit, so gut. Für die Frau mag sich diese Situation ungewohnt anfühlen, doch empfindet sie sich nicht als Ehebrecherin. Das, was sie tut, geschieht mit dem Einverständnis ihres Mannes. Die Lage kippt genau in dem Moment, in dem die Frau, was nicht selten geschieht, innigere Gefühle zu dem anderen Mann entwickelt, sich diese Beziehung intensiviert. Der Ehemann merkt das früher oder später. Das nun will er nicht. Plötzlich wird aus dem herbeigerufenen, ungefährlichen Liebhaber ein Mann, der ihm in seiner Vormachtstellung gefährlich werden könnte. Genau das ist der Moment, in dem die Frau ein „schlechtes Gewissen“ fühlt. In genau diesem Moment regt sich in ihr ein Gefühl der „Schuld“. Die Frage „Tue ich etwas Verbotenes?“ taucht auf. „Darf ich das, was ich tue?“ Die Legitimation ihres Handelns kommt mit einem Mal auf den inneren Gewissensprüfstand. – Der Mechanismus, der hier greift, ist aus der Systemtheorie heraus gut verständlich: Die Mitglieder eines Systems haben, solange sie die ausgesprochenen oder nicht ausgesprochenen Regeln ihres eigenen Systems einhalten, ein „gutes Gewissen“. Sie verhalten sich regelkonform. Also konform den Regeln ihres eigenen Systems. Dabei ist nicht relevant, ob diese Regeln auch den Regeln anderer Systeme (hier: anderer Paare oder Familien) oder des umfassenderen Systems (hier: Kultur oder Gesellschaft) entsprechen. Das „schlechte Gewissen“ entsteht, wenn ein Mitglied eines Systems (hier: die Frau) sich an den nach außen begrenzenden Rand des Systems begibt oder gar den begrenzenden Rand des Systems überschreitet. Das „schlechte Gewissen“ ist ein Grenzgefühl, das anzeigt, dass ein Mitglied an den Randbereich heran gerät oder über den Rand des Systems hinaus; den Rand, der das eigene System von den anderen unterscheidet.
Die Schritte, die ich damals unternahm, die Handlungen, die ich initiierte, fühlten sich – so merkwürdig das anmutet – richtig und stimmig an. Ich handelte – was unsere Beziehungsgestaltung anbelangte – gemäß den Regeln „unseres“ Systems. Unser System war das meines Mannes. Meine eigene Prüfinstanz, mein eigenes Gewissen, hatte ich bereits verlassen, bevor es sich richtig entwickeln konnte, viele Jahre zuvor.
Das Gefühl „falsch“
Die tiefgreifende Aufspaltung, die meine gesamte Prostitutionszeit durchziehen sollte, stellte sich ein, als ich Geld für Sex bekam. Damit war der Rubikon überschritten. Ein Teil in mir wollte das nicht. Es war ein Gefühl von „falsch“. Diese Wahrnehmung kann ich deutlich unterscheiden von vielem anderen, was ich nicht wollte, weil es mir zum Beispiel weh tat, ich mich ausgeschlossen oder übergangen fühlte. Das Gefühl von „falsch“ ist anders. Nicht das bewusste Wollen stellt sich hier entgegen, auch nicht ein schlechtes Gewissen, es reicht tiefer. Es ist eine ganz tiefe, innere Wahrnehmung, die in die Richtung geht: Das jetzt stimmt ganz wesentlich überhaupt nicht! Die Wahrnehmung ist zugleich tief und sehr fein, wie ein feiner Ton, der leise und hoch zu vernehmen ist. Andere Klänge übertönen ihn leicht. Er verliert sich im Lauten und Vielstimmigen. Um diesen leisen Ton wahrzunehmen, bedarf es der Ruhe und der Stille. Es bedarf der Konzentration und der Suche. Woher kommt er? Was ist das für ein Ton? Ganz stille jetzt. Stehenbleiben. Lauschen. Aus welcher Richtung kommt er? Dieser Richtung leise und behutsam nachgehen. Den eigenen Ohren trauen. Leise auftreten. Behutsam atmen. Dem Ton folgen, beobachtend, in welche Richtung gewandt er langsam lauter und klarer wird. Den Klang finden. Manchmal, in der Stille der Nacht, oder wenn ich in der Natur war, an dem kleinen Fluss, an dem ich oft spazieren ging mit meiner Tochter, in der Geborgenheit des Waldes, vernahm ich diesen feinen Ton wieder. Er machte mich sehr traurig. Er machte mich auch ratlos.
Um im Bild zu bleiben: Mit dem Ton war auch ein Geruch verbunden. Es war ein unangenehmer Geruch, etwas Stinkendes, fauliger Schmutz, es war ein Geruch, der mir einen latenten Ekel verursachte. Dieser Geruch erschreckte mich anfangs. Mit der Zeit gewöhnte ich mich an den Geruch. Er war einfach da. Ich bekam ihn nicht los. Er war nicht über die Nase riechbar, so wie der Ton nicht über die Ohren hörbar war. Ich war mir nicht sicher, ob andere Menschen den Ton hören und den Geruch riechen konnten. Mein Kopf sagte nein, mein Gefühl sagte ja. Es fühlte sich so an, als ob sich der unangenehme Geruch durch mich und um mich herum verbreitete. Auch intensivste Waschungen veränderten ihn nicht. Vielleicht sind Prostituierte deshalb stark parfümiert? So begann ich, mit anderen starken Gerüchen meine Nase zu täuschen, mit lauten Tönen meine Ohren abzulenken. Der Geruch blieb, der Ton blieb. Viele Jahre blieben sie. Lange noch, lange nachdem ich nicht mehr in der Prostitution arbeitete, waren der Geruch des Ekels, der Ton des „Falsch“ noch bei und in mir. Ich fühlte mich dadurch kenntlich gemacht, erkennbar, welcher Sorte Frau ich angehörte. – Irgendwann hatte sich der Geruch verflüchtigt, der Ton war verklungen.
Rückblickend kann ich die Situationen sehr exakt identifizieren, in denen das Gefühl von „falsch“ auftauchte. Doch wollte ich dieses „Falsch“-Gefühl nicht haben. Es passte nicht in mein Bild von mir selbst, nicht in meine eigenen Gedanken über mich. Es passte nicht in meine Idee von mir. Mein Kopf hatte sich ausgedacht, wie ich mich gerne hätte. Diesem Plan entsprechend verkaufte ich mir mich selbst und der Welt im Außen. Ich bemühte mich, mir meine Idee von mir zu glauben. Doch das „Falsch“-Gefühl passte einfach nicht. So begann ich, das Nichtpassende zu eliminieren. Ich schnitt die Wahrnehmungen, die nicht kompatibel waren mit meinen Gedanken über mich, aus und verstaute sie, sorgfältig vor meinem Zugriff geschützt, in Bereichen meiner Psyche, zu denen ich damals keinen Zugang hatte. So störten die diskrepanten Wahrnehmungen meine Idee von mir nicht mehr. Meine Idee von mir passte nun besser. Ich hatte mich „passend“ gemacht. Die Idee von mir lautete ungefähr so: „Ich bin eine selbstbewusste und mutige Frau, die tut, was sie will, und sich in keiner Weise von kleinkariert-spießigen Konventionen einschränken lässt. Das, was sich keine traut, traue ich mich. Ich will meinen Mann behalten, denn wir gehören zusammen. Dafür tue ich alles.“ Ich gab mich nach außen unabhängig, selbst entscheidend, unberührbar. Dieses Selbstbild korrelierte mit meinem bewussten Denken. Ich sagte das nicht nur so, ich dachte es auch. – Anfühlen tat es sich jedoch nur sehr selten so und auch nur sehr schwach. Meistens fühlte ich anders. Doch das sagte ich nicht, noch nicht einmal mir selbst. Mein Denken über mich hatte ich schon passend gemacht. Mein Fühlen indes widersetzte sich noch beständig und widerständig der Stromlinienform. Bald vermochte ich auch mein Fühlen nicht mehr auszuhalten. Die Diskrepanz zwischen Innen und Außen wurde zu groß. Das innere Gefühl wurde zu stark, als dass ich es auch weiterhin hätte nicht beachten können. Es drängte sich unaufhaltsam stärker in meine Wahrnehmung. Ich fühlte mich beschmutzt, ausgestoßen, fremd, einsam, gezeichnet. Da ich mich außerstande sah, mich im Außen anders zu verhalten, musste eine Lösung im Innen her: Ich begann – in meinem vertrauten Muster – das unaushaltbare Fühlen nicht mehr zu fühlen. Ich wusste und verstand nicht, was ich tat, doch ich tat. Was unaushaltbar war, wurde „weggepackt“. Und so wurde es scheinbar und zunächst leichter. Dissoziation ist der psychologische Fachbegriff dafür. Das, was nicht mehr zusammengehalten werden kann, fällt auseinander: Gefühle und Körperwahrnehmungen zum Beispiel, Gedanken und Selbstbild, sind im Wohlfühlzustand in einem zusammengehörigen Miteinander, werden als zu uns selbst gehörig erlebt, können erinnert und benannt werden. Wenn das nicht mehr gelingt, fallen die einzelnen Teile auseinander, manche tauchen ins Unbewusste ab, werden „weggepackt“, manche tauchen als Körpersymptome wieder auf, als Schmerzen, als Krankheiten. Die Dissoziationsfähigkeit meiner Psyche, die ich mitbrachte aus meiner Kindheit, die mir damals schon mein psychisches Überleben gesichert hatte, begleitete und „beschützte“ mich nun wieder. Das Nicht-Aushaltbare wurde von mir immer weniger gefühlt. Es war ein langsamer Prozess, der sich auf immer mehr Bereiche ausdehnte. Mit dem ersten Geld, das mir für Sex bezahlt wurde, begann der Dissoziationsprozess sich in einem neuen Feld auszubreiten. Es war mir möglich, in meinem Bewusstsein das zu denken, was ich denken wollte. Es wurde mir möglich, mich selbst glauben zu machen, das, was ich tue, wolle ich. Die Dissoziation schützte mein Bewusstsein vor der Wahrnehmung des sich ausbreitenden Ekels, vor der Wahrnehmung der inneren Ausweglosigkeit, der emotionalen Abhängigkeit, der Enge, Hilflosigkeit und Einsamkeit. Die Dissoziation bewahrte mich davor, bewusst wahrzunehmen, dass ich meinen Körper verkaufte, um meinen Mann zu behalten, um die Zugehörigkeit nicht zu verlieren. Sie bewahrte mich davor, mit klarem Denken und Fühlen die Bedeutung und Tragweite zu ermessen, wie die Zusammenhänge zwischen meiner Prostitution, meinem Mann und seinen Freizeitaktivitäten waren.