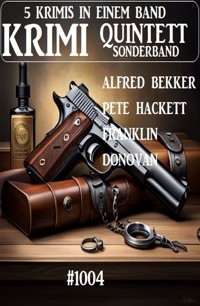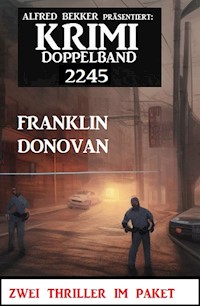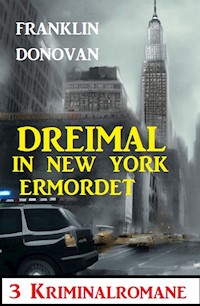Die Beretta Kaliber 22 zitterte in Malcolm Hastings’ Hand. Er
hatte die Waffe auf den fast nackten Körper von Jane Chapman
gerichtet. Die Schönheit mit der wallenden blonden Haarmähne
rekelte sich wollüstig auf dem französischen Bett.
Mit ihrer Zungenspitze befeuchtete sie ihre vollen roten
Lippen.
Daß Hastings mit der italienischen Pistole auf ihr Herz
zielte, machte der abgebrühten Verbrecherin nichts aus. Im
Gegenteil. Sie spielte mit ihm. Zeigte ihm deutlich, daß sie keine
Angst vor ihm hatte.
Janes feingliedrige Hand glitt zwischen ihren festen Brüsten
hinunter. Über ihren flachen Bauch. Verharrte dann. Sie bewegte die
langen Beine, die in schwarzen Strümpfen steckten, spreizte die
wohlgeformten Schenkel, und ihre Hand glitt noch tiefer.
Auf der Stirn des Mannes bildete sich ein Netz aus feinen
Schweißperlen.
»Mache ich dich nervös, Malcolm-Baby?«
Sie flötete die Worte. Doch in den Ohren des Managers klang
ihre Stimme wie eine Stahlsäge, die seine Nervenstränge
durchtrennte.
Warum schoß er nicht einfach? Warum tötete er sie nicht? Diese
Frau, die sein Leben ruiniert hatte.
Er konnte es nicht. Obwohl er den Zeigefinger bereits am Abzug
hatte. Aber seine Glieder waren wie gelähmt.
Malcolm Hastings war Jane Chapman hoffnungslos verfallen. Er
konnte sie nicht erschießen.
Und inzwischen hatte er auch die letzte Gelegenheit versäumt,
die sich ihm dazu bot.
Die Tür des geräumigen Schlafzimmer öffnete sich geräuschlos
hinter ihm. Der Manager spürte nur einen sanften Luftzug. Und einen
plötzlichen, heftigen Schmerz.
Der Mann mit der Beretta brach in sich zusammen und blieb
reglos am Boden liegen. Sein Genick war gebrochen.
Jane Chapman blickte auf zu dem großen kräftigen Japaner, der
sich ins Zimmer geschlichen hatte.
»Das wurde aber auch. Zeit, Nagai.«
Der Asiate betrachtete zufrieden seine Handkante, mit der er
Hastings getötet hatte.
Die blonde Frau zündete sich eine Zigarette an…
***
»Hinterher, Milo!«
Wir hatten uns seit zwei Tagen an die F ersen von Stoney
Watson geheftet. Im Wechsel mit unseren FBI-Kollegen Clive
Caravaggio und Blackfeather waren wir ihm in Pornokinos,
Pfandleihen und schmierige Imbißstuben gefolgt.
Irgendwie hatten mein Freund und Kollege Milo Tucker und ich
es geschafft, von ihm unbemerkt zu bleiben.
Bis jetzt.
Der kleine Ganove hatte sich plötzlich umgedreht, mich
angestarrt, und etwas war in seinen Augen aufgeflackert. Etwas wie
Panik.
Er nahm die Beine in die Hand und floh in eine Straße, die
aussah wie das Eingangstor zur ewigen Verdammnis.
Schweren Herzens entschlossen wir uns, die Tarnung fallen zu
lassen. Wir mußten an ihm dranbleiben. Stoney war unsere einzige
Trumpfkärte in einem Spiel, in dem wir bisher nur verloren
hatten.
Drei Morde. Alle begangen in Midtown Manhattan. Und bei allen
die gleiche Todesursache. Gebrochenes Genick.
Die Opfer: ein prominenter Rechtsanwalt, ein Manager eines
Elektronikkonzerns - und ein hoher Bundesbeamter.
Deshalb hatten wir als FBI den Fall von den Kollegen der City
Police übernommen. Denn Mord an Bundesbeamte fiel in unser
Ressort.
Die Verbrechen mußten miteinander zu tun haben. Doch bisher
hatten wir keine Verbindung zwischen den Ermordeten herstellen
können.
Außer Stoney.
Er hatte sich in allen drei Fällen in der Nähe des
Leichenfundorts herumgedrückt. Ein Gewohnheitsverbrecher. Ein alter
Bekannter sowohl des NYPD als auch des FBI.
Der Mann, hinter dem ich jetzt mit Höchstgeschwindigkeit
herrannte.
Es war, als ob Stoney Watson mit uns eine Stadtführung durch
die miesesten Gegenden von Manhattan veranstalten wollte. Zunächst
lief der kleine Kerl rechts an der Müllverbrennungsanlage vorbei,
die ihren wenig dezenten Duft Tag und Nacht in die Großstadtluft
blies.
Wir ließen die eingezäunten und heruntergekommenen Piers am
Hudson River hinter uns. Der Ganove warf einen gehetzten Blick über
die Schulter.
Wir holten auf.
Trotz seiner kurzen Beine hatte Stoney sich zunächst einen
ordentlichen Vorsprung zusammengehechelt. Kein Wunder. Der Bursche
mußte gut im Training sein. Die Hälfte seines Lebens war er flitzen
gegangen, um sich vor den Cops in Sicherheit zu bringen. Und weil
ihm das nicht immer gelungen war, hatte er die andere Hälfte seines
Daseins in Erziehungsheimen und Gefängnissen verbracht.
Rings um das tortenstückförmige Motel ›Liberty Inn‹ an der
West Street brandete der Verkehr. Mit Todesverachtung warf sich der
kleinwüchsige Ganove in den nicht abreißenden Strom von Autos und
Trucks.
Wütendes -Hupen erklang. Ich fürchtete schon, daß es ihn
erwischen würde. Seine Angst vor einem Unfall mußte geringer sein
als seine Furcht vor uns.
Und plötzlich kam mir eine Idee. Was, wenn er uns für Gangster
hielt? Wir hatten uns nicht als G-men zu erkennen gegeben.
Das wollte ich schnell nachholen.
Stoney war in letzter Sekunde einem Truck ausgewichen. Der
Driver hatte voll in die Eisen steigen müssen und hupte nun
wütend.
Milo und ich sprangen ebenfalls in den fließenden Verkehr.
Wieder blickte sich der Ganove um.
»FBI!« rief ich und hielt meine Marke mit dem goldenen Wappen
gut sichtbar hoch. »Bleiben Sie stehen!«
Für einen Moment schien der Kleine zu zögern. Doch dann
entschloß er sich, im Gewimmel von Manhattans Fleischmarkt
unterzutauchen.
Ich fluchte laut und anhaltend. Hier in dem Dreieck zwischen
14th Street, Gansevoort und Hudson Street ist eine der besten
Gegenden, um Verfolger abzuhängen. Überladene Fleischtransporter
reihten sich an den Gehsteigen. Zwischen ihnen ist manchmal nur
wenige Fußbreit Platz. Muskulöse Kleiderschränke in
blutbeschmierten weißen Kitteln wuchten die Kadaver von Schafen,
Rindern und Schweinen aus den Kühlwagen, um sie an Laufkatzen zu
hängen, so daß sie hinter den Plastikschwingtüren in den
Schlachthöfen weiterverarbeitet werden können.
Der Gestank von Blut und Dieseltreibstoff hing in der schweren
Luft.
In diesem Moment rutschte Stoney Watson in einer öligen Pfütze
aus!
Milo und ich tauschten mitten im Lauf einen triumphierenden
Blick. Noch fünfzig Yards, und wir würden ihn am Kragen haben. Was
wir dann mit ihm anstellen wollten, darüber würden wir uns später
Gedanken machen.
»Vorsicht, Jesse!«
Der Warnruf meines Freundes kam zu spät. Ich hatte mich so auf
Stoney konzentriert, daß ich den Schlachtereiarbeiter übersah, der
sich gerade mit Schwung eine Schweinehälfte über die Schulter
geworfen hatte.
Ich rannte mitten in das tiefgefrorene Fleisch hinein. Prallte
voll dagegen.
Für einen Moment kam ich mir vor wie der Schauspieler
Sylvester Stallone, der in ›Rocky‹ als Boxer im Schlachthof
trainiert und auf die Tierkadaver eingedroschen hatte. Doch dieser
Eber hätte mich beinahe ausgeknockt.
»Passen Sie doch auf!« herrschte Milo den Mann mit der
Schweinehälfte an. »Wir haben hier einen Einsatz!«
»Was glaubst du, was ich hier tue, du Würstchen?«
Der Arbeiter mit der blutbefleckten Schürze ließ das gefrorene
Fleisch in den Rinnstein fallen und schwang seine riesige Faust in
Richtung von Milos Kinn. Er schien nicht abgeneigt, seinen öden und
anstrengenden Job durch eine kleine Schlägerei etwas
aufzulockem.
Ich konnte nicht zulassen, daß er meinen Freund durch die
Mangel drehte. Zumal einige weitere Riesen in Weiß nun ihrem
Kollegen zu Hilfe kommen wollten.
Mit einem herzhaften Judo-Fußfeger riß ich den ersten von den
Beinen. Er schlidderte unter den Truck.
Den nächsten empfing ich mit einem Kopfstoß gegen sein Kinn.
Bei diesen rauhen Burschen mußte man gleich von Anfang an hart
durchgreifen, wenn man überleben wollte.
Milo machte ebenfalls kurzen Prozeß. Sein Gegner war zwar
größer und schwerer als der blonde G-man. Aber diesen Nachteil
konnte mein Kollege durch Schnelligkeit und Taktik
ausgleichen.
Wie alle anderen FBI-Agenten werden wir ständig in den
Techniken des waffenlosen Zweikampfs gedrillt. Deshalb haben wir
die besseren Karten gegen Zeitgenossen, die sich ohne Sinn und
Verstand auf der Straße prügeln wollen.
Trotzdem - ich mußte mich nun mit zwei Angreifern gleichzeitig
herumärgern.
Ich unterlief die Fausthiebe eines baumlangen Schwarzen und
tauchte gleichzeitig in den toten Winkel des anderen, der seinem
flammendroten Haar nach ein Ire sein mochte. Ich verpaßte ihm einen
Leberhaken und sprang aus dem Stand auf die Hebebühne eines Trucks,
der, zum Ausladen bereit, in der zweiten Reihe parkte.
Das war nicht klug. Die Hebebühne des Spezialfahrzeugs war
vereist. So etwas darf normalerweise nicht passieren. Die Kühlung
mußte defekt sein. Jedenfalls glitt ich aus und knallte mit dem
Schädel auf das harte Straßenpflaster.
Mit Gejohle stürzten sich die beiden Arbeiter auf mich.
Ich rollte mich zur Seite und verteilte schnell zwei oder drei
Fußtritte. Das verschaffte mir einen winzigen Moment Luft, bevor
sie wieder angriffen.
»Mach ihn platt, Paddy!« heiserte der Schwarze.
Der Ausruf bestätigte meine Vermutung. Paddy werden die Iren
in New York genannt. Deshalb heißt bei uns ein Streifenwagen im
Volksmund auch ›Paddy Wagon‹ - weil traditionsgemäß immer noch
viele irischstämmige New Yorker beim NYPD arbeiten.
›Paddy‹ griff an. Er hatte sich als Schlagwaffe eine enorme
gefrorene Lammkeule aus einem Plastikbehälter gegriffen. Ein Hieb
damit würde mir glatt den Schädel spalten.
Ich ließ es gar nicht erst soweit kommen.
Ich riß den linken Fuß vor die Brust und schoß ihn nach vorne
ab. Traf die Magengrube des Iren.
Er öffnete seinen breiten Mund, japste nach Luft. Und seinen
Fingern entglitt das schwere Stück Fleisch.
Nun wollte der Schwarze nachsetzen.
Aber ich hatte genug von der Zeitverschwendung. Wir wurden
hier auf gehalten, während Stoney Watson schon am anderen Ende von
Manhattan angelangt sein mußte.
Ich zückte kurzerhand wieder meine Marke und zog mit der
anderen Hand meine Pistole aus dem Gürtelholster.
Der Anblick der riesigen SIG Sauer P226 übte eine enorme
Wirkung auf die Fleischarbeiter aus.
»Schluß jetzt!« rief ich. »Wir sind FBI-Agenten. Und Sie
hindern uns an einer Amtshandlung!«
»Okay, Mann!« Der Schwarze in dem ehemals weißen Kittel hob
abwehrend die Hände und hielt mir die Handflächen entgegen. »Warum
habt ihr Komiker das nicht gleich gesagt?«
Ich ersparte mir einen Kommentar. Es war einfach Pech gewesen,
daß wir mit diesen harten Brocken aneinandergeraten waren.
Stoney war jedenfalls spurlos verschwunden.
Wir liefen noch eine Stunde lang herum zwischen den Trucks,
dem Frischfleisch und den Verkaufstheken von ›Western Beef‹. Aber
der Ganove hatte sich natürlich auf und davon gemacht.
Enttäuscht schoben wir die Hände in die Hosentaschen und
machten uns davon. Vorbei an den mageren jungen Mädchen, die an der
Ecke zur Hudson Street ihre Körper feilboten. Eine andere Art von
Fleischmarkt.
Ich verzog das Gesicht. Was für eine dreckige Welt!
Milo versuchte, unsere Stimmung mit einem Witz
aufzubessern.
»Jetzt haben wir Stoney verloren. Nur wegen dieser blöden
Fleischträger. Aber wir werden uns bitter rächen, Jesse!«
Ich sah ihn an. »Woran denkst du da, Partner?«
»Wir könnten zum Beispiel heute mittag vegetarisch
essen!«
Wir lachten.
Doch bei uns beiden blieb das miese Gefühl zurück, versagt zu
haben…
***
Bei der Einsatzbesprechung im Büro von Mr. McKee servierte
dessen Sekretärin Mandy für alle Anwesenden ihren legendären
Kaffee. In der Besprechungsecke saßen außer Milo und mir auch noch
unsere Kolleginnen Jennifer Clark und Annie Franceso. Clive
Caravaggio und Blackfeather waren inzwischen für einen anderen Fall
abgezogen worden.
Mr. McKee, der Special Agent in Charge des New Yorker FBI
District, erhob sich hinter seinem penibel aufgeräumten
Schreibtisch und kam mit einem Schnellhefter in der Hand zu der
Sitzgruppe hinüber. Jonathan D. McKee trägt als Leiter des FBI
Field Office New York letztlich die Verantwortung für jeden Schritt
seiner Special Agents. Also auch dafür, daß Milo und ich die Spur
von Stoney Watson verloren hatten.
Trotzdem war aus seinem Blick auch nicht der leiseste Vorwurf
zu lesen. Mr. McKee weiß, daß jeder von uns sein Bestes gibt.
»Watson kann sich nicht in Luft aufgelöst haben«, erklärte Mr.
McKee. »Bisher vermuten wir ja auch nur, daß er etwas mit den
Mordfällen zu tun haben könnte.«
»Er ist stets in der Nähe der Leiche gesehen worden, Sir«,
erinnerte ich.
Mr. McKee nickte gedankenverloren und setzte sich zu uns. »Ich
habe hier das Vorstrafenregister von Watson. Er ist im Grunde ein
kleiner Fisch. Unbedeutende Erpressungen und Trickbetrügereien sind
eher seine Spezialität. Ich halte ihn bestenfalls für einen
Zuträger des wahren Killers.«
»Man kann es drehen und wenden, wie man will«, sagte Milo
gallig. »Stoney ist der Schlüssel, wenn wir diese Mordserie
aufklären wollen. Und wir - wir lassen ihn einfach
entwischen!«
»Auch ein Special Agent kann nicht immer Glück haben«, sagte
Mr. McKee weise. »Sie und Jesse haben diesmal einfach Pech gehabt,
Milo.«
»Du kennst doch den alten Spruch, Milo«, warf Jennifer Clark
keß ein. »Pech im Spiel, Glück in der Liebe!«
»Schön wär’s!« seufzte mein Freund.
»Zurück zum Fall!« Mr. McKee sah unsere hübsche Kollegin an.
»Was haben die Computer-Recherchen über die Opfer gebracht,
Jennifer?«
Die Agentin blickte auf den Stapel Papier, der auf ihren Knien
lag. »Alle drei Opfer scheinen anständige Bürger gewesen zu sein,
Sir. Der Bundesbeamte, Gregory Carson, wurde von den Kollegen in
Washington gründlich unter die Lupe genommen, bevor er in den
Staatsdienst trat. Das ist schon zwanzig Jahre her. Seitdem ist er
routinemäßig immer wieder durchgecheckt worden. Nichts. Auch
Montgomery Clifton, der Rechtsanwalt, ist nie auffällig
geworden.«
»Vielleicht arbeitete er ja für das organisierte Verbrechen?«
fragte Milo hoffnungsvoll.
»Fehlanzeige. Der gute Mann hat stets langweilige, aber gut
zahlende Mandanten gehabt. Rechtsberatung von Unternehmen.
Gesellschaftsrecht. Solche Dinge.«
»Und dieser Manager? Malcolm Hastings?« wollte der Chef
wissen.
»Er war der Verkaufsleiter von Softex Electronics. Eine Firma,
die Computerprogramme entwickelt und verkauft. Auch über ihn ist
uns nichts Negatives bekannt.«
Mr. McKee nahm einen großen Schluck Kaffee. »Trotzdem sind
diese drei Männer jeweils durch Genickbruch ermordet worden. Es muß
noch weitere Gemeinsamkeiten zwischen ihnen geben. Wir arbeiten in
diesem Fall eng mit dem NYPD zusammen. Denn streng genommen fällt
nur der Tod von Gregory Carson in unsere Zuständigkeit. Weil er
Bundesbeamter war.«
Der Chef senkte seinen Blick auf den Schnellhefter und
verteilte die Aufgaben.
»Jesse und Milo, Sie versuchen weiterhin, die Rolle von Stoney
Watson bei diesen Verbrechen zu beleuchten. Er ist ja wohl in
Unterweltkreisen kein unbeschriebenes Blatt. Sie, Annie, halten
unseren Kontakt zur City Police. Dort bearbeitet ein gewisser
Detective Sergeant Louis Fernando vom Precinct an der West 47th
Street diese Morde. Und Jennifer, Sie kümmern sich um das Vorleben
der Opfer. Vielleicht hat ja doch einer von ihnen einen schwarzen
Fleck auf seiner weißen Weste!« '
Wenn es so war, würde es Jennifer Clark schon herausfinden, da
waren wir uns sicher.
Wir erhoben uns und machten uns an die Arbeit.
***
Bob Duffy gähnte.
Verschlafen rieb er sich die Augen. Es war erst halb sechs.
Doch er hörte schon, wie seine Freundin Jane Chapman unter der
Dusche den neuesten Song von Madonna trällerte.
Der muskulöse junge Mann streckte beide Arme, räkelte sich,
gähnte herzhaft, dann schwang er sich aus dem Bett.
Mißgelaunt betrachtete er die kleine Pfütze, die sich auf
dieser Seite der Badezimmertür gebildet hatte. Das passierte immer,
wenn jemand duschte. Der Vermieter saß auf den Ohren. Der Schaden
würde nie repariert werden. Und ein besseres Apartment konnte sich
Duffy von seinem Gehalt als Police Officer beim New York Police
Department nicht leisten.
Ja, wenn ich erst Sergeant wäre…! dachte er und schlüpfte in
den weichen weißen Frotteebademantel, den ihm seine Freundin zum
letzten Weihnachten geschenkt hatte.
Die Vorstellung von ihrem nackten, wohlgeformten Körper
beflügelte ihn ganz ungeheuer. Oft träumte er davon, wie er ihr ein
schöneres Leben ermöglichen würde, falls es mit seiner Beförderung
klappte.
Bob Duffy war gut. Einer der besten Cops des ganzen Precinct.
Das hatte sein Lieutenant oft genug gesagt. Und die Truppe brauchte
dringend Leute, die sich mit Leib und Seele dem Job
verschreiben.
Und so einer war Duffy.
Eine andere Karriere lag außerhalb seines
Vorstellungsvermögens. Er hatte immer nur Cop sein wollen. Seit
seiner Kindheit. Und vor einigen Jahren war nicht nur dieser Traum
in Erfüllung gegangen. Sondern er hatte vor sechs Monaten auch noch
diese Wahnsinnsfrau kennengelernt.
Jane Chapman.
Für ihn war es Liebe auf den ersten Blick gewesen. Und ihr
schien es genauso zu gehen. Jedenfalls hing sie immer an seinen
Lippen, wenn er ihr von seinem gefährlichen Job erzählte.
»So wild ist es beim NYPD gar nicht«, sagte Bob oft
bescheiden, wenn sie ihn abends bat, von seinem Arbeitstag zu
berichten. »Achtzig Prozent meines Jobs bestehen aus Tätigkeiten,
die nichts mit Kriminalitätsbekämpfung zu tun haben.«
Er konnte diese Zahl zwar selbst nicht recht glauben. Aber sie
stand in den offiziellen Stellenangeboten der City Police. Also
mußte sie wohl stimmen.
Und gerne zählte er immer wieder die Sozialleistungen auf, die
er als Cop genießen konnte. »Mir stehen jetzt siebenundzwanzig
bezahlte Urlaubstage pro Jahr zu, Jane! Und kostenlose medizinische
Versorgung! Und…«
Die Blondine unterdrückte immer ein Gähnen, wenn er sich über
die Sicherheiten seines Jobs ausließ.
Bob Duffy war in ihren Augen ein ausgesprochener Langweiler.
Wären da nicht seine Qualitäten im Bett und seine Kenntnisse der
Polizeiarbeit gewesen, sie hätte ihn schon längst auf den Mond
geschossen.
Aber das durfte sie nicht. Man hatte es ihr verboten. Und sie
wußte, daß sie ihren Befehlen besser gehorchte…
Jane Chapman hörte unter der Dusche, wie Duffy in der winzigen
Küche seines Apartments hantierte. Nun würde er Orangensaft aus dem
Kühlschrank holen. Wie jeden Morgen. Damit er genug Vitamine
bekam.
Sie verzog verächtlich ihr hübsches Gesicht, als sie an seinen
Gesundheitsfimmel dachte. Und an seine mickrigen Karrierepläne beim
Police Department.
Was für ein Spießer! dachte die junge Frau, die in der
vergangenen Nacht mitleidlos den Mord an Malcolm Hastings
beobachtet hatte. Ich werde froh sein, wenn ich ihn endlich los
bin…
Sie drehte die Brause ab und tastete nach dem Handtuch. Durch
das heiße Wasser war die Luft in der Naßzelle so undurchdringlich
wie echter Londoner Nebel.
Jane fluchte. Dieser raffgierige Vermieter würde den
Dunstabzug bis zum Weltuntergang defekt lassen. Und der
kleinkarierte Bob Duffy würde sich auch in tausend Jahren kein
besseres Apartment leisten können… Und überhaupt: Wo war dieses
verflixte Handtuch?
Sie tastete danach. Aber sie fand es nicht.
Statt dessen spürte sie die harten Muskeln des Cops, der zu
ihr in die Dusche stieg.
Schlagartig wich ihr auf kommender Ärger der Erregung. Denn
Duffy hatte das große Badetuch in seinen Händen. Und er begann sie
damit trockenzureiben, ganz sanft und zärtlich und überall, daß
heiße und kalte Wonneschauer durch ihren Körper fuhren.
Aufstöhnend vereinigten sich die Frau und der Mann in der
engen Duschkabine. Ihre Bewegungen wurden immer schneller,
hastiger, drängender und wilder, ihr Keuchen lauter.
Schließlich kamen sie wieder zu Atem.
»Du warst phantastisch, Darling!« sagte Jane und schmatzte ihm
mit ihren sinnlichen Lippen einen Kuß auf den Mund.
Diesmal meinte sie es ernst. Wenn es um Sex ging, heuchelte
sie ihm nichts vor. Nur, was alles andere betraf.
Denn Jane Chapman war keine Krankenschwester. Sie verdiente
sich ihre Brötchen nicht mit Nachtwachen im Bellevue Hospital, wie
sie dem Cop erzählte. Vielmehr war sie ein hochbezahltes
Edel-Callgirl.
Und ihr Arbeitgeber war die Yakuza.
Die japanische Mafia!
Stoney Watson war gelähmt vor Entsetzen. Ihm ging der Arsch
auf Grundeis. So hätte er selbst es jedenfalls ausgedrückt.
Der kleine Ganove hatte sich in seinem langen Kriminellenleben
schon oft in miesen Situationen befunden. Aber das hier toppte
alles.
Eigentlich war der Job ja ganz einfach gewesen. Er hatte
rausfinden sollen, ob die Bullen die Leichen gefunden hatten. Und
sich am Fundort rumdrücken, um vielleicht die ein oder andere
Bemerkung aufzuschnappen.
So hatten sich das seine Auftraggeber vorgestellt. Damit sie
herausfanden, ob in ihre Richtung ermittelt wurde. Und nun hatten
sie genau das Gegenteil davon erreicht.
Stoney hatte sich durch sein Herumlungern verdächtig gemacht.
Das FBI war hinter ihm her.
Und dann hatte er einen dummen Fehler begangen. Er hatte seine
Auftraggeber um Hilfe angefleht.
»Die G-men wollen mich kassieren!« hatte er ins Telefon
geblökt, nachdem er die geheime Nummer angerufen hatte, die seine
einzige Verbindung zu seinen Bossen darstellte. »Helfen Sie mir,
die Stadt zu verlassen!«
»Ich bedaure, Sir«, hatte die Stimme mit dem leichten
japanischen Akzent erwidert. »Sie sind falsch verbunden.«
Dann war die Verbindung unterbrochen worden.
Stoney Watson griff sich ans Genick. Noch war seine
Halswirbelsäule heil und ganz. Und das sollte auch so
bleiben.
Er verließ die öffentliche Phone Booth und wandte sich
Richtung Times Square.
Am hellichten Tag sah man die trüben Seiten des berühmten
Vergnügungsviertels deutlicher als unter dem Schleier der Nacht und
dem Blinken der tausendfachen Neonreklamen. Zwar hatten sich die
Obdachlosen unter dem eisernen Regiment von Bürgermeister Rudolph
Giuliani in andere Gegenden verzogen. Aber es gab immer noch genug
von ihnen.
Das gleiche galt für die Drogenabhängigen und die Ausreißer,
die aus allen Teilen der USA hierherkamen. Wie von einem riesigen
Magneten angezogen. Doch wenn sie ausgelaugt und zu nichts mehr zu
gebrauchen waren, wurden sie mit der gleichen Kraft vom Times
Square wieder abgestoßen.
Stoney Watson kannte das Spiel. Diese Gegend war seit vielen
Jahren seine Heimat.
Der kleine Ganove in dem abgetragenen Anzug ließ seinen Blick
nach oben wandern. Waffengegner hatten die ›Death Clock‹ am Times
Square anbringen lassen. Die Todesuhr. Sie zeigte genau an, wie
viele Schußwaffen momentan in den USA im Handel waren. Und wie
viele Menschen von ihnen getötet wurden, seit die Uhr im Januar
1994 zu ticken begonnen hatte.
Stoney Watson grinste zynisch.
Ich werde wohl nicht durch eine Kugel draufgehen, dachte er
und griff noch mal an sein Genick.
Der Kriminelle ging weiter, auf das Paramount Building zu. Er
mußte nicht in seine Innentasche greifen, um zu wissen, daß er noch
genau fünfzig Dollar hatte. Damit konnte er sich ein One-Way-Ticket
für einen Greyhound-Bus leisten, die nicht weit vom Times Square am
Port Authority Bus Terminal abfuhren.
Sollte er es wirklich tun? Um dann in irgendeinem Prärie-Nest
zu landen und vor dem Nichts zu stehen?
Das kam nicht in Frage für Stoney Watson. Er brauchte New York
wie eine Droge. Wenn er den Big Apple verlassen mußte, konnte er
sich ebensogut gleich von diesem verdammten Karate-Killer namens
Nagai das Genick brechen lassen.
Grimmig starrte der Kleinkriminelle vor sich hin. Er konnte es
drehen und wenden, wie er wollte. Es gab für ihn nur eine
Möglichkeit, seinen Hals aus der Schlinge zu ziehen.
Wieder steuerte er eine öffentliche Phone Booth an. Und wählte
die Nummer 335-2700.
»FBI District New York«, meldete sich eine weibliche Stimme.
»Wie kann ich Ihnen helfen?«
»Verbinden Sie mich mit einem Agenten, der hinter dem Mörder
von Malcolm Hastings her ist. Aber presto, verstanden?«
***
Nachdem Bob Duffy aufgebrochen war, um seine Schicht im
Precinct anzutreten , machte sich auch Jane Chapman ausgehf ertig.
Sie wählte ein Designerkleid, das eng geschnitten war und bis zu
den Knien reichte. Es betonte ihre körperlichen Vorzüge
außerordentlich, ohne dabei allerdings vulgär zu wirken.
Niemand hätte sie auf der Straße für eine Frau gehalten, die
für Geld zu haben war.
Eher wirkte sie wie eine vielbeschäftigte Geschäftsfrau, die
trotz Streß sorgsam auf ihr Aussehen achtete.
Mit einem mitleidigen Lächeln dachte sie an ihren ›Freund‹,
der jetzt schon im Patrolcar sitzen oder sich mit allen möglichen
üblen Typen herumprügeln mußte. Zu ihrem Glück war Bob Duffy ein
völliger Modemuffel. Sonst wäre es ihm wohl verdächtig vorgekommen,
daß sie sich mit ihrem schmalen Krankenschwesterngehalt so viele
Modellkleider leisten konnte. ‘
Nun - bisher hatte er noch nichts von ihrem Doppelleben
bemerkt.
Liebe macht wohl wirklich blind, dachte das Callgirl zynisch.
Sie ging auf die Straße und winkte sich ein Yellow Cab herbei, das
sie zum Ziel ihrer Sehnsucht führte.
Zur Fifth Avenue.
Nicht nur die Touristen, auch fast alle New Yorker halten
diese Straße für den absoluten Prachtboulevard der
Ostküsten-Metropole. Und da liegen sie sicherlich richtig.
Besonders auf dem Stück zwischen der neunundfünfzigsten und der
vierunddreißigsten Straße reihen sich auf der Fifth Avenue Läden
und Firmen mit klangvollen Namen aneinander.
Ebenso berühmt sind die Gebäude, die hier stehen - Rockefeiler
Center, Empire State Building, Sony Building, Trump Tower, Exxon
Building und so weiter…
Jane warf dem jamaikanischen Cabbie lässig eine
Zwanzig-Dollar-Note zu und stieg an der Ecke East 53rd Street aus.
Dort befand sich das Rolex Building. Und schräg gegenüber die St.
Thomas Episcopal Church.
Wenn die Blondine mehr Sinn für Symbole gehabt hätte, wäre ihr
das aufgefallen. Auf der einen Seite das Gotteshaus, das auf die
Vergänglichkeit menschlichen Lebens hinwies, auf der anderen das
renommierte Uhrenunternehmen, das diese Vergänglichkeit in meßbare
Größen faßte.
Aber für solche Gedanken hatte Jane Chapman keine Zeit.
Obwohl sie noch gar nicht wissen konnte, daß sie nur noch acht
Stunden zu leben hatte…
***
»Was wollen Sie?«
Ich wiederholte meine Frage. Noch konnte ich es nicht fassen,
daß uns das Glück wieder zu lachen schien.
Erst war uns Stoney Watson mit Bravour entkommen, hatte uns
eine lange Nase gedreht. Und nun rief er höchstpersönlich im
Federal Building an, um sich uns auszuliefern.
Das heißt, wenn er es wirklich war. Gesprochen hatte ich noch
nie mit ihm. Obwohl die quengelnde Fistelstimme mit dem New Yorker
Akzent durchaus zu ihm paßte.
»Sie haben mich genau verstanden, Trevellian! Ich will,
verflucht noch mal, in Ihr verdammtes FBI-Zeugenschutzprogramm auf
genommen werden. Ich kenne die Mörder von Malcolm Hastings, Gregory
Carson und Montgomery Clifton!«
Er spielte seine Trümpfe sofort aus.
Der Mann mußte wirklich verzweifelt sein.
Ich fühlte, wie mein Adrenalinspiegel anstieg. Aber trotzdem
blieb ich ruhig. Die Freisprecheinrichtung hatte ich eingeschaltet.
Daher konnte mein Freund und Partner Milo alles mithören. Und das
Tonband lief sowieso.
»Wer war es, Stoney?« fragte ich.
»Halten Sie mich für einen kompletten Idioten, Trevellian?«
Ich hatte mich ihm vorgestellt, nachdem mir Myma aus der Zentrale
den Anruf zugestellt hatte. »Ich packe erst aus, wenn ich heil und
unbeschadet an der Federal Plaza sitze! Möglichst auf dem Schoß des
Staatsanwalts!« Und er lachte meckernd über den dummen
Spruch.
Ich atmete tief durch. »Also gut, Watson. Wir kommen Sie
abholen. Wo sind Sie?«
»Schon besser, Trevellian. Ich bin in einer Phone Booth
gegenüber von einer hübschen kleinen Bar. Bogey’s Place nennt sie
sich. Dort werde ich jetzt reingehen und mir ein Coors
zischen!«
»Das Bogey’s Place ist zwischen Broadway und Seventh Avenue,
richtig? Gegenüber vom Rivoli Twin Movie Theatre.«
»Richtig, Trevellian. Beeilen Sie sich. Ich will Sie hier
sehen, bevor mein Bier warm wird.«
Klick.
Er hatte aufgelegt.
»Ganz schön frech, der kleine Halsabschneider«, kommentierte
Milo. Er hatte alles mitangehört.
»Stimmt, Alter. Aber ich wette, daß ihm in Wirklichkeit die
Knie schlottern. Und das aus gutem Grund. Denn wenn er wirklich
weiß, wer dieser verdammte Killer ist, hinter dem wir her
sind…«
»… dann schwebt er in akuter Lebensgefahr«, beendete Milo
meinen Satz.
»So ist es, Alter«, bestätigte ich.
»Wann ist uns das letzte Mal ein wichtiger Zeuge so dicht vor
der Nase abgemurkst worden?« fragte Milo.
»Ist schon ’ne Weile her, Alter.«
»Ist aber schon vorgekommen, stimmt’s.«
Ich nickte. »Allerdings.«
»Unschöne Sache, sowas.«
»Was willst du mir sagen, Partner?« fragte ich.
»Das wir uns beeilen sollten, wenn wir Stoney lebend
Wiedersehen wollten.«
Ja, da hatte Milo recht.
Wie auf Kommando sprangen wir auf, schnappten uns unsere
Jacketts und rasten Sekunden später hinunter in die Tiefgarage.
Dort ließen wir uns von der Fahrbereitschaft einen unauffälligen
grünen Buick geben.
Ich glitt hinter das Steuer, mein Freund ließ sich auf den
Beifahrersitz fallen.
Von der Federal Plaza ist es nicht weit bis zum Broadway. Doch
diese wohl bekannteste Straße von New York ist verdammt lang. Sie
durchschneidet ganz Manhattan diagonal.
Wir überlegten erst, das Warnlicht mit dem Magnetfuß auf das
Wagendach zu setzen, entschieden uns dann aber dagegen. Es galt,
jedes Aufsehen zu vermeiden. Vielleicht waren die Killer ja schon
in Stoneys Nähe. Wir mußten die Überraschung ausnutzen.
»Laut City Police-Akten ist unser kleiner Freund eine richtige
Broadway-Sumpfpflanze«, berichtete Milo. »Statt mit Milch wurde er
mit wässerigen Cocktails aufgezogen. Lesen gelernt hat er nicht in
der Schule , sondern in Pornoheften. Und Touristen gelinkt statt
gearbeitet.«
»Ein reizendes Kerlchen«, gab ich zurück.
Wir erreichten den Times Square. Hier kreuzte sich der
Broadway mit der Seventh Avenue. Es war nicht mehr weit.
Die bunten Lichter der unzähligen Kinos und Theater leuchteten
und blinkten. Die Show-Meile der Stadt empfing uns. Noch etwas
trübe bei Tageslicht.
Die Blechschlange schob sich gemächlich Richtung Norden. Ich
nutzte jede kleine Lücke im Verkehr aus. Aber die Sekunden schienen
sich so zäh wie Kaugummi in die Länge zu ziehen. Dabei konnten noch
keine fünfzehn Minuten vergangen sein, seit der Anruf von Stoney
Watson auf meinen Apparat geleitet worden war.
Endlich sah ich das Movie Princess-Gebäude.
Ich setzte den Blinker und bog rechts in die 49th Street, die
hier die Verbindung zwischen Broadway und Seventh Avenue darstellt.
Ich parkte in der zweiten Reihe. Lange würden wir hoffentlich nicht
brauchen.
Milo und ich stiegen aus und betraten die Bar.
Augenblicklich hatten wir das Gefühl, in dem Film ›Casablanca‹
gelandet zu sein. Es war offensichtlich, warum der Besitzer seinen
Laden ›Bogey’s Place‹ getauft hatte. Die Einrichtung war exakt der
Kulisse des bekannten Melodramas mit Humphrey Bogart und Ingrid
Bergmann nachempfunden.
Die weißen Mauern, die eine nordafrikanische Atmosphäre
schufen. Die maurischen Torbögen. Die Sessel und Tische aus
Rattangeflecht.
Ich schaute mich um. Wenn der schwarze Pianist Sam am Klavier
gesessen und ›As time goes by‹ gespielt hätte, ich wäre nicht
verwundert gewesen.
Doch statt dessen erwartete uns ein schmierig grinsender
Stoney Watson an der Theke.
Außer ihm gab es noch drei weitere Gäste, die sich im
Hintergrund aufhielten. Ich streifte sie mit einem Blick. Offenbar
die typischen abenteuerlustigen Daddies aus der Provinz. Ihr
Vergnügen bestand darin, nach New York zu fahren und sich dort eine
Woche lang vollauf en zu lassen.
Wenn man so lange im Big Apple gearbeitet hat wie ich, kennt
man die Sorte. Von ihnen drohte keine Gefahr.
Milo blieb zwei Schritte hinter mir und sicherte. Er hatte
seine Rechte unter das Jackett geschoben. Ich wußte, daß seine Hand
auf dem Griff seiner SIG Sauer lag. Wir waren ein eingespieltes
Team. Nicht zum ersten Mal mußten wir einen gefährdeten Zeugen in
Sicherheit bringen.
»Ich bin Jesse Trevellian«, stellte ich mich vor. »FBI New
York. Das da ist mein Partner, Special Agent Milo Tucker.«
Stoney grinste mit einer Mischung aus Anerkennung und Abscheu.
Er war wirklich ein recht kleinwüchsiges Kerlchen. Schütteres Haar
lag auf seinem schmalen Schädel. Unter dem abgetragenen Anzug
leuchtete ein grelles Hawaiihemd.
Vielleicht sollte er mal einen Modeberater aufsuchen, dachte
ich.
»Hoffentlich habt ihr an der Federal Plaza schon Donuts und
Kaffee aufgefahren!« krähte der Kleine und stürzte den Rest seines
Biers hinunter. Dann wies er mit dem Daumen auf mich. »Der
Gentleman hier zahlt.«
Seufzend griff ich in die Hosentasche und holte die zehn
Dollar heraus, die sie in diesem Neppladen für ein Bier
verlangten.
Stoney rieb sich die Hände. »Hervorragend, Trevellian! Wie
schnell Sie mit dem Bezahlen sind. Wären Sie doch auch so schnell
gewesen, als Sie mich zwischen den Fleischtransportern verfolgt
haben, hehehe…«
Ich wollte ihm empfehlen, sich mit seinen dummen Sprüchen mir
gegenüber zurückzuhalten. Doch dazu kam ich nicht mehr.
Eine Salve aus einer Maschinenpistole ließ im ›Bogey’s Place‹
die Hölle losbrechen!
***
Jane Chapman war wie im Rausch, als sie die Fifth Avenue
entlangschlenderte. Sie hatte an diesem Tag eine wichtige
Verabredung. Nagai, ihr Kontaktmann, hatte ihr mitgeteilt, daß sie
einen sehr wichtigen neuen Auftrag erhalten würde. Einen Job, der
sie auf einen Schlag um 20.000 Dollar reicher machen würde. Das war
selbst für ein gutverdienendes Callgirl wie Jane verdammt viel
Schotter.
Ihre Augen sogen sich an den Auslagen der weltberühmten
Juweliere fest, die überall auf der Prachtstraße ihre Schätze
feilboten. Tiffany’s. Cartier. Van Cleef. Ganz zu schweigen von den
Modehäusern.
Jane sah sich selbst ein Leben in Luxus führen.
Und der Schlüssel dazu war ihr Körper…
Besorgt warf das Callgirl einen Blick auf ihre kleine
Damen-Rolex. Auf keinen Fall durfte sie zu spät kommen. Nicht
heute, da sie den wichtigsten Mann der Organisation kennenlernen
sollte.
Aber es war noch früh genug.
Pünktlich erreichte Jane die Adresse 693 Fifth Avenue. Hier
befand sich das neue japanische Kaufhaus ›Jakashimaya‹.
Ein schmales Lächeln erschien auf den schönen Lippen der
jungen Frau. Gab es einen passenderen Ort, um sich mit einem der
Bosse der Yakuza zu treffen?
Das organisierte Verbrechen aus dem Land der aufgehenden Sonne
hatte schon längst in Amerika Fuß gefaßt, und auch Jane arbeitete
bereits seit einiger Zeit erfolgreich für die japanischen
Gangster.
Die meisten Kunden, die sich im ›Jakashimaya‹ aufhielten,
waren allerdings keine Asiaten, sondern Amerikaner und Touristen
aus aller Welt. Von Unterhaltungselektronik bis zu handgearbeiteten
Teeservices fand sich hier alles, was man an japanischen Produkten
kannte und schätzte.
Die Blondine ging achtlos an den dargebotenen Waren vorbei.
Sie fuhr mit der Rolltreppe ins erste Stockwerk. Dort bot ein
nachgebautes japanisches Teehaus dem müden Gast Entspannung in
asiatischer Atmosphäre.
Am Eingang zog Jane ihre hohen Pumps aus und schritt auf
Strümpfen über die weichen Tatami-Matten. Sie war auf die Minute
pünktlich.
Ihren Kontaktmann Nagai sah sie bereits von weitem. Der breit
gebaute und hochgewachsene Karate-Killer stand mit dem Rücken zur
Wand, die großen tödlichen Hände vor dem Bauch gefaltet.
Direkt vor ihm saß ein magerer alter Mann mit
untergeschlagenen Beinen auf einem Kissen.
Der Yakuza-Boß trug einen dunklen Anzug, wie die meisten
Japaner seines Alters. Durch die dicken Gläser seiner Brille
schaute er Jane Chapman forschend an.
Es war ihr unmöglich, etwas aus seinem Blick herauszulesen.
Weder Zustimmung noch Ablehnung. Die meisten Männer zeigten sich
völlig begeistert von ihren Reizen. Doch der mächtige Gangsterboß
ließ überhaupt keine Gefühlsregung erkennen.
Das Callgirl grüßte ihn ehrerbietig und ließ sich ihm
gegenüber auf die Knie sinken.
Der alte Mann machte eine kleine Handbewegung. Nagai beugte
sich hinab und goß beiden eine Flüssigkeit in henkellose Becher,
die nicht viel größer als Fingerhüte waren.
»Das ist Sake«, erklärte der Yakuza-Boß. »Japanischer Reis
wein.«
Langsam führte er das Gefäß mit dem angewärmten Alkohol zum
Mund. Jane folgte seinem Beispiel.
Ihre Wangen waren jetzt schon gerötet. Aber nicht von dem
Sake, der noch nicht ihre Kehle hinuntergeflossen war, sondern vor
Aufregung.
»Ich bin der Daimyo«, sagte der alte Japaner. »Sie wissen, was
das heißt?«
Die Amerikanerin nickte. Er war der oberste der Oberen. Ihm
schuldete jeder in der Organisation absoluten Gehorsam. Der Daimyo
konnte einen Selbstmord befehlen, wenn er es für richtig hielt.
Jedes Mitglied der Yakuza würde dieser Aufforderung sofort und mit
freudigem Eifer nachkommen. So groß war seine Macht.
»Sie waren uns bisher von gewissem Nutzen, Miss Chapman. Sie
haben mir wertvolle Informationen über den amerikanischen
Außenhandel verschafft.«
»Danke, Daimyo-san«, erwiderte die Blondine und verbeugte sich
leicht. Das war ihr Job gewesen, der mit der Ermordung des
Bundesbeamten Gregory Carson geendet hatte.
»Auch beim Ausschalten eines US-Konkurrenten waren Sie mir
behilflich.«
Wieder verneigte sie sich. Diesmal meinte er den Anwalt
Montgomery Clifton, den Jane dazu verführt hatte, vertrauliche
Akten seiner Klienten zu veruntreuen. Ein Treuebruch, der für ihn
tödlich geendet hatte.
»Und die Aktien von Softex Electronics fallen ins Bodenlose.
Auch daran haben Sie einen gewissen Anteil.«
Jane Chapman lächelte geschmeichelt. Sie erinnerte sich an den
Manager des US-Elektronikkonzems, der in ohnmächtiger Wut seine
Beretta auf sie gerichtet hatte. Zu guter Letzt hatte Malcolm
Hastings doch noch ihr doppeltes Spiel durchschaut. Daß sie seine
neueste Entwicklung an die japanische Mafia weitergeleitet hatte.
Daß seine geliebte Bettgefährtin in einer einzigen Nacht sein Leben
und seine Firma ruiniert hatte und der Killer schon unterwegs war,
der ihn beseitigen sollte.
Diese Erkenntnis hatte Hastings allerdings nichts genützt.
Nagais starke Hände hatten sein Leben beendet, bevor er seinen
Verdacht an die Behörden hatte weitergeben können.
»Ich habe heute eine neue Aufgabe für Sie«, verkündete der
Daimyo. »Sie ist schwieriger als alles, was Sie bisher für mich
erledigt haben. Deshalb erhalten Sie Ihre Anweisungen auch nicht
von Nagai, sondern von mir persönlich.«
Erneut bog die Blondine ihren Oberkörper nach vorn. Sie wußte,
daß Höflichkeit in der japanischen Kultur eine große Rolle spielt.
Vor allem Höflichkeit gegenüber Höherstehenden. Und es gab in der
ganzen Organisation niemanden, der höher stand als dieser alte
Mann, der wie ein böser Zwerg wirkte.
»Es geht um ein neues Verteidigungssystem«, sagte der
japanische Mafia-Boß. »Wie Sie vielleicht wissen, verfügt Ihr Land
über die wohl mächtigsten Streitkräfte der Welt. Und es gibt eine
Menge gut zahlender Abnehmer für militärische Geheimnisse aus dem
Pentagon.«
Während er sprach, zog der Daimyo eine Fotografie aus seinem
Jakkett und reichte sie Jane über den kleinen Tisch.
Sie nahm das Bild entgegen. Es zeigte einen untersetzten und
kräftigen Mann Mitte Fünfzig. Er wirkte wie ein Bankdirektor oder
Versicherungsagent aus einer Kleinstadt im mittleren Westen.
»Das ist Senator Andrew Warren, Miss Chapman. Er sitzt in
Washington im Verteidigungsausschuß des amerikanischen Senats. Ein
sehr einflußreicher Politiker. Wir sind sicher, daß er bestens über
das neue Verteidigungssystem Bescheid weiß.«
»Was ist das für ein Verteidigungssystem, Daimyo-san?«
Leichter Ärger klang in seiner Stimme mit, als er antwortete:
»Wenn ich das wüßte, bräuchte ich Ihnen nicht diesen Auftrag zu
erteilen.«
»Verzeihen Sie die Frage. Ich bin zu neugierig.«
»Mh. - Wir sammeln schon seit Monaten Informationen über
Senator Warren. Und er scheint nur eine einzige Schwäche zu haben.
Schöne, junge blonde Frauen. Sie haben völlig freie Hand. Tun Sie,
was Sie tun müssen. Wie üblich wird Nagai in Ihrer Nähe sein, um
Sie zu unterstützen und die Angelegenheit zu beenden.«
Im Klartext bedeutete das: Senator Andrew Warren mit bloßen
Händen zu töten.
Aber erst, nachdem sie ihn ausgequetscht hatten wie eine
Zitrone…
***
Die Attentäter waren zu zweit. Und sie kamen von verschiedenen
Seiten. Beide hatten automatische Waffen in den Händen.
MAC-10-Maschinenpistolen der Marke Gordon Ingram im Kaliber
Neun-Para.
Ich packte Stoney Watson am Revers, riß ihn zu Boden. Die
erste Garbe hatten ihn nur knapp verfehlt.
Obwohl Milo wachsam gewesen war, hatten sie uns völlig
überrascht und nahmen uns in die Zange. Es mußte sich um Profis
handeln. Da gab es bei mir keinen Zweifel.
Während ich den kleinen Ganoven mit meinem Körper schützte,
riß ich meine SIG aus dem Gürtelholster. Das ‘ trockene Aufbellen
in meinem Rücken bewies mir, daß Milo seine Dienstwaffe bereits zum
Einsatz brachte.
Ich jagte drei Kugeln kurz hintereinander aus dem Lauf. Damit
zwang ich den einen Attentäter zumindest in Deckung.
Sein Gesicht konnte ich nicht erkennen. Ertrug eine Strumpf
maske.
Das irritierte mich. Heutzutage ist diese Tarnung bei
Kriminellen ziemlich aus der Mode gekommen. Man wird zwar nicht
erkannt, wenn man sich so einen Nylon über den Schädel zieht. Aber
andererseits verzerrt sie auch das Blickfeld, und man hat
Schwierigkeiten, beim Schießen sauber zu treffen.
Naja, darüber konnte ich mir später Gedanken machen.
Der nächste Feuerstoß aus der Gordon Ingram ließ mir die
Holzspäne nur so um die Ohren fliegen. Ich hatte mich zusammen mit
Stoney hinter einen umgeworfenen Tisch geduckt, doch die
automatische Waffe sägte durch das Möbelstück wie durch
Papier.
Mir dröhnten die Ohren von dem Lärm der Waffen. Mein Gegner
tauchte für Sekundenbruchteile hinter seiner Deckung auf, die MPi
im Anschlag.
Als der Feuerstoß endete, schnellte ich hoch, die SIG in der
Faust.
Und drückte ab. Zweimal hintereinander.
Meine Pistole hat insgesamt sechzehn Schuß. Eine wirkliche
Verbesserung gegenüber meines alten 38ers. Aber wenn man es mit
Gangstem zu tun hat, die mit Maschinenpistolen um sich ballern, ist
es immer noch ziemlich wenig.
Aber das Schießen habe ich ja gelernt. Es gehört zu meinem
Job. Leider. Und ich trainiere auch regelmäßig auf dem Schießstand
im Keller des FBI-Building.
Ich traf den Gangster. Mit beiden Kugeln. Ich hörte seinen
Schmerzensschrei. Und das Poltern, als seine MPi zu Boden fiel. Da
war ich längst wieder hinter dem Tisch in Deckung gegangen.
Milo schoß, was das Zeug hielt, um den anderen Verbrecher in
Deckung zu halten. Breitbeinig stand er da, die SIG im
Beidhandanschlag, und verfeuerte Kugel auf Kugel. Nur einmal ging
er kurz in die Knie, um das Ersatzmagazin in die SIG zu rammen,
dann federte er wieder hoch und schoß weiter.
Der Barkeeper und die betrunkenen Touristen hatten sich flach
zu Boden geworfen. Das beste, was sie tun konnten.
»Abhauen!« schrie der Attentäter, den mein Partner unter
Beschuß genommen hatte, aus voller Kehle.
Das ließ sich der von mir Getroffene nicht zweimal sagen. Er
war durch den Notausgang gekommen. Und auf diesem Weg wollte er
auch wieder verschwinden.
»Sie bleiben liegen!« herrschte ich Stoney Watson an.
Er erwiderte nichts. Seine große Klappe hatte er angesichts
der vielen blauen Bohnen, die hier die Luft gesiebt hatten, vorerst
verloren.
Mit vorgehaltener Pistole sprang ich über den von den
MPi-Garben zerfetzten Tisch und sprintete hinter dem verwundeten
Attentäter her. Er hinterließ eine Blutspur am Boden und an der
Wand, wo seine verschmierte Hand sie berührte. Daß er sich mit zwei
Kugeln im Leib überhaupt noch bewegen konnte, zeigte mir, daß er
eine rauhe Natur war.
Ich erreichte den Notausgang, trat die Tür auf, hechtete vor
und zielte in den Korridor.
Da war niemand mehr. Nur die häßliche Blutspur.
In der Bar verstummten die Schüsse, die Milo und der zweite
Gangster noch immer ausgetauscht hatten. Der andere Attentäter
würde sich wohl durch den Vordereingang davonmachen wollen.
Hoffentlich erwischte ihn Milo.
Ich hetzte den schmalen Gang entlang. Eine Schwingtür bewegte
sich leicht. Ein Zeichen, daß gerade jemand hindurchgestürmt
war.
Aber ich lief nicht in die Falle wie ein Anfänger. Suchend sah
ich mich um.
Wie für mich bestellt stand ein kaputter Barhocker in der
Ecke. Man hatte ihn hier wohl abgeladen, um ihn irgendwann einmal
auf den Müll zu werfen. Ich würde ihn besser verwenden
können.
Auf Knien und Ellenbogen kriechend schob ich den Barhocker vor
mir her, um damit die Schwingtür aufzustoßen.
Ich hatte mich nicht getäuscht.
Eine lange Salve aus der Gordon-Ingram fetzte in das Holz der
Tür, als ich den Barhocker dagegen schlug. Von meiner Position aus
konnte ich unmöglich erkennen, wo das Mündungsfeuer herkam.
Dann verstummte die automatische Waffe.
Ich arbeitete mich Inch für Inch weiter an die Tür heran, die
nur noch lose in ihren Angeln hing.
Verdammt!
Eine deutliche Blutspur führte zur Umfassungsmauer des
Innenhofs, der mit leeren Getränkekisten und Müllbeuteln überfüllt
war. Dort oben mußte der Attentäter auf mich gelauert haben.
Jetzt hörte ich einen Automotor aufheulen und quietschende
Reifen.
Ich konnte mir vorstellen, wie das Fahrzeug auf die Seventh
Avenue einbog. Es würde im Verkehrsfluß verschwunden sein, bevor
ich mich auch nur an der Mauer hochgezogen hatte.
Eine Fahndung war sinnlos. Ich kannte ja nicht mal den
Wagentyp. Vom Nummemschild ganz zu schweigen.
Unzufrieden steckte ich meine SIG Sauer wieder in das
Gürtelholster und ging zurück in die Bar. Doch es sollte noch
schlimmer kommen.
Eine eiskalte Hand krampfte sich um mein Herz.
Milo kniete neben dem blutbesudelten Körper von Stoney
Watson!
»Ein Querschläger muß ihn erwischt haben!« rief mein Partner.
Verzweifelt versuchte er, die Blutung am Hals des Ganoven zu
stoppen. »Ich habe schon eine Ambulanz alarmiert!«
Aber wir wußten beide, daß es sinnlos sein würde. Mit Stoney
ging es zu Ende. Das Leben wich zusehends aus dem Blick seiner
jetzt glasigen Augen.
»Wer?« fragte ich den Sterbenden. Wir mußten unbedingt
erfahren, wer hinter diesem scheinbar sinnlosen Tötensteckte. »Wer
war es, Stoney?«
»Na…«, hauchte er fast unhörbar. Ich hielt mein Ohr ganz dicht
an seine bleichen Lippen. »Nag…«
»Ich verstehe nicht!«
Der Sterbende unternahm noch einen letzten Versuch. »City…
Co…«
Dann brach der Blick seiner Augen.
Der wenige Minuten später eintreffende Notarzt konnte nur noch
den Tod von Stoney Watson feststellen…
***
Die FBI-Agentin Annie Franceso war ziemlich überrascht, als
sie das Polizeirevier an der West 47th Street betrat. Die
Bundespolizei arbeitet eng mit dem NYPD zusammen. Daher ging auch
Annie Franceso in den Precincts der City Police ein und aus wie die
meisten New Yorker G-men.
Sie wußte also, daß Streß und Hektik bei den dunkelblau
uniformierten Kollegen an der Tagesordnung waren.
Doch ah diesem Tag herrschte eine beinahe friedliche Stille im
Mannschaftsraum. Sogar die Besoffenen in den Arrestzellen schienen
sich leiser zu übergeben als üblich.
Die puertoricanischstämmige Agentin sah den grauhaarigen Desk
Sergeant fragend an. Er kannte Annie schon seit einiger Zeit.
»Ah, die chica vom FBI!« begrüßte er sie. »Du hast heute einen
ganz besonderen Tag erwischt, Annie. Einer von uns kriegt eine
Medaille verliehen.«
Neugierig spähte die dunkelhaarige FBI-Agentin zu der Menge
von Cops in Uniform und Detectives in Zivil hinüber, die sich im
Halbkreis versammelt hatten.
»Geh nur hin«, forderte der Desk Sergeant sie mit
stolzgeschwellter Brust auf. »Wenn du ein dienstliches Anliegen
hast - das müß bis nach der Verleihung warten.«
Annie nickte und setzte sich in Bewegung. Insgeheim hatte sie
sowieso eine Vorliebe für feierliche Zeremonien. Vor ihrem
geistigen Auge zogen die Momente ihres Lebens vorbei, in denen sie
selber im Mittelpunkt solcher Rituale gestanden hatte. Der
Highschool-Abschluß. Das Jura-Diplom an der Uni. Die Vereidigung
als Agentin des FBI in Washington. Und nicht zuletzt die Verleihung
des obersten Schülergrads in Kung-Fu.
Annie Franceso wurde von ihren Kollegen liebevoll-spöttisch
›Miss Lee‹ genannt. Wegen ihrer Verehrung für den unvergessenen
Kampfkunst-Filmstar Bruce Lee. Sie hatte nicht nur seine sämtlichen
Filme auf Video, sondern verbrachte auch jede freie Minute in einer
Kung-Fu-Schule in Chinatown.
In den letzten Tagen hatte sie das Training sogar noch
intensiviert, um wieder fit zu werden. Einige Zeit lang hatte sie
wegen einer Schußverletzung im Krankenhausbett zubringen müssen,
denn bei ihrem letzten gemeinsamen Fall waren sie, Jesse Trevellian
und Milo Tucker zwischen die Fronten verfeindeter Syndikate
geraten, und Annie war angeschossen worden. [1]
Die Verwundung war inzwischen gut verheilt, nur eine kleine
Narbe war zurückgeblieben, und jetzt trainierte Annie um so
eifriger, um ihre Muskeln wieder zu stählen.
Die FBI-Agentin bahnte sich einen Weg zwischen den Cops
hindurch, bis sie einen guten Blick auf die Verleihungszeremonie
hatte. Inmitten des Kreises aus Polizisten standen einige Bürger in
Zivil. Und ein Cop, dem eine alte Dame gerade eine Medaille an
einem roten Band um den Hals legte.
»Im Namen des Bürgervereins Midtown Manhattan verleihe ich die
diesjährige Auszeichnung für ›Tapferkeit im Dienst an den Bürgern
von Manhattan‹ an Police Officer Robert Duffy vom Precinct West
47th Street.«
Der Uniformierte errötete. Seine Kollegen applaudierten.
Die Lady fuhr fort: »Natürlich wissen wir, daß Sie alle Ihren
Job so gut wie möglich machen. Aber wir vom Bürgerverein meinen,
daß sich Officer Duffy besonders hervorgetan hat. Er hat monatelang
seine Freizeit geopfert, um den Dealern auf unseren Spielplätzen
das Handwerk zu legen. Er hat nicht auf gegeben, hat sich weit über
seine dienstlichen Verpflichtungen hinaus engagiert.«
Die anderen Zivilisten schüttelten dem verlegenen Cop die
Hand. Er bedankte sich höflich. Dann drängten sich auch seine
Kollegen nach vorn, um ihm ebenfalls zu gratulieren.
Annie tippte einer Polizistin auf die Schulter, die direkt
neben ihr stand. »Kannst du mir sagen, wo ich Detective Louis
Fernando finde?«
Irritiert sah die Frau in Uniform die Agentin an. So, als
wüßte sie nicht, weshalb sie einer Fremden so etwas verraten
sollte.
Aber dann fiel ihr Blick auf den FBI-Dienstausweis, den sich
Annie an das Jackett ihres beigen Hosenanzugs geheftet hatte. »Ach,
sie sind vom FBI.«
»Richtig, Kollegin.«
»Und Sie wollen Detective Fernando sprechen?«
»Wie ich bereits sagte.«
»Das ist der hübsche Kerl, der da am Sodaautomaten
lehnt.«
»Ah, ich sehe ihn. Danke.«
Annie mußte dem weiblichen Cop recht geben, was das Aussehen
des Detective betraf. Fernando war Anfang Dreißig und für einen
Latino ziemlich hochgewachsen. Sein modisch kurzgeschnittenes Haar
war naturgelockt. Unter seinem Anzug von der Stange steckten breite
Schultern und schmale Hüften. Aus dunkelbraunen Augen blickte er
interessiert in die Welt.
Die FBI-Agentin trat auf ihn zu. »Detective Fernando?«
Er linste auf ihren Ausweis, und ein schüchternes Lächeln
erschien auf seinem Gesicht. »Sie müssen Annie Franceso sein. Mein
Lieutenant hat mir schon gesagt, daß wir Zusammenarbeiten werden.
Es geht um die drei Mordopfer, denen das Genick gebrochen wurde,
nicht wahr?«
»Exakt.«
»Wie ich hörte, wurden Sie vor einiger Zeit im Dienst
angeschossen.«
»Das ist schon längst vergessen.« Annie gab sich ganz
dienstlich, obwohl sie die männlich-attraktive Ausstrahlung dieses
NYPD-Kollegen zunehmend verwirrte. Sie ertappte sich bei dem
Gedanken, möglichst schnell einen Termin bei ihrem Friseur zu
machen.
»Gehen wir doch hinüber zu meinem Schreibtisch.« Fernando
bewegte sich unsicher, fast ein wenig linkisch.
Das unterschied ihn von den zahlreichen Latino-Machos, die
Annie in ihrem Leben schon kennengelemt hatte. Die hielten sich
alle für unwiderstehlich.
Der zerschrammte Blech-Schreibtisch war mit Akten überhäuft.
Offenbar litt Louis Fernando nicht gerade unter
Arbeitsmangel.
Annie nahm auf seinem Besucherstuhl Platz. Sie gab sich
besonders forsch, um ihre aufkeimenden Gefühle für den Detective zu
überspielen.
»Wie sind Ihre Ermittlungen vorangegangen, Detective
Fernando?«
Er zuckte mit den Schultern. »Ehrlich gesagt, gar nicht, Agent
Franceso.« Er redete sie genauso förmlich an wie sie ihn. »Ich war
jedesmal am Fundort der Leichen. Sie wurden alle im Umkreis von
einer Quadratmeile um den Precinct abgelegt.«
»Das ist doch schon mal ein Anhaltspunkt«, sagte Annie.
Versonnen betrachtete sie seine schlanken und doch kräftigen
Hände, die er auf der Schreibtischplatte gefaltet hatte.
»Außerdem ist mir dieser Stoney Watson aufgef allen, der
unseren Leuten von der Spurensicherung bei der Arbeit zugeschaut
hat«, fuhr Fernando fort. »Ein kleiner Ganove, den ich selbst schon
mindestens fünfmal hinter Gitter gebracht habe. Aber weiter bin ich
noch nicht gekommen, Agent Franceso.«
»An Stoney Watson sind meine Kollegen Trevellian und Tucker
dran«, berichtete die puertoricanischstämmige Agentin. »Wir sollten
nach Zeugen Ausschau halten, die die Opfer noch lebend gesehen
haben. Vielleicht sogar in Begleitung des Täters.«
Der Detective mit den dunklen Locken wiegte den Kopf. »Das
bedeutet viel Beinarbeit.«
»Kein Problem«, meinte Annie. »Wir sind ja jetzt zu
zweit.«
»Darüber freue ich mich«, erwiderte Louis Fernando und sah ihr
in die Augen.
Annie Franceso biß die Zähne zusammen und schaffte es mit
einer übermenschlichen Anstrengung, nicht zu erröten. Sie war auf
dem besten Weg, sich in den Detective Sergeant zu verlieben!
***
»Was ist das?« fragte Milo und verzog das Gesicht.