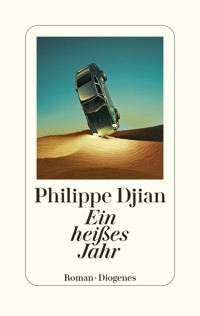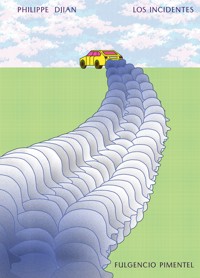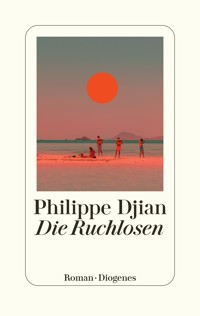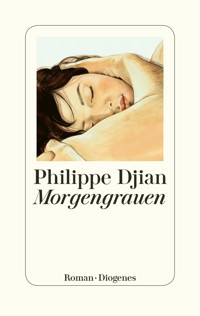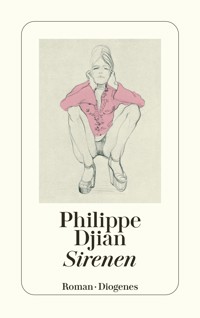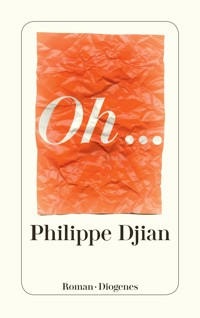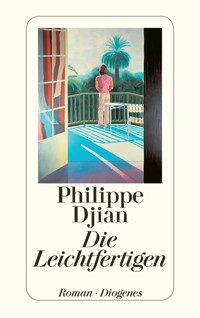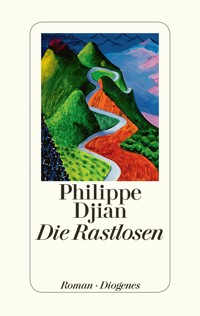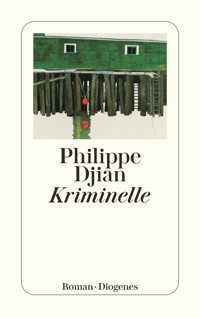
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auch fünf Jahrzehnte Lebenserfahrung sind keine Garantie dafür, dass nun alles leichter ginge – im Gegenteil. Francis' Vater wird zum Pflegefall, seine Lebensgefährtin lässt ihn fallen, mit seinem Bruder spricht Francis schon seit Jahren nicht, was sein Sohn erzählt, versteht er nicht. ›Kriminelle‹ handelt vom Horror der Midlife-crisis und den unspektakulären Mördern, die ihre eigenen Ideale auf dem Gewissen haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Philippe Djian
Kriminelle
Roman
Aus dem Französischen vonUlrich Hartmann
Titel der 1997 bei
Éditions Gallimard, Paris,
erschienenen Originalausgabe:
›Criminels‹
Copyright © 1997 Philippe Djian
et Éditions Gallimard
Die deutsche Erstausgabe erschien 1998
im Diogenes Verlag
Umschlagbild von
Tomi Ungerer
Alle deutschen Rechte vorbehalten
Copyright © 2013
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 23251 9 (1.Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60374 3
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] Im Grunde könnte jeder irgendein anderer sein.
Man muß sich entscheiden.
Richard Ford
[7] Marc ist mein Bruder, und es fällt mir schwer, mir vor zustellen, daß er sich ficken läßt.
»Was soll’s, es ist aber ganz einfach wahr!« meint Élisabeth.
Sie hat sich nicht einmal die Zeit genommen, ihren Mantel auszuziehen. Sie fixiert mich über den Küchentisch hinweg, den ich fürs Frühstück gedeckt habe, während ich auf sie wartete. Ich weiß nicht recht, wie ich mich verhalten soll. Sie gibt sich sichtlich Mühe, sich zu beherrschen.
»Jetzt sieh mich nicht so an, ich kann nichts dafür«, sage ich.
Sie hat noch ganz rote Backen. Vom Bahnhof ist es ein guter Kilometer, und wir haben zwar blauen Himmel, doch vom Schnee ist noch rein gar nichts geschmolzen. Aber ich glaube nicht, daß die kalte Luft an ihrer Gesichtsfarbe schuld ist.
»Lieber Himmel! Du mußt gar nicht so ein verwundertes Gesicht machen!« fährt sie mich genervt an.
Sie knöpft ihren Mantel auf, sieht mich an, zuckt dann die Achseln.
Als sie sich schließlich hinsetzt, gieße ich ihr Kaffee ein. Ich hab nicht oft Gelegenheit, das Frühstück zu machen, und ich mußte früher aufstehen, um das Geschirr von [8] gestern abend zu spülen. Ehrlich gesagt hatte ich nicht geglaubt, daß sie mit guten Neuigkeiten heimkommen würde. Und ich hatte recht behalten.
Sie stellt die Tasse wieder hin, bevor sie auch nur daran genippt hat. Ich frage sie, ob sie unterwegs schlafen konnte. Ich versuche, Zeit zu gewinnen, ein bißchen nachzudenken. Mir geht dieses Talent ab, so spontan auf etwas zu reagieren. Bei Élisabeth ist es hoch entwickelt und verblüfft mich immer wieder.
Mit einem wütenden Seufzer zieht sie ihr Haar in den Nacken und bindet es mit einem Gummi zusammen, das sie irgendwo hergezaubert hat. Dann sieht sie mich wieder an und schüttelt schließlich den Kopf.
»Du glaubst mir nicht, stimmt’s?«
»Ich hab’s dir gesagt. Ich habe ihn seit Jahren nicht gesehen.«
»Verdammt noch mal! Aber uns hast du derart mit ihm in den Ohren gelegen!«
Sie fegt mit ihrer Hand zwischen uns beiden durch die Luft. Ich stehe auf und stelle die Kaffeekanne auf die warme Platte, setze mich wieder hin und fahre mit dem Wischlappen kurz übers Wachstuch, obwohl es nicht nötig ist.
Weil sie nichts sagt, stehe ich wieder auf und stelle mich ans Fenster, die Hände in den Hosentaschen vergraben. Ich fühle mich plötzlich gereizt, aber unfähig zu reagieren. Und dann hat auch noch irgend jemand SAU auf die Heckscheibe von meinem Auto geschrieben.
»Soll er doch machen, was er will«, redet sie hinter meinem Rücken weiter. »Ist mir vollkommen egal. Darum geht es nicht.«
[9] Ich lache laut auf: »Du denkst doch was ganz anderes. Ich weiß ganz genau, was du denkst.«
»Nein, du kapierst überhaupt nichts. Du kennst mich schlecht.«
Ich drehe mich zu ihr um, antworte ihr aber nicht, trinke meinen Kaffee aus und gehe dann runter in den Keller.
Ich sehe nach, ob die Batterie inzwischen aufgeladen ist. In der Werkstatt haben sie mir gesagt, sie sei nicht mehr zu gebrauchen und ich würde nur meine Zeit vergeuden. Ich stelle erfreut fest, daß dieser Tag mir nicht nur Ärger bringt. Es kann sogar sein, daß die Batterie bis zum Frühjahr hält.
»Ich sehe nur, daß er nicht die Absicht hat, einen kleinen Beitrag zu leisten.«
Sie ist hinter mir hergekommen, unter dem Vorwand, daß sie eine Wäsche machen muß. Ich bleibe hocken und sehe ihr zu, wie sie unsere Bettlaken in die Maschine stopft.
»Hör mal zu«, sage ich. »Versuch dich doch mal in meine Lage zu versetzen.«
Sie stemmt ihre Fäuste in die Hüften.
»Na wunderbar! Dann erklär mir doch bitte, wie wir das alles schaffen sollen!«
»Keine Ahnung.«
Ich nehme die Batterie, gehe zur Treppe und steige ein paar Stufen hoch, bevor ich hinzufüge: »Wäre es dir vielleicht lieber, wenn er im Rollstuhl säße?«
Ich lasse ihr keine Zeit zum Antworten. Oder ich höre einfach nichts.
Die Eisschicht auf der Motorhaube von meinem Volvo ist gut einen Zentimeter dick. Letztes Jahr hatte ich eine Plane gekauft, aber die ist mir gestohlen worden.
[10] Mit einem Schraubenzieher kratze ich die Schlitze frei. Ich baue die Batterie ein. In dem Moment, als ich sie anschließe, fällt mir eine Szene wieder ein, die sich vor vielleicht zwanzig Jahren abgespielt hat. Doch ich sehe alles noch genauso brutal und deutlich vor mir, als wäre es gestern gewesen. Es war an einem Feiertag. Marc und unser Vater gerieten plötzlich in Streit. Ich mischte mich ein, und schließlich landeten wir alle drei auf dem Boden, zwischen den Gästen, und unsere Mutter sprach eine ganze Woche lang kein Wort mehr mit uns.
Das ist so lange her. Ich kann nicht anders, ich muß lächeln, wenn ich daran denke. Bei der Schlägerei bekam Vater einen bösen Schlag auf die Nase. Er blutete wie ein Schwein, doch nicht einmal er selbst konnte sagen, wer ihn derart zugerichtet hatte. Keuchend fixierte einer den anderen, die Fäuste noch immer geballt, die Haare zerzaust, das Hemd aus der Hose gerissen. Vor allem diesen Augenblick sehe ich vor mir. Eine Menge Leute in unserem Umkreis dachten, daß es eines Tages noch böse enden würde mit uns. Sogar echte Freunde der Familie, Leute, die uns gut kannten.
Mir ist eiskalt. Das kleine Thermometer auf dem Handschuhfach zeigt 9° minus. Ich schalte die Heizung ein, doch die Luft wird gegen die vereiste Windschutzscheibe geblasen und fällt mir wie ein Sack voll Steine auf den Kopf.
Kaum bin ich durch die Tür, sagt sie: »Wirklich sehr schlau, was du da gesagt hast. Das ist wirklich intelligent!«
Ich gehe zum Spülbecken, um mir die Hände zu waschen, antworte dann: »Trotzdem, der Gedanke kommt einem, wenn man dich so reden hört…«
Meine Stimme klingt nicht sehr überzeugend. Ich fange [11] an, den Tisch abzuräumen. Sie verschwindet im Schlafzimmer, zieht sich im Zurückkommen einen Pullover über. Sie sieht mich einen Moment an, blinzelt dann und meint, daß sie was im Auge hat. Sie geht ins Bad, ruft mich gleich darauf. Mit der Spitze eines Kleenex befreie ich sie von einer Wimper, die unter dem Lid hängt.
»Du mußt mir Zeit zum Nachdenken geben«, sage ich.
Sie wirft sich einen schnellen Blick im Spiegel zu.
»Scheint wieder in Ordnung zu sein«, meint sie und läßt ihren Rock fallen.
Dann zieht sie ihren Slip aus und wirft ihn in den Korb.
»Du weißt nicht immer, was ich denke«, erklärt sie, als sie ins Zimmer geht. »Glaub mir, du bist sogar weit davon entfernt.«
Sie beugt sich über eine Schublade und zieht eine Handvoll Unterwäsche heraus, die sie im Tageslicht näher untersucht.
»Und dann will ich dir noch etwas sagen«, fährt sie fort und schlüpft dabei in ein frisches Höschen. »Als ich zum ersten Mal geheiratet habe, war mein Trauzeuge ein Homosexueller.« Das Gummiband ihres Slips macht ein schnalzendes Geräusch. »Also erzähl du mir nicht, daß du weißt, was ich denke!«
Sie wird an Ostern fünfundvierzig. Von Zeit zu Zeit rückt sie mit einem Detail aus ihrer Vergangenheit heraus. Neulich habe ich erfahren, daß sie früher Fallschirm gesprungen war, dann, daß sie einmal fast auf einem Polizeirevier vergewaltigt wurde. Und jetzt also, daß sie sich mit Homosexuellen auskennt. Wir leben seit beinahe drei Jahren zusammen. Ich habe natürlich nicht alles nachgeprüft.
[12] Das Telefon klingelt. Es ist das Krankenhaus. Sie wollen wissen, ob wir eine Entscheidung getroffen haben, weil sie meinen Vater nicht länger als eine Woche dabehalten können. Ich verspreche ihnen, im Laufe des Tages vorbeizukommen.
»Nimm du das Auto«, schlägt sie vor.
»Laß nur. Ich kann noch ganz gut laufen.«
Sie mustert mich und meint, daß sie mir die Haare schneiden muß. Ich rate ihr, das Auto am Hang zu parken, falls die Batterie wieder leer wird.
Sie hat noch fünf Minuten. Ich wärme den Kaffee noch mal auf.
»Jedenfalls liegt die Entscheidung bei dir«, sagt sie.
Ich antworte nicht, sehe aus dem Fenster.
»Ich wollte dich nicht ärgern«, seufzt sie. »Es ist dein Bruder. Er hat mich wirklich enttäuscht.«
»Ich war dagegen, daß du zu ihm fährst, stimmt doch, oder nicht?!«
»Ich hatte mir einfach mehr von ihm erwartet…«
Ich schüttle den Kopf wie ein Büffel, der gegen ein Hindernis gerannt ist und einen Moment die Augen zumacht. Dann hole ich den Kaffee und setze mich an den Tisch.
»Ihr habt die gleiche Nase«, bemerkt sie.
»Warte mal, ich glaube, dir ist nicht richtig klar…«
»Mir ist vollkommen klar.«
Wir sehen uns an. Ich sage: »Hör mir mal gut zu… Es handelt sich nicht um einen netten Opa, der brav in seiner Ecke sitzt, also erzähl mir kein dummes Zeug.«
»Ich weiß. Darüber haben wir ja geredet.«
[13] »Es reicht aber nicht, darüber zu reden. Wir drehen uns im Kreis.«
Sie holt eine Zigarette aus ihrer Handtasche, steckt sie sich an und steht dann auf. Kurz darauf höre ich, wie sie pinkelt. Mit zunehmendem Alter ist mir klargeworden, daß ich auf jeden Fall mit einer Frau zusammenleben muß. Das ist ein für allemal entschieden.
Sie steht vor mir, den Mantel über die Schultern geworfen.
»Wie dem auch sei«, sagt sie, »du mußt einfach eine Entscheidung treffen. Blamont behält ihn sicher nicht bis Weihnachten.«
»Ich rede mit ihm. Ich brauche Zeit, um mal Luft zu holen. Sag mal, bist du nicht zu spät dran?«
»Schon okay, ich habe noch Zeit.«
Und zum Beweis gießt sie sich noch eine Tasse Kaffee ein.
»Worauf wartest du denn?« frage ich sie. »Mir kommt jetzt bestimmt keine plötzliche Erleuchtung.«
Die Sonne schiebt sich über die Dächer und scheint in die Küche. Ich schüttle den Kopf: »Ich wüßte gern, was du an meiner Stelle tun würdest!«
»Das hat mich dein Bruder auch gefragt.«
Sie zündet sich noch eine Zigarette an.
»Lieber Himmel! Du endest noch im Sanatorium!«
Nachdem sie gegangen ist, räume ich ein bißchen auf. Ich hole Laken und beziehe das Bett neu. Bevor ich aus dem Haus gehe, überrasche ich mich dabei, wie ich mitten im Wohnzimmer stehenbleibe, regungslos, ohne irgendeinen Gedanken im Kopf.
Ich leihe mir Élisabeths Fahrrad aus – wird Zeit, daß ich [14] mein eigenes zurückbekomme. Ich habe mir eine Mütze aufgesetzt, Handschuhe und meine pelzgefütterte Lederjacke angezogen und einen dicken Schal um den Hals gewickelt, doch auf der Straße kommt mir der eisige Wind mit solcher Wucht entgegen, daß ich mich nur mit Mühe auf dem Rad halten kann.
Ich gehe in die Bar und höre als erstes: »Wirst du dafür bezahlt, bei der Eiseskälte mit dem Rad zu fahren?«
Ich antworte, daß ich schließlich nicht aus Zucker bin, bestelle mir einen Kaffee und hocke mich an die Bar.
»Wir müssen einen Zylinderkopf besorgen«, sagt er zu mir.
»Ja, laßt euch Zeit. Sie nimmt solange mein Auto.«
Er gießt zwei Gläser Schnaps ein.
»Und dein Rücken? Wie steht’s damit?«
»Sieht so aus, als ginge es einigermaßen. Aber ich kann nichts heben.«
»Und was ist mit deinem Vater?«
Ich drehe mich um und sehe nach draußen. Zwei Räumfahrzeuge sind dabei, die Schneemassen auf den Kai zu schieben. Ein bißchen weiter weg, auf dem Containergelände hinter den Kränen, liegt bereits ein riesiger Haufen Schnee. Im letzten Jahr war der Frühling halb vorbei, bis der letzte Schnee geschmolzen ist. Ich dachte schon, er würde nie mehr verschwinden.
»Ich gehe ins Krankenhaus. Sie haben mir eine Woche Zeit gegeben.«
»Ach du Scheiße! Eine Woche…«
Er gießt mir noch ein Glas ein und wirft mir einen Blick zu.
[15] »Wozu hast du dich denn entschlossen?«
»Ich habe mich noch zu gar nichts entschlossen. Ich gehe ins Krankenhaus und bespreche das mit denen.«
Es ist kein Mensch in der Bar, der Raum ist fast leer. Trotzdem beugt er sich zu mir vor.
»Ich kenne sie, sie hat ein gutes Herz. Aber sie wird ihre Meinung ändern, wenn er ihr erst mal auf der Pelle sitzt, das kannst du mir glauben! Versaut euch nicht das Leben… Weißt du, sie sagt manchmal Sachen, die sie nicht wirklich so meint. Da kannst du drauf gehen, ich kenne sie.«
Ich sehe ihn an, ohne zu antworten. Dann laufe ich schnell nach draußen, weil ich Georges Azouline entdeckt habe, der gerade sein Auto vor dem Bürogebäude parkt. Er besieht sich kritisch den Lack an der Wagentür.
»Georges, haben Sie einen Augenblick Zeit?«
Er richtet sich auf und lächelt mich an. Er ist fast ein Greis, doch man muß sich trotzdem vor ihm in acht nehmen.
»Ah, Francis! Wie geht es dir? Was willst du?«
Ich lächle ihn meinerseits an.
»Ja also… Ich muß mit Ihnen über meine Arbeit reden.«
»Dann ist alles in Ordnung? Bist du wieder gesund?«
»Ja, es geht mir besser. Aber ich kann keine schweren Sachen tragen.«
»Ja also, was willst du dann?«
Ich vergrabe die Hände in den Taschen meiner Lederjacke, frage schließlich: »Bin ich gefeuert?«
Er zuckt mit den Achseln. »Habe ich dich gefeuert?«
»Ich weiß nicht recht…«
»Hast du mich sagen hören, daß du gefeuert bist?«
[16] Über seine Schulter hinweg sehe ich Eisschollen auf der Sainte-Bob treiben. Andere zerbersten weiter oben an den Brückenpfeilern.
»Hör zu, Francis, du kannst zurück an deine Stelle, wann immer du willst. Heute, morgen, in sechs Monaten, in zehn Jahren… Das mußt du selbst entscheiden. Mehr kann ich dir nicht anbieten.«
»Glauben Sie etwa, ich tu nur so als ob?«
»Das weißt nur du. Nicht ich.«
Er legt mir die Hand auf die Schulter, während er zu Ende spricht, und läßt mich dann stehen. Mir ist wieder kalt. Ich winke ein paar Männern zu, die mich grüßen und dann in einem Schuppen verschwinden. Der Schneehaufen ist nach Abzug der Räumfahrzeuge doppelt so hoch wie vorher. Schon fast ein kleiner Berg. Ungefähr so groß wie der Haufen meiner Probleme. Und weit entfernt davon, zu schmelzen. Ich sehe ihn mir einen Augenblick an, bevor ich kehrtmache und mich frage, durch welches Wunder ich noch nicht zermatscht auf dem Boden liege.
Vor dem Krankenhaus kette ich mein Fahrrad an einen Betonpfeiler an. Ich hasse es hierherzukommen.
Victor Blamont ist für die psychiatrische Abteilung zuständig. Unser Umgang miteinander ist sehr viel herzlicher geworden, seit mein Vater nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Vorher hat er sich auf ›Guten Tag‹ und ›Auf Wiedersehen‹ beschränkt, wenn wir uns im Ruderclub begegnet sind, während Victor heute davon redet, Élisabeth und mich zum Essen einzuladen, und meint, wir sollten mal einen Termin ausmachen. Ich bin nicht gerade begeistert [17] davon, doch dank ihm darf mein Vater noch im Krankenhaus bleiben. Wenn er nichts unternommen hätte, dann hätten sie ihn längst rausgeworfen.
»Wir wollen nicht übertreiben«, sagt er und bietet mir eine Zigarette an. »Ich würde Ihnen gerne mehr helfen, wenn ich könnte.«
»Hören Sie… Es wäre für mich eine Erleichterung, wenn Sie ihn noch vierzehn Tage dabehalten könnten. Aber nur, wenn Sie dadurch keine Schwierigkeiten bekommen.«
Er lächelt. Dann steht er auf und setzt sich mir gegenüber auf die Schreibtischkante.
»Schwierigkeiten? Darüber machen Sie sich mal keine Gedanken, Francis. Doch ich mache mir Sorgen um Sie. Sie stehen vor einer furchtbaren Entscheidung.«
»Ja, es ist nicht einfach.«
»Francis, Sie wissen doch, daß Sie mir sympathisch sind, oder?«
»Ja, ich denke schon…«
»Gut, dann hören Sie auf mich, denn ich spreche als Freund zu Ihnen. Tun Sie es nicht. Denken Sie erst gar nicht daran. Das wirft Ihr ganzes Leben über den Haufen, glauben Sie mir.«
Ich schüttle den Kopf und kneife die Lippen zusammen. Ich kenne ihn nicht gut genug, um mit ihm über mein Leben zu sprechen.
»Das ist eine viel zu große Belastung«, fährt er fort. »Die schwerste, die man sich vorstellen kann.«
Ich warte ein wenig, dann frage ich ihn, wie es meinem Vater geht.
»Gut«, sagt er und seufzt. »Wenn das noch irgend etwas [18] bedeutet. Alzheimer kann sich über zehn Jahre hinziehen, wissen Sie. Bei Ihrem Vater kann es sich auch um Pick handeln, doch das ist die gleiche Art von Gehirnzellenschwund. In dem einen Fall ist die Krankheit diffuser, in dem anderen etwas genauer definiert.«
Da ich die Stirn runzle, versichert er mir, daß es kaum einen Unterschied gibt, außer daß sich eine Pick-Erkrankung schneller dramatisch zuspitzt. Aber er zuckt mit den Schultern, um mir zu zeigen, daß er nicht allzuviel darüber weiß.
Er geht hinüber zum Fenster.
»Francis«, sagt er, »kommen Sie mal einen Moment her.«
Ich gehe hin, und wir sehen uns zusammen die Landschaft an. Der Himmel ist blau. Am Ufer gegenüber, an der Mündung der Sainte-Bob, sind grün- und gelbbelaubte Bäume zu sehen, mit einzelnen Flecken in leuchtendem Rot. Man ist dabei, die Eisdecke stromaufwärts aufzubrechen, um die Becken zu erreichen, und große, durchscheinende Schollen treiben Richtung Meer, vereinzeln sich dann und werden langsamer. Zur Linken, jenseits der Bäume, glänzt der Schnee auf dem Land und den Dächern der Häuser.
»Finden Sie nicht, daß das Leben es wert ist, gelebt zu werden?« fragt er mich schließlich.
»Doch, Sie haben recht«, antworte ich, um ihm nicht zu widersprechen.
»Wissen Sie«, fährt er mit einem Blick irgendwohin ins Leere fort, »wir kommen in ein Alter, in dem man keine Zeit mehr zu verlieren hat. Fühlen Sie sich nicht auch voller Lust auf alles, was Sie umgibt? Juckt es Sie nicht irgendwie?«
[19] »Doch, das kommt vor.«
Er legt mir eine Hand auf die Schulter und sieht mich freundschaftlich an.
»Wenn das so ist, Francis, dann passen Sie auf. Tun Sie nichts Unüberlegtes. Sollten Sie beschließen, Ihren Vater zu sich zu nehmen, fürchte ich, daß es mit all diesen Dingen vorbei ist. Wenn ein Mann die Fünfzig erreicht, muß er sich entscheiden, ob er leben oder sich endgültig beerdigen lassen will.«
Ich versuche einen Scherz: »Falls es darum geht, zögere ich keine Sekunde!«
Er will, daß wir uns nachher zum Essen treffen, aber ich bin nicht in der Stimmung dazu und sage ihm, daß es nicht geht. Daraufhin nimmt er seinen Kalender und fragt, ob Élisabeth und ich am kommenden Samstag Zeit hätten. Ich zögere eine Sekunde, bevor ich kapituliere: »Ja also… Ich muß erst mit ihr reden, aber ich glaube, das müßte gehen.«
Er begleitet mich hinaus auf den Gang. Die Fenster sind vergittert, doch er erzählt mir davon, wie er oft frühmorgens am Strand entlangläuft, und von der unglaublichen Lust auf Leben, die er dabei empfindet.
»Aber im Ernst! Reizt Sie das nicht?«
Er bleibt vor dem Aufzug stehen und drückt auf einen Knopf.
»Francis, Sie müssen sich eine Sache klarmachen: Uns bleiben nur noch zehn oder fünfzehn Jahre. Das ist, als hätte der Wald Feuer gefangen, wissen Sie.«
Ich sage nichts, warte nur, daß er in den Aufzug steigt. Er verabschiedet sich mit: »Dann also am Samstag?«
Mein Vater sitzt in seinem Zimmer an einem kleinen [20] Tisch. Er ißt gerade. Als er mich sieht, strahlt er über das ganze Gesicht. Er schiebt mir den Teller zu.
»Nein, danke.«
»Nimm die Wurst!« drängt er mich.
Ich schüttle den Kopf und setze mich ihm gegenüber hin.
»Na? Wie geht’s?«
»Nun mach schon, nimm die Wurst!«
Ich beiße ein Stück ab. Er sieht mir zufrieden zu. Jedesmal, wenn sich unsere Blicke treffen und ich nicht wegschaue, lacht er, als würde ich ihm einen Witz oder irgend etwas Verrücktes erzählen.
»Wo ist dein Bruder?« fragt er.
»Keine Ahnung.«
»Ist er nicht da, der Feigling?«
Seit zwanzig Jahren, vielleicht auch länger, haben sie sich nicht gesehen, kein Wort miteinander gewechselt.
Eine Frau im Nachthemd steht plötzlich in der Tür. Sie starrt uns erschrocken an.
»Hast du die Titten gesehen?« fragt er.
Das ist ungefähr das einzige, was ich an ihm wiedererkenne, dieser geile Blick, mit dem er manchmal eine Frau ansah und den er sehr früh mit seinen Söhnen teilen wollte, schon als wir noch Kinder waren. Ich erinnere mich, wie unwohl wir uns dabei fühlten und wie er unsere Reaktion genau beobachtete. Er ist seit einem Monat in der Klinik, doch man könnte meinen, er habe schon zehn Jahre hier drinnen verbracht. Ich frage mich, ob er noch weiß, wer ich bin. Blamont meint, daß er ab und zu ein paar klare Momente hat. Aber das ist auch schon die große Ausnahme, denke ich.
[21] Er ist aufgestanden und kramt in seinem Koffer. Er holt haufenweise Tütchen hervor, die er auf den Tisch legt. Zucker in Portionsverpackung.
Wir gehen zum Rauchen an ein Fenster im Flur.
»Ich kann sehen, wo du wohnst«, sagt er.
Sein Finger zeigt auf das Feuerwehrhaus.
Élisabeth arbeitet bei Melloson, in der dritten Etage. Ich mache in der ersten halt, um Unterwäsche für meinen Vater zu kaufen. Ich weiß nicht, was er immer damit anstellt; das weiß niemand.
Seit einem Monat arbeitet sie wieder mit Monique zusammen. Sie sind jetzt beide in der Wäscheabteilung. Normalerweise wird es nicht gern gesehen, wenn man kommt, um sich mit den Verkäuferinnen zu unterhalten, aber ich muß ja nichts Bestimmtes besprechen. Es ist schön warm hier drinnen.
Élisabeth ist beschäftigt. Sie wirft mir einen fragenden Blick zu. Ich gebe ihr zu verstehen, daß nichts Besonderes ist.
»Sie ist eine Heilige!« seufzt Monique.
Sie hat sich über den Ständer mit Strümpfen gebeugt, der zwischen uns steht, und fährt prüfend mit den Fingerspitzen darüber.
»Was habe ich denn getan?«
»Du hast gar nichts getan. Noch nicht…«
Da ich nicht antworte, wirft sie mir einen kurzen Blick zu und fügt hinzu: »Mag sein, daß es mich nichts angeht, aber ich sage dir doch meine Meinung. Manchmal frage ich mich, ob du nicht vollkommen verrückt bist.«
[22] »Ich habe doch noch gar nichts entschieden.«
»Genau das meine ich ja.«
Mir reicht es. Ich lasse sie stehen. Sie startet einen weiteren Angriff, hat ein paar Unterröcke über die Schulter geworfen, als müßte sie die unbedingt gerade jetzt zusammenlegen.
»Und du hast keine Arbeit mehr! Glaubst du, daß du dir erlauben kannst, irgend etwas zu planen?«
»Darum geht es nicht. Ich komme immer irgendwie durch.«
Élisabeth taucht auf, fragt: »Worüber redet ihr beiden denn?«
»Ich sage ihm, was ich ihm zu sagen habe«, erklärt Monique. »Er muß sich nur ein Beispiel an seinem Bruder nehmen.«
»Er ist alt genug, um zu wissen, was er zu tun hat.«
»Da bin ich mir nicht so sicher…« Sie wendet sich mir zu. »Verdammt! Du bist schließlich nicht allein!«
Ich gehe lieber.
Trotz meiner Rückenprobleme spüre ich, daß ich eine Runde rudern könnte. Seit vierzehn Tagen habe ich kein Ruder angefaßt, und das fehlt mir langsam. Ich zögere kurz, dann gehe ich hinunter zum Ufer. Ich sehe Zweierboote flußaufwärts zu den Becken fahren. Es drehen sich noch ein paar Eisschollen in der Strömung, doch das sind die letzten. Und weiter oben ist der Fluß vollkommen frei. Ich bin unentschlossen. Ich hätte wirklich Lust, doch schließlich lasse ich es sein. Ich habe Angst, Victor Blamont in die Arme zu laufen.
[23] Élisabeth kommt nach Hause. Ich setze mich hin, damit sie mir die Haare schneiden kann.
»Leg los, nur keine Hemmungen«, sage ich.
»Aber doch nicht zu kurz?«
»Ich hätte sie gern so.«
»Ich schneide sie lieber ein bißchen weniger kurz und dafür öfter. Ich finde, so kurz steht dir nicht.«
»Ich sehe ja aus wie ein Mädchen. Tu, was ich dir sage.«
»Sie sind ein bißchen lang, das ist alles. Ich schneide sie dir zwei oder drei Zentimeter kürzer.«
Ich drehe mich zu ihr um, dann nehme ich das Handtuch von meiner Schulter und schleudre es auf den Boden, stehe auf und gehe aus der Küche.
Ich setze mich mit der Zeitung in einen Sessel, lese eine halbe Minute darin, die Haare feucht, es tropft auf meine Schultern. Als ich aufschaue, steht sie in der Tür, Kamm und Schere noch in der Hand.
»Meinst du nicht, daß du übertreibst?« fragt sie.
Ich falte die Zeitung zusammen und sage: »Nun? Wollen wir?«
Ich setze mich wieder in die Küche.
»Hör zu, ich bin müde.«
»Ich bin auch müde, stell dir vor. Ich habe die Nacht im Zug verbracht.«
Während sie das Handtuch in meinem Rücken richtet, halte ich ihr mit schleppender Stimme vor: »Habe ich es dir etwa nicht gesagt? ›Élisabeth, das führt zu nichts… Élisabeth, hör mir zu… Élisabeth, sei vernünftig…‹ Hast du auf mich gehört? Du hast nicht auf mich gehört. Also beklag dich nicht.«
[24] Das Telefon klingelt. Mein Sohn ist dran.
»Sag mal«, fängt er an, »ich hab hier zwei Pizzas. Wollt ihr die?«
»Was ist drauf?«
»Schinken und Artischockenherzen.«
»Das ist gut. Bring sie her.«
Élisabeth hat sich in der Zwischenzeit hingesetzt. Wir machen eine schwierige Phase durch. Alles scheint schiefzugehen. Ich weiß nicht, wohin das noch führen soll. Alles, was wir anfassen, fliegt gleich in die Luft.
Ich setze mich wieder auf meinen Stuhl. Sie muß mir die Haare noch einmal naß machen, weil sie inzwischen fast trocken sind. Dann fliegt die Schere über meinen Kopf. Am liebsten würde ich Élisabeth bitten, mir den Kopf kahl zu scheren, doch ich halte mich zurück. Ich habe das Gefühl, das würde mich ein bißchen friedlicher stimmen. Aber nun gut.
»Und? Was hat Blamont gesagt?« fragt sie.
»Ist soweit in Ordnung. Er setzt uns nicht die Pistole auf die Brust. Er tut, was er kann. Wir können uns auf ihn verlassen.«
Sie drückt meinen Kopf nach vorne. Ich sehe die langen Haare auf dem Boden, dunkle Locken, und fahre fort: »Er findet mich sympathisch. Er hat uns sogar für Samstag mittag zum Essen eingeladen. Ich konnte nicht nein sagen.«
»Warum hättest du denn nein sagen sollen? Das bringt uns wenigstens mal auf andere Gedanken. Und die beiden machen eigentlich einen netten Eindruck.«
»Wir kennen sie doch viel zuwenig. Vielleicht tun sie das nur, weil sie sich gegenseitig auf die Nerven gehen.«
[25] »In dem Fall machen sie es ganz richtig, wenn sie versuchen, etwas zu unternehmen.«
Ich habe die Anspielung sehr wohl verstanden. Aber ich antworte lieber nicht.
Ein paar Minuten später kommt Patrick mit seinen Pizzas. Ich bin gerade im Badezimmer dabei, mir meinen neuen Kopf genauer anzusehen. Ich denke daran, daß der Wald schon brennt. Höre, wie Élisabeth Patrick fragt, ob er mit uns essen will. Er lehnt ab, sagt, er könne gerade mal fünf Minuten bleiben. Ich gehe zu ihnen in die Küche, frage ihn: »Und was ist mit meinem Fahrrad?«
Er starrt mich einen Moment an, schüttelt dann den Kopf: »Ja, ich weiß…«
»Ich brauche es. Wir hatten eine Woche abgemacht. Du mußt die Sache doch irgendwie regeln.«
Ich schiebe mich an ihm vorbei und wende mich den Pizzas zu, sage noch: »Ich möchte dich nicht mehr daran erinnern müssen.«
Ich nehme an, daß sie sich hinter meinem Rücken Blicke zuwerfen, daß sie die Augen verdreht, während er die Zähne zusammenbeißt, aber das läßt mich völlig kalt. Wenn man mir mit über zwanzig das Fahrrad geklaut hätte, wäre ich nicht zu meinem Vater gelaufen und hätte mir seins geholt. Er hätte mich außerdem zum Teufel gejagt.
Ich drehe mich um und erkläre: »Das ist eine Frage des Respekts vor den anderen. Du kannst dein Problem nicht einfach mir aufladen. So läuft das nicht mehr.«
Ich bekomme nicht heraus, ob das, was ich ihm sage, den geringsten Eindruck auf ihn macht. Er ist wie seine Mutter. Zehn Jahre meines Lebens habe ich mit einer Frau [26] zusammengelebt, der ich nie nähergekommen bin. Das haben andere für mich übernommen.
»Okay. Bist du fertig?« schaltet Élisabeth sich ein.
»Geht’s deinem Rücken besser?«
Er ist ein Meister im Themenwechsel. Wenn ich von seiner Mutter wissen wollte, was in ihrem Kopf vorging, beschränkte sie sich darauf, woanders hinzusehen.
»Jedenfalls ist auf den Röntgenaufnahmen nichts zu erkennen«, sagt Élisabeth.
»Wenn auf den Röntgenaufnahmen nichts zu erkennen ist, heißt das nicht, daß ich keinen kaputten Rücken habe. Aber glaub doch, was du willst. Niemand zwingt dich, mit einem Lügner zusammenzuleben.«
»Ich habe nicht gesagt, daß du ein Lügner bist.«
»Aber das denkst du doch.«
Ich sehe, wie ihre Nasenflügel beben. Sie wendet sich Patrick zu: »Du mußt wissen, daß dein Vater eine besondere Gabe hat: Er kann meine Gedanken lesen. Bald werde ich nicht mal mehr den Mund aufmachen müssen!«
»Man kann mit dir wirklich nicht diskutieren«, sagt Patrick zu mir.
»Ach, was soll’s«, fährt Élisabeth fort und greift nach ihrer Handtasche. »Er wird sich nicht gerade jetzt ändern.« Sie nimmt sich von ihren Zigaretten und wirft das Päckchen auf den Tisch. »Sieht jedenfalls nicht danach aus.«
Ich lasse ein spöttisches Lachen hören. Élisabeth mustert mich, als sie sich ihre Zigarette ansteckt, und fragt Patrick schließlich, wie denn er mein Aussehen findet. Bevor er antworten kann, sagt sie mit resignierter Miene zu mir: »Du gibst dir kein bißchen Mühe. Dir ist alles ganz schön egal.«
[27] Ich mache den Ofen an und schiebe die Pizzas rein, damit sie warm bleiben. Patrick erzählt, daß ich mir einmal den Kopf rasiert habe und daß seine Mutter sich wahnsinnig darüber aufgeregt hat. Ich sage: »Ich weiß von einem, der ist an Krebs gestorben, ohne daß sie den jemals finden konnten.«
»Francis, du hast keinen Krebs«, seufzt sie.
»Weiß ich denn, was ich habe?! Meinst du, ich halte diese Röntgenbilder für eine göttliche Offenbarung?«
»Du hast keinen Krebs, das ist alles!« wiederholt sie eigensinnig.
»Dann nenn es meinetwegen nicht ›Krebs‹, nenn es doch ›Arsch auf Grundeis‹, wenn es dir Spaß macht.«
»Du übertreibst einfach«, murmelt Patrick. »Wir haben nicht gesagt, daß du nichts hast. Nur, daß es vielleicht nicht so schlimm ist.«
Ich sehe ihn einen Moment lang scharf an, bevor ich ihm sage, wie ich die Sache sehe: »Ich stelle mir bei dir immer die gleiche Frage: Wie kommt es, daß du grundsätzlich auf ihrer Seite bist? Bist du das nicht ein bißchen leid?«
Er legt seine Stirn in Falten. Sie sieht plötzlich aus wie ein alter Hintern. Ich sage noch: »Und du kannst mir trotzdem mein Fahrrad zurückbringen. Ich habe dir ja schon erklärt, daß ich es brauche. Und tschüs! Ich gehe unter die Dusche.«
Als ich zurückkomme, ist er weg. Élisabeth und ich essen still seine Pizzas, dann meint sie: »Du könntest ein bißchen netter zu ihm sein.«
»Seine Mutter und er haben mir das Leben schwergemacht, das kannst du mir glauben.«
»Er war noch ein Kind! Das ist doch normal…«
[28] »Ich finde nicht, daß das normal war. Ich konnte nie mit ihm reden. Und das wird sich nicht gerade jetzt ändern.«
Ich stehe auf, um abzuräumen. Ich kann ihr gerade noch den Teller wegziehen, bevor sie ihre Zigarette darauf ausdrückt. Und schon ist sie auf der Suche nach einem Aschenbecher.
»Du bist vielleicht lustig«, sage ich. »Du gehörst zu den Leuten, die sich vorstellen, daß es ein großes Glück ist, Kinder zu haben. Ich sage dir eines: Das funktioniert nicht immer. Es ist sogar selten so.«
Sie setzt sich wieder an den Tisch und steckt sich noch eine an, während ich mit dem Abwasch beginne.
»Weißt du, ich bin davon überzeugt, daß ich eine gute Mutter gewesen wäre. Was meinst du?«
Ich sehe auf die Wand vor mir, über dem Spülbecken.
»Keine Ahnung… Aber warum nicht?«
»Nimm zum Beispiel Monique. Sie interessiert das überhaupt nicht. So selbstverständlich ist das nicht, will ich damit sagen.«
»Aber wie willst du das wissen? Kannst du mir darauf eine Antwort geben?«
»Habe ich dir erzählt, daß ich einmal fast ein Kind bekommen hätte?«
»Was du nicht sagst!«
»Ich bin sicher, daß ich mich wegen einem Fahrrad nicht so anstellen würde.«
Ich trockne mir die Hände ab und sehe sie an: »Hauptsache, du bist dir da sicher.«
Im Wohnzimmer lese ich kurz darauf in der [29] Lokalzeitung, daß Victor Blamont Vorsitzender des Ruderclubs geworden ist.
»Sieh an! Und wie kommt er zu der Ehre?« wundert sich Élisabeth.
Ich zucke die Achseln, um ihr zu zeigen, daß ich keine Ahnung habe. Sie ist dabei, sich über einem Spiegel, den sie sich zwischen die Knie geklemmt hat, die Augenbrauen zu zupfen.
»Und?… Bist du sicher, daß du keine Lust hast? Kannst du Clint Eastwood nicht mehr leiden?«
Ich schüttle den Kopf und lese weiter, bis ich es habe: »Ach so! Das ist es! Er hat im letzten Jahr eine Spende gemacht. Sie sagen nicht wieviel, es heißt nur eine ›beträchtliche‹ Summe. Lieber Himmel! Er muß Geld wie Heu haben, dieser kleine Kacker! Weißt du, was er mir heute morgen erzählt hat? Daß das Leben es wert ist, gelebt zu werden!«
Ich lasse die Zeitung sinken und lehne mich zurück, die Hände im Nacken verschränkt: »Der wäre doch ein wunderbarer Vater. Zaster und eine schöne Philosophie!«
Am nächsten Morgen, nachdem Élisabeth aus dem Haus ist, erhalte ich einen Anruf von Marc. Das letzte Mal, daß wir miteinander geredet haben, war ich noch nicht mit ihr zusammen. Das heißt, es war nicht gerade gestern. Ich lasse mich vor Überraschung in meinen Sessel fallen.
»Marc? Ich kann dich nicht gut verstehen. Wo bist du?«
»Ich bin zu Hause. Also? Was ist denn bei euch los? Ich habe Besuch von deiner Freundin gehabt. Meine Herren! Bist du verrückt geworden?«
[30] »Sag mal, hast du mich angerufen, um mich zu beschimpfen?«
»Du weißt sehr gut, daß ich nichts mehr von ihm hören will.«
»Ich wollte nicht, daß sie zu dir fährt. Was hast du ihr gesagt?«
»Ich habe ihr nichts gesagt. Aber laß ihn, wo er ist, verstehst du mich?!«
»Man kann ihn nicht lassen, wo er ist. Sie werfen ihn da in vierzehn Tagen raus.«
»Die setzen ihn nicht vor die Tür. Er kommt in ein Pflegeheim.«
»Ja, das habe ich mir angesehen. Da würdest du nicht mal einen Hund reinstecken. Und die guten Heime sind viel zu teuer.«
»Francis, hör mir mal zu. Ich könnte es nicht ertragen, daß er seine Tage in einem Viersternehotel beschließt. Selbst wenn ich das Geld dafür hätte, würde ich keinen Finger für ihn rühren.«
»Erklär das mal einer Frau wie Élisabeth. Sie hat einfach ein zu gutes Herz.«
»Ich möchte eines wissen: Hast du vor, ihn zu dir zu nehmen?«
»Ich habe noch nichts entschieden. Aber ich glaube nicht.«
»Du weißt, daß ich dir das nie verzeihen würde, oder?«
»Ja, das kann ich mir denken.«
»Und du würdest es trotzdem tun?«
»Ich weiß nicht… Sag mal, es heißt, du wärst schwul geworden.«
[31] Ein kurzes Lachen am anderen Ende der Leitung.
»Stimmt schon. Habe ich nie mit dir darüber geredet?«
»Nein, wir reden nicht sehr oft miteinander.«
»Und? Stört’s dich?«
»Was? Daß wir nicht sehr oft miteinander reden?«
»Es gibt nicht viel dazu zu sagen, weißt du.«
»Höchstens, daß er mit der Flinte auf dich geballert hätte, wenn er das erfahren hätte.«
»Zu was anderem wäre er ja wohl nicht fähig, oder?«
Ich bleibe noch eine Weile im Sessel sitzen, nachdem ich aufgelegt habe. Den ganzen Tag lang verfolgt mich dieses Gespräch, ich muß immer wieder daran denken.