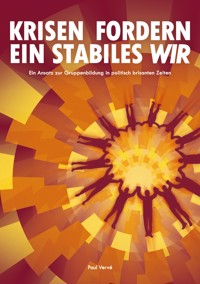
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Gerade in der heutigen Zeit zwischen "Neuer Normalität" und "Zeitenwende" stellt sich die Frage, wer hier wen beherrscht. Aus demokratischer Sicht sollten Krisen- und Kriegsanstrengungen die Gesellschaften herausfordern, für mehr Klarheit und Optionen sorgen. Gemeinsam sich in Einhelligkeit zu üben und in absehbaren Notlagen einander helfen zu können, setzt allerdings eine erfolgreiche und stabile Gruppenbildung voraus. Hier möchte der Autor Hilfe in Form eines Ansatzes anbieten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für eine Gemeinschaft, die mir sehr am Herzen liegt
Inhaltsverzeichnis
0.1 Einleitung (Anlass)
0.2 Zur Nutzung des Buches
1 Ausgangsüberlegungen
1.1 Ein Bild von Organisation finden
1.2 Mehrere Formen der Einigkeit
1.3 Neugierig auf die eigene Zukunft
1.4 Heterogenität der Gruppen
1.5 Komplementärcharaktere
2 Einige Ideen für Netzwerke
2.1 Die Rolle der Sprache
2.2 Der Diskurs als Raum
2.3 Zwei Arten des Konsens
2.4 Konsens als Schnittmenge
2.5 Zwischen Netzwerk und Gruppe
2.6 Aktiva und Passiva: Wir brauchen beide!
2.7 Ruhe bewahren und bitte kein Aktionismus
3 Ein Ansatz für Gruppen
3.1 Ein konsensorientierter Diskurs
3.2 Vier Funktionen – ein Überblick
3.3 Ein Ideal (I): Die diskrete Bahn (der Gruppe)
3.4 Ein Ideal (II): Die diskrete Bahn (der Mitglieder)
3.5 I: Was können wir tun? Lernen! (Schnelleinstieg)
3.5.1 Die Rolle des Anlasses
3.5.2 Die Rolle der Vorarbeit
3.5.3 Die Rolle des Konsens
3.5.4 Die Rolle innerer Konflikte
3.6 Zwei Formen der Priorisierung
3.7 Konkretion und Anschauung
3.8 Mit einem gemeinsamen Rahmen geht’s
4 Pluralität – Wir sind nicht gleich! Und das ist gut so...
4.1 Die Rollen der „Alphas“
4.2 Zwischen „Küche“ und „Bad“
4.3 Es gibt nur ein Fernziel: Kooperation!
4.4 Motivationsschlüssel
4.5 Sozialbindungen als Garant des Vertrauens
4.6 Des Pudels Kern: Die eigene Entscheidung
4.7 Gefahren
4.8 Es gibt noch Vernunft – und auch ein Happy End?
5 Ordnung muss sein.Aber nicht jede...
5.1 Eine Hand voll Literaturvorschläge...
5.2 Ende
0.1 Einleitung (Anlass)
Mit diesem Buch sollen einige Erfahrungen im Bereich Netzwerk- und Gruppenbildung seit Anfang 2020 verarbeitet werden.
Die politischen Veränderungen (vorzugsweise die C-Krise und der Ukraine-Konflikt) werden dabei lediglich als Anlass und selbst nur marginal betrachtet. Dahingehend erscheinen erfreulicherweise weiterhin kritische Beiträge, wenn auch zu wenige.
Doch wichtiger sind hingegen die selbsterlebten Umstände und Einflüsse, die für eine Reihe erwartbarer Reaktionen seitens der Gesellschaften sorgten. Auch der Staat ging mit dem Anfang der C-Krise von gesellschaftlichen Reaktionen des Widerstandes aus und er reagierte auf kleinste Anzeichen ungewohnt streng oder griff teilweise sogar vorweg – ein Aspekt, der ebenfalls die Neue Normalität mitprägte.
Dazu zählt auch die Verschiebung der verfassungsschutzrelevanten Auffassungen zum Thema Opposition und Staatsdelegitimierung. Die Definition von Staatsfeindlichkeit wird zeitgleich erweitert und umfasst zunehmend jede Form von Kritik am Staat, unabhängig der motivationalen Herkunft. Das Phänomen „Cancel-Culture“ dürfte keine zufällige gesellschaftliche Begleiterscheinung sein.
Mit der Ukraine-Krise – zunehmend als Kriegszustand kommuniziert – werden weiterhin kritische Stimmen verstärkt unterdrückt. Von den Zensurmaßnahmen der sozialen Medien ganz zu schweigen. Frieden braucht Verteidigung; ein Slogan eines Wahlplakates 2024(Q2) illustriert eine zunehmende Kriegsrhetorik.
Dies sind einige Schlaglichter der Veränderung, die der Gesellschaft unmissverständlich eine Botschaft mitgibt: Sachbezogene Kritik ist unerwünscht geworden und Faktenchecker verkünden die eine Wahrheit und „korrigieren“ jede konsensabweichende Interpretation.
Eine schöne neue Welt, die wir nur aus dystopischem Literaturgut kennen, deren Ansätze wir in einer (selbst unerlebten) Vergangenheit erinnern sollen oder gewohnt fernen Ländern unterstellt werden. Doch: Die Dystopie prägt als „Neue Normalität“ oder „Zeitenwende“ unseren Alltag – seitens der Gesellschaft überwiegend widerstandslos. Erstaunlich.
Wer hätte gedacht, dass derart wenige kritische Diskussionen zur Zeit der „Lockdowns“ den öffentlichen Diskurs gestalteten. Durch die Leitmedien wird Meinungsfreiheit propagiert und diejenigen, die sachlich argumentativ nicht widerlegt werden können, machen die Erfahrung, Teil eines abschreckenden PR-Sonderprogramms zu werden – bestenfalls.
Der kritische Teil unserer Gesellschaft dürfte ab Anfang 2020 die gesellschaftliche Situation so – oder so ähnlich – wahrgenommen haben.
Dabei sind die zentralen Themen kein Geheimnis. Eines dieser Themen wird von Susan George im Jahre 1999 unter dem Titel The Lugano Report: On Preserving Capitalism in the Twenty-first Century auf beeindruckende Weise dargestellt. Das Fazit des Reports ist eindeutig: Ohne eine effektive Reduktion der Weltbevölkerung wird unser ökonomisches und politisches Dasein im 21. Jahrhundert global umfassend kollabieren.
Georges Report mag fiktiv sein, aber die von ihr angeführten Eckdaten, Statistiken und Prognosen sind es nicht. Der Report geht praktisch weit über das hinaus, was der Club of Rome zwei Jahrzehnte zuvor noch in seinen Berichten lediglich andeutete. Somit geht es im Lugano Report um praktische Empfehlungen an die Weltelite, wie die Weltbevölkerung reduziert werden sollte – nicht ob. Da die menschliche Population sich zwischen 1960 und 2000 verdoppelte, dürfte es nicht schwierig sein, zu erahnen, welche Kräfte in Zukunft aufeinandertreffen werden.
Georges Buch ist nun ein Vierteljahrhundert alt und alle Geister, die sich im Zuge der Globalisierung auch nur einmal kritischer die Frage nach der Rolle des Staates im Zusammenhang mit dem Thema Bevölkerungswachstum stellten, müssten erkannt haben, dass die Gesellschaften und ihre Dezimierung als Schlüssel zum Machterhalt und Aufrechterhaltung des Status quo gesehen werden – ob nun aus ökonomischen, politischen oder ökologischen Gründen.
Die Massenimpfung und der Wiedereintritt in ein kriegerisches Zeitalter sprechen dahingehend Bände und die ökologische Frage hat bereits einen breiten Eingang in den öffentlichen Diskurs gefunden. Schlussendlich kann noch die künstlich herbeigeführte sexuelle Desorientierung angeführt werden, die wir unserem Nachwuchs „angedeihen“ lassen.
Die Jagd nach Hebammen mit dem Vorwurf der Hexerei (vorwiegend im 17. Jahrhundert) wird ersetzt durch die Verfolgung kritischer Ärzte und Richter, die es wagten Maskenbefreiungen auszustellen oder anzuerkennen. Zwar gab es keine öffentlichen Verbrennungen, aber so manche Approbation ging schon in Rauch auf und das letzte gerichtliche Urteil ist bis heute noch nicht gesprochen. Und das Konzept, bestrafe einen, erziehe tausend ist ebenfalls nicht gänzlich von der Hand zu weisen – auch heute noch.
Diese hier aufgeführten, gut wahrnehmbaren Phänomene haben (bei aufgebrachtem Interesse) einen Teil der Gesellschaft umdenken lassen. Mitbürger, die sich daraufhin fragten, ob sie denn allein im Familien-, Freundes- oder Kollegenkreis die Rolle des Schwarzen Schafes in der C-Krise mimten, suchten Anschluss und damit Menschen, welche die zuvor unvorstellbaren Eingriffe in die Gesellschaft als wenigstens fragwürdig einstuften.1 Diese Mitbürger bekamen nicht aus viralen, sondern aus politischen Gründen Angst und standen mit dieser zumeist allein dar. Mittlerweile ist innerhalb unserer Medienlandschaft der Weg vom Coronaleugner zum Putin-Versteher nicht weit und wehe dem, der den Staat delegitimiert.
Diese neuen Einflüsse im öffentlichen Diskurs und somit in unserer Gesellschaft ließen sich aber nicht alle Mitbürger gefallen. Und was machten die Menschen, wenn sie den Mut aufbrachten, sich während der Lockdowns nicht mit der eigenen Isolierung abzufinden und sich den thematischen Widersprüchen nicht verschlossen?
Einige demonstrierten, andere traten neuen Parteien bei oder gründeten Vereine wie Eltern, Ärzte oder Studenten „stehen auf“. Kurz: Sie suchten und fanden sich.
Doch was machten diese teilweise verschreckten, teilweise wachen Mitbürger während sie anerkannten, dass sie sich zwar fanden, aber gemeinsam feststellten, dass sie nur Wenige waren? Sie gaben sich Aufgaben: „Wir müssen die anderen aufwecken!!!“, so hieß es am Anfang. „Auf dass wir mehr und irgendwann viele werden, sodass der Staat uns nicht mehr ignorieren kann“, so die Hoffnungen der ersten Stunde, die von Anfang an enttäuscht wurden, sich aber Dank der gerade entstandenen und medial zügig attackierten Bewegungen u.a. Querdenken noch lange hielten.
Entgegen dieser Hoffnungen entwickelte sich ein kritischer Teil als Netzwerke relativ schnell, doch der Zulauf ebbte spürbar spätestens mit den Lockerungen der Maßnahmen ab. Es war, offiziell und gefühlt, Anfang 2023 pandemisch vorbei. Seltsamerweise wurden im Winter, der wohl gesundheitlich anspruchsvollsten Zeit des Jahres und zudem Grippesaison, fast alle C-Maßnahmen fallen gelassen. Vieles von der „Neuen Normalität“ fühlte sich seither wieder recht vertraut an. Affenpocken kamen als Thema kurz auf, aber LONG-COVID blieb – wie auch eine kolossale weltweite Impfkampagne samt Folgen.
Die klare Trennung zwischen den Symptomen von LONG-COVID und den Nebenwirkungen der Impfstoffe dürfte von Anbeginn bis heute schwierig sein, nicht zuletzt weil heute wieder Krieg herrscht. Die Ukraine-Krise verdrängt das Problemvirus samt Varianten und samt der Folgen der Maßnahmen. Mal schauen, wie lange noch.
Soweit ein knapper einleitender Rückblick (aktueller Stand 2024 (Q2)).
Uns soll am bisherigen Geschehen anhand einiger Leitfragen Folgendes interessieren:
Wenn sich die Menschen in einer politisch brisanten Zeit suchen, welche Bedeutung hat diese Situation aus Sicht der Beteiligten und gleichsam aus der Sicht des Staates? Was heißt es, Gleichgesinnte gefunden zu haben? Ist man gemeinsam gleich ein Staatsfeind, wenn die geteilte Meinung darin besteht, mit dem staatlichen Vorgehen nicht einverstanden zu sein? Wie kann man sich verhalten, nach dem Demonstrieren, Petitionen, Parteiengründungen und die Anwendung gesunden Menschenverstandes entweder zu nichts führte oder gar bis heute zum Teil medial und anderweitig geahndet wird?
Wer hätte gedacht, dass man, um seinen politischen Unwillen zu zeigen, scheinbar allein das Spazierengehen (zu Beginn nur mit Polizeiaufgebot) einem noch bleibt? Noch heute! Kritische Themen werden totgeschwiegen, während sie unser aller Leben mitgestalten. Und: Wie lässt bzw. lassen sich die Spaltung(en) der Gesellschaft interpretieren?
Und weiter bei den Gleichgesinnten:
Was stellen die besorgten Mitmenschen, die sich fanden, aus organisatorischer Perspektive dar? Spricht man hier von einem Netzwerk, weil man die Kontaktdaten ausgetauscht hat oder man sich regelmäßig trifft? Was bedeutet die folgende Frage, die sich die Ansammlung von Gleichgesinnten stellt genau, die alle relevanten Aspekte zugleich auf die Spitze bringt?
Was können wir tun?
Dazu einige Erfahrungen und Gedanken meinerseits in diesem sowohl Erfahrungsbericht als auch Gedankenanstoß für all diejenigen, die sich in einer verlassenen Zeit zwischen Leugnern und Verstehern einander fanden – und sich hoffentlich auch in Zukunft noch finden werden.
Dieses Buch soll denjenigen Mitmenschen helfen, die sich in politisch problematischen Zeiten zusammensetzen und fragen: Wie kann es weitergehen und welche Bedeutung hat der Umstand, dass wir uns in Zeiten der Not gefunden haben?
Die weiterführenden Antworten verweisen automatisch auch auf Herausforderungen der Netzwerk- und Gruppenbildung. Hier soll angesetzt werden, denn was innerhalb einer politisch instabilen Phase (wie der C-Krise) gesellschaftlich geleistet werden kann, um sich gegenseitig zu stützen und dennoch die eigene Haltung nicht zu opfern, dafür gibt es keine Wissenschaft.
Auch Experten sind hier rar, denn derartige Vorkommnisse wie die letzten Eingriffe seitens des Staates ab 2020 sind für die meisten Mitbürger völlig unbekannt gewesen, wenn nicht gar bis heute kaum zu glauben.
Ein (rechtsradikaler) Schelm, wer hier was Böses denkt, so zumindest die Sichtweise der öffentlich-rechtlichen Medien und Politiker auf alle Mitbürger, die über kritische Fragen der Gegenwart Mut zu einer eigenen Haltung zeigen.
Schließlich sind wir teilweise auch dahingehend erzogen worden, in vielen Dingen differenziert und kritisch zu urteilen. Dennoch scheint das Diktum der Unfehlbarkeit des Staates uns tief in den Knochen zu sitzen. Säkularisiert, wie wir sind, schmunzeln wir über den Unfehlbarkeitsanspruch des Papstes oder Autoritäten fremder Religionen und folgen dennoch auf eine recht unmündige Weise dem Staat. Alles nur eine Frage der Komfortzone?
Die „pädagogischen Erfolge“ des Staates erschweren die erfolgreiche Zusammenkunft von Menschen, die sich eine andere Zukunft vorstellen als die propagierte. Zuviel Angst und Unsicherheit prägen politisch motivierte Versammlungen und über alledem steht die nackte Unkenntnis, wie man sich denn alternativ organisieren könnte.
Selbst so manche selbst erlebte Diskussion darüber war häufig unfruchtbar, mal aus Hysterie gegenüber der aktuellen Situation, mal aus unreflektierten und häufig auch unausgesprochenen Erwartungshaltungen, mal aus rücksichtsloser Durchsetzung der eigenen Sichtweise oder Interessen oder einfach, weil man sich für diese Themen eigentlich nie wirklich interessiert hatte und das vorherige Desinteresse nun sehr häufig viel zu früh in eine lähmende und unlenkbare Angst umschlug.
Welche Hürden in den letzten Jahren persönlich wahrgenommen wurden, dies möchte ich hier gern (ohne wissenschaftlichen Anspruch, weder auf Ausdruck, thematische Tiefe oder Vollständigkeit) darlegen.
Wenn hier aus dem einen oder anderen wahrgenommenen Fehler gelernt werden kann, dann hat dieses Buch seinen Zweck erfüllt.
Das Buch möchte sich folgenden Aufgaben stellen:
Die Einführung einiger weniger Leitbegriffe, ohne die eine sachliche Thematisierung von Gruppenentwicklung nur schwer vorstellbar ist.
Das Anlegen einer Folie, welche allen Beteiligten idealiter Orientierung im Gruppenbildungsprozess bieten soll.
Das Aufgreifen von typischen Problemen in Gruppenbildungsprozessen, welche insbesondere seit der C-Krise wahrgenommen wurden.
Die Frage nach politischem Engagement in einer Zeit der Krisen darf durchaus bewusster und fordernder gestellt werden, denn das Individuum wird, neben der Fähigkeit zum eigenen kritischen Denken, wenigstens im Hinblick auf seinen Mut gefordert werden. Mit einem geteilten Ziel vor Augen entwickelt sich überhaupt erst eine Gruppe erfolgreich. Dazu muss allerdings eine Einsicht in die Notwendigkeit bestehen, etwas aus der bisherigen Menschheitsgeschichte zu lernen. Dahingehend lautet ein didaktisches Motto: Die Gesellschaft muss lernen, sich selbst zu organisieren, damit das Individuum langfristig eine Chance der Entfaltung erfahren kann. Oder umgekehrt? Ohne Stabilität und Frieden werden wir dieses Ziel nicht erreichen.
Da hier wohl von ständig sich wiederholenden Parallelprozessen ausgegangen werden muss, so sollten wir uns gewahr werden, dass auf der Seiten der Einzelnen und der Gesellschaften zwar Herausforderungen bestehen, aber nicht ständig und gänzlich von vorn angegangen werden müssen. Und dennoch gilt:
„Es ist weit schwerer, sich von anderen nicht beherrschen zu lassen, als andere zu beherrschen.“
La Rochefoucauld
1Die Veränderungen der Todeszahlen und -arten finden „plötzlich und unerwartet“ seit Impfbeginn nicht mehr den Weg in die Mainstream-Medien. Können Sie sich noch an die Flut an Statistiken und Prognosen in der C-Krise erinnern?
0.2 Zur Nutzung des Buches
Ein derartiges Buch in der heutigen Zeit zu schreiben, fällt nicht leicht. Es ist politisch motiviert und beschreibt eine Position, die zu dem heutigen Konsens der politischen Landschaft – hier in diesem unseren schönen Lande und teilweise auch global – in krasser Opposition steht.
Der Umstand, dass zu (fast) jedem Thema (fast) jedwede Opposition als rechtslastig und zunehmend als bedrohlich eingestuft wird, zeigt die Einseitigkeit im politisch Großen und rückt sich vielen zur Kritik fähigen Mitmenschen bedrohlich ins Bewusstsein.
Wie aber kann im Kleinen über bedrohliche Umstände der gemeinsam geteilten Umwelt und die damit zusammenhängenden Ängste gesprochen oder eventuell gar gemeinsam gehandelt werden? Diese Fragen kamen aus eigener Erfahrung mehrfach in Netzwerken zur Sprache und der Umgang mit ihnen soll hier Thema sein.
Dabei gilt: Es geht hier nicht primär um die politische Sichtweise des Autors, sondern um gemachte Erfahrungen, Probleme und Anregungen „psychosozialer“ Prozesse der Mitmenschen, die die geteilte Fähigkeit zur Kritik „Neuer Normalitäten“ zusammengeführt hat.
Es geht um Netzwerk- und Gruppenbildungsprozesse in Zeiten gesellschaftlicher Not. Die politischen Begebenheiten werden hier lediglich als „Anlass“ angeführt und illustrieren dem Zeitgeist entsprechend die Notwendigkeit einer politischen Auseinandersetzung der Gesellschaft mit ihrer eigenen aktuellen Situation.
Wenn man möglichst wenig akademisch, eher gesellschaftsnah diese Fragen beantworten möchte, wobei die möglichen Antworten das eigene Denken lediglich fördern sollen, dann bedient man sich selektiv unter praktischen Gesichtspunkten bestenfalls der selbstgemachten Erfahrungen und der eigenen Gedanken.
Für ein heterogenes Netzwerk in Anfängen werden wohl nur von einem Teil der Beteiligten vertretene spirituelle Einsichten und auch schwer verständliche wissenschaftliche Erkenntnisse kaum hilfreich sein. Es wird stets eine allgemein vertretbare Anschauung notwendige Bedingung für eine erfolgreiche Gruppenentwicklung sein.
Gegenüber der Wissenschaft möchte ich fünf gute Gründen nennen, warum man zur Zeit einer politischen Umwälzung innerhalb eines Gruppenbildungsprozesses eher auf den eigenen gesunden Menschenverstand vertrauen sollte.
Erstens gibt es, nach eigener Sichtung der Literaturlandschaft, nur wenige Beiträge, die sich in Bezug auf politisch motivierte Fragestellungen aus wissenschaftlicher Sichtweise letztendlich nicht als anrüchig erweisen.
Dies hier ist ein politisch motivierter Beitrag.
Umgekehrt: Viele hilfreiche Beiträge aus der Wissenschaft thematisieren nicht die Aspekte – zumindest in der bisherigen Geschichte des Abendlandes –, die die aktuellen politisch-gesellschaftlichen Umbrüche der jeweiligen Gegenwart adäquat mitberücksichtigen.
Zweitens finden größtenteils Aufarbeitungen politisch-gesellschaftlicher Umbrüche, wenn überhaupt2, überwiegend durch Historiker statt. Doch diese helfen im Hinblick auf die aktuellen Angelegenheiten wohl kaum.
Drittens sind die Universitäten größtenteils Institutionen und wie alle Institutionen dem politischen Konsens unterworfen. Zu politischmotivierten Fragen hinreichend evidente bzw. wissenschaftlich schlüssige Antworten zu erhalten, fiel nicht erst zur „Corona-Maßnahmen-Krise“ erheblich lückenhaft aus. Sowohl der Nachweis der Gefähr-
Viertens werden hier auch selbstgemachten Erfahrungen der jüngsten Vergangenheit verarbeitet und damit unter praktischen Gesichtspunkten gesammelt und interpretiert.
Wo externe Quellen sinnvolle Hilfestellung leisten, werden sie herangezogen und fachgerecht aufgeführt – aber nicht mehr. Hier wird kein Anschluss an eine Schule oder Denkrichtung explizit gesucht und somit auch kein wissenschaftlicher Anschluss.
Fünftens erscheinen teilweise eigene Unterscheidungen und Unterteilungen als didaktisch hilfreicher im Zusammenhang der hier aufgeführten situativen Darstellungen.
Vielleicht erscheinen dadurch manche subjektiven Sichtweisen und Rückschlüsse aus den selbstgemachten Erfahrungen als zugänglicher, anschaulicher, verständlicher und dem Zeitgeist näher als akademische Abhandlungen – so die Hoffnung des Autors.
Es sollen dennoch einige Termini geprägt und sachgerecht eingeführt werden, weil es in Gruppen zumeist u.a. an einem sinnvollen Vokabular und an einer konstruktiv-sachlichen Distanz mangelt.
Einige Vorabklärungen können hier gleich als Beispiele dienen. Um Missverständnisse zu vermeiden, werden hier gleich zu Beginn einige Punkte – hoffentlich hinreichend verständlich – klargestellt.
Die Ausdrücke Netzwerk und Gruppe werden hier getrennt und nicht synonym verwendet. Ein Netzwerk gilt hier als zunächst loses Zusammenfinden im Sinne der Kontaktherstellung und als Resultat einer themenorientierten Vernetzung sich bis zu diesem Zeitpunkt einander fremder Menschen.
Weiterführende und regelmäßige Kommunikation münden dann in einem stabilen Netzwerk.
Gruppen hingegen gehen einen Schritt weiter. Organisatorische Belange nehmen an Bedeutung zu und übersteigen die vorherigen Kommunikationsverhältnisse des Netzwerks. Neue Organisation setzt neue Kommunikationsformen voraus.
Solange wir lediglich über kommunikative Aspekte diskutieren, wird hier von einem Netzwerk gesprochen. Stehen im Gegensatz dazu Organisationsfragen, im Sinne des gemeinsamen Handelns, im Vordergrund, dann sprechen wir von einer Gruppe.
Auf die Frage, die in der Regel recht früh im Netzwerk gestellt wird, was man denn gemeinsam tun könne, antwortet erst die Gruppe erfolgreich.
Und: Sehr häufig blieb die Antwort aus, weil der Gruppenbildungsprozess betrüblicherweise erfolglos blieb.
Warum diese eigentümliche Unterscheidung eingeführt wird und weitere folgen werden, liegt auf der Hand: Ein wenigstens kleines Vokabular, welches wahrscheinlich nicht dem Alltag der Beteiligten entspringt, kann helfen, Missverständnisse zu vermeiden.
Die Definitionen sollen den Leser anregen, sich selbst einmal Gedanken über die angesprochenen Themen zu machen. Sicherlich lässt sich hier und da noch etwas verbessern. Der kritische Leser darf sich aufgefordert fühlen, eigene Gedanken diesem Ansatz zukommen zu lassen, ohne die dieses Vorhaben wahrscheinlich ohnehin nur wenig Sinn haben kann.
An wen ist eigentlich das Buch adressiert? Zunächst an alle kritischen Mitbürger, die davon überzeugt sind, dass sich in politisch fragwürdigen Zeiten gemeinsam mehr erreichen lässt – als allein.
Des Weiteren an diejenigen Mitmenschen, die auch schon selbst – teilweise enttäuschende – Erfahrungen innerhalb von Gruppenbildungsprozessen gesammelt haben.
Die Gegenüberstellung von Netzwerkern und Organisatoren und ihre sich zum Teil widersprechenden Rollen führten in einer Reihe von Netzwerken, die ich in den letzten drei Jahren kennenlernen durfte, wiederholt zu folgenschweren Kollisionen. Ihnen effektiv und möglichst früh entgegenzuwirken, scheint mir nur ein triftiger Grund für dieses Vorhaben zu sein.
So ist schlussendlich das hier vorliegende Vorhaben an alle Mitmenschen adressiert, die erkannt haben, dass Theorie und Praxis in Zeiten der Not Hand in Hand gehen müssen, um ein Gelingen sicherzustellen.
Los geht’s!
2Diese Einschränkung berücksichtigt den Umstand, dass es wohl stets dem Sieger zukommt, die Geschichte zu schreiben.
Kapitel 1
Ausgangsüberlegungen
„Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom.“
Albert Einstein
„Man soll nie vergessen, dass die Gesellschaft lieber unterhalten als unterrichtet sein will.“
Adolph Freiherr von Knigge
„Ein Mensch fühlt oft sich wie verwandelt, sobald man menschlich ihn behandelt.“
Eugen Roth
1.2 Mehrere Formen der Einigkeit
Der letzte Abschnitt sollte u.a. auch zeigen, wie weit wir (als Gesellschaft) von Selbstbestimmung entfernt sind, wie wenig wir mit derartigen Modellen anfangen können und wie verzweifelt wir hoffen, irgendjemand anderes käme zur Vernunft oder wäre niemals so verrückt, das durchzuführen, was dann eben doch folgt.
In unserer asymmetrischen Hierarchie haben die Opfer die Täter nie verhaftet, kein Sieger zeigte sich seiner Verbrechen selbst an und der wahre Gewinner wurde noch nie erfolgreich angezeigt. Dieser Teil der menschlichen Selbstorganisation ist bisher ehern geblieben.
Es scheint, als hätte die Geschichte den Meisten von uns nicht viel Einsicht gebracht. Desto schwerer wird es sein, schlussendlich über Organisation sprechen zu können, denn evidenterweise sind auch die menschengemachten Bedrohungen organisatorische Resultate. Nur nicht unsere – die der Gesellschaften. Mit anderen Worten: Wir sind die Frösche im Teich, der ausgetrocknet werden soll. Viel Abstraktion ist eigentlich nicht nötig für die Einsicht, dass die Gesellschaften auch ein Teil des Teiches sind.
Im Weiteren wird es um eine voraussetzungsvolle Form von Organisation gehen müssen: um Gruppenbildung. Jedes Vorhaben mehrerer Individuen setzt diese Bedingung notwendigerweise voraus. Wo sich dieser Prozess nicht erfolgreich vollzieht, dort wird es niemanden geben, der etwas auf die Beine stellt. Ganz einfach.
Die aufgeführten Erfahrungen, Ideen und Ansätze der Systematisierung werden so dargestellt, dass möglichst wenig Vorwissen seitens des Lesers notwendig ist. Wissen ist hier auch eher ein Nebenprodukt. Hier geht es weniger um wissenschaftlich materiale Erkenntnis als um Inspiration zur subjektiven Einsicht – die eigentliche und bestenfalls geteilte Währung in unserem Vorhaben der Gruppenbildung. Das hier vorgestellte Konzept soll helfen, die Bedingungen günstig zu wählen, um in einer Gruppe geteilte Vorstellungen auch möglichst krisenfrei





























