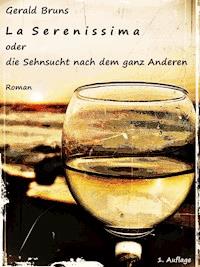
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
L a S e r e n i s s i m a oder die Sehnsucht nach dem ganz Anderen: Ein Roman über die Sehnsucht nach einer existentiellen Aufgehobenheit, die für den Protagonisten nicht befriedigbar ist. - Gott war nie, ist nicht & wird nie sein - Und doch, und doch: Erzeugt jeder Verlust eine Sehnsucht....
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 201
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gerald Bruns
La Serenissima
oder die Sehnsucht nach dem ganz Anderen
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Widmung
Erster Teil - Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Zweiter Teil - Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Impressum neobooks
Widmung
Dieses Buch ist für meine Frau Christa und meine Tochter Michelle.
Manchmal wäre ich gern
wie die Gläubigen.
Ich brauche Gott, also gibt es ihn.
Suche nicht das Wahre
sondern das Wünschenswerte.
Für mich die Unwissenheit
nicht einfach Unwissenheit
sondern Berechtigung des Glaubens
und willkommener Anlass
zu hundertfacher Spekulation.
Ja, ich bin zuweilen
neidisch auf die Gläubigen.
Neid ist ein Symptom des Mangels
und ich bekenne stolz
dass es mir mitunter
an einem leichteren Leben mangelt.
Dennoch bleibt ein Sieg
auch dann ein Sieg
sieht er aus
Erster Teil - Kapitel 1
Eine gute Reise ist eine, bei der man sich selbst begegnet, indem man anderen Menschen begegnet.
Eine von mehreren seelischen Funktionen des Reisens das Wachstum innerer Klarheit, Lebendigkeit.
„Nosce te ipsum“, „erkenne dich selbst!“, lateinische Übersetzung der griechischen Inschrift „Gnothi seauton“ am delphischen Apollotempel, Motto auch des Reisens.
Kapitel 2
Vielen Dank, Tom, dass Du Dich an diesem herrlichen Maiabend zu diesem Treffen so kurz nach meinem Venedigaufenthalt bereit erklärt hast. Es ist, das weißt Du, eigentlich nicht mein Stil, einen Freund mit einem zweifellos längeren Monolog zu behelligen. Das habe ich in den Jahrzehnten unserer Freundschaft nie getan. Andererseits habe ich aber auch noch Deine Worte, Deinen Dank im Ohr, nachdem Nadine sich kürzlich von Dir trennte, ich Dir nächtelang zuhörte, Du schließlich sagtest: „Wenn Du mal einen brauchst, der dir dermaßen intensiv zuhört, wie du das die letzten Tage getan hast, komm bitte zuerst zu mir.“
Und… – voilà, hier bin ich.
Bin ich – was für eine treffliche Wendung unserer Sprache –, um mein Herz auszuschütten. Dem Freund was zu erzählen. Bin ich, obschon auch Laura, meine Schöne, mein Eheweib, mir gestern, vorgestern, auch den Abend davor Stunden lauschte; mein Problem offenbar so virulent, dass ich damit zu meinem eigenen Entsetzen die halbe Welt zu behelligen beginne…
Wie heißt es in einem unserer Filmklassiker: “Ein Freund, ein guter Freund: das ist das Beste, das es gibt auf der Welt…“
Ob ich...? Aber ja. Gut erkannt.
In der Tat habe ich vor ein paar Minuten auf dem Weg hierhin noch rasch in unserer Kölner Südstadt-Stammkneipe auf der Severinstraße zwei Courvoisier getrunken, um meine Zunge ein wenig zu lockern... Offenbar hat das, was ich Dir zu erzählen habe, für mich eine zumindest ähnliche psychische Qualität wie die unserer menschlichen Reaktion auf die Nachricht vom Tod eines geliebten Menschen; auch dort greifen wir ja oft genug zum Schnaps, um die Wucht der entsetzlichen Botschaft zumindest ein wenig abzufedern.
Worum es geht?
Nicht um eine Ehekrise jedenfalls, Tom. Denn auch wenn in diesem Augenblick Dein etwas süffisant wirkender Gesichtsausdruck zu mir sagt: Na ja, jetzt hat´s also auch
den Freund, den „heiligen Jacob“, endlich mal erwischt – der „heilige Jacob“ und seine Laura haben unverändert keine Krise…. Die überlasse ich lieber – wenn ich´s mal so offen, despektierlich sagen darf – Dir.
Bitte!? Ach was! Erzähl mir nichts!
Ich will Dich keineswegs angreifen. Jeder Gewinn hat einen Preis. Und so wird auch echte Freundschaft, die Vertrauen und so Möglichkeit zur Offenheit schenkt, meist begleitet von einem tieferen Blick in die Charakterstruktur des Freundes, Umkehrschluss inbegriffen. Was ein kluger Mann über die Liebe sagte, nämlich dass sie für Liebende eine Art wechselseitiges Vergrößerungsglas sei, gilt gleichermaßen für die Freundschaft. Mag sein, dass einer, der sich selbst massiv kritisiert, wie ich das bald tue, allein dadurch noch nicht das Recht erwirbt, auch andere Menschen, gar seine Freunde zu kritisieren. Doch darf ich vielleicht immerhin eines in aller Direktheit sagen:
Wer wie Du, Journalist, promovierter Dozent, als bekannnter Autor gleich mehrerer erfolgreicher Bücher über Ehe, Liebe von einem Fernsehsender zum anderen gereicht, so über die Liebe denkt, wie Du das insgeheim tust, darf sich nicht wundern, wenn seine Liebesbeziehungen über kurz oder lang scheitern. Du hälst in Wahrheit gar nichts von der Liebe. Sprichst ihr zumindest die segensreiche Wirkung ab. Deinem verlegenen Lächeln, Nicken zu entnehmen, dass Du das offenbar auch selbst so siehst. Fünf gescheiterte Ehen in zwölf Jahren, pro Jahr ein bis zwei gescheiterte Liebesbeziehungen, über allem schwebend die unerkannteste Wahrheit unserer Tage, die besagt, dass Freiheit in unserer Zeit der Verherrlichung von Selbstverwirklichung durchaus eine Form von Selbstzerstörung sein kann: das besagt etwas über einen Menschen. Auch wenn der zugleich höchst intelligent, humorvoll, witzig, großzügig und ein vorbildlicher Freund ist. Niemand von uns ist so gut, wie er glaubt, aber auch nicht so schlecht, wie er meint.
Bei der Vorbereitung auf dies Gespräch habe ich in einigen Deiner Bücher geblättert und mir drei Deiner Aphorismen notiert:
Wenn Liebe die Suche nach der eigenen Bestimmung ist, dann ist die Bestimmung des modernen Menschen der Fernsehapparat.
Liebe als Fähigkeit des Menschen, gemeinsam mit einem anderen Menschen, zu dem man nicht passt, ein glückliches Leben zu führen, das es nicht gibt.
Wenn zwei, die einander gleichen, sich lieben, weil sie so verschieden sind, kann daraus eine ewige Liebe werden, die eine statistische Dauer von wenigen Jahren hat.
Nur, lieber Freund – die am meisten über die Liebe spotten, sind es nicht zugleich die, die sich am intensivsten nach ihr sehnen? Nein, Du hälst nichts von der Liebe, bist einer, der von ihren fünf Formen – erotische Liebe, Kinderliebe, Nächstenliebe, Liebe zur Tierwelt, zur Umwelt – bestenfalls die Liebe zu Tieren, Umwelt favorisiert. Einen Hund hast du. Zahlendes Mitglied in einer Unmweltschutzorganisation bist Du auch. Doch war´s das auch schon. Womit Du allerdings immer noch mehr als ich zu bieten hast. Das ist mir in Venedig klargewordeen.
Du hast Recht, ich sollte zur Sache kommen.
Die Sache diese: Du weißt, dass ich, selber früher Journalist, Hobbykoch, später Inhaber und Küchenchef eines Restaurants mit mediterran-schwäbischer Orientierung, heute vor allem von Kochkursen, Kochseminaren bei Firmen und diversen Bildungseinrichtungen lebe und vor Tagen von einer weiteren Venedig-Reise zurückkehrte. Ab Herbst biete ich nach Kursen über die toskanische und sardische Küche nun auch solche über die Venedigs und des Veneto an. Als solcher einer, auch das weißt Du, der nur dann glaubhaft solche Kursen anbieten mag, verfügt er über ein gewisses Maß an Praxis, Erfahrung, gesammelt vor Ort. Gesammelt also zuvor eben in der Toskana, in Sardinien, nun Venedig, im Veneto. Seit nunmehr bereits zehn Jahren, dass ich deshalb mehrere Wochen im Jahr in Italien bin.
Erstmals war ich übrigens 1958, ein achtjähriger Junge, mit meinen Eltern in Italien, Urlaubsort Diano Marina, Hafennest an der ligurischen Riviera unweit Genua, Name unserer Unterkunft Hotel Bel Soggiorno. Den Namen auch nur eines der Hotels, in denen ich im Laufe der folgenden Jahrzehnte in den USA, Italien, Frankreich, Holland, Russland, Rumänien, Norwegen, Spanien, Marokko, Polen, Tschechien, in der Slowakei, Deutschland und, und, und wohnte, weiß ich nicht mehr. Den Namen jenes ersten Hotels indes habe ich nie vergessen.
Wir hatten Halbpension, das Frühstück wie üblich in Italien eher karg, minimalistisch, Abendessen dafür umso raffinierter, überraschender. Stets vier Gänge: Antipasti, Primi piaiti, Secondi piatti, Dolci. Immer helles Brot mit herrlich knuspriger Rinde auf dem Tisch. In den funkelnden Gläsern meiner Eltern heller oder dunkler Wein.
Aha, so bissfest, wohlschmeckend, alles andere als zerkocht konnten Nudeln sein. So aromatisch, leuchtend gelb, grün, rot Paprikaschoten. Aha, du heißt also Aubergine, du Zucchini, du Olive. Und du, ah ja – du bist also ein Schafskäse...
„Angenehm. Wenn auch ich mich vorstellen darf: Ich bin der kleine Jacob, Jacob Bollnow, und komme aus dem Land der Unwissenden, kulinarischen Banausen.“
Meine Mutter, die zuvor das „al dente“ im Zusammenhang mit der Kochanleitung auf der Spaghettipackung vermutlich stets dahingehend deutete, dass der Hersteller offenbar Dentist war und deshalb empfahl, die Nudeln zur Schonung der Zähne mindestens
fünfzehn Minuten zu kochen. Meine Erinnerung an die Nudeln meiner Mutter die Erinnerung an eine Art Pappmaché, geschaffen aus Wasser und Hartweizengrieß. Hier und jetzt jedoch, dass sich auf einmal ein ganzer Kosmos an Farben, Gerüchen, Aromen vor mir auftat. Jeder Bestandteil deutlich vom anderen abgesetzt. In der Küche ein kulinarischer Zauberer, der unübersehbar der Auffassung war, Freude am Essen nehme im Maße zu, in dem man die Individualität der Zutaten bewahrt, unterstützt, auf ihre Qualität achtet, sie vorsichtig kocht, zuletzt möglichst wenig würzt. Philosophie italienischer Köche: Man nehme die besten aller Zutaten, achte auf Frische, gutes Aussehen und belasse es innerhalb der Grenzen des Möglichen bei ihrer spezifischen Eigenart. Jedes Essen immer nur so gut wie seine Zutaten.
Als ich gegen Ende unseres Urlaubs auf meinen schüchtern vorgetragenen Wunsch hin Gelegenheit erhielt, in die Küche zu gehen, mich umzusehen, für einen Augenblick beim Zubereiten des Abendessens zuzusehen, betrat ich die Küche im Augenblick, als der Küchenchef eben einen Lehrling kräftig zusammenfaltete. Offenbar hatte der, vermute ich, entgegen den Anweisungen seines Chefs nicht nur Zwiebel, Petersilie zu lange angeschwitzt, sondern auch die Blätter eines Basilikumzweiges abgezupft und samt kleingeschnittenem Knoblauch in die Soße gegeben. Der Chef am Toben ob eines solchen Frevels.
Als wir schließlich nach drei Wochen Sonne, Strand, Pasta, Gelati und der wenig glaubwürdigen Attitüde einer vorgeblichen Neureich-Familie in meine Geburtsstadt Osnabrück zurückkehrten, stand bereits in der Zeitung, was mein Freund Jochen, Sohn eines Architekten in der Nachbarschaft, mit einer Mischung aus Unwissenheit und Begeisterung gleich bei unserem ersten Treffen so formulierte:
„Hey, das ist ja was, Jacob!! Weißt du eigentlich, dass ihr pleite seid…!?“
Hatte doch der weinerliche Despot, der mein Vater war, sowohl meine Mutter wie mich regelmäßig mit äußerster Brutalität schlagend, seit Beginn der 50iger Jahre mit generöser Gebärde Hunderttausende Mark Schulden angehäuft und sein Straßen-, Tiefbauunternehmen, zeitweise mehr als hundert Mitarbeiter, an die Wand gefahren: Firma konkurs, das durchaus nicht an den Haaren herbeigezogene Wort vom mutmaßlich betrügerischen Konkurs in der Zeitung zu lesen. Verdacht der Staatsanwaltschaft, dass er ganze Teile des Bauamtes Osnabrück zwecks Auftragserteilung geschmiert hatte.
Ich aber – schließe ich die Augen, versetze mich in jene Zeit zurück, darauf nicht so sehr an Geld, Konkurs, drohende Armut denkend, das ist zu abstrakt, weit weg für einen damals Achtjährigen – sehe meist nur dies: An einem Tag in jenen Sommertagen 1958 unmittelbar nach unserem Urlaub renne ich vom Garten aus in die Küche, um mir etwas zu trinken zu holen, und sehe meinen Vater am Küchentisch sitzen, auf dem Schoß mein Kindermädchen, seine Hand unter ihrem Rock.
Es gab dann täglich Streit zwischen meinen Eltern. Einmal, dass die Polizei kam, ihn vorübergehend festnahm. Später, dass die Anklage wegen Bestechung, betrügerischen Konkurses gegen ihn überraschenderweise mit einem Freispruch zweiter Klasse endete. Parallel dazu, dass meine Mutter die Scheidung einreichte. Später geschieden wur-
de. Erst Jahrzehnte später erzählte mein Vater mir – da bereits vom Alkoholismus gezeichnet, sein Leberzirrhose-Tod wenig später –, dass er damals die letzten versteckten, beiseite gebrachten D-Mark genommen hatte, um einen letzten Urlaub mit der Familie in Italien zu machen, während daheim alles den Bach runterging und niemand wusste, wo wir waren: dafür hatte er gesorgt.
Seither sind 56 Jahre vergangen. Erst 1991, dass ich erstmals wieder mit Frau und Tochter die ersten Tage zuerst in der Toskana mit einigen Tagen Aufenthalt im Mittelmeerstädtchen Viareggio, dann den Rest des Urlaubs an der italienischen Adriaküste und im damals noch existierenden Jugoslawien machte; vor zwei Jahren dann, dass ich eigentlich allein eine kulinarisch orientierte 10-Tage-Fahrradtour durch die Toskana machen wollte, daran jedoch, wenige Monate zuvor 62 geworden, durch eine Peritonitis, Bauchfellentzündung gehindert wurde, häufig tödlich, immer schmerzhaft, angstbeladen, auf einmal, von einem Tag auf den anderen, einer Stunde auf die andere, massiv, unverdrängbar mit Tod, Sterblichkeit konfrontiert.
Als ich aus dem Krankenhaus kam, hatte Laura eine kleine Willkommensfeier mit Freunden, Bekannten organisiert, auch Kristin, ihr Freund, Du unter ihnen; Du übrigens, der an dem Tag wieder seinen wissenden Blick aufgesetzt hatte, mich fortlaufend beobachtete. Wie gesagt: Jeder Gewinn hat einen Preis.
Während der Feier verließ ich einmal kurz, überwältigt von der Zuneigung, die mir all die Menschen entgegenbrachten, den Raum und ging hinüber in mein Arbeitszimmer, schloss die Tür hinter mir, sah zum Fenster hinaus. Der per Datum als Sommertag ausgewiesene Tag eher spätherbstlich als sommerlich. Endlich war der stürmische Wind zur Ruhe gekommen, hatte auch der Nieselregen, tagelang in schrägen Schnüren von schier unendlicher Länge auf einen lange übersättigten Boden fallend, aufgehört; ein grauer, verhangener Himmel mit tief hängenden Wolken, den Menschen fast einen Scheitel ziehend, lag über den Geschäften, Mietshäusern der Severinstraße unterhalb meines Fensters. Passend dazu auf der Fensterbank eine beschriftete Videofilmhülle: Visconti, „Der Tod in Venedig“.
Meine Schöne und ich hatten uns den Film am Tag vor Ausbruch meiner Krankheit angeguckt. Und ich dachte nun an die Szene, in der Gustav von Aschenbach, Protagonist des Filmes, gezeichnet von einem Herzanfall, der ihn an den Rand des Todes bringt, vor einem Stundenglas sitzt, sagt:
„Ich entsinne mich, dass wir so ein Stundenglas auch in meinem Elternhaus hatten. Die Verengung, durch die der rote Sand rinnt, ist so haardünn, dass es zuerst scheint, als ob der Sand im oberen Hohlraum gar nicht abnähme. Nur ganz zuletzt, da scheint´s schnell zu gehen und schnell gegangen zu sein. Nur dem Ende zu. Aber das ist so lange hin, dass es des Daran-Denkens nicht wert ist. Und im letzten Augenblick ist keine Zeit mehr. Da bleibt uns keine Zeit mehr zum Daran-Denken.“
Hatte ich noch zehn Jahre? Zwanzig? Kam Gebrechlichkeit auf mich zu? Starb ich, starb meine Frau eher?
Im Herbst war ich von schlimmen Schmerzen in der Leiste heimgesucht worden, Vorboten vielleicht einer noch schlimmeren Zeit?
Du siehst deine Spuren im Sand, und du weißt, dass sie morgen verweht sein werden, wie du weißt, es wird übermorgen so sein, als habe es dich nie gegeben.
Indem wir geboren werden, erleben wir Menschen ein kurzes Intermezzo zwischen zwei Formen des Nichts. Da ist die bis in den Mikrokosmos reichende Brutalität, Zufälligkeit des Seins, Preis für ein sich vor Milliarden Jahren in den Ozeanen entwickelndes Leben; sind die geheimnisvollen Gesetze des Kosmos, die wir mehr und mehr erforschen, entschlüsseln, sowohl fasziniert wie in die Schranken verwiesen von der Macht der Sonnenwinde, Meteoriten, Naturgewalten; ist die Tatsache, dass wir alle, Bewohner von Nekropolis City, nur wenige Jahrzehnte leben und bereits der nächste Raser, nächste lockere Ziegel unser Schicksal vollenden kann.
Die Struktur, Komplexität unserer Welt erschreckt mich von jeher. Die Tatsache, dass wir Myriaden Jahre nicht leben, um dann einige Jahrzehnte auf diesem Stern zu sein, danach erneut ohne Atem, Leben, Liebe, den salzigen Geschmack des Windes auf unsern verlangenden Lippen, Anblick des türkisfarbenen Meeres, der sich wie Balsam auf unsere wunde Seele legt, hat für mich etwas Schauerliches, Unbegreifliches. Wie die Tatsache, dass keine universelle Harmonie, Gerechtigkeit existiert und das Lachen des Mörders oft genug über die Tränen des Opfers triumphiert, eine schauerliche Erkenntnis darstellt.
Du liebst, der geliebte Mensch stirbt – wie dies ertragen, ohne Sehnsucht nach einem anderen Sein, von mir aus sogar Gott gegebenen Harmonie hinter den Dingen zu entwickeln! Wir beide sind Agnostiker, darin sind wir uns einig. Und doch, und doch: Du wirst diesen Menschen, der dir die Welt war, niemals mehr sehen, sprechen, nie mehr mit ihm reden, weinen, schlafen können. Er ist fort, ausgelöscht, eine abweisende Gestalt aus Stein, die dir nicht einmal mehr sagen kann: Weine, leide, mein Herz, auf dass du meine Seele mit dir fortträgst und ich für dich zum bloßen Gegenstand werde. Die Sehnsucht will, dass der Tod nicht das letzte Wort sei, aber er ist es und verwandelt die Menschen und ihre Beziehungen.
In dieser Welt ist jede Antwort Geburtshelfer wenigstens einer neuen Frage.
Ist der Preis der Fruchtbarkeit der Todschlag, Preis der Schönheit eine universelle Gewalttätigkeit.
Nur einmal die Stärke eines Gottes spüren, der uns beim Abschirren unserer Gedanken hilft; nur einmal mehr sein als dies lächerliche Streichholz, kurz aufflammend in ewiger Nacht, umzingelt von finsterstem Nichts...
Erzeugt nicht jeder Verzicht, Tom – eine Sehnsucht?
Um Dir von dieser Sehnsucht zu berichten, davon, wie sie mich in Venedig überwältigte, was ich dort erlebte: deshalb bin ich hier. Gleich zu Anfang, dass ich Dir das Versprechen abnahm, mich nicht zu unterbrechen, einfach reden zu lassen. Bin ich doch einer, die den Faden meist nicht wiederfindet, hat man ihn einmal unterbrochen.
Erneut gefragt: einverstanden…?
Kapitel 3
Erst im Jahr darauf – 2012 –, dass ich im Juni die zuvor erwähnte Fahrradtour durch Teile der Toskana doch noch machte. Wie geplant mit Tagesausflügen von einem festen Hotel, Standort toskanischen Pisa, Ziel neuerliches Entdecken, Probieren der Küche der Toskana durch tägliche Besuche insbesondere von ländlichen Trattorien. Pinzimonio, Ribollita, Fagioli toscaneli con tonno e pecorino, Bistecca alla fiorentina, Spezzatino alla chigiana und, und, und: all die Klassiker der toskanischen Küche wollten von mir neu entdeckt, gegessen werden. Mit etwas Glück, dass ich dabei vielleicht sogar mit dem oder jenem Koch ins Gespräch kam, der allerdings des Deutschen oder Englischen mächtig sein musste. Italienisch spreche ich, Du weißt, nicht.
Name des Hotels in Pisa, in dem ich mich einquartierte, „Giardino Tower Inn“, Piazza Manin, 1: dies der Platz unmittelbar neben dem alten Stadtor, einem von mehreren Eingängen zur „Piazza dei Miracoli“, dem Platz der Wunder, auf dem sich Dom, Baptisterium, Taufkirche, last not least der weltberühmte „Schiefe Turm“ befinden.
An den nahezu ausschließlich sonnigen, teilweise unerträglich schwül-heißen Tagen meines Aufenthaltes, dass ich abends öfter auf der Terrasse des Hotels saß, Notizen über den abgelaufenen Tag machte, der schweifende Blick immer mal wieder über die wenige Meter entfernte Stadtmauer hinweg gerichtet auf den oberen Bereich des aus weißem Marmor errichteten Baptisteriums, größte Taufkirche der Welt, der aus weißem Marmor errichtete Bau gekrönt von einer ihres Carraramarmors und diversen Statuen, Büsten beraubten Kuppel. Die Statuen, die nicht länger der Luft ausgesetzt, damit zerstört werden sollten, heute zu bewundern im Museo dell´ Opera. Kulinarische Ereignisse der ersten drei Tage: ein einmaliger Fischeintopf – Cacciucco alla Livornese – in einer Fernfahrerkneipe im Hafen von Livorno; fantastisches, wenn auch sündhaft teures Bistecca alla fiorentina in Lucca; zuerst systematisch gequältes, dann erbarmungslos hingerichtetes Bollito misto in Pisa selbst.
Vor meinem geistigen Auge und bis in den Schlaf hinein die Toskana ein illustres Sammelsurium sinnenfroher, farbintensiver Bilder, die durch meine innere Welt vagabundierten: auf einem Hügel kultiviertes Bauernland, seitwärts vor, dahinter Reihen von Maulbeer-, Olivenbäumen mit dazwischen hochgebundenen Weinreben; hier ein romantisches Bergdorf mit schattigem Pinienwald, Strand, Meer, weitem Mohnfeld; dort eine leuchtende Blumenwiese, seitlich blühende Mandelbäume, Mimosen, silbrig schimmernde Ölbäume und ein mittelalterliches Gehöft; fast, dass ich auf dieser Terrasse abends bei geschlossenen Augen den Duft der Weinreben, Blumenwiesen einzusaugen glaubte, Geräusche von Grillen, Zikaden hörte, ohne dass es bereits Nacht war, die Sterne später über mir funkelten und ich mich der seligen Illusion hingab, einen von der Winzer-Akademie in Siena abgesegneten frischen, fruchtigen, rubinroten Chianti aus der Brolio-Weinkellerei von Baron Racasoli in der Hand zu halten.
Um an dieser Stelle einen zeitlichen Sprung zu machen:
Kam Weihnachten 2012/2013, damit ein Problem, das ich jedes Jahr Weihnachten habe. Ein Weihnachtsgeschenk für meine Tochter Kristin war bald gefunden. Nur, was war mit Laura?
Die hat, Du weißt´s, am 20.12. Geburtstag, vier Tage später Weihnachten, drei Tage danach unser Hochzeitstag – eine Konstellation, die mich jedes Jahr zum Grübeln, um nicht zu sagen zur Verzweiflung bringt. Überaus einfallsreicher, empathischer Geschenkespezialist, der meine große Liebe ist – ich hatte früher nicht die geringste Begabung zum Schenken, musste diesbezüglich in den mehr als dreißig Jahren unserer Ehe viel von ihr lernen –, hat aber gerade sie einen Anspruch auf einfallsreiche, an ihrer Persönlichkeit orientierte Geschenke. Was aber, verflucht, schenkte ich ihr diesmal?
Als ich an einem Tag in den Wochen zuvor morgens die Post öffnete, war dort das Jahresprogramm 2013 einer Bildungseinrichtung, bei der ich meine Kurse anbot. Noch nicht darin enthalten, sondern erst geplant für´s Jahr danach ein Kurs über die Küche Venedig´s und des Veneto. Durch die zu diesem Zeitpunkt bereits Jahre währende Beschäftigung mit einem der berühmtesten Venezianer, dem Multitalent, halbseidenen Frauenjäger Giacomo Casanova, wusste ich einiges über die Laguna Veneta, bestehend aus einer Gruppe von ca. 120 Inseln. Hatte zahlreiche Bücher, Zeitungsartikel gelesen. Was für sich genommen schon mal gar nicht so schlecht war. Andererseits aber natürlich nicht langte, um etwaigen Kursteilnehmern die dortige Küche näherzubringen. Das erforderte Praxis, Studium vor Ort, mehrfache Besuche der Lagunenstadt. Deshalb bereits von mir für´s kommende Jahr vorgesehen als Einstieg ins Thema ein einwöchiger Aufenthalt dort, dem dann rasch weitere folgen sollten.
Nur, wenn ich mich doch, was durchaus der Fall war, in den Tagen in der Toskana immer mal wieder intensiv nach meiner Familie gesehnt hatte, mehrfach auch abends zu viel trank, verdächtig früh ins Bett ging – warum machte ich den Venedigbesuch, halb Arbeit, halb Urlaub, nicht gemeinsam mit Laura?
Mein Geschenk zum Geburtstag wie zu Weihnachten wie zum Hochzeitstag eine Woche Venedig incl. Flug, Hotel. Flüge für den 13. 06. 2013 des kommenden Jahres hin, Rückflüge 20.06. gleich gebucht, gebucht auch ein Hotel, wenn auch nicht im Kern Venedigs nahe Canal Grande, sondern in Mestre, auf dem Festland gelegener Stadtteil Venedigs mit gut 200.000 Einwohnern und noch halbwegs bezahlbaren Hotelzimmern. Die sieben Tage dort sechs Monate später mit das Schönste, Interessanteste, Umwerfendste, was wir, wiewohl zuvor beide in vielen Ländern, Metropolen der Welt, je erlebt hatten. Dieses Venedig: es war einfach… war…wow…!! Oder mit den Worten des italienischen Komödiendichters Carlo Goldoni: „Venedig ist eine so außerordentliche Stadt, dass es ganz unmöglich ist, sich eine richtige Idee davon zu machen, ohne sie gesehen zu haben. Mit Karten, Plänen, Modellen, Beschreibungen reicht man nicht aus; man muss sie selbst sehen. Alle Städte in der Welt gleichen sich mehr oder weniger; diese gleicht keiner andern.“
Jeden Morgen, dass wir nach dem Frühstück von Mestre aus mit dem Bus, der vor dem Hotel hielt, Richtung Venedig´s Nadelöhr Busbahnhof fuhren, die im Dunst ver-
schwimmenden Konturen der Industrieschlote von Marghera und Mestre rechts derStrecke, ehe wir im Stadtteil Santa Croce nach fünfzehn Minuten Fahrt über den künstlichen Damm der Strada Ponte della Libertà Kernvenedig erreichten. Vom Busbahnhof aus dann bis zum Beginn des Gran Canale nur wenige Schritte. Als wir erstmals den Bus verließen und vom Piazzala Roma im Stadteil Santa Croce aus die paar Schritte zur breiten, langgezogenen, sich mit mächtigem Schwung Richtung Zentralvenedig streckende Ponte della Costituzione gingen, auf dem Scheitelpunkt der Brücke verharrten, unter uns der Canal Grande im frühen Sonnenlicht, standen wir augenblicklich wie versteinert da und blickten und blickten auf die pulsierende Hauptschlagader der Lagune.
Standen einfach nur da. Verstummten abrupt. Schwiegen lange. Blickten und blickten auf die Wasserstraße. Sahen uns an. Schwiegen weiter. Blickten wieder auf den Canal Grande. Links Stazione Ferroviaria, der Hauptbahnhof, mit Fondamenta Santa Lucia und den Anlegestellen der zahlreichen Schiffbus-, Vaporettolinien; rechts, dem Bahnhof schräg gegenüber, der neoklassizistische Bau des Palazzo Emo-Dieda, gefolgt weiter hinten von weiteren Hotels, Palazzi, Prachtbauten links, rechts, überall auf der von Lärm, Lachen, quirligem Leben überbordenden Wasserstraße, aufgewühlt von deren Motoren, Boote, Boote. Boote aller Art: Frachtboote, Wassertaxis, private Motorboote, laute, ein wenig plump, behäbig wirkende Vaporettoboote, Busschiffe einer Lagune, die außer auf einigen wenigen der zu Venedig gehörenden Inseln wie Lido, Pellestrina u.a. keinen Autoverkehr zulässt, last not least auch Ruderboote, Gondeln.





























