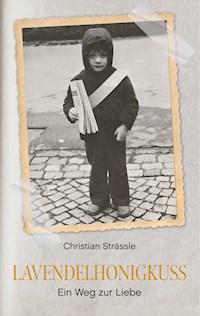
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
«Wenn ich deine Geschichte höre und dich hier im Anzug sitzen sehe, grenzt das an ein Wunder. Andere mit deinem Hintergrund liegen verwahrlost in Parks oder Unterführungen», sagte der geistliche Vater von Noah, nachdem dieser ihm erzählt hatte, was ihm alles widerfahren war. Hilfesuchend hatte er sich an die Kirche gewandt; Noah stand am Abgrund seines Lebens. Noah war noch keine vier Jahre alt, als er von seiner Familie getrennt und in die Obhut einer Pflegemutter gegeben wurde. Nach bitteren Monaten des Getrenntseins ging die «Reise» dann weiter für Noah. Doch führte sie ihn nicht wieder zu seinen Eltern, sondern in ein Kinderheim. Hier sollte er in den folgenden sechs Jahren die pädagogischen «Sitten und Gebräuche» der 70er-Jahre im wahrsten Sinne des Wortes am eigenen Leib erfahren. Als er mit elf wieder zu seiner Mutter zurückdurfte, liess er sich, wie sich selbst geschworen, kaum noch etwas sagen. Jahre später, verheiratet, wuchs in Noah das Bedürfnis, aufzuräumen; die Seele - gebrochen wie sie war - zu heilen, wieder zusammen zu führen und Achtung vor dem Leben zu bekommen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieses Buch widme ich Lea, mit der ich meinen Traum von Liebe lebe und jeden Tag in Wirklichkeit erfahre.
Ich bedanke mich bei Lea für ihre Liebe.
Meinen Dank gilt Salome und Anais; dafür, dass sie mich in der Lehre zum Papi unterstützen.
Ich bedanke mich bei Laura, meiner ersten Frau für die gemeinsame, wertvolle und prägende Zeit.
Einen Herzensdank gilt meinem geistlichen Vater Armin, der nie aufgehört hat, an mich zu glauben und der in Zeiten, in denen ich nicht mehr glauben konnte, dies für mich getan hat.
Ich bedanke mich bei meinen beiden Lektoren Brigitte und Christoph, ohne die ich aufgeschmissen gewesen wäre und durch die ich wirkliche Unterstützung erfahren durfte.
Ich bedanke mich bei all meinen Freunden, bei denen ich immer wieder willkommen bin. Mit ihnen habe ich auch genossen und gelacht, als es mir eigentlich nicht so ging, wie ich das gerne gehabt hätte; Freunde, die mir begegnet sind, mich und mein Handeln auch kritisch hinterfragten, wonach ich mich danach weiter entwickeln konnte.
Dies ist eine wahre Geschichte. Alles, was ich schrieb, ist so geschehen. Einzig, alle Namen in diesem Buch sind geändert.
www.salzundstein.ch
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Erster Teil
So ist das Leben
Kinderheim
Therapie
Frauengeschichten
Neuanfang
Heilsversprechen
Trauer
Familienstellen
Verwandelt
Jim Knopf
Intakte Welt
Erziehung
Fragmentiert
Claudia
Überforderung
Bewusstseinserweiterung
Freunde?
Wer missbraucht wen?
Geduld
The Can(n)abis
José
Versöhnung
Einsicht
Neue Wege
Zweiter Teil
Traum(a)hafte Zeiten
Neuorientierung
Schwulenzirkus
Lena
Delia
Chancen
Angekommen
Frohe Botschaft
Familienleben
Unglück im Glück
Traumatische Grenzerfahrungen
Fröhliche Weihnachten
Yes
Was für Weihnachten
Gottes Segen
Vorwort
Biographien berühmter und vom Schicksal geprägter Menschen, davon gibt es wohl unzählige, und die Regale in Buchhandlungen (hoffentlich gibt es sie noch ewig) sind voll damit. Nicht zu schweigen der Markt im Internet. Weshalb also eine Biographie schreiben? Berühmt bin ich nicht. Ich bin auch kein Held der Leinwand. Kein Fussballstar. Kein Finanzmogul. Kein berühmter Politiker. Was auch immer ich tat, erfüllte ich mit ganzem Engagement. Wer mich selbständig arbeiten ließ, durfte sich an den Resultaten erfreuen und solche, die von meinem Wissen profitieren wollten, denen habe ich es gerne weitergegeben. Und das, so stellte ich es in den vergangenen Jahren immer mehr fest, gab mir bis heute Erfüllung.
Zurück zu meiner Biographie: weshalb habe ich meine persönliche Geschichte geschrieben? Wie vieles im Leben ist auch dieses Buch in der Arbeit mit mir selbst entstanden. «Sie sollten Tagebuch führen», wurde mir von einer meiner Therapeutinnen – ich nenne sie in diesem Buch liebevoll Jim Knopf – empfohlen. Was in mir nicht gleich ein berauschendes Gefühl auslöste. Das Gegenteil war der Fall. Ich bin Legastheniker – das Wort Rechtschreibung kenne ich von Wikipedia. Das Umzusetzen, da gibt es noch einiges nachzuholen und ohne die roten Wellenlinien im Word wäre ich aufgeschmissen. Ja, ein Kindheitstrauma könnte erwachen, wenn ich mich daran zurück erinnere, wie meine Diktate zurückkamen; als hätte sie mir ein Metzger mit blutverschmierten Händen ausgehändigt. Überall nur Rot zu sehen und genau so bedrohlich fühlte es sich auch an. Es war in den siebzig und achtziger Jahren und die einzige Massnahme die es gab, war, dass ich im Einzelunterricht gefördert wurde, jedoch ohne dies im Bewertungssystem – meinen Noten, zu berücksichtigen. Also habe ich mich an die schlechten Noten gewöhnt, denn es blieb mir keine andere Wahl. Dies meine Erklärung, weshalb Jim Knopfs Empfehlung nicht gleich berauschende Gefühle auslösten. Doch da war in mir der tiefe Drang aufzuräumen. Und dafür war ich bereit, Schaufel und Besen in die Hand zu nehmen und anzufangen meine Kammern aufzukehren. Aus dem Rat wurde mein Wunsch.
Eines Abends sass ich in meiner Mansarde am Schreibtisch, blickte auf den PC vor mir und sah mich wenige Augenblicke danach, wie ich meine früheste Erinnerung eintippte. Von Grammatik und Kreativität konnte zu diesem Zeitpunkt nicht die Rede sein. Ich schrieb drauf los, wie es mir so in den Sinn kam und fühlte eine weitere Form der Befreiung in mir, mit jeder Zeile die auf dem Bildschirm erschien. Täglich sass ich nun in meiner Mansarde und schrieb, nachdem ich mich zuerst meinem Tagebuch (zum Schluss sind weit über 3500 Seiten zusammen gekommen) anvertraute, weitere zwei Stunden am PC. Als dann die ersten 280 Seiten geschrieben waren, händigte ich diese meiner Homöopathin, die mich fünfzehn Jahren begleitete und zu einem meiner Lebensretter wurde, sowie Jim Knopf, aus. Nicht zuletzt mit dem labilen Traum, der im Verborgen schlummerte, nun den Bestseller meines Lebens geschrieben zu haben. Das Erwachen kam nicht lange Zeit später, als meine Homöopathin Anita mir die Seiten zurück gab und meinte: «Es tut mir leid, aber wenn ich deine Beschreibungen lese, komme ich mir einerseits vor, wie eine Voyeurin und auf der anderen Seite zieht es mich nach unten, weil eine schaudernde Geschichte der nächsten folgt. Es tut mir leid, aber ich kann das nicht lesen». Und Jim Knopf gab mir die Seiten mit dem Kommentar zurück, wie intelligent ich sei, dass es da noch einiges zu überarbeiten geben würde und ich mir auch Gedanken machen müsste, was ich veröffentlichen möchte und was nicht.
Daraufhin schrieb ich mich bei der Akademie für Fernstudien in Hamburg ein, um mir das Schreibhandwerk anzueignen, damit meine Botschaft, die ich in diesem Buch vermitteln wollte, so gelesen werden konnte, dass es trotz Dramatik auch Freude und Weisheit vermittelt; was es meiner und der Ansicht meiner Lektoren auch tut.
Und welche Botschaft soll dieses Werk nun in die Welt hinaus tragen? Ich bin in meinem Leben vielen Menschen begegnet, die wie ich, eine niederdrückende Last auf ihrem Buckel mittragen. Die einen würdevoll, andere rücksichtslos und eigennützig. Eine Person sehe ich immer wieder einmal in den Gassen der Stadt, in der ich wohne. Er war mit mir im selben Kinderheim aufgewachsen. Auch er wurde zuvor von einem Ort zum anderen geschoben. Sein Zuhause ist die Strasse. Würde ich auf ihn zugehen und ihm Hallo sagen, ich glaube er würde mich nicht wieder erkennen, weil die Drogen sein Hirn durchfressen und dermaßen vernebelt haben, dass es gerade dazu reicht, zu wissen, wo er sich den nächsten Schuss besorgen kann.
Anders lernte ich Menschen kennen, die von ihrem Leben erzählten und ich beim Zuhören dachte: «Mein Gott, was hindert es dich Hilfe anzunehmen? Wussten sie nicht, dass das Leben mit jeder Sitzung beim richtigen Therapeuten leichter werden kann? Herausforderungen können dadurch verständlich angenommen werden, weil die Last nicht mehr so drückend ist. Und und und … Es tut einfach nur gut, das ist meine Erfahrung. Doch ich verstehe auch die Ungewissheit vor dem Hinsehen. Nicht zu wissen, was da auf einen zukommt. Was da alles im Verborgenen schlummert. Also doch lieber verdrängen?
In meiner Ausbildung zum systemischen Coach las ich hierfür die passenden Zeilen:
Jede Erfahrung bleibt unvollständig, bis man mit ihr fertig ist. Die meisten Menschen verfügen über eine grosse Belastbarkeit hinsichtlich unerledigter Situationen… Obwohl man eine beachtliche Menge unerledigter Erfahrungen vertragen kann, so suchen doch diese unvollständigen Entwicklungen ihre Vervollständigung: und wenn sie stark genug werden, wird der Betreffende von Zerstreutheit, zwanghaftem Verhalten, übermässiger Vorsicht, bedrückender Energie und einer sinnlosen Geschäftigkeit befallen.» (Polster 1983, S. 46)
So sah es einst auch in mir aus. Ja, diese von Polster beschriebene Person war ich einmal. Und diese Person stelle ich in meinem Buch vor. Seitdem ich beschlossen habe, meine Lebensgeschichte nieder zu schreiben, bin ich voller Hoffnung, meinen Leserinnen und Lesern Mut zu machen, mit den Aufräumarbeiten in den eigenen Kammern zu beginnen und aufzuhören, sich mit Nebenschauplätzen zu beschäftigen. Selbst wenn hie und da Geschirr zerschlägt - so wie es bei mir der Fall war - ist das neben meinem Auftreten und den liebevollen Begegnungen, die ich täglich habe, mein Beitrag an einen Weltfrieden. Wenn wir wirklich etwas nachhaltig verändern wollen, dann gibt es nur die eine und einzige Möglichkeit. Wir müssen bei uns selbst beginnen. Wie sagte es Nicolas Chamfort:
Es ist schwer, das Glück in uns zu finden, und es ist ganz unmöglich, es anderswo zu finden.
Ich möchte das vermitteln, was ich in der Arbeit mit verschiedenen fachlichen Therapeuten an mir selbst erfahren habe. Und ich möchte es mit aller Deutlichkeit sagen. Das Loch, in das man hineinfällt und wovon geglaubt wird, daraus nie wieder heraus kommen zu können, gibt es nicht. Punkt. Und je mehr wir lernen, uns an uns selbst heran zu tasten, wir Tränen einordnen können, die schon so lange hätten geweint werden sollen, umso befreiender ist es, wenn sie ihren Platz mit Achtung und Würde bekommen. Noch nie erlebte ich etwas Erlösenderes als jenen Zeitpunkt, in dem ich genau das erlebte. Kein Joint den ich rauchte (es waren unzählige) keine Linie Cooks (es waren einige Meter) die ich reinzog, haben mir jemals diese Glücksgefühl gegeben, als ich endlich nach Jahren wieder weinen konnte. Also wovor Angst haben? Kraft entsteht durch das Bewusstwerden, was einmal wirklich war. Damit ich es einordnen kann. Dann gibt es auch nichts mehr, was im Verborgenen schlummert. Dieser ganze Druck, der im Geheimen lag, platzt wie die Luftblase am Horizont.
Ich wünsche mir beim Lesen meiner Biographie, dass die Leser Mut bekommen, ihre eigene Biographie zu erforschen, ablegen und deponieren können, was zuvor zu erdrücken schien. Es sollen hernach noch unzählige Bücher meiner Leserschaft geschrieben werden können, die mit dieser Freiheit enden, wie ich sie in unzähligen Momenten erfahren und hier beschrieben habe.
Denn der Kern des Friedens ist in jedem von uns. Was hindert uns also, diese Kraft gedeihen zu lassen?
Mut wird deshalb benötigt, weil nur dann aufrichtige Versöhnung stattfinden kann, nachdem wir die Verletzung als solche erkannt und auch wahrgenommen haben. War es die unverständliche Ohrfeige, die uns einst im Spiel verpasst wurde? Oder gar andere schwerwiegende, missbräuchliche und traumatisierende Handlungen, vor denen wir uns seither mit falschen Glaubenssätzen versuchen zu schützen und die wir uns deshalb immer wieder selbst einreden? Es braucht Mut, sich „Lügen“ zu stellen und uns von hausgemachten Einwänden zu lösen. Nachdem wir unsere falschen Glaubenssätze, die uns einst schützen sollten, erkannt haben, werden wir wahrnehmen, welche misslichen Handlungen wir im Glauben, das Richtige aus Liebe getan zu haben, in falscher Form weiter gaben. Genau deshalb wird es Mut brauchen, auf Menschen zuzugehen, um sie um Verzeihung zu bitten. Manchmal wird das viel Zeit brauchen und ist durch nichts zu beeinflussen. Dies liegt im Ermessen meines Gegenübers und gibt genügend Zeit, uns weiter um uns selbst zu kümmern, um die gewonnene Befreiung in unserem Tun und Handeln weiterzugeben.
Erster Teil
Ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu Zeugen; Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, damit du das Leben erwählst und am Leben bleibst, du und deine Nachkommen, indem ihr den Herrn, euren Gott, liebt und seiner Stimme gehorcht und ihm anhangt.
5. Mose 30, 19.20
1
Kinderheim
Ahnungslos, die Hände in den Hosentaschen meiner Latzhose vergraben, den Kopf leicht Richtung Boden geneigt, stand ich in einem hohen Flur, an einem mir unbekannten Ort. Hinter mir eine grosse Pendeltüre aus Rauchglas, durch die ich soeben dieses grosse Haus betreten hatte. Im Hintergrund nahm ich ein immer leiser werdendes «Buoab buoab buoab», der sich einschwenkenden Türhälften wahr. Wie in einer schlechten Momentaufnahme eines Familienporträts stand ich in einem Gang zwischen meinen Schwestern und meinen Eltern. Ich hatte sie alle schon lange nicht mehr gesehen. Bei meiner Mutter und meinem Vater stand ein mir fremder Mann.
Was mache ich hier? Und wer ist dieser Dicke mit Bart?.
Sie sprachen einige Sätze mit dem Mann in den sandfarbenen Hosen, über die sein, in ein Holzfällerhemd eingepackter Bauch hing.
Über was die wohl sprechen?
Ich blickte zur grossen Schwester, der anscheinend gerade dieselben Gedanken durch den Kopf schossen. Sie schaute mich an. Und die Art, wie sie ihre Augen verdrehte, sagte mir, dass auch sie nicht wusste, um was es da gerade ging.
Im Gang roch es nach Erbrochenem, nach Tee, Kakao und Kaffee. Die Luft war stickig und die Atmosphäre bedrückend.
Wo bin ich hier? Das ist nichts Gutes.
Meine Blicke schweiften von Mama zu Papa, vom Bärtigen zum Wandschrank und durch die Fenster nach draussen, erreichten dann meine grosse Schwester und schliesslich wieder ihren Ausgangspunkt: Mami. Dabei wurde mir bang und banger. Mich «drückte» es von allen Seiten und die Enge drohte, mir den Atem zu nehmen. Ich fühlte mich als hätte mich irgendein Riese in eine Schuhschachtel gezwängt, aus der ich ohne fremde Hilfe nie mehr hinauskommen würde.
Das Klimpern von aufeinanderschlagenden Tellern, aber auch das Kratzen und das raue Gemurmel, welches ich von der anderen Seite der Wandschränke her wahrnahm, trugen das Ihrige dazu bei. Auch Manuela und Sybille schauten fragend um sich; ihnen war es anzusehen, wie unwohl sie sich fühlten. Uns drei erfasste eine immer gedrücktere Stimmung.
«Ihr müsst hier bleiben», sagte Papi plötzlich.
Was??? Hierbleiben??? Hilfe!!!
Ein dicker Kloss setzte sich mir im Hals fest. Ich fühlte mich, als würde man mich in die Mangel nehmen.
Ich will wieder nach Hause zurück!
Mami sah, mit rotem Gesicht und Tränen in den Augen, zu uns Kindern herab. Sie wischte sich darauf mit der Hand die Augen klar und nahm mich und meine beiden Schwestern in ihre Arme.
«Macht’s gut und passt auf euch auf. Mami liebt euch und ich komme wieder und besuche euch», erklärte sie schluchzend.
«Es muss so sein», sagte Papi, während er uns kurz in die Arme schloss und uns fast regungslos an sich drückte.
Danach verliessen beide das Haus durch dieselbe Tür, durch die wir erst vor wenigen Minuten hereingekommen waren. Die Pendeltüre schwang sich leicht klappernd ein, und wir folgten dem unbekannten Dicken.
«Kommt mit», sagte er mit fast tonloser Stimme.
«Wir bringen jetzt zuerst einmal das Gepäck auf eure Zimmer; dann könnt ihr zum Abendessen gehen».
Eure Zimmer?
Wir folgten ihm mit kleinen, leisen Schritten. An den Wandschränken vorbeigehend, sahen wir das erste Mal in den Saal, aus dem die Geräusche kamen, die mich zuvor so geängstigt hatten. Da sassen Mädchen und Jungen unterschiedlichen Alters zusammen mit Erwachsenen an Tischen beim Essen und unterhielten sich.
Als wir in Sichtweite kamen, verstummte der ganze Saal. Blicke fixierten und taxierten uns drei Neuankömmlinge. In jenem Augenblick schien alles still zu stehen. Das Kratzen auf den Tellern hatte aufgehört. Kein Gemurmel war mehr zu hören. Niemand regte sich. Absolut niemand.
Nur das Summen der Fliegen, die ungeachtet dieses «ungeheuerlichen Moments» im Saal herumschwirrten, war zu vernehmen. Alle Blicke schienen stumme Fragen an uns zu richten. Als wir mit dem Bärtigen in einem weiteren langen Gang verschwanden, löste sich die Starre im Saal auf und wechselte wieder in die vorherige Stimmung über. Der grosse Mann ging voran. Seine Schritte wirkten schwer, der Boden knirschte und knackte unter seinem Gewicht.
Wo sind wir? Wohin gehen wir? Warum sind wir hier? Was habe ich nur angestellt?
Da sass ich nun. Gegenüber Gesichtern, die kommentarlos ihr Essen in sich hineinschaufelten und mir fragende Blicke zuwarfen. Am oberen Tischende sass eine Frau, die mir als Irene vorgestellt worden war. Sie hatte ein rundliches Gesicht mit Pickeln an Kinn und Stirn, sowie lockiges, zerzaustes Haar. Ihr oblag die Aufsicht am Tisch.
Irgendwann einmal würde ich erfahren müssen, dass es nur das zu essen gibt, was auf dem Tisch steht. Und dass auch alles gegessen wird, was auf den Teller kommt – ob es einem nun schmeckt oder nicht! Am ersten Abend gab es Apfelkuchen. Die Äpfel waren geraffelt und mit viel zu viel geriebenen Nüssen im Aufguss bedeckt. Der Kuchen war es denn auch, welcher den Speiseraum mit dem Geruch nach Erbrochenem ausfüllte. An diesem ersten Abendessen lächelte Irene, die Tischaufseherin, mich an und fragte mich nach meinem Namen. Ich war viereinhalb Jahre alt.
2
Therapie
«So als würde mir mit Wucht ein Dolch in den Rücken gerammt, fühle ich ein Stechen in meiner Brust», erklärte ich mein Anliegen beim ersten Praxisbesuch.
Wenige Augenblicke zuvor hatte mir eine Frau die Tür geöffnet und mich freundlich hereingebeten. Die leicht korpulente Frau ging mit mir durch einen kurzen Gang voraus in ihr Behandlungszimmer. Der Raum glich mehr der Bibliothek eines Adligen, denn einer Praxis. Links neben der Türe, hinter einem mächtigen Schreibtisch, wo sie sich hinsetzte, thronte ein altes mit Schnitzereien verziertes Büchergestell. Nur die Liege hinter mir, der Wandschirm und ein Glaskästchen, gefüllt mit diversen Globuli-Hülsen, erinnerten mich daran, dass ich mich bei einer Homöopathin befand.
Laura meine Frau hatte sie ebenfalls schon konsultiert und schwärmte von den Erfahrungen, die sie bei ihr gemacht hatte. Und so sass ich nun da. Gegenüber einer Frau, die ansteckend Sicherheit, Grazie und Lebensfreude ausstrahlte.
«Was ist dein Anliegen?» fragte sie, nachdem wir uns einander vorgestellt und die Formalitäten erledigt hatten.
«Ich leide seit einiger Zeit an wiederkehrendem Sodbrennen. Ich war auch im Spital, wo man eine Magenspiegelung durchführte. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, nicht wirklich weiter zu kommen.»
«Was machst du beruflich?»
«Ich bin im Aussendienst tätig und nebenher führe ich die neuen Mitarbeiter in die Praxis ein.
Seit vier Jahren klappere ich nun schon die Hausfrauen in meinem, Verkaufsgebiet ab. Gehe von Tür zu Tür und versuche Termine abzumachen, um «das» Reinigungssystem präsentieren zu dürfen. Ich bin Staubsaugervertreter.»
«Das ist ein anstrengender Job.»
«Ja, ich gehe morgens um halb acht zur Arbeit und komme gegen zehn Uhr abends wieder nach Hause.»
Zwei Stunden lang befragte sie mich; und ich antwortete ihr, so gut ich konnte. So erzählte ich ihr von den Schulden, in die ich geraten war.
«In meinem neuen Job als Berater verdiente ich auf einmal das Doppelte und dachte nicht eine Sekunde daran, dass kein Weg am Fiskus vorbeiführt. Abseits der Arbeit lebte ich ein Leben wie ein kleiner Millionär. Ich parkte den Wagen wo und wie lange ich wollte – und wurde so zu einem sicheren Stützpfeiler für das Budget der lokalen Polizei.» erzählte ich mit den dazu passenden Bildern im Kopf und auch etwas stolz mit einem Schmunzeln im Gesicht. «Ich kaufte Kleider wie mir danach war. Natürlich nicht bei «H&M»; Ich habe einen Freund der eine Boutique besitzt und bei dem ich gerne regelmässig vorbei schaute. Nie ohne mit einem der exklusiven Teile in der Hand aus dem Laden zu gehen. Und in Restaurants bestellte ich mir immer das, worauf ich gerade Lust hatte.
Eine gewisse Zeit lang ging das Ganze gut. Aber es kam der Moment, von dem an mir Lohnschwankungen im wahrsten Sinne des Wortes einen Strich durch die Rechnung machten. Denn nachrechnen, dieses Wort gab es in meinem Wortschatz nicht wirklich. Rechnungen der Boutique flatterten rein. Dazu die Bussen und obendrauf die Steuern. So geriet ich immer tiefer in die Schuldenfalle, die mir zusehends grössere Sorgen bereitete.» Erzählte ich frei heraus weiter und fühlte mich geborgen dabei, eine Frau vis-à-vis zu erleben, die unvoreingenommen da sass, aufmerksam zuhörte und mir das Gefühl gab, wie ein Vogel im Himmel kreisen zu dürfen.
Egal was ich erzählte, da war kein Einspruch wie; «wie konntest Du nur,» oder «bist nicht ganz bei Trost?» Nein, sie sass einfach nur da, und fragte nach, wenn sie etwas nicht verstand oder Genaueres wissen musste.
Ich erzählte ihr auch, wie ich aus meiner alten Heimat an meinen neuen Wohnort umzog, und wie ich Laura meine erste Frau kennenlernte.
«Wie läuft’s in der Ehe?»
«Na ja», gestand ich nach kurzem Zögern, «wir geraten immer wieder aneinander. Sie ist so anders als ich. Sie telefoniert jeden Tag mit ihrer Mutter; manchmal auch zwei oder drei Mal. Und sogar nach Feierabend geht sie noch bei ihr vorbei, um zu plaudern. Laura ging kaum aus; weder mit mir, noch mit einer ihrer Freundinnen. Sie schaute sich lieber einen Film an, lass in einem Buch oder blätterte Zeitschriften durch. Sich sportlich zu betätigen oder ein anderes Hobby ausserhalb der vier Wände zu pflegen – so etwas gab es bei ihr lange Zeit nicht. Eines Tages jedoch kam Laura mit der Idee einer Arbeitskollegin nach Hause.»
«Jazzercise verbindet tänzerische Elemente mit modernsten Klängen.» So Laura, als sie nach der ersten Übungsstunde nach Hause kam. «Dabei wird die Ausdauer und die Koordination trainiert, die Muskulatur gestärkt und das Gleichgewicht verbessert».
«Hinzukam, dass sie Nordic Walking für sich entdeckte. Zu meiner grossen Überraschung stand sie hierfür um fünf Uhr in der Früh auf. Und nachdem sie einen Grundkurs besucht hatte, interessierte auch ich mich für diesen Sport, und so lernte ich von ihr, auf was es beim Nordic Walking so alles ankam.
Bei jedem Wetter greife ich seither zu meinen Nordic Walking-Stöcken und marschiere durch die Kornfelder, über die Hügel und staune dabei immer wieder über das Schauspiel, das die Natur mir bietet.»
Die ganze Zeit folgte Anita die Therapeutin meinen Erzählungen und schien so, als würde sie mit mir in meine Bilder eintauchen, die in mir aufkeimten. Die Wellenbewegungen der Ähren, die im Wind wogten und mit den letzten Sonnenstrahlen tanzten. Oder den Tag, an welchem es nur einmal geregnet hatte und es sich ergab, dass sich die Wolken just in dem Moment von Westen her verzogen, als die Sonne genau am Horizont stand. Kein van Gogh der Welt wäre fähig gewesen, solch einen magischen Moment einzufangen, war ich doch genau in diesem Augenblick ein fester Bestandteil des «Gemäldes». Die dunklen Wolken fingen zu brennen an - glutrot wie Kohle, die sich langsam verzehrt und allmählich zu Asche wird. Mit dem goldenen Korn, das mit dem Wind zu tanzen schien, flogen so manche meiner Gedanken der Sonne hinterher.
«So überrascht es mich heute nicht, wenn Laura jeweils nach einem Walk mit roten, verschwitzten Wangen, gleichzeitig beschwingt und stolz vor mir steht. Das Wohlbefinden ist ihr von Weitem anzusehen. Auch freute ich mich, als sie anfing, mit ihren Freundinnen auszugehen. Mal schlemmen sie gemeinsam in einem Lokal, mal bestellt Laura ein Abendessen, das ich für sie und ihre Freundinnen zubereite. Ich decke dann den Tisch auf der Veranda, nehme die hohen Weingläser aus dem Schrank und stelle die passenden Wassergläser dazu. Und die «Damen» dinieren bei Kerzenlicht bei uns in der Veranda.» Anita schmunzelte bei der Erzählung und machte weiter ihre Notizen und in mir kreuzte der Gedanke, wo eigentlich die Frau geblieben war, die, als wir in die Flitterwochen gehen wollten, zuerst aus lauter Heimweh, gar nicht erst wegfahren wollte? Etwas, das ich nie verstand.
«Ich fühle mich manchmal eingeengt. Wenn ich mal ausgehen will, lässt sie mich nur schweren Herzens gehen. Meistens streiten wir, bis ich schliesslich wütend das Haus verlasse. Ich meine, ich gehe ja nicht mehr so oft wie früher aus, aber einmal im Monat liegt doch noch drin? Auch möchte ich schon lange in meine Heimat zurückkehren - aber sie will nicht mit! Ich wollte für ein Jahr weg und nun bin ich schon zwei Jahre hier.»
«Wie hast Du Deine Kindheit und Jugend erlebt?» fragte Anita weiter und ich erzählte aus der Zeit, wie ich aus dem Heim kam und über die Schwierigkeiten in der Schule. «Da waren Kumpels mit denen ich allerlei Schabernack betrieb. Zu Rauchen begann ich Ende der fünften Klasse. Und die Zigaretten klauten wir im Dorf bei «Tante Emma» aus dem Gestell heraus. Wenn ich auf dem Schulhof angegriffen wurde, dann knallte es heftig,» beichtete ich Anita und sah mich dabei auf Check, meinem verhassten Klassen-«Kameraden» liegen, meinen Daumen in sein Auge gepresst.
«Heimkind nannte mich Check und hänselte mich wegen meiner Herkunft, worauf ich ihn dann meinen Hass auf meine Vergangenheit auf unsanfte Weise spüren liess. In Trance packte ich ihn und ließ erst ab, als mich die Pausenaufsicht von ihm wegzehrte. Dass er sein Auge hätte verlieren können war mir …egal.»
«Weshalb musstest Du ins Kinderheim?», fragte sie erstaunt.
«Das weiss ich nicht wirklich; meine Eltern trennten sich, als ich dreieinhalb Jahre alt war. Ich konnte das nicht begreifen.»
Sie hörte interessiert zu und hakte nach, sobald sie über eine Sache mehr wissen wollte. Wie der kleine Junge, der vor dem Schlafen gehen an Mamas Seite, die warme Decke bis zum Hals herangezogen, von seinen Erlebnissen des Tages erzählend, empfand ich Geborgenheit.
Am Ende bekam ich ein Globuli und wurde mit dem Rat, nicht mehr als zwei Tassen Kaffee täglich zu trinken, sowie auf Bier und Weisswein zu verzichten, verabschiedet.
3
Frauengeschichten
Wieder auf dem Weg zur Arbeit fand ich mich nach der Verabschiedung von Anita in meinen Gedanken, die während der Fahrt am See entlang, im Kurzfilm durch meinen Kopf liefen. Ich als begeisterter Jugendlicher beim Eishockeyspiel. Um Profi zu werden, reichte es jedoch nicht. Nicht zuletzt auch deshalb nicht, weil die finanziellen Mittel mehr als fehlten. Ich konnte nur dann an den Trainings oder an den Spielen teilnehmen, wenn ein Kollege ausfiel und ich so die Ausrüstung ausleihen konnte.
Auch die Schlittschuhe musste ich stets mieten. Doch irgendwann reichte es für den Kauf von gebrauchten Schlittschuhen; sie waren mein ganzer Stolz.
Das Geld für die Hockeystöcke sparte ich mir vom Taschengeld ab. Oder ich stand nach einem Hockeymatch an der Bandentür und wartete auf die abgekämpften Spieler, welche hier hindurch mussten, um in die Umkleidekabinen zu gelangen. Und so bettelte ich gelegentlich den einen oder anderen an, ob ich denn nicht seinen gebrauchten Schläger haben könnte. Und tatsächlich: manchmal ergatterte ich auf diese Art und Weise wirklich ein etwas ausgeleiertes Spielgerät. Für mich waren das jeweils unbeschreiblich magische Momente.
Ich stand beinahe täglich auf dem Eis und spielte Eishockey. Wir drehten Runden mit den Mädchen, die oft danach fragten, und flitzten Fangen spielend über die Fläche und – fühlten uns in diesen Augenblicken wie Helden.
Mädchen, die Interesse an mir zeigten, gab es einige. Auszuprobieren auch. Und das kam nicht von ungefähr. Ich trug langes Haar wie die Pop-Ikone George Michael. Es waren zwar die Achtziger, ich jedoch frönte der Musik der Sechziger und Siebziger: Pink Floyd, Simon & Garfunkel, Supertramp oder Marillion. Das Hippiedasein – ab und zu einen Joint rauchen und dabei in mich gehen, gehörte damals bei mir einfach dazu. Wenn ich mit einer Zeitmaschine an ein Ereignis aus der Vergangenheit hätte zurückreisen können, dann wäre das Woodstock-Festival sicherlich in der engsten Auswahl meiner Reiseziele gewesen.
«Träumer» würde ich mir zurückblickend heute schmunzelnd zurufen.
Neue Hits hingegen waren nur dann Inhalt meines Lebens, wenn ich mit Bekannten eine Disco für eine Nacht aufbaute. Ansonsten wollte ich nichts von dieser seichten Musik wissen. Ausser, wenn ich bei den Mädchen landen wollte. Dann durfte es selbstverständlich auch Kuschelrock sein.
Meine erste feste Freundin hiess Rachel. Ich lernte sie kennen, als wir erstmals eine Disco auf dem offenen Eisfeld organisierten. Sie war wegen Markus da, dem die Disco-Anlage gehörte. Rachel sass mit ihm an der Kasse, als ich dazustiess. Wir plauderten und lachten, nachdem sich Markus zum DJ-Pult begeben hatte, um den Abend zu starten.
Mädchen, mit denen ich meine ersten Erfahrungen machte, gab es zuvor nicht wenige. Aber so? Wenn sie mich anlachte, dann strahlte ihr ganzes Gesicht. Ihre Augen glitzerten wie ein Bergsee bei einem lauen Lüftchen einer Vollmondnacht und entzündeten in mir etwas mir bis dahin Unbekanntes. Aufgeregt sass ich ihr gegenüber. Der Bass der Discomusik entsprach meinem Herzschlag, der sich im Laufe des Abends immer kraftvoller zeigte. Mit flotten Sprüchen aber, die uns immer wieder zum Lachen brachten, überspielte ich den nervösen Teenager, der sich damals am Verlieben war.
Schon bald nahm ich alles in Kauf, nur um in ihrer Nähe sein zu können. Ich setzte mich auf das «ausgeliehene» Fahrrad meiner Schwester und strampelte mit einer Tasche auf dem Rücken, in dem ich den ebenfalls «ausgeliehenen» Kassettenrekorder meiner Schwester mit mir führte, die gut dreissig Kilometer zu Rachel die Hügel hinauf. Völlig verschwitzt legte ich mich dann zu ihr, und wir kuschelten zusammen. Ob sie gerade für Ihre Ausbildung zur Sportfachangestellten lernen musste, wenn ich angefahren kam, kümmerte mich nicht gross. Weshalb auch? Für mich war Lernen ein Fremdwort, und Schule eine Nötigung, auf die ich mich nur deshalb einliess, weil mich meine Mama, bei der ich damals wieder wohnte, dorthin schickte.
Dann war da noch die Sache mit der Eifersucht. Ich bin nicht stolz darauf, doch ich fühlte mich stets zurückgesetzt, wenn Rachel mit anderen und nicht mit mir zusammen war. Und das nahm, geradezu obsessive Züge an: Wenn sie mit ihren Freunden etwas unternahm, erschien ich dort immer wieder auf der Bildfläche.
Ich tauchte an ihrem Ausbildungsplatz auf und telefonierte ihr immer und immer wieder hinterher. Was, wohlgemerkt im Zeitalter vor dem Handy, sowohl für den Anrufenden als auch für die Angerufene jeweils einen ziemlich grossen Aufwand bedeutete.
Meine Güte, wie krank ich damals war, realisierte ich Tage später, als ich gedankenversunken von Haus zu Haus gehend, mich in der Vergangenheit wieder fand.
Ich kam aus einem Kenia-Urlaub zurück, den mir Mama zum Schulabschluss geschenkt hatte, als sich Rachel drei Monate nach unserem ersten Treffen, von mir trennte, weil ich ihr mit meiner Eifersucht den Atem nahm. Ich heulte wie ein junger Schlosshund, als sie mir im Bahnhofrestaurant sagte, dass es mit uns beiden aus sei. Es dauerte danach fast ein Jahr, bis ich mich wieder für Mädchen interessierte.
So wie es am Bahnhof mit Rachel sein vorhersehbares Ende nahm, so begann zwischen den Geleisen mein neuer Weg, als ich meine Ausbildung zum Betriebsangestellten bei der Eisenbahn anfing. Ich lernte das Zusammenstellen von Zugkompositionen, sowie andere Tätigkeiten, die den Bahnbetrieb aufrecht erhielten und beendete meine Lehre erfolgreich. Kaum zu glauben, ich konnte lernen, wenn ich es nur wollte. Wärend dieser Zeit trat Nicole in mein Leben. Es war eine Hassliebe, die über zwei Jahre dauerte und mit der ich damals meine erste gemeinsame Wohnung bezog.
Diese Beziehung scheiterte nun am «Gegenteil» - denn nun war ich es, der kaum «atmen» konnte, weil meine Freundin immer in meiner Nähe sein musste. Ich sah meine Kumpels kaum noch; und wenn, dann musste sie dabei sein. Und zu schlechter Letzt sah ich mich auch noch damit konfrontiert, dass Nicole sowie ihre Mutter meinen Glauben, den ich mit Überzeugung lebe, nur schwer akzeptierten.
Ich pubertierte zu jener Zeit gegenüber Gott. Ich besuchte den Gottesdienst kaum noch. Und wenn ich dies tat, dann mit gemischten Gefühlen. Einerseits fühlte ich mich in der Kirche wohl – wie zu Hause, betete und nahm das gepredigte Wort in mich auf. Andererseits plagte mich Nicole gegenüber ein schlechtes Gewissen. Und so kam es, dass ich immer öfter nach Argumenten suchte, die gegen meinen Kirchenbesuch sprachen.
Wenn ich am Sonntagmorgen aufstand – manchmal stand auch mein Papa vor der Tür und klingelte mich raus –, hörte ich, nachdem ich wieder zurückkam, irgendwelche Vorwürfe, weil ich zuvor nicht liegen geblieben war. «Was willst du nur in dieser Sekte?» Ein anderes Mal wiederum – wir hingen gerade in einem Pub ab, wo wir mit Freunden Bier tranken, rauchten, Darts und Billard spielten - spürte ich auf einmal tief in mir das Verlangen, in die Kirche gehen zu wollen.
Ich war viel zu schüchtern, um ihnen allen zu sagen, dass ich am Sonntagabend am liebsten in die Kirche gehen würde. Ich sah vor meinem geistigen Auge, wie meine «Freunde» mich auslachen würden, wenn ich ihnen von meinem Wunsch erzählen würde. Ich, der sonst jeden Schabernack mitmachte.
Früher noch… Ja, ich war noch in der 7. und 8. Klasse. Meine Freizeit verbrachte ich mit Skifahren, Eishockey-, Billard- und Dartspielen im Pub während der Wintersaison, und in den Sommernächten zogen wir um die Häuser und klopften an manchen Fenstern bei Kumpels und Girls, die uns interessierten und mit denen wir durch die Gassen der Stadt ziehen wollten. Viel bieten konnten wir nur aus einem Grund. Wir bedienten uns am Zigarettenständer und am Bierregal, so als wären wir die Besitzer des Ladens. Und wenn es sonst einen Wunsch gab und ein Herz etwas begehrte, schritten wir ins nächste Geschäft und klauten es einfach; die Ohrringe - Cannabisblatt oder Playboyhasen-Stecker aus der Bijouterie-Abteilung im Warenhaus, das Rollbrett aus dem Spielwarenladen – es war so schön vor dem Laden ausgestellt, dass ich es nur auf die Vorderräder habe fallenlassen müssen. Draufstehen und weg war ich. Zigaretten gleich Stangenweise. Ich steckte sie mir jeweils in die Hose und ließ den Pullover darüber fallen oder schob sie in die Ärmel des Pullis und spazierte aus dem Geschäft. Manchmal kaufte ich noch einen Pack Kaugummi, damit es nicht so auffiel und verabschiedete mich freundlich bei der Kassierin. Auch die Vesperplatte durfte nicht fehlen. Also schön brav in der Metzgereiabteilung in die Reihe stellen um Salami, Schinken, Mortadella und Fleischkäse zu bestellen, dann um das nächste Gestell herum gehen und ab in die Hose damit. Bezahlt, wenn überhaupt, haben wir die Brötchen oder die Flasche Bier, die wir danach im Jugendhaus oder im Stadtpark genossen. Meist teilten wir uns die «Einkaufsliste» und gingen zu zweit in ein Warenhaus, um uns zu besorgen, wonach wir Lust hatten. Dann gab es die Kellerabteile in den verschiedenen Wohnblocks, in denen wir uns mit Wein oder Prosecco versorgten, damit wir berauschende Feste feiern konnten. Und je grösser die Beute umso stolzer war ich. Meine «Freunde» gaben mir einen Auftrag und ich besorgte, was gewünscht wurde. Meistens Zigaretten im Zehnerpack.
Es war an einem Mittwochnachmittag. Wir alberten im Hinterhof eines Kumpels herum, der für viele Jungs der Stadt die Mofas frisierte. Der «Mechaniker» war gerade damit beschäftigt, einen Auspuff abzumontieren, als ich mir die letzte Zigarette aus der Packung pulte, in den Mund steckte, das Feuerzeug aus der Hose nahm und den Glimmstängel damit anzündete. «Ich gehe noch kurz in den Laden um Zigaretten zu holen», kündigte ich an und schon wurden die Rufe laut: «Bitte mir auch noch welche.» Zwei Minuten später drückte ich die Kippe im Aschenbecher aus und betrat ein Geschäft, das gleich um die Ecke gelegen war. Wie gewohnt lief ich zum Gang, in welchem die Zigaretten aufgestapelt waren. Ich packte mir zwei Stangen Zigaretten wie bestellt und ging langsam und um mich sehend um das Regal herum. Dabei schob ich die Packungen je in einen Ärmel meines Pullis und lief in Richtung Kasse. Dort schnappte mir eine Packung Kaugummis (Mama sollte ja auch nicht merken, dass ich rauche), legte diese aufs Band und bezahlte brav, als ich an der Reihe war. Mit einem Lächeln im Gesicht ging ich in Richtung Rolltreppe durch die Schiebetüre, als mich eine nette Dame bat, sie doch bitte begleiten zu wollen und mich dabei höflich und bestimmt am Arm fasste.
«Für wen sind die beiden Stangen» wurde ich von der Polizei gefragt, als die mich wenige Minuten später zuerst im Geschäft verhörten, bevor sie mich mitnahmen.
«Scheisse» ging mir das Schaudern durch Mark und Bein. «Lügen zwecklos, da verschiedene Marken». Ich sah zu jenem Zeitpunkt keine andere Möglichkeit, als die Wahrheit zu sagen und verpfiff meine Kumpels. Eine Stunde später befand ich mich auf einer Bank am Empfang des Polizeipräsidiums, neben meinem Kumpanen. Die bedrohliche Stimmung raubte mir beinahe den Atem. Wir durften keinen Mucks von uns geben. Ja, wenn wir uns nur ansahen und die mörderischen Blicke die Ruhe unterbrachen, wurden wir vom Polizisten vis-à-vis ermahnt, still zu bleiben. Und jedes Mal, wenn die Ruhe vom Öffnen der Türe unterbrochen wurde, fing mein Herz von Neuem an zu rasen. Es dunkelte an diesem Herbsttag schon, als wir zum Verhör gebracht wurden, was beinahe befreiend wirkte. Denn der Beamte, der mir gegenübersass, wirkte verständnisvoll und sah die jugendliche Tat nicht so streng wie ich. Er wurde ja danach auch nicht mit dem Streifenwagen nach Hause gebracht und stand dann auch nicht seiner Mutter gegenüber. Ich erinnere mich nur noch an ihre Lautstärke und den darauf folgenden Tinnitus. Was sie alles von sich gab, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Die Konsequenz daraus war es jedoch, dass sie mir verbot, mich jemals wieder mit diesen «Freunden» zu treffen. Gott sei es gedankt. Keine Ahnung, ob ich den Moment überlebt hätte, wäre ich einige Tage später bei den Jungs aufgetaucht? Mit dem Rüffel in der Schule ging es am darauffolgenden Tag weiter. «Noah», höre ich meinen Klassenlehrer noch heute sagen, «gerade jetzt, wo ich dachte, dass es endlich in eine positive Richtung geht mit dir, geschieht wieder so etwas.»
Nach einem Besuch auf dem Jugendrichteramt, wurden wir beide zu einer Geldbusse (mein Tagegeld wurde für eine ganze Weile gestrichen) verdonnert.
Eine Lehre fürs Leben. Wenn ich heute beim Bezahlen zu viel zurückerhalte, mache ich darauf aufmerksam. Mit meinen Kumpels kam ich etwa ein Jahr später wieder zusammen und wir absolvierten gemeinsam die Ausbildung auf demselben Bahnhof.
Und da sass ich nun in Mitten meiner Kumpels, rauchte eine Zigarette, trank mein Bier und «mimte» den Heiligen?
Meine «Freunde» sollten auf keinen Fall erfahren, was ich vorhatte. Stattdessen fragte ich Nicole und die Clique, ob sie noch eine Stunde hier wären – ich würde gerne noch kurz meinen Vater besuchen. Es war wohl jugendliche Feigheit, jedoch keinesfalls eine Lüge, der ich mich bediente, denn ich wusste ja, dass mein Papa jeweils zu dieser Zeit in der Kirche sass und mein geistiger Vater Gott im Himmel ist.
Als ich mich mit der damaligen Situation beschäftigte, fühlte ich die Beklemmung von einst, denn als ich den Pub betrat, kam mein damaliger Weggang zur Sprache – und ich gestand Nicole, wo ich wirklich gewesen war. Da wurde sie richtig sauer. Nicht, weil ich die Kirche besucht, sondern weil ich ihr nicht vertraut, nicht die Wahrheit gesagt hatte.
Und meine Kumpels? Diese fielen verbal über mich her und verhöhnten mich und meinen Glauben. Das Harmloseste war noch die Frage, ob ich denn dort «richtig beten» würde. Ein anderer aus der Runde hielt sich weniger zurück: «Du spinnst ja wirklich. In die Kirche…?», liess er den angefangenen Satz vielsagend unvollendet und – zeigte mir demonstrativ einen «Vogel». Und ich? Ich sass beschämt da und wäre am liebsten davongelaufen.
Doch ganz alleine ohne Kumpels.
Oft musste ich mir von Nicole sagen lassen, ich sollte mich einmal im Spiegel betrachten, wenn ich sie anschrie, wenn wieder einmal etwas zwischen uns stand. Sex war unser probates Allerheil- und Versöhnungsmittel. Es war als ich meinen Militärdienst zu absolvieren hatte und ich erfuhr, dass sie sich in meiner Abwesenheit mit einem anderen trifft. Sie war so frei und erzählte mir an den Wochenenden, mit wem sie während der Woche was unternommen hatte. Und als durchsickerte, dass sie eigentlich immer wieder mit ein und derselben Person unterwegs war, stellte ich sie zur Rede. Ich fühlte mich verlassen und im Stich gelassen und wie einst im Kinderheim, vor die Tür gesetzt.
Damals teilte ich mit drei weiteren Kindern ein Zimmer, in dem zwei Etagenbetten standen. Und wenn die Heimleiter nach dem Nachtgebet das Zimmer verliessen, plauderten wir oft noch etwas, bis wir schlussendlich einschliefen. Dann gab es aber auch Abende, an denen wir lachten und etwas lauter waren, wie wir das hätten sein dürfen. Da ging dann die Türe auf und der Heimvater betrat das Zimmer. «Wenn ihr noch nicht müde seid, dann kommt mit», äusserte er sich in bestimmendem Ton, und ehe wir uns versahen, fanden wir uns, jeder für sich, mit dem Gesicht in der Ecke, im Treppenhaus stehend wieder. Manchmal schlief einer von uns ein, weil es zu lange dauerte, bis wir von der Strafe befreit wurden.
Mit der Wut des damals Zurückgelassenen stand ich dann hasserfüllt Nicole gegenüber, nachdem ich vor die Tatsache gestellt wurde.
Nach einem Streit, in dem ich ihr fast die Hand brach, setzte ich sie vor die Tür.
Es dauerte keine zwei Monate und ich lernte Tamara an einem Novemberabend in einer Disco kennen.
Sie war Tochter wohlhabender Eltern und es schien so, als sollten ihr keine Wünsche verwehrt sein.
Monate später, es war ein bezaubernder Frühlingstag, an welchem wir ausgelassen durch die Gassen der Stadt schlenderten, fragte sie mich plötzlich, ob ich ihr treu bleiben könnte, falls sie für länger ins Ausland vereisen würde. «Zum Beispiel nach Amerika, um Englisch zu lernen», erläuterte sie mir.
Sie weilte schon während gut drei Monaten auf Guam bei Ihrem Vater, als ich erfuhr, dass sie – in Bangkok angekommen – gleich in ein Kloster zum Entzug geschickt worden war. Dabei hätte es mir schon längst klar sein müssen, dass Tamara nicht nur Hasch rauchte. Denn ein ganz spezielles Erlebnis mit ihrer «Ware» hätte mich fast das Leben gekostet.
Oft sassen Tamara und ich zusammen und rauchten einen Joint. Eines Nachmittags wartete ich in Tamaras Zimmer auf ihre Rückkehr aus der Stadt. Auf einmal verspürte ich Lust, eine «Tüte» zu rauchen, hatte aber nichts dabei. Ich sah mich suchend um: «Tamara wird doch sicher irgendwo was zu Rauchen haben?». Auf dem Bücherregal fand ich dann auch ein gefaltetes Alupapier. «Endlich!», dachte ich und drehte mir einen Joint, den ich dann, genüsslich auf dem Fensterbrett sitzend, rauchte.
Kurz darauf rief mich Tamara an und fragte mich, ob ich nicht in die Stadt kommen wolle. Gesagt, getan. Ich lieh mir ihr Mofa und fuhr los, nicht wissend, dass ich mich gerade auf einen Höllentrip begeben hatte. Dabei war das Gefühl keineswegs höllisch. Im Gegenteil. Halleluja, was war das für eine Fahrt! Ich schwebte auf Wolke sieben, steuerte unkontrolliert auf eine Kurve zu, verlor vollends die Kontrolle über das Zweirad und krachte unsanft auf die Motorhaube eines korrekt entgegenkommenden Autos. Dabei hatte ich Glück im Unglück, denn bis auf die Wunde am Schienbein, die genäht werden musste, hatte ich keinen weiteren Kratzen abbekommen. «Was hast du geraucht?», fragte mich Tamara, als ich vom Notfall zurückkam? «Hast du im Spital gesagt, dass du gekifft hast?» «Ganz sicher nicht», antwortete ich, womit ich die Geschichte für mich ad acta legte.
Es kam, wie es kommen musste. Ich feierte meinen 20. Geburtstag. Im Pub sass auch Nicole, meine Ex, mit ihrer Freundin und der Abend endete bei ihr in der Wohnung. Ich mit Nicole im Bett. Ein, zwei Tage später schrieb ich Tamara einen Brief, in welchem ich ihr gestand, dass das mit der Treue nicht so wie gewünscht und gedacht geklappt habe und zog, mit Gewissensbissen, weil ich nun der verlassende Betrüger war, einen Schlussstrich unter die Beziehung.
Die Nächste in meinem Leben hiess Beate. Mit ihr war ich über zwei Jahre zusammen. An einem Sommerabend schlenderte ich gedankenverloren durch die Gassen und hielt Ausschau nach bekannten Gesichtern.
In einer kleinen Strasse sah ich ein Grüppchen junger Frauen. Eine davon fiel mir auf, obwohl sie mir den Rücken zuwandte. Sie hatte blondes, über die Schultern fallendes Haar, war einen halben Kopf kleiner als ich und wirkte attraktiv schlank.





























