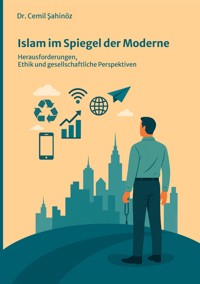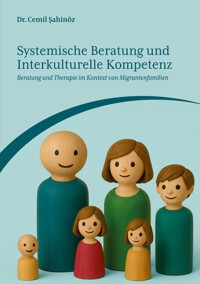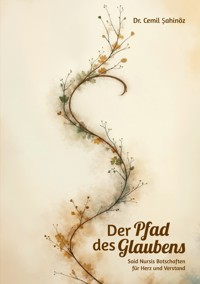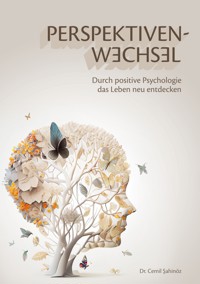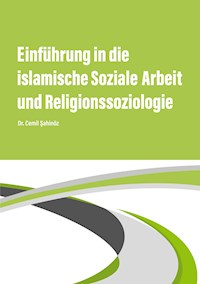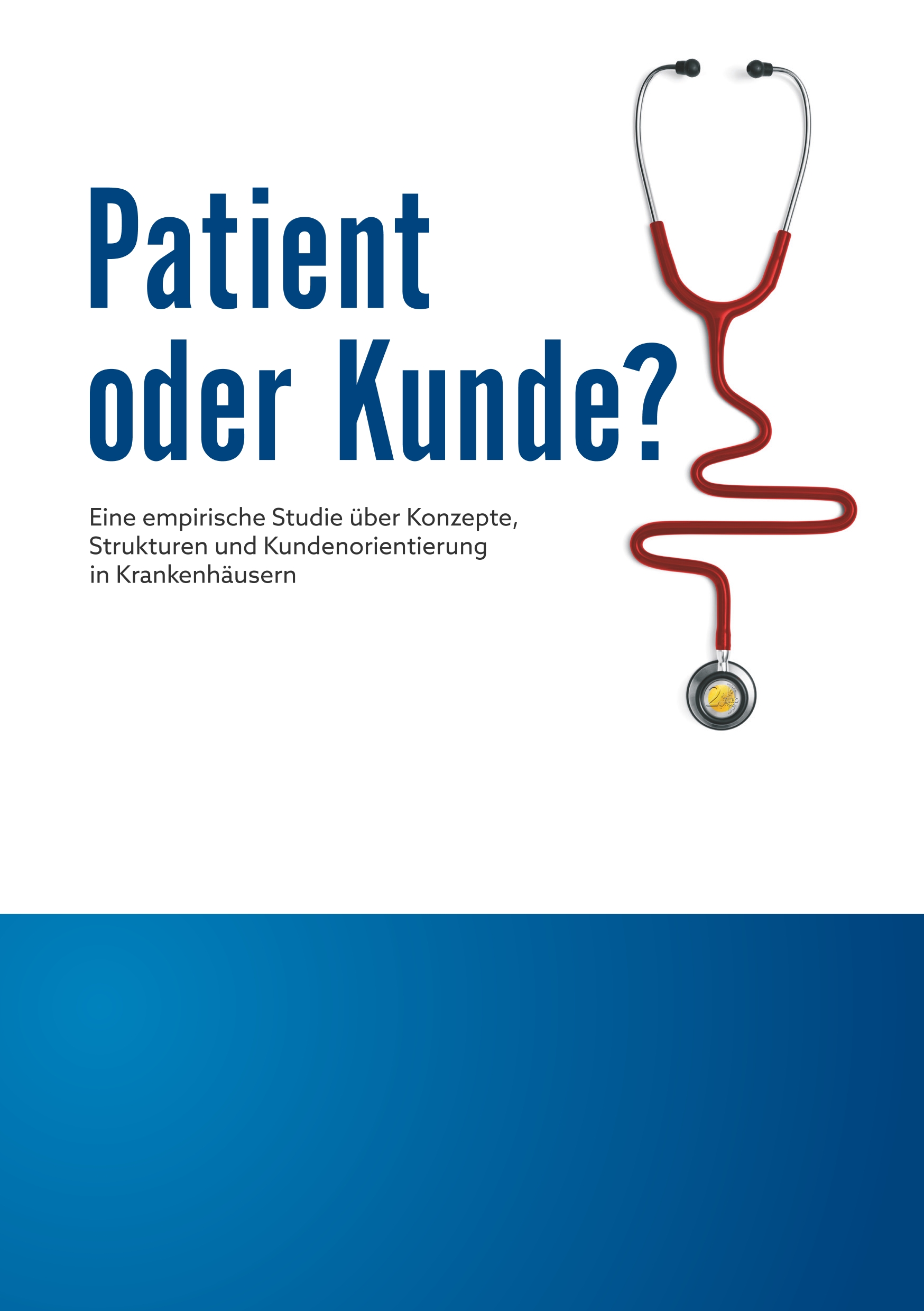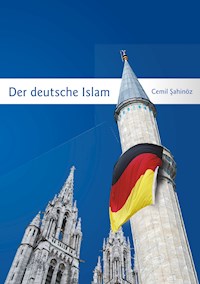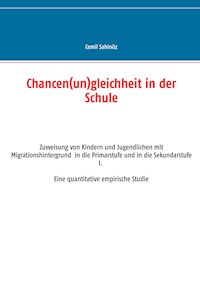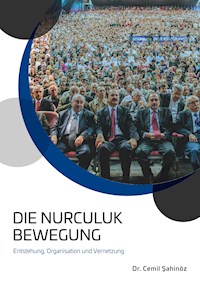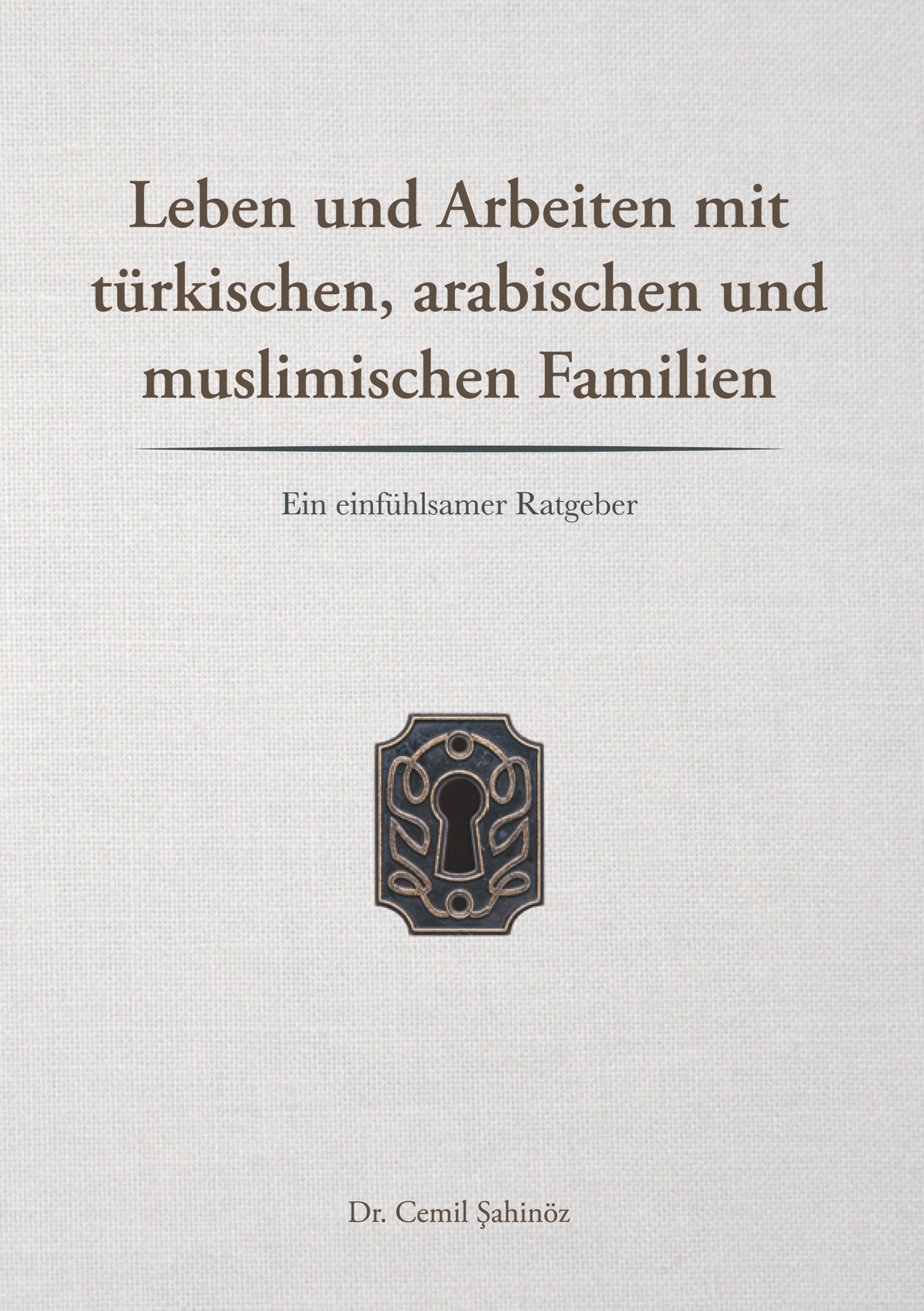
4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wir leben in einer interkulturellen Gesellschaft, in der verschiedene Kulturen aufeinander treffen. Der Zugang zu den verschiedenen Kulturen ist für Außenstehende nicht nur aus Sprachgründen oft schwierig, sondern vor allem auch aus kulturellen Gründen. Das Wissen und Erkennen von bestimmten kulturellen und religiösen Werten und Mustern jedoch erleichtert diesen Zugang. Diesem Ziel widmet sich dieses Buch, in dem die türkische, arabische und muslimische Kultur nähergebracht werden. In erster Linie richtet sich das Buch an Multiplikatoren, die mit türkischen, arabischen und muslimischen Familien arbeiten, wie z.B. an Berater, Psychologen, Therapeuten, Lehrer, Erzieher, Polizisten, Flüchtlingsberater, Migrationsberater, Mitarbeiter der Stadtverwaltungen, Staatsanwälte, Richter, Sozialarbeiter, Migrationsdienste, Seniorendienste, das medizinische Personal, speziell Ärzte, Hebammen, Krankenschwester, Kinderärzte, Besuchsdienste, Arzthelferinnen, Gynäkologen aber auch an gewöhnliche Interessierte, die einen Einblick in diese Kulturen gewinnen möchten. "Der Autor spricht von einem einfühlsamen Ratgeber. Das Buch richtet sich in erster Linie an Multiplikatoren, die mit türkischen Familien arbeiten. Hier sollten Sich aus dem Bereich der Strafrechtspflege gleichermaßen Polizisten, Staatsanwälte, Richter und Sozialarbeiter angesprochen fühlen. In einer klaren Gliederung, gut unterteilt und mit eingängigen Beispielen ergänzt, gelingt es dem Verfasser grundlegendes Wissen darzustellen und zu vermitteln. Widersprüchliches wird begreifbar und auflösbar. Fachleute wie z.B. Staatsanwälte und Richter finden hier Erkenntnisse und Antworten für den Umgang, Gespräche und Fragestellungen. Es können entscheidende Hilfen insbesondere bei der Einschätzung von erwarteten Antworten auf Fragen in den Hauptverhandlungen sein. m.E. sehr empfehlenswert. R.D.Hering" Arbeitsgemeinschaft Deutsche Gerichtshilfe e.V.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 120
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
VORWORT
DAS PHÄNOMEN DER MIGRATION
AUSWANDERUNG AUS DEUTSCHLAND
MIGRATIONSTHEORIEN
BEZEICHNUNG
MULTI ODER INTER?
KEINE BEWERTUNG
ANEKDOTE
FREMDE SIND KEINE ALIENS… ODER DOCH?
INTERKULTURELLER DIALOG
UNKENNTNIS
INTERKULTURELLE KOMPETENZ
BARRIEREN
KULTUR
KULTURSTANDARDS UND KLISCHEES
STATISTIKEN – TÜRKEN IN DEUTSCHLAND
STATISTIKEN – MUSLIME IN DEUTSCHLAND
STATISTIKEN – RELIGIÖSE ORIENTIERUNG
STATISTIKEN – ABSOLUTE ZAHLEN IN STÄDTEN
STATISTIKEN – % DER AUSLÄNDER IN STÄDTEN
STATISTIKEN – ALTERSSTRUKTUR
STATISTIKEN – BILDUNG
STATISTIKEN – BERUF
KONTEXT
BEGRÜßUNG 1
BEGRÜßUNG 2
KOMMUNIKATION
SPRACHE 1
SPRACHE 2
SCHRIFTLICH VS. MÜNDLICH
ANREDE
ZEITGEFÜHL
TAGESABLAUF
BETRETEN EINES HAUSES
ESSKULTUR
TEE VS. KAFFEE
DER FERNSEHER
GASTFREUNDSCHAFT 1
GASTFREUNDSCHAFT 2
NACHBARSCHAFTSPFLEGE
SITUATIONSBEISPIEL
FAMILIENBILD 1
FAMILIENBILD 2
ERZIEHUNG
ERZIEHUNGSSTIL 1
ERZIEHUNGSSTIL 2
INTIMSPHÄRE
EHRE
PRIVATSPHÄRE
KRISENSITUATION
TRAUERFORMEN
NOTSITUATIONEN
KONFLIKTMANAGEMENT (MEDIATION)
GEMEINSCHAFT
EHESCHLIEßUNG
HOCHZEITSFEIER
ROLLE DER SENIOREN
STATIONÄRE FORM DER ALTENHILFE
DEFINITION VON “ALT“
SENIOREN – ZUKUNFTSPERSPEKTIVE
SENIOREN – SENIORENARBEIT
SENIOREN – BEDÜRFNISORIENTIERTE ARBEIT
SENIORENARBEIT - MIGRATIONSARBEIT
BILDUNG IM ISLAM
VORSTELLUNG VON SCHULE 1
VORSTELLUNG VON SCHULE 2
KULTUR VS. RELIGION 1
KULTUR VS. RELIGION 2
HETEROGENITÄT
RELIGION
ROLLE UND BEDEUTUNG DER RELIGION
DER ISLAM – GRUNDLAGEN
RELIGIÖSE FEIERTAGE
RELIGIÖSE ERZIEHUNG
KRANKHEIT UND HEILUNG
KRANKHEIT
HEILUNG
GLEICHGEWICHT KÖRPER
GLEICHGEWICHT SEELE
GLEICHGEWICHT SOZIALES
GLEICHGEWICHT
KOMBINATION
BEHINDERUNGEN
VOLKSGLAUBE
FALSCHES VERSTÄNDNIS VOM ISLAM 1
FALSCHES VERSTÄNDNIS VOM ISLAM 2
KRANKENHAUS – BESUCHE
KRANKENHAUS – SPEISEN
KRANKENHAUS – FASTEN
KRANKENHAUS – MEDIKAMENTE
KRANKENHAUS – DAS GEBET
KRANKENHAUS – KLEIDUNG
KRANKENHAUS – BEHANDLUNG
KRANKENHAUS – SPRACHE
GEBURT
WOCHENBETT
UMGANG MIT SÄUGLINGEN
STERBEBETT - SEELSORGE
DER TOD
BEERDIGUNG 1
BEERDIGUNG 2
BERATUNG – DIE BERATUNGSSTELLE 1
BERATUNG – DIE BERATUNGSSTELLE 2
BERATUNG – DER KLIENT 1
BERATUNG – DER KLIENT 2
THERAPIEUNTERSCHIEDE 1
THERAPIEUNTERSCHIEDE 2
SPEZIELLE PROBLEME BEI MIGRANTEN
FRAGESTELLUNGEN
BERATUNG – INHALTLICHE GESTALTUNG 1
BERATUNG – INHALTLICHE GESTALTUNG 2
BERATUNG – TIPPS
WIE ERREICHT MAN MIGRANTEN?
WELCHE MIGRANTEN?
WIE ERREICHEN?
ERREICHEN DURCH DIENSTE / MULTIPLIKATOREN
ERREICHEN DURCH PR
SCHLUSSWORT
LITERATUR
Vorwort
Die vorliegende Arbeit war zunächst ein Vortrag mit dem Titel “Zugang zu türkischen, arabischen und muslimischen Familien“. Zudem sind einige der Themen aus dieser Arbeit Bestandteil von interkulturellen Trainings, Sensibilisierungsseminaren und Workshops zur Förderung von interkulturellen Kompetenzen, die ich anbiete. Auf Grund von positiven Rückmeldungen wurden Teile des Vortrages und der Seminare in dieser Form verschriftlicht.
Wir leben in einer interkulturellen Gesellschaft, in der verschiedene Kulturen aufeinander treffen. Der Zugang zu den verschiedenen Kulturen ist für Außenstehende nicht nur aus Sprachgründen oft schwierig, sondern vor allem auch aus kulturellen Gründen. Das Wissen und Erkennen von bestimmten kulturellen und religiösen Werten und Mustern jedoch erleichtert diesen Zugang. Diesem Ziel widmet sich dieses Buch, in dem die türkische und arabische Kultur nähergebracht werden.
Hinzu kommt, dass 56% der Muslime in Deutschland türkischer Herkunft sind. 2011 waren es sogar 67,5% (DIK, 2015). 98,8% der Türken sind Muslime und 85% der Muslime in Berlin geben an, dass Religion in ihrem Alltag eine große Rolle spielt (zum Vergleich: 88% in London, 68% in Paris; Nyriri, 2007). Ähnliche Zahlen ergeben sich für arabische Menschen in Deutschland. Dies zeigt, dass die Religion für türkische und arabische Familien kein Nebenthema ist. Der Islam spielt eine wichtige Rolle im Alltag dieser Menschen.
Daher wird auch das Thema Islam behandelt. Dabei geht es nicht um die theologischen Grundlagen des Islams, sondern um spezifische Themengebiete, die die Kultur prägen, wie z.B. Krankheit, Gesundheit, Beratung und Bewältigung von Krisensituationen.
Um das Verstehen zu erleichtern, werden viele Themen mit alltagsbezogenen Beispielen beschrieben, so dass sich der Leser selbst in die Situationen hineinversetzen oder sogar vieles wiedererkennen kann.
An manchen Stellen kann es zu Verdoppelungen kommen. Dies ist beabsichtigt, da einige Themen auch eigenständige Themen sind und daher ein Vernachlässigen bestimmter Gebiete zur Unvollständigkeit führen würde.
In erster Linie richtet sich das Buch an Multiplikatoren, die mit türkischen, arabischen und muslimischen Familien arbeiten, wie z.B. an Berater, Psychologen, Therapeuten, Lehrer, Erzieher, Polizisten, Flüchtlingsberater, Migrationsberater, Mitarbeiter der Stadtverwaltungen, Staatsanwälte, Richter, Sozialarbeiter, Migrationsdienste, Seniorendienste, das medizinische Personal, speziell Ärzte, Hebammen, Krankenschwester, Kinderärzte, Besuchsdienste, Arzthelferinnen, Gynäkologen aber auch an gewöhnliche Interessierte, die einen Einblick in diese Kulturen gewinnen möchten.
Dr. Cemil Şahinöz
1 Das Phänomen der Migration
Das Thema der Migration und Integration ist von großer Bedeutung. Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft stehen weltweit im Einfluss der Migration. Durch die Migration gibt es in Einwanderungsländern demografische Veränderungen. Das Zusammenleben findet in multiethnischen Gesellschaften statt.
Vorurteile sind meistens dort vorhanden, wo es wenige Kenntnisse über fremde Kulturen gibt. Hierdurch entstehen Missverständnisse. Ein besseres Verständnis zueinander schafft jedoch ein günstiges emotionales Klima. Der eigene Horizontkreis erweitert sich. Man eignet sich mehr Kenntnisse über andere Kulturen an und kann seine eigene Identität und Kultur wiederum besser verstehen.
Weltweit leben ca. 3,4% der Weltbevölkerung nicht in ihren Herkunftsländern (UN, 2017). Der größte Teil der Einwanderung findet in westeuropäische Staaten statt.
In Deutschland wurde erst mit den Gastarbeitern Migration zum Thema. Auf Grund von Fachkräftemangel kamen zwischen 1955 und 1973 ausländische Arbeitnehmer u.a. mit dem Ziel, das Land nach dem 2. Weltkrieg wiederaufzubauen. Die eigenen Ressourcen Deutschlands reichten nicht aus, um die Nachfrage auf dem Beschäftigtenmarkt zu decken.
Der deutsch-italienische Vertag von 1955 war Anlass einer Zuwanderungswelle. Die Forcierung der Anwerbung nach dem Bau der Berliner Bauer (1961) führte dazu, dass der Zustrom der potenziellen Beschäftigtenkräfte nur noch im geringen Maße stattfand.
Die meisten Gastarbeiter wurden in der Türkei, in Italien und im ehemaligen Jugoslawien angeworben. Zum größten Teil waren es ungelernte oder angelernte junge Männer.
1973 gab es ein Anwerbestopp. Inzwischen gab es ca. 3,9 Millionen Gastarbeiter in Deutschland. Die Regierung erhoffte sich jedoch, dass die Gastarbeiter wieder zurückkehren würden. Daher gab es sozialpolitisch keine gezielten Förderungsmaßnahmen für diese Menschen. Aus den politischen Kreisen wurden langsam etliche bedenkliche Äußerungen laut.
Zwischen 1973 und 1979 gab es einen kontinuierlichen Nachzug von Familienangehörigen der eingeladenen Gastarbeiter. Willy Brandt äußerte damals, dass die Grenzen dieses Landes überstiegen seien. Es gab weitere Debatten bzgl. der Signifikanz von Migration. Deutschland wurde nicht als Einwanderungsland empfunden.
Hinzu kamen EU-Bürger, die eine Freizügigkeit in der EU genossen, Bürger anderer Staaten, die sich aufgrund entsprechender Abkommen im Land aufhalten konnten und politische Flüchtlinge, vor allem aus Bürgerkriegsregionen.
So entstanden 1979 erste Integrationskonzepte. 1981 gab es ein plötzliches Rennen um eine Begrenzungspolitik. Auf der staatlichen Ebene wurde die Einreisebegrenzung der Migranten aus der Türkei zu einem offiziellen Ziel erklärt. Und es kam das Rückkehrförderungsgesetz. Den Gastarbeitern bot man finanzielle Hilfe an, wenn sie in ihre Heimat zurückkehren würden, was dann einige auch taten.
Die Aussiedler erhielten schon 1965 die Erlaubnis zur Wiederrückkehr. Im Laufe der 70er bis Mitte der 80er Jahre gab es jedoch nur einzelne Migrationsfälle von Aussiedlern. Erst während und nach der Perestroika-Zeit (1986) in Sowjetunion gab es Massenwanderungen nach Deutschland. Im Laufe der 90er Jahre wurde die Migration von Aussiedlern erschwert. Gründe hierfür waren u.a. a.) eine große Zahl von Aussiedlern, die Anträge auf eine Einreise stellten, b.) zunehmende Zahl von Eingereisten, die wenige Bezüge zur Kultur ihrer Vorfahren hatten und c.) es keine Möglichkeiten zur Gewährleistung der Integration von diesen Personengruppen gab.
Nach der Jahrhundertwende gewann das Thema Integration in Deutschland noch einmal an Schwung. Diesmal ging es um Begrifflichkeiten wie Chancengleichheit und Diskriminierung. Integrationsbeauftragte und Migrationsfachdienste wurden in allen Städten, Gemeinden und Kommunen eingerichtet. Integrationskonzepte sprangen wie Pilze aus dem Boden. Als 2015 Geflüchtete in größeren Zahlen nach Deutschland kamen, erhitzten sich die Debatten. Rechtsextremismus wurde wieder zu einem Thema. So wird das Thema der Migration noch mehrere Jahre die Gesellschaft beschäftigen.
2 Auswanderung aus Deutschland
Inzwischen ist aber auch ein neues Phänomen erkennbar: Auswanderung aus Deutschland. Laut amtlicher Statistik sinkt der Wanderungssaldo türkischer Staatsbürger seit 2002. Und seit 2006 ist er erstmals negativ, d.h. es wandern mehr Türken aus als zu (Obergfell, 2016).
Es gibt keine verlässlichen Daten über den Typus des türkischen Auswanderers, jedoch ist ersichtlich, dass Hochqualifizierte per se häufiger auswandern. Junge, ausgebildete Türkeistämmige aus Deutschland wandern ins Herkunftsland ihrer Eltern aus. Strukturell gut integrierte Migranten der zweiten und dritten Generation verlassen freiwillig Deutschland und ihre Arbeitskraft hier geht verloren.
Ein wichtiger Grund für eine Auswanderung ist ein “fehlendes Heimatgefühl in Deutschland“ (42%). Knapp 80% glauben nicht, dass eine glaubwürdige Integrationspolitik herrscht (Spiegel, 2008). Auslöser dieser Gefühle sind die sehr intensiv geführten Integrationsdebatten mit einer negativen Problemfokussierung auf so genannte integrationsunwillige Migranten sowie auf die vermeintliche Unvereinbarkeit von Islam und Rechtsstaat. Die Zuschreibung, als Migrant gehöre man einer Gruppe an, die anders und letztlich problematisch ist, führt bei den Betroffenen oft zu einer Abwehrreaktion. So wird durch undifferenzierte Integrationsdebatten die Wahrscheinlichkeit, dass gut integrierte Akademiker das Land verlassen, immer höher.
Hinzu kommt noch, dass sich die wirtschaftliche Situation in der Türkei wesentlich verbessert hat. In den letzten Jahren ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um durchschnittlich 4,6% pro Jahr gewachsen. 2001 betrug das BIP pro Kopf 3053,28$, 2013 betrug es 12395,37$ (Statista, 2019c). Die Jobaussichten für junge Akademiker mit Auslandserfahrung sind sehr gut. Da auch durch Bekannte und Verwandte in der Türkei schon ein soziales Netzwerk und Ressourcen vorhanden sind, wird die Auswanderung aus Deutschland in die Türkei für diese Gruppe attraktiver.
3 Migrationstheorien
Soziologisch gibt es verschiedene Gründe, warum Menschen auswandern.
Ökonomisch motivierte Ansätze begründen Wanderungen in erster Linie mit den Lohnunterschieden zwischen den Ländern. Die Auswanderer machen einen “Kosten-Nutzen-Kalkül“. Die Summe der persönlichen Entscheidungen und der Ausgleich der Lohndifferenzen sind dann entscheidend. Wenn der Lohn im Zielland gleich oder niedriger ist, findet demnach keine Migration statt.
Die Push-and-Pull-Modelle gehen davon aus, dass nicht nur der ökonomische Rationalismus zur Auswanderung führt. Demnach gebe es Push- und Pull-Faktoren. Push-Faktoren sind Abstoßungsfaktoren in der Heimatregion und Pull-Faktoren sind Anziehungsfaktoren in der Zuwanderungsregion.
Andere Typologien, die sich zu den bereits genannten Arten nicht zuordnen lassen, sind u.a. ursprüngliche Wanderung (primitive migration), gewaltsame Wanderung (forced migration), durch einen Treib hervorgerufene Wanderung (impelled migration), freiwillige Wanderung (free migration) und massenhafte Wanderung (mass migration).
4 Bezeichnung
Der Soziologe Georg Simmel unterscheidet den Fremden und den Gast folgendermaßen: Der Gast ist der, der heute kommt und morgen geht. Der Fremde ist der, der heute kommt und morgen bleibt (Simmel, 1908, S. 509; vgl. Schütz, 1972).
Die Gastarbeiter aus den verschiedenen Ländern kamen alle als Gäste nach Deutschland. Sie wollten alle irgendwann wieder zurück. Ihre Motivation war dementsprechend. Demnach brauchten sie weder die deutsche Sprache zu erlernen, noch sich Bildungsmäßig weiterzubilden. Auch die Einheimischen verlangten von ihnen nicht, dass sie die deutsche Sprache erlernten.
Doch sie wurden schnell von Gästen zu Fremden, weil sie nicht zurückkehrten. Sie blieben in Deutschland. Und da sie sich in Deutschland nicht auskannten, waren sie eben die Fremden. Sowohl aus ihrer eigenen Sicht als auch aus der Sicht der Einheimischen.
Zunächst waren sie nur die “Gastarbeiter“. Dann wurden sie zu “Ausländern“. Heute sind sie die “Migranten“. Obwohl auch hier kein Konsens herrscht. Es gibt verschiedene Bezeichnungen, die verwendet werden: Menschen mit Migrationsgeschichte, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Zuwanderungshintergrund.
Bei jüngeren Generationen verwendet man öfters den Begriff “Menschen mit Migrationsvorgeschichte.“ Hierbei soll betont werden, dass die Migrationsgeschichte der eigenen Geschichte vorgeht.
Damit jemand mit einem dieser Begriffe bezeichnet werden kann, werden soziologisch die letzten drei Generationen betrachtet. Dass heißt, erst, wenn man drei Generationen vorher niemanden mehr in der Familie hat, der immigrierte, wird man nicht mehr als Migrant bezeichnet.
Juristisch gesehen, zählt nur der Begriff “Ausländer“. Alle, die keinen deutschen Pass haben, sind demnach Ausländer. Alle anderen sind Deutsche.
Der Einfachheit halber benutze ich in dieser Arbeit den umgangssprachlichen Begriff “Migrant“.
5 Multi oder Inter?
Der Begriff “Migration“ kommt von “migratio“ (“migrare“) und bedeutet Auswanderung. Im soziologischen Sinne versteht man darunter den längerfristigen Wohnortwechsel eines Menschen.
Integration ist vom lateinischen integratio abgeleitet und bedeutet in der Soziologie die Ausbildung einer Lebensgemeinschaft. Integration beschreibt einen dynamischen, lange andauernden und sehr differenzierten Prozess des Zusammenfügens und Zusammenwachsens, der den Zustand der Exklusion und der Separation aufheben soll.
Der Soziologie Meißner beschreibt Integration als ein Prozess, bei dem verschiedene Teile zu einem neuen Ganzen zusammengefügt werden. Es ist die Entstehung von gleichgewichtigen Interdependenzen zwischen Personen und Gruppen, was man unter Integration versteht. Minderheit und Mehrheit treffen aufeinander. Es entsteht ein Prozess des Austauschs, dessen Ergebnis eine Gesellschaft ist, die an kulturellem Reichtum gewonnen hat. Ziel der Integration ist die gleichberechtigte wirtschaftliche, gesellschaftliche, politische und kulturelle Teilhabe der Zuwanderer in der aufnehmenden Gesellschaft. Nach dem Soziologen Hartmut Esser gelingt dieser Prozess nur dann, wenn kognitive, strukturelle, soziale und identikative Integration in den Blick genommen werden. Luhmann dagegen, benutzt den Begriff der Integration gar nicht und ersetzt ihn mit Inklusion / Exklusion. Er geht davon aus, dass eine Integration in funktional, differenzierte Teilsysteme nicht möglich ist. Stattdessen findet eine Inklusion, also Teilnahme von Personen an den jeweiligen Leistungen der ausdifferenzierten gesellschaftlichen Teilsysteme und Organisationen, oder eine Exklusion, die Nichtteilnahme, statt.
Auch multikulturell und interkulturell sind Begriffe, die öfters durcheinandergeworfen werden.
Multikulturell
bedeutet, dass mehrere Kulturen nebeneinander existieren, ohne sich zu berühren.
Interkulturell
ist die Schnittmenge, wenn sich verschiedene Kulturen schneiden. Es ist das “Neue“, was hervorkommt.
Das Anliegen sollte sein, eine interkulturelle Gesellschaft aufzubauen. Also eine Gesellschaftsform zu entwickeln, in der nicht nebeneinander, sondern miteinander gelebt wird und in der die soziale und ethnische Herkunft keine Rolle mehr spielen.
Der Begriff interkulturell kommt übrigens aus der Wirtschaft. Wie so häufig, war auch hier die Wirtschaft Vorreiter. Denn um das eigene Produkt auch in anderen Ländern verkaufen zu können, bedarf es, dass man den Markt und die Kultur der Zielgruppe genauestens einstudiert. Nur so kann man das Produkt “an den Mann und an die Frau“ bringen. Daher ist interkulturelle Arbeit für viele international agierende Unternehmen ein lange bekanntes Arbeitsfeld.