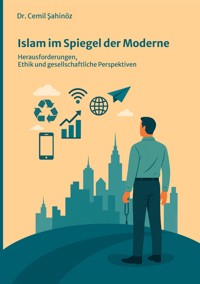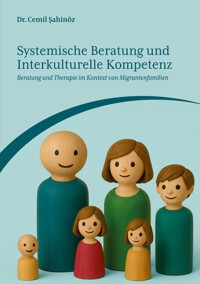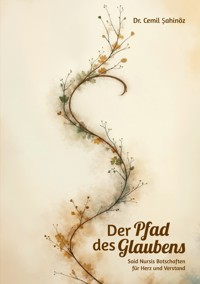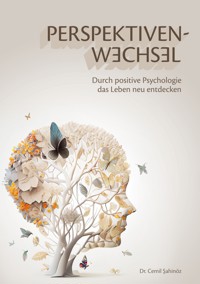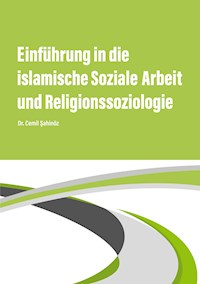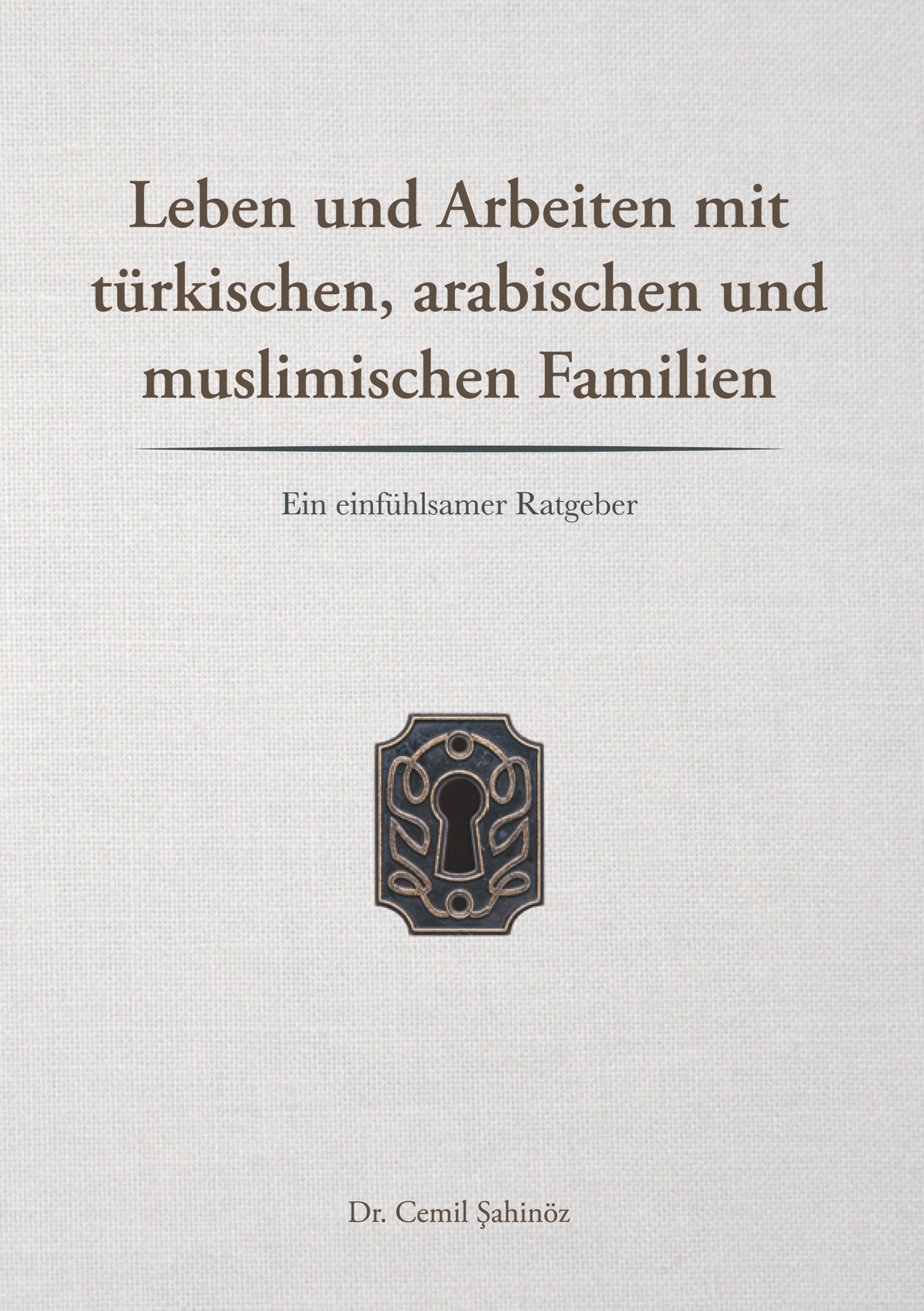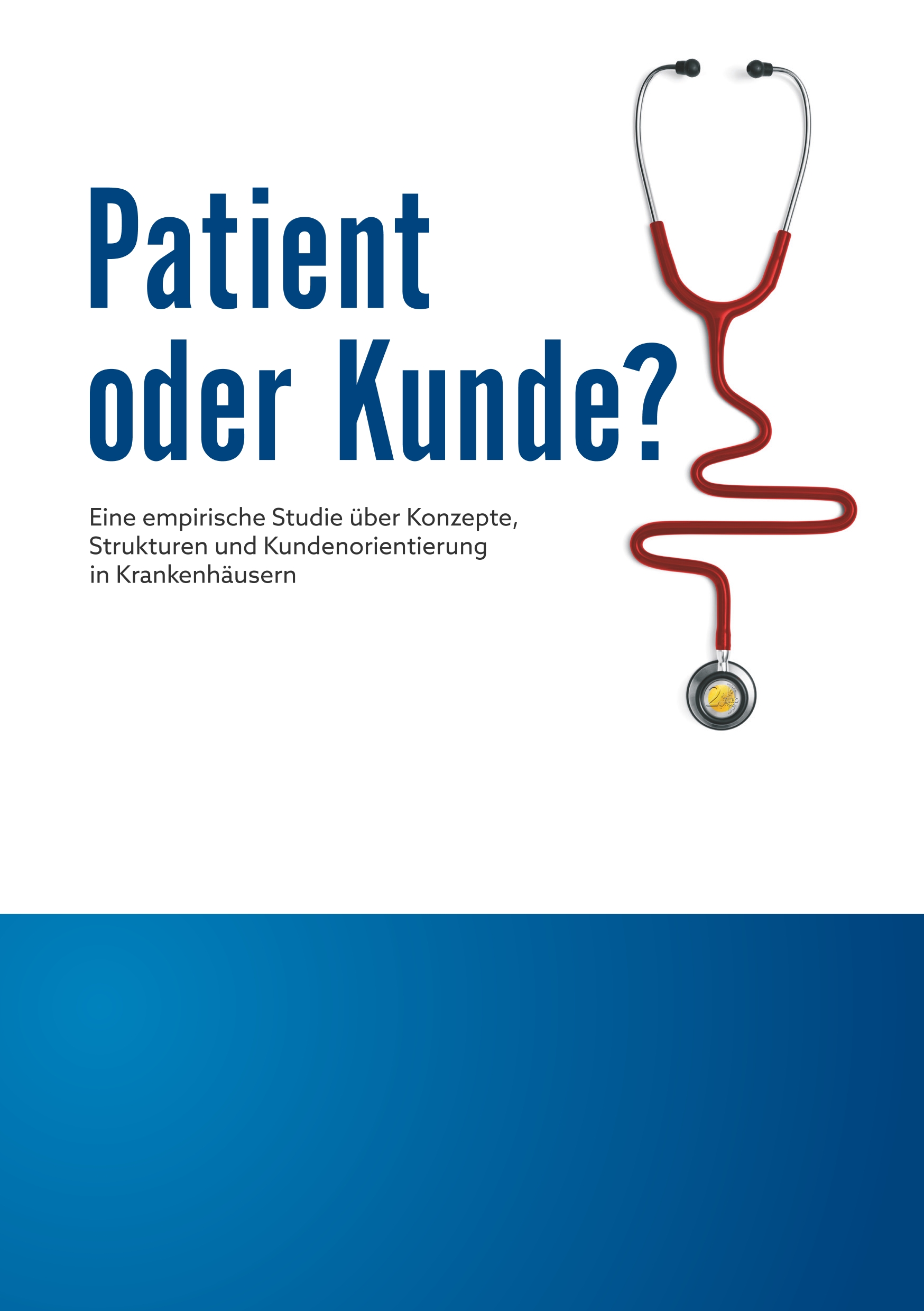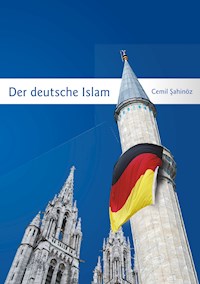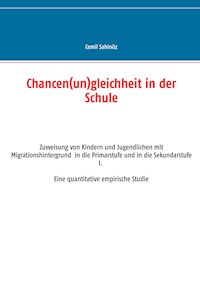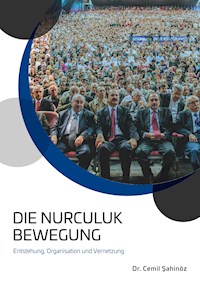
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Obwohl in den letzten Jahren viele soziologische Studien zu den verschiedenen islamischen Gruppen durchgeführt wurden, blieb eine Gruppe, die relativ unpopulistisch ist, unbemerkt. Die Rede ist von Said Nursis Nurculuk Bewegung, die mit Millionen von Anhängern die islamische Strömung in der Türkei ist, die am meisten Einfluss auf die Bevölkerung der Türkei zu haben scheint. Sie ist die erste organisierte religiöse Bewegung der heutigen Türkischen Republik. Auch in Deutschland ist die Bewegung vertreten. Jedoch wird die Strömung nicht wahrgenommen. Sie existiert und agiert völlig unbemerkt, ja quasi unsichtbar. Trotz der Tatsache, dass es über Said Nursi und die Risale-i Nur dutzende Bücher gibt, gibt es kaum empirisch, wissenschaftlich analysierende Arbeiten über die Bewegung selbst. Daher ist dieses Buch das erste in seinem Gebiet. Zum ersten Mal wird die Nurculuk Bewegung ausführlich wissenschaftlich, soziologisch und empirisch unter die Lupe genommen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
1.0 Einleitung
2.0 Forschungsstand und -fragen
3.0 Theoretischer Rahmen
3.1 Gesellschaft, Gemeinschaft, Jama´at
3.2 Sinnbildung und Charisma
3.3 Netzwerk
4.0 Methodischer Rahmen
5.0 Historische Entwicklung
5.1 Die Situation in der Türkei zu Beginn des 20. Jahrhunderts
5.2 Der Gründer Said Nursi
5.2.1 Alter Said
5.2.2 Neuer Said
5.2.3 Dritter Said
5.3 Die Entwicklung nach dem Tode des Gründers
5.4 Verschiedene Gruppierungen der Bewegung
5.4.1 Yazıcılar (Die Schreiber)
5.4.2 Yeni Asya
5.4.3 Erbakan, der politische Islam und Türkeş (MHP)
5.4.4 Die Gülen-Bewegung
5.4.5 Der Verlag Türdav mit „Zafer“ und „Sur“
5.4.6 Der Verlag Zafer
5.4.7 Med-Zehra
5.4.8 Der Militärputsch, die Gruppe um Mehmet Kırkıncı und die Meşveret Gruppe
5.4.9 Der Verlag Nesil und der Radiosender Moral FM
5.4.10 Zehra-Stiftung
5.4.11 Der Verlag Tahşiye
5.4.12 Der Verlag İhlas Nur und Dost
5.4.13 Weitere Gruppen
6.0 Die Entwicklung in Deutschland
6.1 Von der Wohnung zur Medrese
6.2 Netzwerkarbeit
6.2.1 Die Gruppen in Deutschland
6.2.2 Netzwerkarbeit
6.3 Umma Engagements
7.0 Organisationsstruktur
7.1 Sufi-Orden, Jama´at, Gemeinschaft oder Gesellschaft?
7.2 Mitglieder
7.3 Offene Struktur
7.4 Hierarchie
7.5 Zentrum
7.6 Schura (Rat, Gremium)
8.0 Sinnbildung und Merkmale der Bewegung
8.1 İhlas (Aufrichtigkeit)
8.2 Hizmet (Dienst)
8.3 Uhuvvet (Brüderlichkeit)
8.4 Müsbet Hareket (Positives Handeln)
8.5 Heiligenkult
8.6 Verschiebung des Charismas
8.7 Vergesellschaftung
8.8 Religion und Wissenschaft
8.9 Politik
8.10 Dialog
9.0 Schlussbetrachtung
10.0 Fazit
11.0 Literatur
Abkürzungsverzeichnis
Vorwort
Das vorliegende Buch erschien erstmals 2009. Seitdem hat sich viel getan. Die Nurculuk Bewegung ist in der Türkei, aber auch weltweit und in Deutschland, gewachsen. Es entstanden neue Themen. So wurde es an der Zeit, eine aktualisierte Neuauflage dieses Buches herauszubringen.
Dabei ist diese Arbeit weder eine Streitschrift noch ein Werbeblatt, von denen es sonst so viele gibt. Vielmehr ist es das Ziel der Arbeit, eine objektive, kritische, empirische und wissenschaftliche Analyse hervorzubringen.
Cemil Şahinöz, April 2019
1.0 Einleitung
In Deutschland leben ca. 5 Millionen Muslime, ein großer Teil der praktizierenden Muslime organisieren sich in Vereinen und Institutionen. Aufgrund dieser Größenordnung, sucht der deutsche Staat nach einem Gesprächspartner und die unterschiedlichen islamischen Gruppierungen streben nach Repräsentation der Muslime in Deutschland. Aber nicht nur für die Politik sind die Muslime interessant. Spätestens nach den Integrations- und Migrationsdiskussionen, richtete sich auch das Augenmerk der Soziologen verstärkt auf spezielle islamische Bewegungen. Die Integrationsfrage ist eine der wichtigsten Gründe, warum nun vermehrt islamische Gruppierungen in das Visier von Politikern und Forschern geraten. Die Muslime befinden sich im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit. Dabei sind das Verständnis des Islams und der Muslime, die sich als Teil dieser Gesellschaft fühlen, ausschlaggebende Faktoren für die Lösung der Integrationsproblematik.
Obwohl in den letzten Jahren viele soziologische Studien zu den verschiedenen islamischen Gruppen1 durchgeführt wurden, blieb eine Gemeinschaft, die relativ unpopulistisch ist, unbemerkt. Die Rede ist von Said Nursis Nurculuk Bewegung, auch Nurcu, Nur oder Risale-i Nur Bewegung genannt, die mit Millionen von Anhängern die islamische Strömung in der Türkei ist, die am meisten Einfluss auf die Bevölkerung der Türkei zu haben scheint. Sie ist die erste organisierte religiöse Bewegung der heutigen Türkischen Republik. Auch in Deutschland ist die Bewegung vertreten. Jedoch wird die Strömung nicht wahrgenommen. Sie existiert und agiert völlig unbemerkt, ja quasi unsichtbar. Unter den Anhänger dieser Bewegung, die man als Risale-i Nur Schüler, Nurcu2 oder Nur Schüler bezeichnet, ist ein großer Anteil an Akademikern, Wissenschaftlern, Studenten oder Lehrern (so auch in der Türkei) und dementsprechend gehören Intellektuelle3 zu ihrer Zielgruppe.
Wissenschaftlich ist die Bewegung jedoch kaum ausgeleuchtet. Die wenigen Arbeiten, die man über sie findet, sind sehr dürftig. Daher bietet sich hier eine ausführliche Betrachtung an. Aus zwei weiteren Gründen ist die Bewegung interessant für diese Arbeit. Zum einen, da es eine Bewegung ist, die türkisch limitiert begonnen hat und später zu einer internationalen Bewegung wurde, die den weltreligiösen Dialog anstrebt und damit global agiert. Und zum anderen, da sie eine Bewegung eigener Art ist. Weder im islamischen noch in anderen religiösen Kreisen findet sich eine ähnlich strukturierte und organisierte Bewegung.
Da es nicht möglich ist, die Bewegung in politischen oder populistischen Debatten zu finden, ist sie quasi „unsichtbar“. Auch nehmen die Anhänger der Bewegung fast nie an religiösen „Streit“-Diskussionen teil und meiden öffentliche Debatten. Vielmehr organisieren sie eigene Foren, in denen sie verschiedene muslimische und nicht-muslimische Akademiker einladen. Auf diese Weise sind sie für die breite Öffentlichkeit unsichtbar und Said Nursi relativ unbekannt.
Die Werke von Said Nursi werden als Gesamtkollektion “Risale-i Nur” (deutsch: Sendschreiben des Lichtes4; kurz als Risale) bezeichnet. Abu Rabi bezeichnet das Werk als „transnational historical and religious text“ (2000) und als „one of the most important documents in modern Muslim intellectual history, a document that had a major impact on several generations in post-Kemalistic Turkey, and that is slowly being discovered by the rest of the Muslim world“ (2003, S.77).
Doch der Gründer der Bewegung Said Nursi war nicht jemand, der sich von der Öffentlichkeit zurück hielt. Er wandte sich von den Formen der traditionellen islamischen Strömungen, wie der Sufi-Orden, ab und entwickelte seinen eigenen Weg. Er lehnte es ab, dass religiöse Institutionen für sich den Anspruch nahmen, im Besitz der einzigen Wahrheit zu sein (1995b, S.121; 2001d, S.645; 2004b, S.368; 2004e, S.17). Das Verständnis des Islams hänge von Zeit, Ort und Umständen ab und daher dürfe man abweichende Paradigmen der Interpretation nicht zum Schweigen bringen. Auch war er der Meinung, dass die Politik die freie Interpretation des Islams beeinträchtigen würde und man deshalb die Religion für politische Ziele nicht missbrauchen dürfe (Yavuz, 2004, S.126ff). Diesen neuen Weg im Islam kann man vom heutigen Standpunkt aus als einen Weg von der Tradition in die Moderne bezeichnen. Für die Probleme der muslimischen Gesellschaft zog Nursi die „modernen Wissenschaften“5 heran. Eins der Ziele Nursis war es, zu zeigen, dass die islamischen Glaubenswahrheiten nicht in Konflikt mit den modernen Wissenschaften stehen. Er war der Meinung, dass sich Religion, bzw. Theologie, und Wissenschaft (bzw. empirische Wissenschaft) nicht ausschließen, sondern sich ergänzen. So entwickelte sich im 20. Jahrhundert in der Türkei eine soziale Bewegung, die als „Nurculuk Bewegung“ bezeichnet wird.
So wie bei allen islamischen Strömungen, kamen auch Anhänger der Nurculuk Bewegung als Gastarbeiter nach Deutschland. Sie versuchten der Entfremdung zu entfliehen, in dem sie sich in Vereinen zusammenschlossen und Strukturen für die Weiterführung ihrer Bewegung bildeten. Im Vergleich zu den großen türkisch islamischen Gruppen in Deutschland, waren die Nurcus jahrzehntelang sehr zurückhaltend. Allerdings versucht sie gegenwärtig auch neben anderen islamischen Gruppen einen Platz in Deutschland zu bekommen. Sie konkurriert mit ihnen um den Platz des „richtigen Repräsentanten des Islams“ und des Ansprechpartners für den Staat (vgl. Schiffauer, 2003).
Zunächst wird im nächsten Kapitel der Forschungsstand wiedergegeben und im Hinblick auf diese Forschungsfragen bearbeitet. Im Anschluss daran folgt der theoretische Rahmen, auf dem diese Arbeit basiert. Begriffe wie Gesellschaft, Gemeinschaft, Sinnbildung, Charisma und Netzwerk spielen dabei eine entscheidende Rolle. Im vierten Kapitel geht es um den methodischen Rahmen der Arbeit. Hier werden die Erhebungs- und Auswertungsmethoden vorgestellt. Das fünfte Kapitel handelt von der historischen Entwicklung in der Türkei. Dabei geht es um die Situation der Türkei zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Kontext der Biographie des Gründers Said Nursi. Die Entwicklungen nach dem Tode des Gründers und die verschiedenen Nurcu Gruppen, die nach vielen Spaltungen entstanden, sind ebenso Bestandteil dieses Kapitels. Im sechsten Kapitel wird es eine historische Darstellung der Bewegung in Deutschland geben. Hierzu gehören die Netzwerkarbeit und das Engagement der Nurcus für die muslimische Gemeinschaft. Hierauf folgt die Darstellung der Organisationsstruktur. In diesem Zusammenhang wird der Frage nachgegangen, mit welchen organisatorischen Begriffen die Bewegung bezeichnet werden kann. Hierarchie, Mitglieder oder Zentrum sind einige der Unterkapitel, die zum besseren Verständnis durchleuchtet werden. Kapitel 8 widmet sich Begriffen und Merkmalen der Bewegung, die den Basis der Bewegung bilden und zur Sinnbildung führen. Sowohl Begriffe wie Aufrichtigkeit, Dienst, Brüderlichkeit, Positives Handeln als auch Heiligenkult, Charisma, Politik, Dialog und Wissenschaft werden hier behandelt. Im neunten Kapitel gibt es eine Schlussbetrachtung, in der versucht wird, die Fragestellungen der Arbeit anhand der Auswertungen zu beantworten. Die Arbeit endet mit einem kurzen Fazit und Ausblick auf die Zukunft. Mit Gewissheit kann gesagt werden, dass diese bescheidende Arbeit, die erste ausführliche Forschungsarbeit über die Nurcus ist. Jedoch ist sie nicht erschöpfend. Daher ist einer der Ziele dieser Arbeit ein Basismaterial für weiterführende Forschungen anzubieten.
1 Wenn ich von Gruppe schreibe, meine ich die alltagssprachliche Bedeutung und nicht einen soziologischen Begriff.
2 Das „cu“ am Ende des Wortes gibt im türkischen die Zugehörigkeit zu Etwas wieder. Wenn ich im Text die Begriffe Anhänger, Nurcu, Nur Schüler oder Risale-i Nur Schüler benutze, meine ich die Personen, die sich selbst als solche bezeichnen.
3 Als „Intellektuell“ bezeichne ich Personen, die wissenschaftlich gebildet, Akademiker oder Wissenschaftler sind.
4 Mit „Licht“ ist der Koran gemeint. Die Analogie hierzu ist, dass die Werke Nursis ihre Kraft dem Licht des Korans zu verdanken hätten.
5 Wenn ich von „modernen Wissenschaften“ spreche, meine ich Said Nursis Verständnis. Vermutlich konnotierte er Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften und nicht die Geisteswissenschaften. Wenn ich von Nursis Verständnis schreibe, wird der Begriff daher im Sinne des Said Nursi eingesetzt. Siehe hierzu seine große Begegnung in der Bibliothek in Van (siehe Kapitel 5.2.1).
2.0 Forschungsstand und -fragen
In der Literatur tauchen die Nurcus kaum auf. Gelegentlich wird von ihnen zwischen den Zeilen berichtet. Paul Geiersbach (1990, S.24) z.B. sieht sie als „die Jesuiten unter den türkischen Moslems, oft hochgebildet, elitär im Anspruch und ein feines Gespür für Macht ist ihnen eigen.“ Utermann bezeichnet die Bewegung als eine „intellektuell geprägte Bewegung“ (1995, S.18). Für Hermann ist Nursi einer „der schillerndsten Figuren der jüngeren türkischen Geschichte“ (1996, S.38; h.z.n. Agai, 2004, S.65). Metin Karabaşoğlu, ein Intellektueller aus der Nurculuk Bewegung, schreibt: „People affiliated with the Nur movement are certainly not Kemalist nor are they Islamist in the usual sense; ´religiously minded´ (religiös gesinnt; Ü.d.A.) is the most suitable way to describe them“ (2003, S.286). Yavuz (2004, S.135) beschreibt Nursi als den „Begründer des modernen religiösen Diskurses in der Türkei” und Cüneyt Ülsever, ein türkischer Journalist, ist der Meinung, dass die Türkei Said Nursi verstehen und anderen erklären muss (2004). Für Posch (2005, S.174) ist die Bewegung eine „konservative islamische Reformbewegung“ und Heimbach schreibt den Nurcus uneingeschränkte Offenheit zu (2001, S.103; h.z.n. Wunn, 2007, S.86). Der Pfarrer Herbert Weinbrenner (1997) beschreibt die Arbeit der Nurcus in Deutschland folgend: „Sie eröffnen in Deutschland Medresen. Sie machen eine recht gute Jugendarbeit, an der es im islamischen Bereich in Deutschland seit langem fehlt.“
Auch das Auswertige Amt schrieb über Said Nursi und die Nurcus: „Neben fundamentalistischen Strömungen gab und gibt es in der islamischen Welt eine Reihe von Denkern, die ein liberales Konzept vertreten und einer Versöhnung mit dem Westen das Wort reden. Werden sich ihre Ideen durchsetzen und die Grundlage für eine eventuelle Reform des Islam bilden? [...] International zunehmende Bedeutung besitzt die in der Türkei entstandene Bewegung »Nurcu Cemaati« (auch als »Nurculuk« oder » Jama´at-un Nur« bekannt). Der 1960 verstorbene geistige Führer Said Nursi lobt in seinen Schriften die wissenschaftlichen und zivilisatorischen Leistungen der Moderne. Er entwirft eine nüchterne Form der Religionsausübung, in der er Elemente aus Schriftislam und Mystik zusammenkommen. Die Entscheidung, Muslim zu sein, sei, so Nursi, ein individueller Entschluss, der auf rationaler Grundlage getroffenen werde. Politischen Aktivismus lehnt Said Nursi strikt ab. Sein umfangreiches Schrifttum entfaltet neben zahlreichen Diskussionen zum Propheten Mohammad und dem Jenseits eine ausgesprochene Arbeitsethik. Tätigkeit sei eine Tugend und gottgewollt. Was Fragen der Wirtschaft, Gesellschaft und Erziehung angeht, so vertritt er einen pluralistischen Ansatz, der den ganzheitlichen Tendenzen fundamentalistischen Bewegungen entgegensteht. Said Nursi lehnt den Fanatismus ab und mit ihm auch den Dschihad als ein Mittel der Gewalt, um die Gesellschaft zu verändern und den Unglauben zu bekämpfen“ (Szyska, 2002, S.25).
Aufgrund der Tatsache, dass zum untersuchten Forschungsgegenstand bisher keine ausführlichen Forschungsarbeiten existieren, müssen grundsätzliche Fragen, wie z.B. die Entstehung der Bewegung bearbeitet werden. Dies ist wichtig, um überhaupt ein Grundverständnis für diese Bewegung zu bekommen. Deshalb ist die historische Entwicklung in Deutschland und der Türkei ein wichtiger Bestandteil dieser Arbeit. Dadurch kann nachvollzogen werden, welche Faktoren die Entstehung der Bewegung ermöglichten. Weiterhin müssen bestimmte Merkmale und Muster, auf die sich die Anhänger im Alltag beziehen, analysiert werden, um die Interviewpartner zu verstehen.
Diese Gedanken führen zu den folgenden, relevanten Fragestellungen der vorliegenden Arbeit:
Was ist die Nurculuk Bewegung? Mit welchen Organisationsarten oder - strukturen kann man sie beschreiben? Was für eine Bewegung ist es?
Um diese Fragen zu beantworten wird mit der Netzwerktheorie gearbeitet. Hierfür werden die Struktur und Organisation der Bewegung analysiert. Weiterhin werden die Begriffe Gemeinschaft, Gesellschaft und Jama´at herangezogen, um die Bewegung beschreiben zu können (Kapitel 6.2. und 7).
Wie konnte sich die Nurculuk Bewegung trotzt Widerstände (Verbote, Verfolgungen und massiver Anti-Propaganda) verbreiten?
Hierfür werden konkrete Punkte analysiert, die maßgeblich für das Wachsen der Bewegung waren. Das Umfeld und die soziale Situation der Türkei spielten hierfür eine wichtige Rolle. Daher werden relevante historische Ereignisse wiedergegeben. Sowohl die Entstehungsgeschichte in der Türkei als auch die Ausbreitung in Deutschland liegen der Analyse der vorliegenden Arbeit zu Grunde (Kapitel 5 und 6).
Welche Merkmale zeichnet die Bewegung aus? Wie bildet sie einen Sinn für ihre Anhänger? Was sind konkrete Begriffe im Diskurs des Nurcu Netzwerkes?
Diese Fragen werden besonders durch Interviews und Quellenforschungen beantwortet. Denn besonders hier ist das Selbstverständnis der Anhänger wichtig. Daher werden gerade für diese Themen die Interviewpartner als wichtigste Quellen herangezogen (Kapitel 8).
Die Fragestellungen werden mit Blick auf die Theorien, die Interviews und die Werke Said Nursis bearbeitet. Der theoretische Rahmen wird im nächsten Kapitel vorgestellt.
3.0 Theoretischer Rahmen
Bevor wir nun zu den einzelnen Punkten übergehen, muss vorab etwas Anderes durchleuchtet werden. In dieser Arbeit wird bewusst auf eine umfassende theoretische Sicht verzichtet. Dabei geht es um das Problem, dass viele nichtmuslimische Forscher bei der Betrachtung von muslimischen Forschungsgegenständen haben. Leider werden zu oft, christliche Muster direkt auf den Islam übertragen, so dass keine authentische Betrachtung des Forschungsobjektes zu Stande kommen kann (vgl. Tezcan, 2003). Der Islam wird aus den Erfahrungen christlicher Diskurse beurteilt. Da aber islamische Phänomene kaum mit christlichen Termini hinreichend erklärt werden können, besteht die Gefahr, dass das „islamische Geschehen“ gedanklich vorbelastet wird. Die Ergebnisse derartiger Forschungsarbeiten fallen indes sehr bedürftig aus. Um diesem Problem zu entgehen, werde ich deshalb keine standardisierten Schablonen für meine Arbeit verwenden, sondern einzelne Teile von Theorien aufgreifen, die für islamische Betrachtungen in Frage kommen.
Zunächst werden die Begriffe Gesellschaft, Gemeinschaft und Jama´at analysiert. Hauptsächlich geht es hier um die Betrachtungen von Tönnies. Hierauf aufbauend geht es im Anschluss um Sinnstiftung. Sinn wird in Gemeinschaften öfters durch einen charismatischen Führer aufgebaut. Diesem Aspekt wird im selbigen Kapitel nachgegangen. Im letzten Teil des theoretischen Rahmens geht es um das Verständnis eines Netzwerkes. Das Augenmerk liegt hier besonders auf sozialen Netzwerken, da diese dem Forschungsobjekt besonders zu Grunde liegen.
3.1 Gesellschaft, Gemeinschaft, Jama´at
Schon Aristoteles beschrieb im 4. Jahrhundert vor Chr., dass der Mensch auf das Zusammenleben mit seinesgleichen angewiesen ist. Und Durkheim (1992) verwies auf die „Solidarität“, welches die Quelle der sozialen Ordnung und der Erhaltung der Gesellschaft sei. Somit entstehe eine Gesellschaft von sich aus als Bedürfnis des Menschen. In „Gemeinschaft und Gesellschaft“ (1979) analysiert Ferdinand Tönnies die Entwicklungen „von der ständisch-feudalen, agrarischen „Gesellschaft“ zur modernen Industrie-Gesellschaft mit ihren Trends der Anonymisierung und der Sonderstellung des einzelnen Individuum“ (Schäfers, 2003b, S.111). Auch Ibn Khaldun (1969) schrieb im 14. Jahrhundert über die Unterschiede zwischen dem Dorfleben und dem Leben in der Stadt. Sein Begriff Asabiyya spielt heute noch eine wichtige Bedeutung in der Beschreibung von Gruppenzugehörigkeit. Bell (1989) bezeichnet die fortgeschrittenen westlichen Industrien als postindustrielle Gesellschaften, Spinner (1998) als Informations- und Wissens-Gesellschaften, Castells (2001) als Netzwerk-Gesellschaften und Beck (1986; 1991; 2007) als Risiko-Gesellschaften (Schäfers, 2003b, S.113). Inzwischen erweiterte sich der Diskurs des Begriffes zu dem einer Theorie der Weltgesellschaft (Beck, 1998; Luhmann, 1995b). Durch die Massenmedien ist die Kommunikation nicht mehr regional begrenzt. Die kommunikative Erreichbarkeit ist nicht mehr eingeschränkt. Jeder Ort der Welt ist erreichbar. Es gibt keine ausgeschlossenen sozialen Inseln, daher Weltgesellschaft.
Der Gesellschaftsbegriff ist also in der Soziologie ein sehr komplexer Begriff. Man kann mit dem Begriff die Verbundenheit von Lebewesen (also Menschen, Tiere, Pflanzen), eine Vereinigung zur Befriedung und Sicherstellung gemeinsamer Bedürfnisse oder auch eine organisierte Zweckvereinigung meinen. Allerdings ist die Gesellschaft immer ein Konstrukt. Der Mensch lebt also nicht in „der“ Gesellschaft, sondern in ihren Gruppen, Vereinen, Organisationen und Institutionen (Schäfers, 2003b, S.109ff). Das, was die Menschen als Glieder eines Ganzen zusammenhält, ist laut Tönnies (1973, S.17) Verständnis (consensus). Verständnis sei eine besondere soziale Kraft und Sympathie, dass auf intimer Kenntnis voneinander beruhe. Hinzu kommt das Solidaritätsgefühl, welches die Menschen zu einer Einheit zusammenschließt (vgl. Durkheim, 1992; Anderson, 1991; Mettele, 2006, S.48).
Durch ein positives Verhältnis unter den Menschen entsteht laut Tönnies (1979, S.3ff) entweder Gesellschaft oder Gemeinschaft. Alle sozialen Gebilde könnten durch diese erklärt werden. Gemeinschaft und Gesellschaft stehen daher in einem dauernden Spannungsverhältnis. Kleinere, intime Zusammenkünfte, die als reales und organisches Leben begriffen werden, nennt er Gemeinschaft, während größere Gruppen von Menschen, die ideell und mechanisch miteinander verbunden sind, als Gesellschaft bezeichnet werden. Zudem ist Gemeinschaft eine althergebrachte aber dauerhafte Verbindung und die Gesellschaft ist das „neue“, welches vergänglich ist und mit Öffentlichkeit in Verbindung gebracht wird. So ist die Gemeinschaft ein „echtes“ Zusammenleben und die Gesellschaft nur ein scheinbares. Daher bezeichnet Tönnies die Gemeinschaft als lebendigen Organismus und die Gesellschaft als mechanisches Aggregat und Artefakt.
Mit Beginn der Soziabilität des Menschen (die Mutter-Kind-Beziehung als Urverhältnis) beginnt auch eine Form des gemeinschaftlichen Zusammenlebens, das nicht erst organisiert oder veranstaltet werden muss. Gemeinschaft im engeren Sinne ist die Form menschlichen Zusammenlebens, „die als besonders eng, vertraut, aber auch als ursprünglich und dem Menschen, ´wesensgemäß´ angesehen wird“ (Schäfers, 2003a, S.98). Die Gemeinschaft erleichtert das Leben und Überleben ihrer Mitglieder. Wo immer Menschen in organischer Weise und mit freiem Willen zusammenkommen, und die durch gemeinsames Tun, gemeinsame Tradition oder gemeinsamen Besitz verbunden sind, gibt es eine Gemeinschaft, deren Ursprungsformen die Verwandtschaft, Nachbarschaft oder Freundschaft (Tönnies, 1979, S.12ff) sind. Zudem stuft Tönnies die Gemeinschaft als wichtig und erstrebenswert ein. Es sei von großer Bedeutung für das Zusammenleben der Menschen und sei der Idealvorstellung nach gekennzeichnet durch Nähe, Gefühlstiefe, Solidarität, Geborgenheit, Schutz und Hilfsbereitschaft. Als Gegenleistung gibt es die moralische Verpflichtung, eine Leistung für die Gemeinschaft zu erbringen (Schäfers, 2003a, S.99ff).
Bei der Gemeinschaft ist die Verbundenheit zueinander das ausschlaggebende. Alles, was vertraut und heimlich ist, gehört zur Gemeinschaft. Man gehört ihr von Geburt an. Tönnies (1979, S.169) unterscheidet drei Arten und Zusammenhänge: Die Gemeinschaft des Blutes (Verwandtschaft), des Ortes (Nachbarschaft) und des Geistes (Freundschaft). Familienbanden oder Verwandtschaften bilden von Natur aus eine Gruppe, die nicht erst extern künstlich geschaffen werden muss. Die Familie, das Dorf oder die Kleinstadt symbolisieren nach Tönnies (1979, S.12) eine Gemeinschaft, wobei das erstere die engste Form und den Typus aller gemeinschaftlichen Verbindungen darstellt. Diese Art sozialer Beziehung beruht auf subjektiv gefühlter Zusammengehörigkeit (Weber, 1984, S.69). Die Mitglieder einer Gemeinschaft orientieren ihr Verhalten aneinander. Der Zusammenhalt wird geregelt durch den Wesenwillen (Tönnies, 1979, S.73ff), worunter Normen, Sitten, Bräuche und die Religion fallen. Der Wesenwille ist nicht künstlich erstellt, sondern besteht von Natur aus.
In der Gesellschaft aber, herrscht das Nebeneinander. Die Menschen sind nur in einer organischen Weise durch ihren Willen miteinander verbunden. Man ist in ihr wie in der Fremde. Die Individuen leben getrennt und nicht füreinander. Sie kommen zusammen, wenn sie einen persönlichen Nutzen davon haben und trennen sich wenn sich der Nutzen eingestellt hat. Die Herren und Gebieter der Gesellschaft sind Kaufleute und Kapitalisten. Die Gesellschaft ist ihr Werkzeug und existiert ihretwegen (Tönnies, 1979, S.52). Weiterhin bezeichnet Tönnies die Gesellschaft als die Menge natürlicher und künstlicher Individuen (Tönnies, 1979, S.44). Deshalb setzt Tönnies Individualismus als Voraussetzung der Gesellschaft (1979, S.139). Die Gesellschaft sei die höchste Steigerung eines sich entwickelnden gemeinschaftlichen- und völkischen Lebens, der Übergang von allgemeiner Hauswirtschaft zu allgemeiner Handelswirtschaft, von vorherrschendem Ackerbau zu vorherrschender Industrie (1979, S.46). Laut Weber (1984, S.69) beruht die Einstellung des sozialen Handelns auf rational motiviertem Interessenausgleich. Tönnies hierzu: „Gesellschaftliche Verbindungen können sich auf Zwecke aller Art beziehen, die als mögliche Erfolge gedacht werden und als erreichbar durch vereinigte Kräfte oder Mittel [sind]“ (1979, S.171). Auch die Gesellschaft teilt Tönnies (1979, S.216) in drei Formen auf: großstädtisches Leben, nationales Leben und kosmopolitisches Leben. Die Gesellschaft wird durch den Kürwillen (1979, S.91ff) zusammengehalten. Der Kürwillen findet seinen Ausdruck in den Gesetzen und den Institutionen des Staates. Im Gegensatz zum Wesenwillen, muss der Kürwille abgesprochen und beschlossen werden.
Durch die Entwicklung der Industrie, Säkularisierung und der Moderne hat sich das Zeitalter der Gemeinschaft in das Zeitalter der Gesellschaft verwandelt. Den Untergang des schaffenden und genießenden gemeinschaftlichen Haushalts sieht Tönnies in der Emanzipation der Individuen von allen Banden der Familie und des Glaubens (1979, S.182). Anstelle der teilenden, hilfsbereiten Verbindungen treten nun rationale Verbindungen. Das Rationale ist das, was früher in der Gemeinschaft Sitte, Brauch und gemeinsame Werte waren. Durch diese waren die Menschen in der Gemeinschaft trotz aller Trennungen miteinander verbunden. Doch in der Gesellschaft sind die Menschen trotz aller Verbundenheit getrennt (Tönnies, 1979, S.34).
Auch in der islamischen Welt haben „Gemeinschaften“ eine lange Tradition. Die islamischen Gruppen, die Jama´at genannt werden, waren allerdings weder Gemeinschaften des Blutes noch des Ortes. Vom arabischen Wortstamm her, bedeutet der Begriff „zusammen sammeln“ und meint einen Zustand, in dem verschiedene Personen sich zusammenfinden und Einigkeit zeigen (Akgündüz, 1995, S.157ff). Daher ist der islamische Begriff Jama´at, der für jegliche islamische Gruppen benutzt wird, nicht gleich zu setzen mit Tönnies´ Begriff von Gemeinschaft. Jama´at ist vielmehr ein zeitgenössisches, vom türkischen Standpunkt her republikanisches Phänomen.
Die Entstehung der Jama´ats ist zurückzuführen auf Reaktionen der Verstädterung und der Industrialisierung. Sie sind eine moderne Anpassung traditioneller Beziehungsformen. Daraus schlussfolgert Agai, dass die Jama´ats für die Erfüllung von sozialen und religiösen Bedürfnissen entstanden (Agai, 2004, S.51, 77). Die Jama´at verschaffe ihren Anhängern neue Möglichkeiten, den Alltag nach den Bedürfnissen entsprechend, mit einem religiösen Bezugsrahmen, zu gestalten. Die Anhänger schaffen sich im sozialen Handeln einen sozialen Raum. Dabei verfolgen sie gleiche Idela und Ziele und richten ihr Leben nach diesen. „Im netzwerktheoretischen Sinne ist die cemaat (Cemaat ist die türkische Schreibweise für Jama´at; A.d.A.) damit ein Netzwerk mit Beziehungen, die auf der Anerkennung eines Diskurses und zweckrationaler Motive beruhen“ (Agai, 2004, S.51ff).
Die Jama´at ist also keine vormoderne Erfindung. Sie ist kein Produkt von schlechten wirtschaftlichen oder politischen Krisen. Auch ist sie keine vorübergehende Reaktion auf die Moderne (vgl. Göle, 1997, S.69; Çayır, 2000, S.44). Im Gegenteil, die Jama´ats erleben ihre Blütezeit in der Moderne und werden von islamischen Autoren auch als Produkt dessen bezeichnet (Akdoğan, 2000, S.121ff; Göle, 1986, S.515; Roy, 1995 S.77). Muslimische Autoren gehen nämlich davon aus, dass sich Parallel zur Urbanisierung auch der Zweifel am Glauben entwickelte (Yavuz, 1995, S.646). Dies bot den Jama´ats einen großen Handlungsspielraum. Die „Bekämpfung der Zweifel“ führte dazu, dass die Jama´ats wuchsen. Sie wurden für die Muslime in der Moderne zum Stützpfeiler, um ihre Religion bewahren zu können. Auch Said Nursi betont den Zweifel am Glauben, der laut ihm seinen Höhepunkt in der Moderne fand: „Wo früher im gesamten Land nur ein einziger absolut Ungläubiger gefunden werden konnte, können nun dagegen hundert in einem Städtchen gefunden werden“ (1994, S.149; 2003, S.179; vgl. 1995b, S.22ff). Dieser Gedankengang führte dazu, dass sich Nursi nur in den Glaubenswahrheiten spezialisierte und nicht in Themen, wie z.B. islamisches Recht.
Erwähnenswert ist auch, dass die Führungseliten der islamischen Gruppen in der Moderne keine Mollas sind, die in Bergen leben oder sich von dieser Welt abgeschottet haben, sondern bildungsnahe Sprösslinge des Säkularismus6. So ist auch der politische Islam ein Produkt der Moderne (Akdoğan, 2000, S.314).
In der islamischen Moderne sind Jama´ats also unerlässlich. Sie bieten dem Individuum eine Möglichkeit des religiösen Zusammenlebens. Die Jama´at gilt als Ort, in der ein Individuum auf die Gesellschaft vorbereitet wird. Dies erfolgt, in dem ihm eine Identität7 und ein Sinn gegeben werden. Durch diesen Sinn findet eine Kontingenzbewältigung statt. Die islamischen Gruppen haben eine weitere Besonderheit. Sie gießen die Modernität in eine islamische Identität. Fragen wie Wirtschaft, Menschenrechte oder Demokratie werden muslimisch aufgegriffen und modern, im Sinne von Modernität, beantwortet. Demnach verbleiben die Jama´ats nicht in ihren Kulturvereinen und Moscheen, sondern treten in die Öffentlichkeit und sind aktiv in der Gesellschaft. Hierzu gehört u.a. die Gründung von Banken, die ohne Zinsen arbeiten. In nichtmuslimischen Ländern entwickeln sie Methoden wie z.B. Helal-Stiftungen8, die Gütesiegel für Produkte vergeben, die laut islamischem Recht verzerrt werden dürfen. Dadurch werden die Bewegungen verweltlicht. „In jedem Bereich gestalten die als moderne Institutionen verkleideten islamischen Gemeinschaften den öffentlichen Raum nach den ihnen eigenen Strukturprinzipien und reproduzieren ihr sozialmoralisches Milieu“ (Seufert, 1997, S.149). Immer neue Handlungsfelder werden als islamisch relevant definiert (Agai, 2004, S.185). Dazu gehören z.B. auch Gründungen von Wirtschaftsunternehmen, um die Jama´ats aufrechtzuerhalten. Im Normalfall werden die Jama´ats durch die Spenden ihrer Anhänger unterstützt. In der globalisierten Wirtschaft reichen aber Spenden alleine nicht aus, um Ideen genügend zu verbreiten. Auf diese Weise werden islamische Wirtschaftsunternehmen, die durch die Jama´ats errichtet werden, legitimiert. So lösen sich die Jama´ats von der wirtschaftlichen Abhängigkeit ihrer Anhänger. Für die Verbreitung werden zudem moderne Technologien benutzt. Das Internet ist für die Jama´ats eine wichtige Plattform, ihre Ideen zu verbreiten. Auch die Digitalisierung in Form von DVDs erlebt in der islamischen Welt ein Boom und dient der Ideenverbreitung. Während die Nurcu Bewegung noch in den 90ern die einzige Bewegung war, die diese Optionen nutzte, gibt es heutzutage kaum eine islamische Strömung, die nicht auf diese Mittel zurückgreift. Mit dieser Methode wird ein breites Publikum erreicht und die Zielgruppe erweitert.
Die großen islamischen Bewegungen, die in Deutschland aktiv sind, sind fast alle türkischsunnitischer Herkunft. Sie haben ihren Ursprung in der Türkischen Republik. Deshalb ist es an dieser Stelle nützlich, einige soziale Fakten aus der Türkei mit in die Analyse einzubeziehen. Ab Mitte des 20. Jahrhunderts kam es in der Türkei zu großen Wanderungen von Dörfern in die Städte:
Jahr
Anteil der Bevölkerung, das in der Stadt lebt.
1950
18,1%
1960
22,5%
1970
35,8%
1980
45%
1985
51%
1990
56%
1997
65%
1950 lebten nur 18,1% der türkischen Bevölkerung in der Stadt. 1960 stieg diese Zahl auf 22,5 % und 1970 auf 35,8%. Dieser rasante Anstieg erlebte in den kommenden Jahren ihren Höhepunkt. 1980 lebten 45%, 1985 51%, 1990 56% und schließlich 1997 65% der Bevölkerung in der Stadt. Laut Mardin (1997, S.371) ziehen jeden Tag 3000 Menschen nach Istanbul. Diese Verstädterung war mit sozialen Veränderungen in der türkischen Gesellschaft verbunden. In der Moderne gab es andere Bedürfnisse und Fragen, die im Dorf nicht existierten9. Für die Menschen aus dem Dorf boten die Jama´ats in der Stadt einen Stützpunkt. Die Auswanderer und Landflüchtigen konnten so der Entfremdung fliehen. Die Jama´ats füllten die Lücke der Sozialisation für viele, die in der Stadt keine Anpassungspunkte finden konnten. Für die Lösung von sozialen Problemen wurden diese Jama´ats zu Alternativen (Albayrak, 2002, S.49). Für die Jama´ats jedoch war dies mit Problemen verbunden. Der „Volksislam“ des Landes zog nun in die Städte. Primär vom „Volksislam“ bevorzugte Gruppen waren die Sufi-Orden (Tarikat), die dadurch große Veränderungen erlebten. Nach inneren Konflikten entwickelten sie neue Interpretationsmuster. Diese Orden verwandelten sich so zu Zentren, an denen sich sowohl die früheren Dorfbewohner als auch die neuen Stadtbewohner zurückziehen konnten. Es war also gleichzeitig ein Fliehen vor der Stadtgesellschaft. Die Öffnung zur und Gestaltung der Gesellschaft, die ein charakteristisches Element moderner islamischer Bewegungen sind, konnte in diesem Fall nicht genutzt werden.
Der Solidaritätsgedanke spielt in den Jama´ats eine wichtige Rolle und ist für ihr Zustandekommen maßgebend. Der Islam ist eine Religion, die auf Zusammenarbeit und Unterstützung der Muslime aufbaut10. Daher haben sich recht früh Jama´ats in der islamischen Welt herausgebildet11, die sich auf Zusammenarbeit und Unterstützung gründeten. Hilfswerke und Stiftungen sind oft Einrichtungen, die von solchen Gruppen errichtet werden. Die vielen Stiftungen, die diese Jama´ats gründen, sind ein Hinweis auf die Unterstützungs- und Motivationskraft, die aus dem Islam für die Muslime hervorgehen.
Allgemein, ob es sich um einen Hoch- oder Volksislam handelt, haben die Jama´ats, wie schon oben beschrieben, eine sinnstiftende Funktion für ihre Mitglieder. Sie geben ihnen einen kontingenzbewältigenden Code, um die Welt zu verstehen. Darum geht es im nächsten Kapitel.
6 Hier einige Beispiele (Akdoğan, 2000, S.313ff): Prof. Dr. Necmettin Erbakan (Milli Görüş), Gulbettin Hikmetyar (Hizb-i İslami), der Soziologe Prof. Seyyid Kutub (İhvan-i Müslimin), der Psychologe Muhammed Kutup, Burhaneddin Rabbani (Cemiyet-i İslami), Raşid el-Gannuşi (Tunesische Islamische Bewegung), Abbas Medeni (Algerische Bewegung), Malik Binnebi (Algerische Bewegung), Abdulkadir Udeh (İhvan), Mustafa Sıbai (Syrischer İhvan).
7 Zur Rolle der Identität in der Moderne: „Identität herzustellen wird als eine lebensnotwendige Aufgabe der Individuen in modernen Gesellschaften, in denen sie mit unterschiedlichen Rollenerwartungen konfrontiert sind und Rollendistanz entwickeln müssen, betrachtet“ (Mıhçıyazgan, 1994, S.33).
8Helal bedeutet „erlaubt“ oder „rein“ und meint alles, was laut islamischem Recht erlaubt ist; Stiftungen sind Teil des islamischen Rechts.
9 Diese Verstädterung wurde im Wesentlichen vorangetrieben durch die Einwanderung der dörflichen Modernisierungsverlierer: Die Viehwirtschaft verlor an Bedeutung. Die landwirtschaftliche Produktion vermochte die Produzenten nicht mehr zu ernähren. Handwerker gerieten unter den Druck industrieller Produktion.
10 Man schaue auf die Bruderschaft der Muslime im ersten Jahr der Hidschra, wo eine einheitliche Gruppe entstand.
3.2 Sinnbildung und Charisma
Für Peter L. Berger ist die Gesellschaft ein dialektisches Phänomen (1973, S.3). Es ist ein Produkt des Menschen, aber gleichzeitig ist auch der Mensch ein Produkt dessen. So geht er davon aus, dass sich jede menschliche Gesellschaft eine Welt baut. Die Menschen bringen also eine Gesellschaft hervor. Und in dieser selbigen Gesellschaft erst, wird der Mensch zur Person. Hier erhält er seine Identität. Berger beschreibt drei Schritte dieses dialektischen Prozesses: Externalisierung, Objektivierung und Internalisierung12 (1973, S.4).
Externalisierung: Mit Externalisierung ist das ständige Strömen menschlichen Wesens in die Welt gemeint. Der Mensch externalisiert also einen Sinn.
Objektivierung: Objektivierung meint den Prozess, in der eine Wirklichkeit gewonnen wird.
Internalisierung: Der letzte Schritt ist die Wiederaneignung dieser Wirklichkeit.
Durch die Externalisierung wird die Gesellschaft erzeugt. Sie ist also ein Produkt des Menschen. Durch die Objektivierung wird sie zur Realität. Internalisierung lässt den Menschen wiederum zum Produkt der Gesellschaft werden. Das Individuum selbst ist also Koproduzent der sozialen Welt und damit auch seiner selbst (Berger, 1973, S.19). Die soziale Welt wiederum verleiht den Beziehungen zwischen den Menschen eine bestimmte Struktur und Ordnung. Sie, die Gesellschaft, „strukturiert, distribuiert und koordiniert das welterrichtende Handeln des Menschen“ (Berger, 1973, S.8) und das individuelle Bewusstsein. Die Gesellschaft gibt dem Menschen also einen Sinn. Der Mensch strebt nach diesem Sinn und sucht eine Sinnhaftigkeit.
Da aber der Mensch im Gegensatz zu den Tieren unfertig ist, muss er seine Welt selber errichten. Die Strukturen, die der Mensch produziert, sind aber nicht so stabil wie die Welt der Tiere (Berger, 1973, S.7). Die Ordnung, die der Mensch errichten muss, bezeichnet Berger als Nomos13 (1973, S.20ff). „Gesellschaftlich gesehen, ist Nomos ein den ungeheuren Weiten der Sinnlosigkeit abgerungener Bezirk der Sinnhaftigkeit, die kleine Lichtung im finsteren, unheilschwangeren Dschungel“ (1973, S.24). Die gesellschaftliche Welt konstituiert demnach sowohl subjektiv als auch objektiv einen Nomos. Der objektive Nomos wird im Verlauf der Sozialisation internalisiert. Durch die Erfahrungen der Gesellschaft gewinnt diese Ordnung an Stabilität. Neue Erfahrungen werden integriert, so dass die Ordnung gelegentlich kleine Modifikationen erfährt. Dieser Nomos bietet die Möglichkeit geordnet und sinnvoll zu leben. Die Gesellschaft hütet sozusagen Ordnung und Sinn. Eine radikale Absonderung von der sozialen Welt wäre für das Individuum gefährlich. Sie würde zu Orientierungs-, Sinn- und Identitätsverlust führen. So bietet der Nomos durch einen verbindlichen Sinn Schutz vor Unsicherheit. Dieser Schutz steht im Sinne des Menschen, der nach Sinnhaftigkeit verlangt. Somit sei, laut Berger, die wichtigste Funktion der Gesellschaft die Nomisierung, „das Setzen verbindlichen Sinns“ (1973, S.22).
Um eben diesen Sinn geht es bei Luhmann. „Wenn man von der Unterscheidung sinnvoll/sinnlos ausgeht, braucht man ein Kriterium, das festlegt, was sinnvoll ist und was nicht“ (1995, S.11). Für subjektive Lebensfragen ist dies noch recht einfach. Schwierig wird es in Entscheidungen, die die gesamte Gesellschaft betreffen. Hier kommt der Religion eine wichtige Rolle zu. „Die Funktion der Religion scheint dann darin zu bestehen, [...] Irritation durch Unbestimmbarkeit in bestimmte oder doch bestimmbare Information zu verwandeln“ (Luhmann, 1995b, S.12). Religion soll also das Unübersichtliche (unbestimmbare) in eine Übersichtlichkeit (bestimmbares) umwandeln und somit die Komplexität der Welt reduzieren. Um bei Berger zu bleiben, die Funktion der Religion ist die der Welterrichtung (1973, S.28). Es soll einen Nomos, also eine Ordnung bilden, das dem Individuum einen Sinn verleiht. Demnach sei die Religion ein Sinnsystem mit psychischen und sozialen Funktionen und hat eine herausragende Bedeutung bei der Konstruktion und Legitimation der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Es bindet das Individuum in eine ganzheitliche und objektive Wirklichkeit und verleiht ihm einen Sinn (vgl. Berger 1965; Berger, Luckmann, 1970). Das Medium Sinn wird dabei erzeugt durch die Kommunikation (Luhmann, 1998, S.138) und wird gerade in Gemeinschaften und Gesellschaften durch einen charismatischen Führer vermittelt.
Laut Max Weber (1995, S.271ff; 1980, S.245ff) sagt Charisma etwas über die Qualität eines Menschen aus. Individuen, die „übernatürlich“, „übermenschlich“ (im Sinne von: nicht jedermann zugänglich), also „außeralltäglich“ erscheinen und von Anhängern als „gottgesandt oder als vorbildlich und deshalb als ´Führer´ gewertet werden“ sind charismatisch. Solche charismatischen Führer können in allen möglichen sozialen Lebensfeldern vorkommen. Charakteristisch für sie ist, dass sie nicht nur zentrale soziale Wertbezüge auf sich ziehen, sondern auch Werte darstellen und diese auf die Gesellschaft zurückwirken. Sie schaffen es einen „Sinn“ für ihre Anhänger zu geben. Der charismatische Führer einer Gemeinschaft schafft es, Umdenken in bestehende soziokulturelle Maßstäbe zu bringen. Er ist die „revolutionäre Macht in der Geschichte“. Revolutionen, soziale Umbrüche und Wandel bedingen einen charismatischen Führer, der außeralltäglich erscheint und als „Held“ dargestellt wird (Lipp, 2003, S.45ff). Dieser Held versucht eine neue soziale Identität der Masse aufzubauen (Lipp, 1985 und 1994) und durch die kollektive Zustimmung erhält er den nötigen Charisma. Der zeitgebundene Charakter von charismatischen Gemeinden ist jedoch zur Veralltäglichung verdammt (Weber, 1995, S.271ff). Der Begriff des Charismas und wie Nursi das Veralltäglichungsproblem löst, werden in der Arbeit noch eine wichtige Rolle spielen.
11 Aber nicht nur in der islamischen Welt. Man denke an die Gastarbeiter der 60er in Deutschland, die mit allen Mitteln sich drum bemühten, Gebetsstätten und schließlich Kulturvereine zu eröffnen. Die Motivation hierfür entnahmen sie gewiss ihrer Religion.
12 Für die theoretische Fundierung des Begriffes „Internalisierung“ bedient sich Berger bei Mead (1968) und Strauss (1956).
13 Berger leitet den Begriff des „Nomos“ von Durkheims „Anomie“ (1973) ab.
3.3 Netzwerk
Schon Anfang des 20. Jahrhunderts schrieb Simmel (1908) über die Formen der Vergesellschaftung. Diese Untersuchungen kann man als die ersten Ansätze für die heutige Netzwerkanalyse betrachten. Auch die Sozialanthropologie, besonders die britische, leistete Mitte des 20. Jahrhunderts einen wichtigen Beitrag für die Netzwerkanalyse (z.B. Fortes, 1949). So geht z.B. der Begriff „network“ auf den britischen Sozialanthropologen Alfred R. Radcliffe-Brown zurück. Eine vollständig ausgearbeitete Netzwerktheorie gibt es aber bis dato noch nicht. Instrumentalismus (Braun, 2004; Gould, 1993), Determinismus (Watts, 2004; Urry, 2004), relationaler Konstruktivismus (White, 1992 und 1993) und die Systemtheorie (Tacke, 2000; Teubner, 1993; Fuchs, 2001) haben versucht, die Theorielücke zu schließen (Holzer, 2006, S.73ff).
Ohne nun darauf einzugehen, dass der Netzwerkbegriff vielfältige Interpretationsmöglichkeiten bietet (vgl. Dehnbostel, 2001), kann man allgemein betrachtet sagen, dass Netzwerke aus Akteuren bestehen, die miteinander verbunden sind und ein bestimmtes Ziel verfolgen. Sie sind das Ergebnis von arbeitsteiliger Vergabe ökonomischer Aktivitäten innerhalb eines Systemverbundes (Staber, 1999, S.58; vgl. Johanson, Mattson, 1987). Der Begriff „Netzwerk“ bezeichnet auch Verbände, „die nicht auf formalisierter, verwalteter Mitgliedschaft beruhen, sondern auf persönlicher Bekanntschaft und bestimmten partiellen Gemeinsamkeiten, etwa geteilter Migrationserfahrung“ (Becker, 2004, S.316). Als Basis dienen Faktoren, wie z.B. Kooperation, interdependente Beziehungen, Vertrauen und gemeinsame Werte, Ziele und Interessen (Jütte, 2002, S.23). Der Netzwerkbegriff kann also „zur Erklärung sozialer Differenzierung von zwischenmenschlichen Beziehungen in einem System“ (Hartfiel, Hillmann, 1982, S.537) verwendet werden. Die Beziehungen können laut Granovetter (1973) unterschieden werden in weak ties und strong ties, dazu aber unten mehr.
Die moderne Welt ist charakterisiert durch Komplexität und Multiperspektivität. Umwelt und System sind nicht vollständig beobachtbar und Ereignisverläufe sowie Aktivitäten nicht vollständig plan- und gestaltbar (Sydow, Windeler, 1999, S.1). Akteure der modernen Welt versuchen deshalb durch verschiedene Methoden die Komplexität, Unsicherheit und Kontingenz der sozialen Umwelt zu reduzieren. So ist die soziale Welt „unordentlich“: „In einem Moment scheint (fast) alles determiniert und erwartbar zu sein, im nächsten aber höchst kontingent und unübersichtlich“ (Holzer, 2006, S.81; vgl. White, 1992). In diesem Sinne müssen Erwartungen kontrolliert werden können, um „sicher“ zu sein. Luhmann führt in Bezug auf Erwartungen den Begriff der doppelten Kontingenz ein: „Jeder kann so handeln, wie es der andere erwartet – oder auch anders; und beide unterstellen, dass der andere dies weiß – und seinerseits erwartet“ (Luhmann, 1984, S.148ff). Es geht also darum, Erwartungen kontrollieren zu können und gleichzeitig unerwartete Handlungen auszuschließen. Hier ist die Rolle der Netzwerke wichtig.
Castells (2001) bezeichnet die Gegenwartsgesellschaft als „Network Society“. Er geht davon aus, dass Netzwerke die Funktion und Ergebnisse von Prozessen verändern und sich mühelos in verschiedene gesellschaftliche Diskurse einbinden (2001, S.527ff). Vor allem durch die globale Vernetzung durch das Internet findet man überall sowohl lokale als auch transnationale Netzwerke. Holzer (2006, S.5) schreibt, dass die Entstehung von Netzwerken keinesfalls Zufall ist; sondern sie sind beabsichtigt und in den meisten Fällen notwendig. Individuen und Organisationen suchen und pflegen bewusst Netzwerke.
Soziale Beziehungen sind ausschlaggebend für Netzwerke. Dabei können Anlass und Dauer von sozialen Beziehungen höchst unterschiedlich sein. Trotz aller Unterschiede gehören sie zum Begriff der „sozialen Beziehung“, der von Weber folgendermaßen definiert wird: „Aufeinander gegenseitig eingestelltes und dadurch orientiertes Sichtverhalten mehrerer“ (Weber, 1980, S.13; h.z.n. Holzer, 2006, S.9). Das Handeln der Akteure wird also mit in die soziale Beziehung eingebunden (Granovetter, 1992). Wenn soziale Beziehungen ein stabiles und erwartbares Beziehungsmuster annehmen, wird es relevant für die Netzwerkanalyse (Holzer, 2006, S.9).
Reziprozität spielt in sozialen Beziehungen eine entscheidende Rolle. Sie führt dazu, dass Beziehungen aufrecht erhalten und weitergeführt werden. Denn Reziprozität bedeutet für die Teilnehmer, dass eine wechselseitige Verpflichtung eingegangen wird. Man kann auf die Vorleistung eine Gegenleistung erwarten. Doch diese Erwartung bedingt eine andere Variable: Vertrauen.
Max Weber bezeichnete die moderne Gesellschaft als eine notwendige Vertrauensgemeinschaft (1988, S.470ff). Je komplexer und turbulenter die Lebenswelt ist, desto wichtiger sind verlässliche Vertrauensbeziehungen (Grunwald, 1995, S.73). Laut Simmel (1992, S.393) ist Vertrauen „ein mittlerer Zustand zwischen Wissen und Nichtwissen. Der völlig Wissende braucht nicht zu vertrauen, der völlig Nichtwissende kann vernünftigerweise nicht einmal vertrauen“. Vertrauen ist der Schlüssel für eine reibungslose Funktion einer sozialen Beziehung. Es ist „ein Mechanismus zur Reduktion von Komplexität“ (Luhmann, 1973, S.1) und reduziert komplexe Realitäten sehr viel schneller und ökonomischer14 als Voraussage, Autorität oder Verhandlung (Powell, 1996, S.226). Denn es ist ein vereinfachter Code zur schnellen und sicheren Kommunikation zwischen sozialen Akteuren (Bachmann, 2000, S.110). Natürlich vermindert Vertrauen nicht das Risiko komplett, aber es macht soziale Interaktion erst möglich. In einer unendlich komplexen Welt dient Vertrauen bei spezifischen Risikoproblemen als Lösung, da es Ungewissheit effizient reduziert. Die Zukunft bietet mehr Möglichkeiten, als man in der Gegenwart erwartet. Man entscheidet also unter Unsicherheiten. Durch Vertrauen wird die Zukunft erwartbar, da es Annahmen möglich macht. Ziel dabei ist es, unerwartetes Handeln zu minimalisieren. Es ist also stets in die Zukunft gerichtet. Die Informationen für Vertrauen stammen aus der Vergangenheit, deshalb setzt Vertrauen ein Mindestmaß an Vertrautheit voraus. Vertrautheit muss jedoch durch wiederholte Kontakte und Interaktionen aufgebaut werden (Ripperger, 1999, S.267ff). Ein Mangel an Vertrauen wiederum verringert aktives Handeln (Luhmann, 2001, S.158). Je homogener (ethnisch, geographisch, ideologisch, professionell) eine Gruppe ist, desto größer ist das Vertrauen und leichter die Kooperation. Oft ist es auch so, dass gegenseitiger Informationsaustausch zur Entstehung gemeinsamer Werte führt und somit Vertrauen aufgebaut wird (Powell, 1996, S.254-256; Buckley, Casson, 1988). Nach Coleman (1990; vgl. Preisendörfer, 1995, S.270) ist Vertrauen eine Kreditvorgabe. Es ist das Resultat einer Entscheidung und die Entscheidung ist das Resultat einer rationalen Kalkulation. Die Entscheidung wiederum wird beeinflusst durch drei Größen: Gewinnchance, möglicher Gewinn und möglicher Verlust15 (Coleman, 1991, S.127). So ist Vertrauen an eine Vorleistung geknüpft und erzeugt Erwartungen und Hoffnungen. Man kann es auch als Wette über das künftige Handeln anderer bezeichnen, womit es eine Annahme zur Bewältigung der Zukunft ist (Sztompka, 1995, S.255ff). Da eine Annahme niemals Gewiss ist und Missbrauch nicht verhindert werden kann, bezeichnet Luhmann Vertrauen als „risky investment“ (1979, S.24).
Vertrauen kann aber nicht jedem Interaktionspartner gewährt werden. Trotzdessen muss Misstrauen verhindert werden. Deshalb kommt ein anderer Faktor in die Analyse: Selektion. „Die Kapazitäten, persönliches Vertrauen zu entwickeln, sind ebenso begrenzt wie die Notwendigkeit, dies zu tun. Persönliche Netzwerke sind dann die Form, in der sich die Selektivität der Kontakte ausdrückt, also ein Mechanismus, soziale Komplexität zu reduzieren und als Relevant und Zugänglichkeit spezifischer Personen verfügbar zu halten“ (Holzer, 2006, S. →