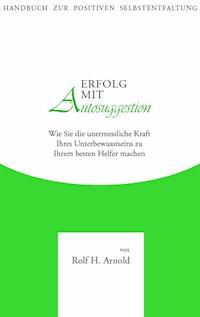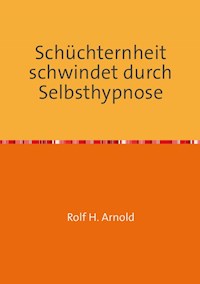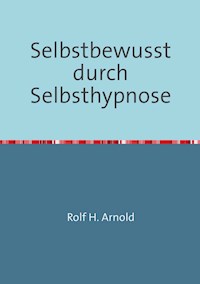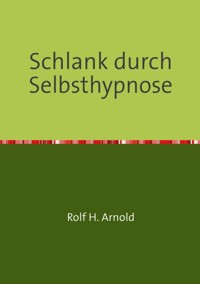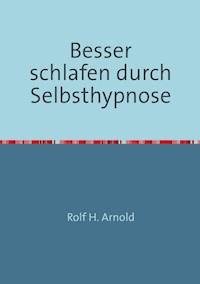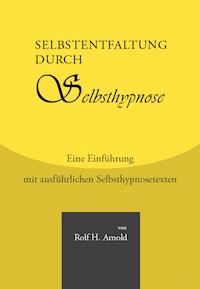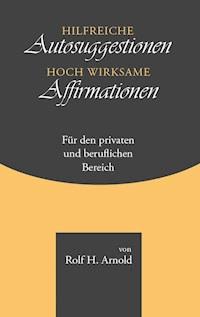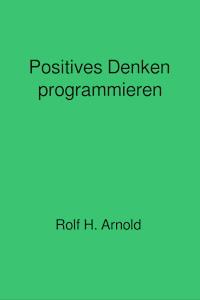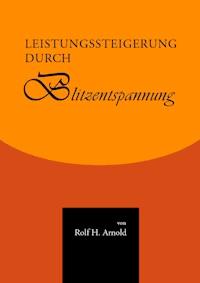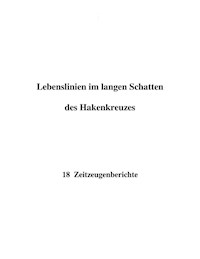
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
18 Zeitzeugenberichte aus dem 2. Weltkrieg und der unmittelbaren Nachkriegszeit Internierung, das Schicksal der Auslandsdeutschen, ein guter Chef wurde verhaftet - nur weil er Jude war, als Schüler fern der Eltern im Lager der Kinderlandverschickung, beim Vater im besetzten Warschau, mit viel Glück die tagelangen, schweren Luftangriffe auf Hamburg überlebt, einen Orden für ausgestandene Ängste beim Luftangriff, ausgebombt bei Luftangriffen: vor den Trümmern der Existenz, ohne Hab und Gut, ohne Wohnung, Flucht vor den Russen aus Ostpreußen, Flucht aus der Festung Berlin, Chaos im Zusammenbruch des Großdeutschen Reiches in Magdeburg, Vergewaltigungen durch russische Soldaten, Tieffliegerangriffe überlebt, nach Einmarsch der Engländer verhaftet, vom Nachbarn denunziert, als jüdischer "Mischling" I. Grades in Deutschland überlebt, aus der Heimat Oberschlesien von Polen vertrieben, aus der Heimat Hinterpommern von Polen vertrieben, das Schicksal des Kindes einer Norwegerin mit einem deutschen Soldaten, Entnazifizierung mit Berufsverbot und Verlust der Pension, die große Hungersnot in den drei ersten Nachkriegsjahren – Hamstern, die extrem kalten Winter 1946 und 1947 – Kohlenklau.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Arnold, Rolf H., Herausgeber
Lebenslinien im langen Schatten des Hakenkreuzes
18 Zeitzeugenberichte
Copyright © Rolf H. Arnold, Hamburg 2011
Published by epubli GmbH, Berlin
www.epubli.de
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-7375-5608-8
Widmung
Dieses Buch widme ich meiner Enkelin Emily
in der Hoffnung, dass ihre Generation
und die ihrer Kinder sicher stellen werden,
dass eine solch barbarische Entwicklung
Inhalt
Seite
Einführung 9
Internierung – das Schicksal der Auslandsdeutschen 11
Selma Kühn
In der Kinderlandverschickung 39
Klaus Hückel
Mein Mann bekam als „unbelehrbarer Nazi“ Berufsverbot 68
Wally Kühn
Vom Reichsarbeitsdienst zum Barras 83
Rudi Radow
Der Wasserwagen 104
Drei Kreuze 106
Christa Reimann
Meine Flucht aus der Festung Berlin 110
Bittere Not nach dem Kriege 117
Lucie Wichman
Im Zusammenbruch des Großdeutschen Reiches 120
Gisela Siewers-Dörner
Bund Deutscher Mädel (BDM) 130
Beim großen Bombenangriff auf Hamburg alles verloren 130
Einen Orden für ausgestandene Ängste 133
Mein Heimatdorf Finkenthal in Mecklenburg 134
Unvorstellbare Wohnungsnot 135
Kein Brennmaterial in den sehr kalten Wintern 1946, 1947 135
Die große Hungersnot in den ersten Nachkriegsjahren 136
Mein Schwager Willy vor größeren Aufgaben in Russland 136
Eine unüberwindliche innerdeutsche Grenze 137
Aus dem 1. Weltkrieg nichts gelernt 138
Ilse Templin
Mit sehr viel Glück die Luftangriffe auf Hamburg überlebt 140
Verhaftung meines Vaters durch die Engländer 150
Rolf Arnold
Das 1.000-jährige Reich überlebt 152
Fronteinsatz nach Ablehnung der NSDAP-Mitgliedschaft 153
Wegen der Luftangriffe Evakuierung mit den Kindern 154
Flucht vor den Russen 155
Eine Gartenlaube als Wohnung zugewiesen 156
Gustel als Blockwart von den Russen verhaftet 159
und durch 2 Jahre Haft zu Tode gebracht
Extrem schlechte Versorgung der Bevölkerung in der DDR 160
Charlotte Walter
Ständige Luftangriffe in Leipzig 161
Auch minderjährige Hitlerjungen im Kampf um Berlin 165
Einsatz als Sanitäter an der Ostfront 165
Vom meiner Abitur-Klasse 1939 166
überlebten von 24 Schülern nur 8 den Krieg
Die drei Hungerjahre nach dem Kriege 171
Der Schwarze Markt mit der Zigarette als Ersatzwährung 174
Sehr kalte Winter und kein Heizmaterial 177
Extreme Wohnungsnot 178
Das Elend der Flüchtlinge und Vertriebenen 180
Abenteuerlicher Zugverkehr 181
Entnazifizierung 184
Prof. Dr. med. K.-H. Schulz
Unsere Flucht vor den Russen aus Ostpreußen 187
Christiane Walter
Als „Mischling“ I. Grades in Deutschland überlebt 209
Flucht aus der sowjetisch besetzten Zone (SBZ) 219
Größte Wohnungsnot in Hamburg 220
Das Schicksal unserer jüdischen Verwandten und Freunde 221
Gerd Wundermacher
Aus der Heimat Oberschlesien vertrieben 223
Wahnsinnige Ideologie der Nationalsozialisten 225
führt zu unvorstellbaren Verbrechen
Als 14Jähriger zwei Tage im Kriegseinsatz 227
und zwei Tage in Gefangenschaft
Kampf ums Überleben mit Betteln, Stehlen, „Organisieren“ 227
Deutsche vom Schulbesuch ausgeschlossen 232
Vertreibung aus der Heimat im Juni 1946 232
Zuweisung einer neuen Heimat 233
mit deprimierenden Wohnverhältnissen
Rückkehr des Vaters aus der Gefangenschaft in die Familie, 234
die gelernt hatte, ohne ihn zu leben
Friedrich Rischer
Bleibende Erlebnisse aus der frühen NS-Zeit 239
Meine Zeit beim Jungvolk 241
Der Beginn des Luftkrieges 246
Kinderlandverschickung (KLV) 249
Durch ein geheimnisvolles Telegramm 253
vor dem sicheren Tode bewahrt
Ein Bewohner der Quickbornstraße berichtet 254
Mit der Familie bei Vater im besetzten Warschau 256
Heim ins Reich 260
Der Absturz eines „Terrorbombers“ 261
Unsere Zeit bei Vater im besetzten Lemberg 262
Die Vereidigung des Volkssturms 270
Die Fluchtbewegung 275
Ein Tieffliegerangriff 280
Die letzten Kriegstage 281
Einleitung
Das unendliche Elend, das Hitlers Angriffskrieg mit mehr als 50 Millionen Toten und mehr als 6 Millionen ermordeter Juden über die Welt gebracht hat, sollte nicht verdunkeln, dass auch in Deutschland fast jeder in irgendeiner Form vom Leid und Elend des von Deutschland entfesselten Krieges betroffen war.
In meiner Verwandtschaft und Bekanntschaft habe ich immer wieder Geschichten erfahren, die mir zeigten, dass auch auf sie, von denen ich es gar nicht vermutet hätte, der lange Schatten des Hakenkreuzes gefallen war.
Damit diese leidvollen Erfahrungen nicht der Vergessenheit anheim fallen, sondern als stete Mahnung dienen können, habe ich begonnen, diese Zeitzeugenberichte unter www.zeitzeugen.info ins Internet zu stellen und nun auch als Buch zu dokumentieren.
Insbesondere die Personen, die unmittelbar mit brutalen Kriegshand-lungen konfrontiert waren, wie Männer, die an der Ostfront kämpften oder als Kriegsgefangene russische Arbeitslager in Sibirien überlebt hatten und Frauen, die beim Einmarsch russischer Soldaten vergewaltigt worden waren, konnten oder wollten jahrzehntelang nicht darüber sprechen. Sie waren „zu“, pflegten wir zu sagen. Oft können sie sich erst jetzt, wo sich ihr Leben dem Ende zuneigt, öffnen und über ihre Erlebnisse berichten.
Auch wir Kinder des Krieges und des Luftkrieges hätten eigentlich alle eine Therapie gebraucht, selbst wenn wir nicht direkt durch Kriegshand-lungen betroffen waren. Indirekt waren wir alle irgendwie betroffen. Voller Angst, durch das, was wir von unseren Eltern oder anderen gehört, gelesen oder erlebt hatten. So habe ich, der ich keinerlei Erfahrungen mit russischen Soldaten hatte, noch mehr als zehn Jahre lang nach dem Krieg immer wieder einmal den gleichen Albtraum, wie ich vor angreifenden russischen Soldaten in einer Knicklandschaft voller Angst immer wieder Deckung suchend flüchten musste.
Ich habe nie verstanden, dass eine Generation, die noch in den „Abnutzungsschlachten“ des 1. Weltkrieges das entsetzliche Grauen des brutalsten Abschlachtens von 15 Millionen Soldaten erlebt hatte, sich 20 Jahre später wieder in einen brutalen Krieg mit dann 50 Millionen Toten treiben ließ.
Die bittere Erkenntnis drängt sich auf, dass die Menschen wohl nichts aus der Geschichte lernen. Man muss den Vätern der Europäischen Union daher dankbar sein, dass sie uns die Hoffnung gaben, dass zumindest in den Grenzen der EU Kriege kaum mehr möglich werden.
Bei den Zeitzeugenberichten, die in diesem Buch aufgeführt sind, handelt es sich um deutsche Schicksale, denn nur solche sind mir aus meinem unmittelbaren Umfeld bekannt geworden. Deren Leid ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass es Deutsche waren, die mit einem verbrecherischen Angriffskrieg unsägliches Elend über die Welt brachten, das am Ende auf sie selber zurückschlug.
Es sind dies Schicksale von ganz normalen Menschen, Normalverbrau-chern, wie man zu sagen pflegt, die das Leid und das Elend des Krieges deutlich machen. Selbst diese Menschen, die für die Masse des Volkes stehen und dem „Tätervolk“ zugerechnet werden, haben die Auswirkun-gen des Krieges nachhaltig negativ zu spüren bekommen.
Der Herausgeber im Juni 2011
Selma Kühn
Jugend und Ausbildung
Meine erste Kindheit erlebte ich in meinem Elternhaus, einem landwirtschaftlichen Besitz. Leider hatte ich keine Geschwister, auch keine weiteren Verwandten. So wuchs ich zwischen Feldern, Wiesen, Wäldern und Tieren auf. Ich konnte die Toleranz meiner Eltern restlos genießen. Als ich mein sechstes Lebensjahr beendete, starben meine lieben Eltern kurz hintereinander.
Für mich begann ein anderer Lebensabschnitt. Der landwirt-schaftliche Besitz wurde verpachtet. Ich kam in das Pastorenhaus einer Freundin meiner Mutter in Pflege. Dort fand ich eine kleine Freundin. Zusammen gingen wir in die Volksschule in Hermannsruhe, Kreis Thorn, Westpreußen. Mit dem elften Lebensjahr kamen wir beide nach Posen und besuchten dort die Töchterschule bis zur Abschlussreife.
Da mein Vater in seinem Testament den Wunsch hatte, dass ich eine gründliche Ausbildung in allen Fächern der Landwirtschaft bekommen sollte, kam ich zur weiteren Ausbildung in die Reifensteiner Maiden Kolonial Schule. In der Schule lehrte man sämtliche Fächer für das In- und Ausland. Krankenpflege, Kinderpflege, Sozialpflege, Küche, Garten, Landwirtschaft, Löten, Schustern, Reiten. Damals wusste mein Vater nicht, dass ich durch den polnischen Korridor in Westpreußen den Besitz verlieren würde und einmal im Ausland die Ausbildung sehr gebrauchen würde.
Zur praktischen Ausbildung kamen wir auf Güter, Gärtnereien, Krankenhäuser usw. In Posen war ich auf einem Gut, das der Familie Eschenbach gehörte. Dort fand ich eine neue Heimat. Ich war sehr gerne dort.
Nach dem Versailler Vertrag von Polen enteignet
Inzwischen war der erste Weltkrieg mit allen traurigen Erlebnissen beendet. Nach der Abstimmung laut Friedens-vertrag ging auch meine Heimat, ein Teil Westpreußens, zum polnischen Korridor über. Von den polnischen Behörden bekam ich Bescheid, mich auf dem „Starostamt“ in Thorn zu melden, da ich inzwischen 21 Jahre geworden war. In polnischer Sprache, die ich nicht beherrschte, wurde mir erklärt, mein Besitz sei enteignet. Ich bekam 2 Koffer voll polnischer Zloty als Entschädigung. Das Geld hatte bei dem Grenzübertritt fast keinen Wert.
Mein Vormund war vorher von den Polen erschossen worden, so hatte ich niemand, der meine Rechte vertrat. Einen Dolmetscher bekam ich nicht. Nach der Unterschrift erklärte man mir, ich sei nun polnische Staatsangehörige. Aber als solche hatte ich doch kein Recht. So musste ich für Deutschland optieren. Das war mit viel Geld verbunden. Mein Lehrherr Oekonomierat Eschenbach half mir dabei. Aber auch er wurde in Posen enteignet und musste den sehr gut geführten Besitz verlassen.
Bei Freunden fanden wir auf dem Gut „Bischdorf“ bei Oels ein zu Hause. Ein ganz altes Schloss mit 50 Zimmern, Park und großem Gemüsegarten hatten wir zur Verfügung. Da Herr und Frau Eschenbach zur Erholung in ein Bad fuhren, war ich allein mit den vielen Geistern im Schloss. Eine sehr schöne Zeit. So konnte ich mich zu meinem Abschlussexamen sammeln und arbeiten. Im Jahre 1922 bestand ich die Prüfung als staatlich geprüfte Hauswirtschaftsleiterin.
Aufbruch nach Mexiko
Um mich in einem großen Haushalt zu vervollkommnen, kam ich zur Freifrau von Richthofen auf das Gut „Wangrowitz“ in Schlesien als Haustochter. Ich war dort sehr gerne, aber ich musste an meine Zukunft denken. Mein heißer Wunsch war, ins Ausland zu gehen. Durch die Kolonialzeitung hatte ich verschiedene Angebote. Europa war mir zu nah. Da fand ich eine Anzeige für Mexiko auf eine Hochland-Kaffeeplantage. Einen Dreijahresvertrag und freie Hin- und Rückreise. Frau v. Richthofen wollte nicht, dass ich fortgehe. So nahm sie mir die Anzeige fort und warf sie in den Kamin. Zum Glück war kein Feuer darin. Ich holte sie später heraus und schrieb dorthin. Es kam lange keine Antwort. So hatte ich schon nach Johannes-burg, Afrika, geschrieben. Da wir in Deutschland eine traurige Zeit hatten, Inflation, Hunger, Streik und Arbeitslosigkeit, hatten sich 470 Damen in Mexiko gemeldet. Es kamen 7 zur engeren Wahl. So fiel dann das Los auf mich.
In drei Wochen musste ich mich auf der „Orinocko“ in Hamburg zur Abfahrt melden. Es gab viel zu besorgen. Mein Gehalt hatte ich wertbeständig in Weizen bekommen, da es sonst täglich entwertet worden wäre. So fuhren wir, Frau v. Richthofen und ich nach Breslau und kauften Tropenkoffer, Reitzeug und so manches andere. Zwei Dackel hatte ich, von denen ich mich nicht trennen mochte und sie mitnehmen wollte. Aber es gab auch da allerlei, besondere Erlaubnis, Impfungen, Atteste usw.
Endlich war es soweit, noch ein schönes Abschiedsfest und dann ein Lebewohl. Obgleich ich keine Verwandten hatte aber liebe Freunde, so fiel mir der Abschied nicht so leicht. Gottlob wusste ich nicht, unter welchen Bedingungen ich Deutschland einmal wiedersehen sollte.
In Hamburg blieb ich einen Tag. Am 16. Oktober, an meinem Geburtstag, reisten wir ab. In meiner Kabine fand ich schöne Blumen, eine Torte, etwas gegen Seekrankheit sowie 100 Dollar der Firma aus Mexiko. Die Reise dauerte drei Wochen. Endlich legten wir in „Vera Cruz“ an. Leider mussten meine Dackel in eine 14tägige Quarantäne.
Eine tropische Landschaft mit viel Palmen und herrlichen Blumen allerdings auch eine große Hitze. Ich beherrschte die spanische Sprache nicht, aber ein deutscher Arzt war von der Kaffeefarm gebeten worden, mir zu helfen. Ein junger Mexikaner überreichte mir in einer Eisdiele einen großen Strauß Orchideen, der mich in große Verlegenheit brachte. Doch der Arzt erklärte mir, es wäre Landessitte, einem jungen Mädchen aus dem Ausland einen Begrüßungsstrauß zu überreichen.
Mein Vertrag musste erst in das Spanische übersetzt werden, aber letzten Endes war alles so weit, und die Bahnreise nach dem Süden Mexikos konnte losgehen. Mein Ziel mit der Bahn war die Stadt „Tapachula Chiapas“. Die Fahrt dauerte drei Tage und Nächte. Der Zug war von Soldaten bewacht. Trotz der Hitze war die Reise sehr interessant. Eine Studentin hatte sich mir zugesellt. Wir übernachteten nach Ankunft in einem Hotel. Am Morgen meldete sich ein Indio mit ein paar Reitpferden. So machten wir uns auf den Weg. Die kleine Studentin hatte fast das gleiche Ziel, stand aber mit dem Pferd auf Kriegsfuß. Wir schafften dennoch am ersten Tag acht Reitstunden. Auf einer Kaffeefarm übernachteten wir.
Es war Trockenzeit, und die Ernte hatte gerade begonnen. Überall roch es nach frischem Kaffee, der noch einen großen Arbeitsprozess durchmacht. Es war eine große Finka, und viele Herren verschiedener Nationen waren hier tätig. Nach dem Essen und dem Cocktail mussten wir unsere müden Reitbeine noch im Tanze schwingen. Diese erste Tropennacht war so bezaubernd schön, voll Duft und fremder Geräusche, dass ich nicht schlafen konnte. Früh am Morgen mit einem grässlichen Muskelkater ging unser Ritt weiter. Teils Urwald, dann wieder gepflegte Farmen. Überall fleißige Indios mit Frauen und Kindern beim Kaffee pflücken.
Auf der Farm „Cowadonga“ mitten im Urwald
Spät am Abend waren wir am Ziel. Die Farm hieß „Cowadonga“ und dazu gehörten noch die Farmen „Miseceito“ und „Pareisa“. Das Wohnhaus lag auf einem Hügel, umgeben von schönen Bäumen und Pflanzen. Nach einem Begrüßungscocktail und Abendessen waren wir froh, das Bett aufzusuchen.
Am Morgen wurde ich mit meinem Arbeitsfeld vertraut gemacht. Ein Haushalt von 20 Personen und zwei Kindern. Das Baby war zwei Monate alt. Die Mutter war sehr krank und fuhr für längere Zeit in ein Sanatorium in die Schweiz. Das Hauspersonal bestand aus Indianern. Auch die Amme für das Baby war eine Indianerin. Zuerst hatte ich Schwierigkeiten der Sprache wegen, da ich weder Spanisch noch die Indianersprache sprechen konnte. Aber nach einiger Zeit, abends lernte ich fleißig, ging es ganz gut.
Da wir mitten im Urwald lebten, mussten wir uns mit allem selbst helfen, backen, schlachten und das Gemüse selbst anbauen. Da machte ich so manche Erfahrungen. Die erste Aussaat im April ging am ziemlich entfernten Fluss auf. Ich hatte keine Ahnung, was die Regenzeit aus meinem Garten machte. So musste ich damit bis zum Oktober warten. Aber bald hatte ich den Haushalt im Griff. Das Personal war fleißig und lernte schnell. Aber das Personal wechselte jedes halbe Jahr, da die Jungens mit den Eltern dann wieder in die Berge ihrer Heimat gingen. Alle versprachen wiederzukommen, und sie taten es auch. Es mussten aber wieder neue Indios fürs Haus angelernt werden. Das gab viel Spaß, aber man musste viel Geduld haben. Zuerst schickte ich sie in den nächsten Fluss baden. Dann bekamen sie weißes Zeug, Hose, Hemd und Schürze. Das größte Glück war ein Spiegel, ein Kamm und Brillantiene fürs Haar. Nachdem ich ihr widerspenstiges Haar so einigermaßen in Ordnung hatte, ging es an die Arbeit. Aber unglaublich schnell begriffen sie alles. Der Koch sagte mir einmal, als er beim Brot kneten war, die Hausarbeit sei viel schwerer, als Kaffee zu pflanzen. So ist es also mit der Hausarbeit einer Frau.
Das größere Kind war vier Jahre alt und hatte ein Kindermädchen. Fast täglich machten sie mit dem Stalljungen einen kleinen Ausritt.
Der nächste Arzt zwei Reittage entfernt
Wir hatten viel Besuch. Forscher aus allen Erdteilen, so war doch immer viel Abwechslung. Aber auch viel Kranke mussten versorgt werden. Sie bekamen vom Haus eine Krankenkost, aber zuerst mussten sie ihr Misstrauen überwinden. Der nächste Arzt war in zwei Reittagen zu erreichen. So waren wir oft auf die Heilkunst der Medizinmänner angewiesen, von denen ich viel lernte. Heute gibt es dort Hubschrauber. So kann man den Kranken schneller helfen.
Zuerst hatte ich Heimweh, bis ich die Sprache kannte. Aber dann hatte ich mich gut eingelebt, und die drei Jahre waren schnell vorübergegangen. Von meinem ersten Gehalt kaufte ich mir ein Reitpferd und einen Sattel. So konnte ich viele schöne Ritte in den Urwald unternehmen. Manchmal stand ich vor so viel Schönheit in stiller Andacht versunken. Natürlich gab es auch allerlei Gefahren, Schlangen, die mir unheimlich waren, Pumas und Tiger, Wildschweine und vieles mehr. Meine beiden Dackel begleiteten mich immer. Wenn ich den Fluss überqueren musste, nahm ich sie in die Satteltaschen. Einmal waren sie vier Tage fort. Eines Tags flog meine Tür auf, und zwei struppige, blutende und magere Dackel stürmten auf mein Bett. Es war ein aufregendes Wiedersehen. Sicher waren sie in einem Dachsloch verschüttet. Eines Tages schenkten sie uns vier kleine Dackel-kinder, die sich ganz gut einlebten.
Die Nachbarn einen Tagesritt entfernt
Kleine Feste mit Nachbarn, die man in einem Tagesritt erreichte, waren die einzige Abwechslung. Dann gab es recht lustige Erntefeste mit viel Allotria, Tanz und Essen bei Marimba-Musik.
Die Kaffee-Ernte begann in der Trockenzeit Ende Oktober bis April. Da der Kaffee sehr sorgfältige Arbeit mit vielen Maschinen, Fermentiertanks bis zur Handauslese erfordert, wurde oft Tag und Nacht gearbeitet. Dann wurde er mit Ochsen-karren oder Mulas zur nächsten Bahnstation gebracht. Das geschieht heute auch auf dem Luftwege bis zum Schiff. In der Erntezeit waren 600 Indianer beschäftigt, die sich halbjährlich abwechselten. Sie kamen hoch oben von den Bergen, 3000 m hoch, wo sie alle einen kleinen Besitz hatten.
Bei den Indianern in San Christobal
Meine Ferien verlebte ich bei den Indianern in San Christobal. Da viele bei uns auf der Farm auch im Hause tätig waren, luden sie mich dorthin ein. Ich konnte die Reise mit dem Flugzeug machen, es wäre sonst ein zehn Tage Ritt gewesen. Es waren unvergessliche Tage. Ich wohnte auch in ihrem Rancho mit Kindern, Esel, Hühnern und Schweinen zusammen. Diese Liebe und Aufrichtigkeit ist wohl nur bei diesen Naturvölkern anzutreffen. Da der Ort sehr hoch liegt und daher recht kalt wird, sahen die Tiere alle so zottelig mit dem dicken Fell aus. Große Felder mit Mais, Bohnen und Zuckerrohr gehörten zu ihrem Besitz. So viel schöne Blumen habe ich selten gesehen. Es gab einen traurigen Abschied, man beschenkte mich mit vielen schönen Sachen, kostbaren alten Silbersachen, die ich mit viel Mühe bis heute gehütet habe.
Auf der Farm gab es morgens von 6 - 8 Uhr eine Krankenhilfe. Zwei Herren hatten abwechselnd Dienst. Auch ich half oft mit und besuchte die Kranken im Rancho. Es gab Spritzen und Medikamente, auch wurden Diätsuppen verteilt. Sie bewohnten alle ein kleines Häuschen mit Wasserleitung und Licht. Neben ihrem Lohn bekamen sie auch wöchentlich ein Deputat von Mais, Bohnen und Fleisch. Sonnabends sangen, tranken und tanzten sie.
Nach zweieinhalbjährigem Aufenthalt in einem Sanatorium in der Schweiz kam die Mutter der Kinder wieder heim. Es war für die Kinder wie auch für die Mutter und auch für mich sehr schwer. Die Kinder konnten sich nicht an die Mutter gewöhnen, die Kleine kannte sie ja nicht. Ich war eine große Verantwortung los.
Eine neue Aufgabe in Mexico City
Inzwischen war auch mein Dreijahresvertrag zu Ende. Da ich nicht nach Deutschland zurück wollte, fuhr ich in die Hauptstadt Mexikos. Noch in der selben Woche übernahm ich die Leitung eines schwedischen Haushalts. Der Haushalt war sehr gepflegt. Das Haus, in einem alten spanischen Stil gebaut, lag mitten in einem alten Park etwas außerhalb von der City. Auch dort hatte ich zwei Kinder zu betreuen. Das Baby hatte eine Kinder-schwester. Die vierjährige Tochter bekam Reitunterricht, wobei ich sie stets begleiten musste. Zweimal in der Woche besuchte ich abends die Kunstgewerbeschule, um etwas von der alten indianischen Kunst zu lernen. Auch hier gefiel es mir sehr, und es fiel mir nicht leicht, wieder fort zu müssen, da ich das Klima in der Höhe nicht vertragen konnte. Immerhin hatte ich in der Umgebung von Mexico City viele Kulturstätten der alten indianischen Kunst gesehen.
Ein neues Arbeitsfeld auf der Kaffeefarm „Germania“
Bald danach fand ich wieder auf einer Kaffeefarm im Süden Mexikos ein neues Arbeitsfeld. Auch hier gehörten wieder zwei Kinder zu meiner Betreuung, dazu ein Haushalt mit 20 Personen. Nun war ich mit der Sprache und einem Haushalt im Urwald schon vertraut. Die Farm hieß „Germania“. Es gehörten noch „Prusia“, „San Viecente“, „Hanover“ und „Primawera“ dazu. Es waren auch große Farmen mit selbständigen Verwaltern und frauenlosem Haushalt. Von Zeit zu Zeit musste ich dort nach dem Rechten sehen. Da gab es allerlei Überraschungen und viel Arbeit. Nachdem man drei Tage geritten war und zweimal im Urwald übernachtet hatte, war man am Ziel. Sehr aufregend aber schön so am Lagerfeuer zu übernachten, das von Indios bewacht war, die auch die Reittiere betreuten. Aber auch nicht ohne Gefahr. Viele Schlangen, Pumas und Tiger, Wildschweine und viele Affen, die sehr neugierig sind, gab es da. Die Affen waren sehr zutraulich und kamen dicht an das Lager. Ganze Familien unterhielten sich über uns. Ab und zu warfen sie Äste auf uns herab. Wir waren immer bewaffnet. Vor so viel Schönheit im Urwald mit den vielen Vögeln, Pflanzen, Bäumen und Blumen, hoch in den Bäumen die schönsten Orchideen, ist man oft versunken vor Respekt in die Natur.
Das Leben auf der Farm war wie auf der anderen mit viel Arbeit und Verantwortung verbunden, da alles selbst getan werden musste, backen, schlachten, Gemüse anbauen, Kinder und Kranke pflegen. Das Haus ist sehr groß und lag oben auf einem Berg. Die Büroräume und die Zimmer der Herren mussten auch in Ordnung gehalten werden. Zu meiner Unterstützung waren Indianerjungen da, die sehr fleißig und geschickt waren und sehr sauber.
Weihnachten war für alle ein großes Fest. Eine Tanne wurde aus den Bergen geholt. Da so eine Reise vierzehn Tage dauert, haben wir in der Küche allerlei Gebäck für das Fest gezaubert, auch eine ganze Anzahl von Stollen. Endlich war es Heilig Abend. Alle, die im Hause arbeiteten, sowie auch die Alten, die schon dem Gründer der Farm gedient hatten, waren mit viel Freude dabei und wurden beschenkt. Die Alten konnten sogar „Stille Nacht“ singen. Ganz ergriffen in ihrem besten Zeug aber barfuß staunten sie den Weihnachtsbaum an. Da sie das europäische Essen nicht mochten, bekamen sie draußen an einer großen Tafel ein Essen nach ihrem Geschmack mit dem entsprechenden Getränk. Bald war eine lustige Stimmung da.
Für uns im Hause war es sehr heiß. Damit eine Weihnachtsstim-mung aufkommen sollte, hatten wir die Fenster verdunkelt. Draußen blühten die Rosen, und es war unglaublich heiß und natürlich noch sehr hell bis abends um 22 Uhr. Auch ein wenig Heimweh packte uns.
Heimlich verlobt
Hier lernte ich auch meinen zukünftigen Mann kennen. Er war Ingenieur und kam aus Hamburg, um neue Kaffeebearbeitungs-maschinen aufzustellen. Auch er musste sich erst an das Klima gewöhnen. Wir wurden nicht von Malaria, Typhus und Amöben verschont. Während heute mit dem Flugzeug oder Hubschrauber schnelle Hilfe geleistet werden kann, war es damals oft mit Lebensgefahr oder mit dem Tod verbunden. Da mein Verlobter viel auf den anderen Fincas zu tun hatte, waren wir zwei Jahre heimlich verlobt. Mein Schwager war auch auf der Finca Germania, er war dort als Prokurist tätig. Aber er wusste nichts von unserem Geheimnis. Auf meinen Inspektionsreisen nach Prusia sah ich meinen Verlobten ein- oder zweimal im Jahr. Briefliche Verbindung war unmöglich. Es war eine harte Probezeit.
Erfolgreiche Geburtshilfe mit Kaiserschnitt
durch vier Ingenieure und Kaufleute
Auch in Prusia gab es oft recht ernste Probleme, was Krankheiten anbetrifft. Eines Tages war eine Indiofrau in großer Gefahr, ihr Kind nicht zur Welt zu bringen. Nachdem sie vier Tage in furchtbaren Qualen war, obwohl sie neun gesunde Kinder geboren hatte, und auch der Medizinmann nicht helfen konnte, kam ihr Mann zu den Herren, die alle Junggesellen waren, und bat dringend um Hilfe. Vier deutsche Herren, darunter auch mein Verlobter, hatten in Deutschland einen Kursus in Krankenpflege bekommen. Sie konnten spritzen und auch bei Schlangenbissen helfen. Jede Finca ist mit einem Sanitätsraum und Medikamenten versehen. Nun war aber höchste Eile, schnell zu helfen. Um in ein Krankenhaus zu kommen, war es zu spät, es hätte drei Tage gedauert. Der Mann bat die Herren dringend, doch zu helfen. Er gab eine schriftliche Erklärung, konnte sogar schreiben. Nur durch einen Kaiser-schnitt konnte man der Frau helfen. Ein Buch für erste Hilfe im Ausland war auch da.
Drei Herren gingen nun mit viel Angst und Mut an die schwere Arbeit. Der eine Herr, ein Buchhalter, musste aus dem Buch langsam alle Anweisungen vorlesen. Die Frau hatte eine leichte Narkose bekommen, und die Herren arbeiteten. Nach dreistündiger Arbeit mit viel Angst, Schweiß und Zittern in den Beinen war es gelungen, einen kleinen zehn Pfund schweren Jungen zum Leben zu helfen. Auch die Mutter hat es glücklich überstanden. Das Kind hatte eine Querlage und es nicht geschafft. Die Herren fühlten sich genau so elend wie die Wöchnerin und stärkten sich mit Cognac und Schlaf. Der Junge bekam die Namen der vier Geburtshelfer und ein ganz großes Tauffest mit Marimba, Schnaps und ein Ochsenbraten am Spieß. Das war eine dolle Abwechslung. Der Vater war ein reicher „Arjero“, ein Eseltreiber mit 90 Mullas.
Tödliche Masernepidemie
Oft gab es Verletzungen, die sich die Indios mit dem Buschmes-ser aus irgend einem Anlass beibrachten, aber alles heilte trotz der Hitze erstaunlich schnell. Auch viele Sozialleistungen waren zu erledigen. Plötzlich brach eine Masernepidemie aus, die in den Tropen fast immer tödlich sind. Wir hatten 40 kleine Kinderleichen in der Kirche aufgebahrt. Eine ergreifende Trauerfeier nach Indioart ließ auch uns tief bewegt in Andacht zurück.
Viele Wurmkuren mussten bei den Kindern gemacht werden.
Kauf einer Kaffeeplantage in Costa Rica
Mein Verlobter und ich hatten noch ein Jahr, um unseren Vertrag zu erfüllen. Darum hielten wir unsere Verlobung geheim. Wir sparten fleißig, hatten auch keine Gelegenheit, Geld auszugeben. Durch einen bekannten Nachbarn, der unser Gönner war, hatten wir die Möglichkeit, in Costa Rica eine Kaffeefarm zu erwerben, denn dort waren die Fincas kleiner und wurden von den Banken übernommen, wenn die Besitzer überschuldet waren. Allerdings sind solche Farmen sehr heruntergewirt-schaftet, und viel Mut, Fleiß und Verständnis gehörten dazu, sie zu übernehmen. Auch einen Kredit gewährte man uns. Zusam-men mit unseren Ersparnissen gingen wir an den Aufbau.
Hochzeit in Tapachula, Mexiko
Nun waren wir soweit, um endlich unsere Hochzeit zu feiern. Das geschah dann auch dreimal. Einmal auf der Farm Germania, dann auf dem Standesamt in Tapachula, Mexiko, der nächsten Stadt. Die Feier fand im Deutschen Klub statt. Ein deutscher Arzt, Dr. Heusen, hatte alles für uns erledigt und auch die Feier bezahlt. Die dritte Feier mit kirchlicher Trauung fand in Costa Rica auf dem Schulschiff „Schleswig Holstein“ statt, da die Kirchen in Mexiko geschlossen waren.
Die Hochzeitsreise ging wie folgt vor sich: Zu Pferd, dann Ochsenkarren, Bahn, Flugzeug mit der Pan Am. Dann von Guatemala mit der „Karibia“ bis Porto Limon. Wieder die Bahn bis San José, weiter zu Ross und Ochsenkarren bis zur Finca „El Cerro“. Endlich am Ziel fanden wir einen verwahrlosten Schuppen vor, in dem Hühner und Schweine übernachteten, auch das entsprechende Ungeziefer. Morgens steckten die Kühe die Köpfe durch die Fensterlöcher und der Briefträger stieg auch da durch.
Harte Aufbauarbeit
Am Morgen ging es an die Arbeit, davon gab es wirklich genug. Im Zitronenbaum hing ein Säckchen mit einem Brot und Salz und ein paar Centiemes. Es war ein Geschenk von einem sehr weit entfernten Nachbarn. Bald meldeten sich Mädchen, viele Mulatten, hübsche Mädchen. Eine Carmen trat dann den Dienst an.
Wochenlang haben wir den Schuppen, der ja unser Wohnhaus werden sollte, gereinigt. Mit dem Buschmesser bearbeiteten wir die Böden. Da kam ein wunderbares Mahagoniholz zum Vorschein. Das Haus musste bewohnbar gemacht werden, aber Handwerker gab es nicht. So blieb alles für meinen Mann. Auch mussten zur Kaffeeernte die Maschinen, die verkommen waren, wieder brauchbar gemacht werden. Es war ein sehr hartes Jahr, aber wir schafften es.
Ich legte einen Gemüsegarten an und pflanzte Obstbäume. Die wir vorfanden, waren verwildert. Im April begann die Regenzeit. Da hatten wir unser Häuschen bis auf die Fenster und die Türen schon ganz wohnlich hergerichtet. Holz gab es genug im Urwald, aber es musste ja erst brauchbar gemacht werden.
Die Geburt unseres Sohnes Claus Peter
Im Juni 1936 erwartete ich mein Baby. Ich war in San José, der Hauptstadt von Costa Rica in der „Klinia Bieblica“ angemeldet. Da in der Regenzeit der Weg von der Farm bis an die panamerikanische Straße als Kranker nur auf einer Bahre möglich war, musste ich vorher in die Stadt. Nach vierwöchent-licher Wartezeit wurde uns am 9. Juni unser Sohn Claus Peter geschenkt.
Inzwischen hatte mein Mann, da nur in der Regenzeit Kaffee gepflanzt wird, einen großen Teil neues Kaffeeholz angepflanzt. Als ich mit unserem kleinen Sohn wieder zur Farm kam, waren auch die Fenster und Türen im Bau. Alles war sauber. Auch eine kleine Wiege hatte mein Mann gezimmert. Mit Freude und neuem Mut gingen wir weiter an die Arbeit. Auch im Kaffeeanbau sahen wir einen ziemlichen Fortschritt.
Leider konnte ich mein Baby nur zwei Monate stillen. Da ich Malaria bekam, mussten wir wieder in die Klinik. In den Tropen ist es sehr schwierig, einem kleinen Kind plötzlich eine andere Ernährung zu geben. Der Arzt suchte eine Amme. Nach gründlicher Untersuchung fanden wir eine Indianerin, die mit uns auf die Farm kam. Fünf Monate blieb sie bei uns, und der Junge entwickelte sich prächtig.
Taufe auf dem Schulschiff „Schleswig Holstein“
Da kam das Schulschiff „Schleswig Holstein“ nach Costa Rica. Das war ein großes Ereignis für die Deutschen aber auch für die Eingeborenen. Die Deutschen ließen sich trauen, taufen und konfirmieren. Auch wir flogen nach Port Limon, wurden getraut und unser Kind getauft. Es waren dreizehn Paare mit ihren Kindern. Es gab keine protestantischen Kirchen im Land. Es war ein sehr schönes, unvergessliches Erlebnis, wieder einmal auf deutschem Boden zu sein. Leider ist dieses schöne Schulschiff im II. Weltkrieg bei Gotenhafen zerstört worden. Auch unsere Trau- und Taufpaten sind dabei ums Leben gekommen.
Eine Frühgeburt mit Zwillingen
Wir waren ganz gut vorangekommen. Unser Wunsch, noch ein Kind zu haben, ging in Erfüllung. Aber leider erlitt ich eine Frühgeburt mit Zwillingen im achten Monat. Mein Mann war zum Kaffeeverladen in Port Limon. Das Mädchen war in der Klinik, um einen Sandfloh aus dem Zeh zu entfernen. Die Leute hatten ihre Arbeit eingeteilt bekommen, so kam niemand ins Haus. Ich musste mir selber helfen. Gottlob war man im Urwald für besondere Fälle etwas vorbereitet. Die beiden Jungen lebten noch eine Stunde, aber ich war nicht fähig, sie ins Bad zu bringen. Klaus Peter, meinem kleinen Jungen, hatte ich eine Dose Kekse in sein Bettchen gegeben.
Am zweiten Tag kam mein Mann wieder. Er fand mich in keiner guten Verfassung. Sofort wechselte er das Reittier, um einen Arzt zu holen. Es waren sechs Reitstunden. Da es Nacht war, kam der Arzt nicht, schützte eine dringende Operation vor. Aber er gab meinem Mann Spritzen mit. Amächsten Nachmittag kam er dann. Ich war zu schwach, um in die Klinik gebracht zu werden. Ein Schutzengel hatte sicher über meinem Jungen gewacht, er war 1 ½ Jahr alt und konnte gut aus seinem Bettchen klettern, hinaus in den Garten. Dicht vor dem Hause war ein Bach, den er sehr liebte. Heute noch denke ich mit Schrecken an diese Tage und bin dankbar, dass noch alles gut ging. Mein Mann pflegte mich und den Jungen, kochte und backte Brot. Es war sehr hart aber doch Brot.
Mit dem Kriegsausbruch 1939 alles wieder verloren
In der Kaffeeplantage gab es viel Arbeit. Immer wieder pflanzten wir Bäume an, die in eigener Baumschule gezogen wurden. Auch die Schattenbäume mussten gepflegt werden. In ein paar Jahren hofften wir auf recht gute Erträge. Leider hörten wir aus Europa bedrohliche Nachrichten, die sich zu dem schrecklichen Krieg im Jahre 1939 entwickelten. Alle Deutschen im Ausland lebten in großer Sorge, dass auch Nord- und Lateinamerika mit hineingezogen würde. So erklärte auch Costa Rica wie auch andere Länder am 11. Dezember 1940 den Deutschen den Krieg. Die Deutschen kamen auf die Schwarze Liste. Der Kaffee, der im Hafen verschifft werden sollte, wurde im Meer versenkt. Ein großer Teil Deutscher, Lehrer, Mediziner, Chemiker und Ingenieure, darunter auch mein Mann, wurden als erste interniert. Die Farm, die schon gute Erträge brachte, wurde als deutsches Eigentum beschlagnahmt. Ich musste mit meinem Kind in drei Tagen fort. So waren unsere Arbeit, Ersparnisse und Hoffnung dahin.
In der Hauptstadt San José fand ich eine kleine Wohnung, leider recht teuer. Die Einheimischen, die uns recht gut gesonnen waren, konnten uns kaum helfen. Das Geld auf der Bank war beschlagnahmt. Oft hatten wir fast nichts zum Leben, aber dann hing an unserer Tür ein Beutel mit Lebensmitteln. Unsere Männer waren zuerst in der Festung inhaftiert. Die Verpflegung war sehr schlecht. So brachten wir Frauen täglich etwas für sie dorthin. In der Bahn mussten wir oft viele Beschimpfungen einstecken. Nach einem Vierteljahr wurden die Männer über Nacht mit einem Schiff an ein unbekanntes Ziel gebracht. Ein halbes Jahr bekamen wir keine Post. Auf Umwegen erfuhren wir, dass sie zuerst in New Orleans, dann in verschiedenen Lagern herum kamen. Dann erhielten wir endlich Post aus dem Lager „Kap Kennedy“.
Unsere Kinder wurden krank. Die deutschen Ärzte waren interniert. Geld für die Miete und 25 Peso zum Leben bekamen wir von dem spanischen Konsul. In meiner Not ging ich zu unserem Kinderarzt, einen Costaricaner, und bat ihn um Hilfe. Er war sofort bereit, mein Kind zu behandeln mit den Worten: „Ich bin Arzt und helfe jedem Kranken.“ Sogar Medizin gab er mir kostenlos. Unser Zustand wurde immer unerträglicher, wir wandten uns an das Rote Kreuz. Auch unsere Männer baten dort im Lager, dass man die Frauen auch interniere. Nach langer Wartezeit bekamen wir Nachricht, dass wir uns im Deutschen Klub zwecks Internierung einfinden sollten. Unsere letzten Habseligkeiten wie Wäsche, Bilder, Silber und verschiedene Andenken, sollten in einem Lagerhaus untergebracht werden. Leider haben wir nie wieder etwas davon zurückbekommen.
Eine lange Reise ins Internierungslager
Es waren 70 Frauen und 50 Kinder aller möglichen Rassen, Amerikaner, Mulatten und Neger, die mit deutschen Männern verheiratet waren. In einen Saal eingepfercht, mussten drei Frauen ein Bett teilen. Wasser war Mangelware. Sehnsüchtig warteten wir auf eine Erlösung. Zuerst sollten wir mit dem Flugzeug fort, 50 Pfund Gepäck war erlaubt. Dann wurden auch die letzten deutschen Männer interniert. Endlich bekamen wir Nachricht, dass wir um 24 Uhr mit der Bahn nach Puntarenas am Pazifischen Meer gebracht werden sollten. Dort wurden wir auf die „Orinoko“ gebracht. Ich erkannte das Schiff gleich, war ich doch mit demselben nach Mexiko gereist. Es war zu einem Truppentransporter umgebaut und hieß nun „Puebla“. Inzwi-schen war unter den Kindern Keuchhusten ausgebrochen. Auch mein Klaus Peter war sehr krank, erst an Keuchhusten mit einer Leberentzündung dazu, aber keine Medizin war vorhanden. Es gab auch für die Erwachsenen keine Medizin, die Fenster dicht verschlossen, Temperatur 40 Grad. Wir lagen noch vierzehn Tage im Hafen, das Schiff fast voll besetzt mit anderen Deutschen aus Kolumbien und vielen Japanern, alles Zivilinter-nierte.
Täglich gab es Probealarm, mit Schwimmwesten in fünf Minuten an Deck, auch nachts. An Bord waren Zwillinge geboren worden, die in Schwimmwesten an Deck gebracht wurden. Die Westen waren so groß, dass man nicht sehen konnte, wo Kopf oder Füße waren. Im Laderaum waren Japaner und die deutschen Männer untergebracht. Wir Frauen waren in den Kabinen mit vielen zusammen. Die deutschen Männer mussten uns bedienen beim Essen, durften aber kein Wort mit uns wechseln. Eine junge Mittelamerikanerin machte so ihre Hochzeitsreise. Die Fahrt dauerte vier Wochen. Wir schliefen mit den Schwimmwesten, da im Pazifik die japanischen U-Boote uns oft verfolgten.
Mein Klaus Peter war sehr krank. Während ich für eine halbe Stunde an Deck musste, hatte man ihn in das Schiffshospital gebracht. Jeden zweiten Tag durfte ich ihn eine viertel Stunde besuchen. Es war dort etwas kühler. Er wurde gut versorgt, aber oft zweifelte ich an seiner Genesung, weil noch eine Gelbsucht dazu kam.
Endlich kamen wir in San Pedro Los Angeles an. Mit Schnellbooten wurden wir an Land gebracht und kamen in das Emigrantenheim, alles unter strenger militärischer Bewachung. Ein Schiffsarzt untersuchte uns und fand uns in einem bedauer-lichen Zustand. So kamen wir in Quarantäne. Nach vier Wochen Aufenthalt mit ärztlicher Betreuung ging die Reise weiter mit der Bahn nach Texas. Unser Ziel war das Familienlager „Christal City“. Während der ganzen Fahrt wurde mein Kind von einem Arzt betreut. Auch die Frau B. L. war sehr rücksichtsvoll. Wir hatten ein kleines Kabinett allein. Sehr viele Geschenke brachte man dem Kind. Nach viertägiger Fahrt wurde mein Kind und ich von San Antonio mit einer Ambulanz in ein Hospital nach Christal City gebracht. Es gehörte nicht zum Lager, dort wurde erst eines gebaut. Es war sauber und gut geführt. Mit dem Arzt verständigten wir uns in englisch, spanisch und deutsch. Zu unserer Bewachung bekamen wir eine Dame vom F.B.I., die uns Tag und Nacht bewachte, obgleich uns eine Flucht mit dem kranken Kind und ohne jeden Pfennig wirklich unmöglich war.
Endlich zu meinem Mann
in das Familienlager der Zivilgefangenen
Der Chefarzt untersuchte Klaus Peter sehr gründlich. Ich hatte volles Vertrauen zu ihm, und nach vier Wochen konnten wir entlassen werden, endlich zu meinem Mann und den anderen in das Familienlager fahren. Dort waren Familien aus allen Ländern als Zivilgefangene, auch 2.000 Japaner. Bald waren wir alle eine große Familie. Im Lager wurden Schulen, Kranken-häuser und Kindergärten gebaut. Mein Mann arbeitete im Ingenieurbüro. Ich war teils im Hospital, Kindergarten und auch in der Messhalle beschäftigt. Zu Weihnachten gab es viele Wiedersehensbabys.
Das Klima machte uns sehr zu schaffen. Neben den tropischen Krankheiten gab es noch allerlei Gefahren. Es waren Schlangen, Scorpione, Tausendfüßler usw. Auch mein Kind wurde von einem Tausendfüßler gestochen. Zuerst glaubten wir an einen Schlangenbiss, da die Lähmungserscheinungen die gleichen sind. Die Lähmung dauerte eine halbe Stunde, für mich eine Ewigkeit. Die Ärzte, zwei Deutsche und ein Amerikaner waren sofort mit Spritzen da. Nach acht Tagen war auch der Schrecken vorbei.
Schule und reges kulturelles Leben
im Lager Christal City
Im Lager Christal City wurden die Kinder eingeschult, auch unser Klaus Peter. Unsere Lehrer aus Costa Rica leiteten die Schule. Für die größeren Kinder gab es eine Berufsschule, in der auch mein Mann unterrichtete. Es waren Nähstuben und Friseursalons entstanden. In der Aula wurden Vorträge, Theater, Konzerte und Andachten gehalten. Die Japaner waren immer Gäste und sehr interessiert an allen Veranstaltungen. Oft luden sie uns auch ein.
Das Weihnachtsfest rückte immer näher. Wir wollten doch unseren Kindern gerne eine kleine Freude machen. Unser Verdienst waren zehn Dollar die Stunde. Von unserer Zuteilung mussten wir uns selbst verpflegen. Wir bekamen Lagergeld und konnten damit in der Kantine einkaufen. Jeder sparte Mehl, Zucker, Honig und Früchte. Der Koch war auch aus Costa Rica und zauberte Stollen und Weihnachtsgebäck. Alle halfen abends fleißig mit. Auch unsere Kriegsgefangenen, die in unserer Nähe in Hauston waren, wollten wir beschenken.
Eines Tages kamen aus dem Lager unserer Kriegsgefangenen 40 Kisten mit handgefertigtem Spielzeug für unsere Kinder. Jedes Stück, Puppen, Bilderbücher, Flugzeuge, Schiffe und viele Tiere mit viel Liebe und fast ohne Handwerkszeug angefertigt. Wir veranstalteten eine Ausstellung mit einer Weihnachtsfeier. Unsere Künstler hatten die Aula in ein ganz bezauberndes Café verwandelt. In einem großen Bazar luden wir auch die Angestellten, Amerikaner und Japaner ein. Ein Los kostete ein Dollar, es gab Kaffee und Kuchen. Unsere jungen Mädchen bedienten in Landestrachten. Alle Länder in Deutschland waren vertreten. In netten Nischen waren auch die Kapellen aufgebaut. Sogar ein bayerisches Bierzelt gab es. Es war ein großer Erfolg, und der Erlös wurde für Geschenke für unsere Kriegsgefangenen verwendet. Selbst die Amerikaner baten um Wiederholung solcher Veranstaltungen und erlaubten nicht den Abbau der Einrichtung. Sogar ein Tannenbaum war irgendwo herge-zaubert. Noch öfter fanden wir alle in unserem Café zum Sonntag Nachmittag nette Unterhaltung.
Austausch gegen Amerikaner aus Deutschland
Mit unserem Los hatten wir uns abgefunden und warteten mit Spannung auf das Ende des Krieges. Weder Post noch Zeitungen erhielten wir. Eines Tages verbreitete sich die Nachricht, wir sollten gegen Amerikaner aus Deutschland ausgetauscht werden. Im März 1944 wurden wir alphabetisch bis zum Buchstaben L aufgerufen. Man erklärte uns, in drei Tagen sollten wir wirklich ausgetauscht werden, auch gegen unseren Willen.
Da unser Gepäck ja nur aus 50 Pfund bestand, war das Problem schnell gelöst. Man gab uns einen Mantel und einmal Schlafzeug dazu. Es gab viel Tränen beim Abschied, da die Jungen über 16 Jahre nicht mit den Eltern ausgetauscht wurden, sondern zum Militärdienst eingezogen wurden.
Mit der Bahn wurden wir nach New York verfrachtet. Dort wartete das schwedische Diplomatenschiff „Gripsholm“ auf uns. Zugleich wurden viele schwer verwundete Kriegsgefangene aus Afrika auf das Schiff gebracht. Die meisten haben Deutschland nicht mehr erreicht. Diesmal fuhren wir 1. Klasse in Begleitung etlicher Konvoischiffe. In Lissabon tauschten wir die Plätze gegen Amerikaner.
Mit einer kurzen Ansprache erklärte uns der Kommandant, dass wir nun frei wären, also keine Zivilgefangenen mehr. Daran mussten wir uns erst langsam gewöhnen. In einem Hotel gut untergebracht, blieben wir 14 Tage. Dann ging die Reise von Lissabon über Spanien, Frankreich nach Saarbrücken.
Nach 20 Jahren zwangsweise zurück in Deutschland
Ein Privatquartier, vor dem ein Blindgänger lag, war im März 1944 unser Wiedersehen in Deutschland nach 20 Jahren, mit zwei Koffern, ohne Geld und Beruf, ohne Heim, mit tropischen Krankheiten belastet. Die nächste Station war Neuenahr. Nach einer gründlichen ärztlichen Untersuchung kam der größte Teil nach Thüringen in das Tropeninstitut, auch mein Mann, unser Kind und ich. Viele wurden gleich zur Arbeit verpflichtet, auch Frauen, die kein Wort Deutsch konnten. Nach einer Kur von sechs Wochen wurden wir entlassen.
Mein Mann war Hamburger, aber wir hatten ein Kind. So durften wir nicht in die ausgebrannte Stadt. Eine Freundin nahm mich und das Kind in Breslau auf. Während mein Mann sich in Hamburg und Umgebung um Arbeit bemühte, wurde er wiederholt aufgefordert, sich beim Militär zu stellen. Da wir aber drüben einen Eid ablegen mussten, wie auch die Amerikaner hier, niemals Waffen gegen eine feindliche Nation zu ergreifen, wurde mein Mann davon befreit.
Neubeginn in Mecklenburg in Neuhaus an der Elbe
In Neuhaus an der Elbe, Mecklenburg, fand er endlich ein Arbeitsfeld als Ingenieur. Dort lagen sämtliche elektrischen Anlagen durch Bombeneinwirkungen brach. Auch ein halbfertiges Behelfsheim konnten wir uns fertig bauen.
Inzwischen waren die Russen bis kurz vor Breslau vorgedrun-gen. Ich konnte gerade noch rechtzeitig mit meinem Jungen nach Neuhaus zu meinem Mann kommen, bevor Breslau zur Festung erklärt und total zerstört wurde.
Es war schon sehr kalt, das Häuschen feucht. Aber wir wohnten direkt am Walde und konnten Feuerung beschaffen.
Das Kriegsende in Neuhaus
Nun rückten die Alliierten Truppen immer näher. Wir bauten einen Bunker, in dem wir drei Tage und Nächte zubrachten, bis endlich an der Elbe der schreckliche Krieg zu Ende ging. Zuerst besetzten die Amerikaner unsere Gegend, dann die Engländer und zuletzt die Russen. Fast jede Nacht gab es eine Razzia.
Die Amerikaner halfen meinem Mann für seine Werkstatt aus den Heeresbeständen in Begleitung amerikanischer Soldaten etliche brauchbare Maschinen zu holen. Auch für das Kranken-haus waren sehr wichtige Reparaturen an den verschiedenen sehr wichtigen Röntgenapparaturen zu erledigen. Dafür musste mein Mann die Ersatzteile aus Hamburg besorgen. Aber eine Erlaub-nis gaben die Russen nicht, also heimlich über die Elbe.
Wieder alles verloren
Inzwischen hatte ich einen Garten angelegt, auch viele Obstbäume gepflanzt, mit viel Mühe Walderde heran ge-schleppt. Nun hatten wir uns schon ein wenig eingelebt, als eines Abends zwei Polizeibeamte erschienen, meinen Mann baten, sogleich ein Radio in ihrem Büro zu reparieren. Da mein Mann sehr dringend die Nacht durcharbeiten musste, um den Röntgenapparat bis zum Morgen zu reparieren, und die Herren sich überzeugt hatten, dass es so war, so sollte sich mein Mann um 7 Uhr morgens im Büro melden.
Am selben Abend kam ein Bekannter von uns, ein Arzt, um unseren Jungen zu untersuchen, der Masern hatte. Vor der Tür fand er einen russischen Posten, wusste sogleich, was es bedeutete. Er riet uns, sofort unsere Sachen zu packen und möglichst schnell in den Wald an einen bestimmten Platz zu flüchten, von wo er uns in der Nacht nach Westberlin helfen wollte. Wir packten die nötigsten Sachen zusammen. Den Jungen in Decken eingewickelt, wieder mit zwei Koffern verließen wir abermals unsere eben geschaffene Existenz und Heim.
Es waren schrecklich aufregende und kalte Stunden im Walde, es war schon November. Endlich kam der Retter in einem Ambulanzwagen und fuhr uns selbst bis Westberlin ohne Zwischenfälle. Später erfuhren wir, man hatte uns Spionage vorgeworfen, da wir mit Amerikanern Briefwechsel hatten. Am nächsten Morgen wurden wir überall gesucht, an der Elbe und in der Bahn. In Berlin stellten wir uns bei den amerikanischen Behörden und bekamen Schutz. In einer Pension fanden wir Unterkunft.
Wieder ein erzwungener Neuanfang von ganz unten
Wieder brauchten wir Arbeit und eine Wohnung. Mein Mann glaubte, in Hamburg wohl bald etwas zu finden. Mit einem Kinobillett von den Amerikanern wurden wir in einem Bomber nach Hamburg geflogen. Die erste Unterkunft war im Lager „Jahnhalle“ zwischen vielen Leidensgenossen zusammenge-pfercht (Pior ist nada), schlimm ist gar nichts. Lange suchten und warteten wir auf eine andere Unterkunft, bis wir endlich eine halbe Nissenhütte bekamen. Eine kleine Auslandsdeut-schen-Ecke, man sprach viele Sprachen, aber wir waren allein.
Leider musste unser Kind dauernd umgeschult werden, es litt sehr darunter. Schwer war es für Auslandsdeutsche, wieder Arbeit zu finden. Immer die gleiche Antwort: Zu alt, zu lange im Ausland gewesen. Endlich erhielten wir eine Wohnung mit einem Baukostenzuschuss von der Baugenossenschaft „Hansa“. Mein Mann fand ab und zu Vertretungen. Auch ich hatte Arbeit.
Geblieben sind viele schöne Erinnerungen
Mein Sohn erlernte das Gold- und Silberschmiede Handwerk, ging später zur Bundeswehr. Leider erkrankte mein Mann an Krebs und verstarb im Jahre 1963. Auch ich musste meine Arbeit aufgeben. Mit meiner bescheidenen Rente lebe ich ganz zurückgezogen mit vielen schönen Erinnerungen.
Oft treffen sich die Costa Rica Deutschen und auch viele, die mit uns in Texas interniert waren. Leider war es mir in den letzten Jahren gesundheitlich nicht möglich, eine Reise nach Bonn zu machen.
Meine Wahlheimat ist Hamburg. Aus den Trümmern des schrecklichen Krieges ist wieder eine schöne Stadt erstanden.
„Erlebtes“, Aufzeichnung von Selma Kühn,
Hamburg 1965
Klaus Hückel
In der Kinderlandverschickung
Vorwort
Manche Ausdrücke, die ich hier verwende, stammen aus der Nazi- und Nazi-Folgezeit. Sie waren die Ausdrucksweise von damals. Ich habe sie mit Absicht nicht immer in Anführungsstriche gesetzt oder kursiv geschrieben. Sie entsprachen dem damaligen Denken und Sprechen. Halten Sie mich, bitte, nicht für einen unverbesserlichen Alt-Nazi, der nichts dazu gelernt hat. Im Gegenteil – ich habe. Sogar sehr viel. Aber ich denke, die Vergangenheit, gerade unsere Vergangenheit, drückt sich auch in der Sprache aus. Und ich will versuchen, das auch erkennbar werden zu lassen.
Endlich ein Arbeitsplatz – in der NSDAP
Mein Vater war seit 1937 in der Partei, weil er durch sie Arbeit bekommen konnte. Arbeitslos von 1927 bis 1937. Er hatte also seit 1937 nach 10 Jahren Arbeitslosigkeit endlich Arbeit, wenn auch bei der NSV, Nationalsozialistische Volksfürsorge. Wenn er dort bleiben wolle, bedeutete man ihm, müsse er natürlich in die Partei, in die NSDAP. Da gab es nichts zu diskutieren. Er hinein in die Partei wie Millionen andere auch. Sogar eine Parteiuniform bekam er verpasst. Die trug er aber nie. Er meinte, mit seinem Feuermal – es reichte über die gesamte linke Gesichtshälfte – wäre er als Uniformträger nicht recht geeignet.
„Typischer Mitläufer“ würde ich aus heutiger Sicht sagen. Nach dem Krieg im Rahmen der Entnazifizierung auch als solcher eingestuft. Durch Zufall bekam mein Vater im letzten Arbeitslosenjahr Gelegenheit, eine KdF-Schiffsreise mit einem „Monte“- Dampfer mitzumachen. „Monte“-Dampfer waren Schiffe, deren Name mit „Monte“ begann, z.B. „Monte Rosa“ oder „Monte Samiento“. Und KdF-Reisen – Kraft durch Freude – waren Reisen, durch die das Volk von den „Wohltaten“ der neuen nationalsozialistischen Zeit überzeugt werden sollte. Arbeiter fuhren nach Norwegen und Madeira! Wo gab es das denn sonst? Man kam ja nicht einmal in die Lüneburger Heide!
Mein Vater war auf diese Reise überhaupt nicht eingestellt. Nicht einmal einen Koffer hatte er und musste daher mit einem Pappkarton an Bord. Und Taschengeld? Bei 28 Reichsmark/Woche Krisenunterstützung (eine Art Sozialhilfe) für 2 Erwachsene und Kind, und das einschließlich Miete? Aber was tat Erwin Liedtke? Er lieh meinem Vater 50 Reichsmark auf unbestimmte Zeit. Wenn er irgendwann mal könne, erst dann bräuchte er es zurückzuzahlen.
Die Reise ging in Kaiser Wilhelm II. liebstes Reisegebiet, nach Norwegen. „Im Geiranger-Fjord bei dem Wasserfall 'Die sieben Schwestern' haben wir alle geweint – so ergreifend schön war das!“
Arbeitslos zu sein, ist an sich schon schlimm. Damals wie heute. Sieben Millionen Menschen sollen es ja in den Dreißigerjahren gewesen sein. Trotzdem heirateten meine Eltern 1931 und waren nun zu zweit arbeitslos. Um die Sozialhilfe etwas aufzubessern, machten sie Heimarbeit: Sie rollten kleine Pappplättchen, mit denen man Milchflaschen verschloss (Milch gab es ja lose), zu Hunderterrollen.
Und außerdem konnten meine Eltern einen Kleingarten von etwa 300 m² Größe pachten. Der sollte uns später nach dem Ausbomben und in der Nachkriegszeit von unschätzbarer Bedeutung werden. Eine kleine grüne Laube gab es da.
Kindheit in der Kriegszeit
1939 Kriegsausbruch. Die Nachricht konnten wir aus einem Detektor hören, einem radioähnlichen Gerät, wenn man sich ein richtiges Radio noch nicht leisten konnte. Später hatten wir einen Volksempfänger Marke „Goebbelsschnauze“. Aber den Ausdruck verwendeten wir natürlich damals nicht. Das wäre lebensgefährlich gewesen.
Und es gab Lebensmittelkarten (Fettkarten gelb). Mit der Zeit wurde alles und jedes rationiert, nur Salz nicht. Schon vorher war ein Kellerraum als Luftschutzkeller hergerichtet worden. Ein „asoziales“ Schwesternpaar, das dort im Keller hauste, musste einen Raum abgeben – unglaublich dreckig und verflöht. Die Kellerdecke wurde mit einem Stützbalken „armiert“. Die eine Schwester – sie hinkte, und deshalb nannten wir Kinder sie Hinkepinke – war „idiotisch“ und erschlug eines Tages ihre ältere Schwester mit einem Schürhaken (Feuerhaken). Was geschah mit der Täterin? „Die wurde abgeholt!“ Mir war eigentlich damals als Kind durchaus schon klar – mit der machte man „kurzen Prozess“. Unnütze Fresser.
Gleich in den ersten Kriegstagen jagten uns die Alarmsirenen aus dem Bett: Fliegeralarm. Meine Eltern waren so aufgeregt, dass sie mir meine Hausschuhe verkehrt anzogen – rechts auf links und umgekehrt. Und dann Volksgasmaske auf! Schrecklich. Erstens roch sie erbärmlich nach Gummi, und zweitens konnte man eigentlich nicht mal richtig atmen.
Meistens passierte ja nichts, jedenfalls nicht bei uns in Eimsbüttel. Die Luftabwehr allerdings ballerte mächtig. Eine größere Flak-Stellung hinter dem Eidelstedterweg (Sportplatz Tiefenstaken) sorgte dann bei uns für reichlich Granatsplitter, die wir Kinder nach der Entwarnung mit Begeisterung sammelten. Manchmal richtige Dubasse (= große Splitter) dabei mit scharfen Kanten.
Mein Vater war nicht wehrtauglich und deshalb als einer der wenigen Männer in unserem engeren Umfeld Luftschutzwart geworden. Als solcher durfte er auch bei Alarm bzw. vor Entwarnung auf die Straße. Manchmal fand er dabei Granatsplitter, bevor meine Konkurrenten auf die Straße gelangten. Auf diese Weise kam ich zu vielen besonders tollen Exemplaren.
Eigentlich war er in der NSV Buchhalter, hatte aber auch mit der Organi-sation der Kinderlandverschickung zu tun. Die war wohl noch nicht sehr populär, eben weil in Hamburg doch kaum etwas passierte. Schließlich siegten wir ja am laufenden Band. Ständig Sondermeldungen und anschließend, wenn der Sieg mal wieder besonders spektakulär war, Hakenkreuzflaggen überall. Nur im Luruper Weg wurde etwas spärlicher geflaggt. Kommunistengegend, wenngleich die Leute dort sich am meisten Hilfspakete vom WHW, dem Winterhilfswerk holten. Das Kriegsende, der Endsieg lag doch in greifbarer Nähe! 70.000 BRT feindlicher Schiffsraum versenkt, 90.000 BRT feindlicher Schiffsraum versenkt. Ha, was kriegte Churchill auf sein dreckiges Lügenmaul! Unsere U-Bootwaffe – dagegen konnte der nicht an! Und dann erst unsere Luftwaffe, die britische Städte geradezu ausradierte!
In der Kinderlandverschickung
Meine Eltern gingen „mit gutem Beispiel“ voran und meldeten mich zur Kinderlandverschickung. Damals, also 1940, ging es vielfach zu Familien im Hinterland. Bayern, Sachsen, Erzgebirge, alles Gegenden, in die nie, NIE ein feindliches Flugzeug gelangen würde! So kam ich im Oktober 1940 nach Kronach in Oberfranken, einem Städtchen mit 7.000 Einwohnern. „Pflegeeltern“ wurde ein Ehepaar in der sog. „Stadtrand-siedlung“, Hausnummer 15, heute Heinrich-Lersch-Straße. Bescheidene Zweifamilien-Doppelhäuschen.
Sonnabends seifte sich die ganze Familie in einer großen Emailschüssel ab, und sonntags wurde in derselben Schüssel der Kartoffelbrei für die üblichen Kartoffelklöße angerichtet! „Ärfelklüass“, Erdäpfelklöße, waren Standardessen. Dienstags, donnerstags und sonntags aß fast ganz Kronach Kartoffelklöße – zwei Drittel gekochte und ein Drittel rohe geriebene Kartoffeln, geröstete Weißbrotwürfel als Füllung. Das war für mich als Hamburger natürlich ungenießbares exotisches Essen, bis ich eines Tages feststellte, dass die doch richtig gut schmeckten. Als meine Mutter mich mal besuchte, war es das erste, dass ich ihr das mitteilte: „Du musst unbedingt Klöße essen!“ Klöße waren später nach dem Krieg Festessen bei meinen Eltern, und auch meine aus Schweden stammende Frau konnte sich damit bestens anfreunden.
Als ich zum ersten Mal zur Schule kam, fragte mich der Lehrer – Kronach lag in einem religiösen Grenzgebiet: Richtung Thüringen evangelisch, Richtung Süden katholisch - , ob ich evangelisch oder katholisch sei. Keine Ahnung. Das war ja in Hamburg gar kein Thema. „Ich bin deutsch“ soll ich laut Familiensage geantwortet haben.
Wieder in Hamburg bei den Eltern
Ich erinnere mich, dass ich sechs Monate in der KLV bleiben sollte, aber höchstens bis Kriegsende. Es wurden elf Monate, und der Krieg war noch lange nicht beendet. Als ich wieder in Hamburg war, hatten meine Eltern Probleme, mich zu verstehen, denn ich sprach Kronacher Dialekt.
In den alten Luftschutzkeller gingen wir nicht mehr, es gab inzwischen einen Röhrenbunker. Zwei Röhren und für einen ganzen Häuserblock gedacht. Ich schätze für ein Dutzend Häuser. Es roch nach Kalk. Den Geruch habe ich noch heute in der Nase.
Eigentlich eine nicht sehr aufregende Zeit. An allen Fronten siegten wir weiterhin, es sei denn, die Truppen wurden „zur Verkürzung der Front planmäßig“ zurückgenommen. In der Schule hatte mein Klassenlehrer Rempage mich beauftragt, eine Art Kriegstagebuch zu führen. Alle wichtigen Zeitungsausschnitte wurden in eine Kladde geklebt. Siege, Ritterkreuzträger, U-Boot-Helden und Jägerasse. In unserer Wohnung hing endlich auch ein Hitler-Bild im Flur. Allerdings nur im Postkarten-format.