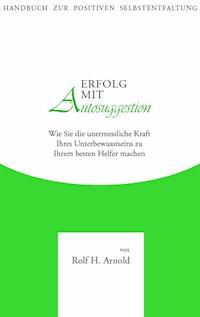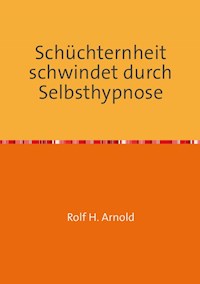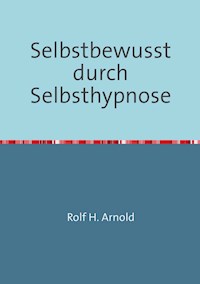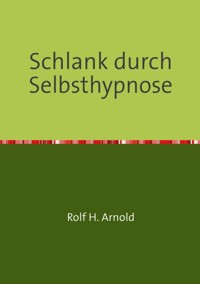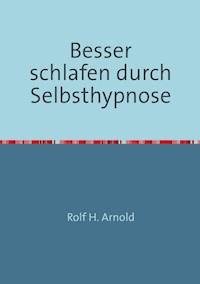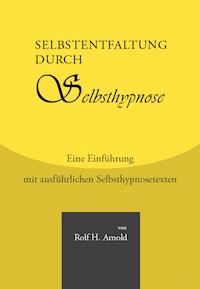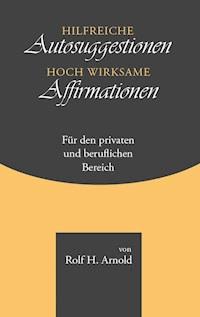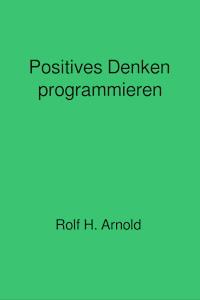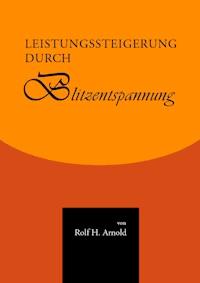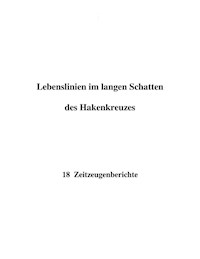Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Zunächst erzählt der Autor von seiner Kindheit in Hamburg vor dem Krieg, dann vom Krieg mit seinen Aktivitäten als Pimpf in der Hitlerjugend, von dem mehrtägigen Luftangriff auf Hamburg, der Kinderlandverschickung zu Pateneltern in die sichere Provinz und dann nach Schließung und Evakuierung der Hamburger Schulen vom Leben im Klassenverband in einem KLV-Lager in Gößweinstein in Bayern und als dieser Ort in die Frontbereich geriet, von dem neuen KLV-Lager in Kellenhusen an der Ostsee. Er schildert die Flucht der Lagerleitung und des Küchenpersonals aus dem Lager gegen Kriegsende und der daraus resultierenden Hungersnot der Schüler bis zu ihrer abenteuerlichen Rückkehr in die "Festung Hamburg" und nach deren bedingungsloser Kapitulation den Einmarsch der Engländer in die Stadt, die Verhaftung seines Vaters und dann das Chaos der schlimmen ersten Nachkriegsjahre mit Trümmerbeseitigung, unvorstellbarer Wohnungsnot, quälender Hungersnot mit völlig unzureichenden Lebensmittelkarten, Schulspeisung, Hamstern und Schwarzmarkt mit der Zigarette als Ersatzwährung, die bitter kalten Winter mit Frieren, Bäumefällen und Kohlenklau und schließlich die Rettung der Familie durch Verwandte in den USA mit CARE-Paketen und getragener Kleidung. Er beschreibt auch den problematischen Schulalltag in zerstörten Schulen mit Lehrermangel, fehlenden Lehrmitteln und Schulheften. Die Schilderungen werden unterstützt durch Tagebuchaufzeichnungen des Autors. Das 340seitige Buch verfügt über einen Anhang mit einem sehr umfangreichen Literaturverzeichnis, einem ausführlichen Glossar. sowie einer Zeitschiene.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
63
Meine Jugend im III. Reich
und im Chaos der Nachkriegszeit
Bericht eines Zeitzeugen des Jahrgangs 1932
von
Rolf H. Arnold
Arnold, Rolf H. Meine Jugend im III. Reich und im Chaos der Nachkriegszeit Bericht eines Zeitzeugen des Jahrgangs 1932 Druck und Verlag: epubli GmbH, Berlin www.epubli.deCopyright © 2012 Rolf H. Arnold Alle Rechte vorbehalten
Diese Aufzeichnungen erfolgten auf Anregung
meiner Cousine Eleanor Nielson und ihrer Tochter Susan Goldstein, New York, die mich motiviert haben, „alles einmal aufzuschreiben“.
Ich widme diesen Bericht meiner Enkelin
Emily Arnold.
Ich möchte, dass sie später einmal lesen kann,
unter welch ungewöhnlichen Verhältnissen
Inhaltsverzeichnis
Seite
Vorwort 9
Herkunft
Die Wurzeln laut Ahnenpass 10
Die dänische Komponente 14
Die Nachkommen der Familie Schmidt in den USA 17
Die Nachkommen der Familie Arnold in den USA 19
Ein Großvater, der auf der Walz in Hamburg blieb 34
Eine Dänin als Großmutter väterlicherseits 38
Wenden als Großeltern mütterlicherseits 42
Aus dem 1. Weltkrieg nichts gelernt 56
Sonstige Verwandtschaft
Onkel Artur auf der Yacht „Hohenzollern“ des Kaisers II. 58
Onkel Otto in Norwegen „auf der Flucht erschossen“ 63
Onkel Harald, ein Däne als Patenonkel 69
Tante Else und Onkel Franz - ein ungleiches Paar 72
Kindheit
Die ersten 7 Kinderjahre im Hamburger Stadtteil Horn 77
Sommerfrische in der Laubenkolonie im Horner Moor 87
Der erste Kontakt zu einem SA-Mann 90
Im Fangnetz der neuen Straßenbahn 93
Durch den Umzug nach Harvestehude den Krieg überlebt 95
Jugend im Krieg
Mit Adressschild auf der Brust mit 8 Jahren in die Fremde 99
Bei Tante Olga im mittelalterlichen Duderstadt 103
Duderstadt nach dem Krieg im Zonenrandgebiet 113
Ein halbes Jahr bei Pflegeeltern in Kopenhagen 118
Mit 10 Jahren voller Stolz als Pimpf zum Jungvolk 124
Mit viel Glück die Luftangriffe auf Hamburg überlebt 132
Ein hoffnungsloser Brief meines Vaters vom 15. 9. 1943 146
Im Kinderlandverschickungslager in Gößweinstein 152
Das Kriegsende glücklich überlebt
Noch Mitte März 1945 in ein neues Lager an der Ostsee 205
Zurück in das zur Festung erklärte Hamburg 208
3. Mai 1945 – Hamburg kapituliert bedingungslos 209
Wie ich den Einmarsch der Engländer in Hamburg erlebte 209
Die Verhaftung meines Vaters durch die Engländer 212
Die Stunde Null – der totale Zusammenbruch des Staates 214
Opferzahlen des Krieges 217
Kriegskinder 219
Pubertät im Chaos der Nachkriegszeit
Unvorstellbar große Wohnungsnot 221
Trümmerbeseitigung 224
Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes 229
Die große Hungersnot in den Städten 231
Lebensmittelkarten 232
Die Schulspeisung 238
Größter Mangel an Kleidung und Schuhen 240
Schwarzer Markt mit der Zigarette als Ersatzwährung 246
Mit 14 Jahren an der Schwelle zum Millionär 250
Das „Hamstern“ der hungernden Stadtbevölkerung 253
Chaotischer Zugverkehr 259
Kohlenklau und andere Vergehen in schlimmen Zeiten 262
Verwundete Soldaten prägten das Stadtbild 271
Heimkehrer aus russischer Kriegsgefangenschaft 271
Schulunterricht vor großen Problemen 274
Unsere Rettung kam aus Amerika: CARE-Pakete 278
Das Elend der Flüchtlinge und Heimatvertriebenen 283
Die Abschulung wird empfohlen – ein Schock 285
Die Währungsreform beendete die allgemeine Not 291
Die Blockade Berlins durch die Sowjetunion 294
Mit sechzehn Jahren unter 130 hübschen Mädchen 297
Attraktives Angebot: Karriere und Einheirat 310
In der Nordseebrandung an der Grenze des Lebens 311
Unterricht in den Dünen von Wenningstedt/Sylt 317
Das „Arbeitergymnasium“ mit eigenem Ruderklub 324
Erich, der Löwe, als erster Steuermann 326
Eine Seefahrt ist nicht immer lustig 330
Es war in Urach – Eleanora hieß sie – ich war 18 335
Unsere letzte Klassenreise 347
Unsere Lehrer 349
Die Qual der Berufswahl 355
Danksagung 361
Literaturhinweise 362
Glossar 370
Zeitschiene 392
Ceterum Censeo:
Plädoyer für eine modernisierte Friedhofskultur 403
Vorwort
Diesen Bericht habe ich nach bestem Wissen und Gewissen so geschrieben, wie ich die Dinge erlebte und sie erinnere. Das schließt nicht aus, dass das eine oder andere auch Aspekte hat, die mir nicht bekannt waren oder an die ich mich nicht erinnere. Diese Schrift ist also durchaus subjektiv, dessen bin ich mir bewusst.
Ich möchte meiner Enkelin Emily und mit ihr anderen jungen Menschen von einer Zeit erzählen, die es heute hier glücklicherweise so nicht mehr gibt. Auch diese jungen Menschen haben in unserer Zeit mit vielen Problemen zu kämpfen, aber generell sicherlich nicht in der existentiell bedrohlichen Form, wie es damals insbesondere bei der städtischen Bevölkerung in Deutschland die Regel war. Vielleicht hilft es ihnen, ihre Probleme zu relativieren und somit leichter zu tragen, wenn sie von den lebensbedrohenden Herausforderungen lesen, die die Jugendlichen aus den Städten in den Kriegs- und Nachkriegsjahren des Zweiten Weltkrieges zu bewältigen hatten.
Mit meiner Geschichte beschreibe ich die Zeit, die ich erlebt habe, in der es uns in Deutschland mit Bombenkrieg in den Städten, Flüchtlingselend, Vertreibung und in den ersten drei Jahren nach dem Krieg mit Hunger, Not und Elend sehr schlecht ging. Deshalb ist es mir wichtig, vorab zu betonen, dass ich nicht aus dem Auge verliere, dass dies alles geschah, nachdem die Deutschen eine Partei in die Regierung gewählt hatten, die Judenverfolgung zum Regierungs-programm erhob und bereits Jahre vor dem Kriege eine Reihe gesetzesbrecherischer Maßnahmen zu verantworten hatte. Was ich beschreibe, ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass die deutsche Reichsregierung vorher in blutigen Angriffskriegen Nachbarvölker unterjocht hatte und in Konzentrationslagern systematisch grauenvolle Untaten beging, die alle vorstellbaren Dimensionen sprengten.
Rolf H. Arnold im September 2012
Herkunft
Die Wurzeln gemäß Ahnenpass
Im April 1933 erließ die Reichsregierung das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“, gemäß dem alle Beamten einen Ahnenpass erstellen mussten. Auch mein Vater hatte daher, als er 1937 Beamter wurde, den Nachweis zu erbringen, dass er „arischer“ Abstammung“ war und sein „Blut“ – gemeint waren wohl die Gene – von „artfremden Einflüssen rein“ geblieben war.
Dieses Gesetz bot den nationalsozialistischen Machthabern die Möglichkeit, politische Gegner und insbesondere jüdische Beamte aus dem Dienst zu entfernen. Beamte, die ihre arische Abstammung nicht nachweisen konnten, weil sie etwa einen jüdischen Großelternteil im Stammbaum hatten, konnten entlassen oder in den Ruhestand versetzt werden. Ausnahmeregelungen gab es auf Intervention von Hinden-burg zunächst noch für „Frontkämpfer“ und für Beamte, deren Vater oder Sohn im Ersten Weltkrieg als Soldat gefallen waren, sowie für diejenigen, die vor 1914 verbeamtet wurden. Mit der „Ersten Verordnung zum Reichsbürgergesetz“ vom November 1935 wurden jedoch auch diese Ausnahmeregelungen beseitigt. Alle noch verbliebenen jüdischen Beamten mussten aus dem Dienst ausscheiden. Der Beamtenstatus blieb „Deutschblütigen“ vorbehalten.
Die drei Nürnberger Gesetzevom September 1935 verlangten dann von jedem Bürger des Deutschen Reiches einen „Ariernachweis“, um die neugeschaffene Reichsbürgerschaft erwerben zu können, die nur „Deutschblütigen“ offen stand. Mit diesem „Reichsbürgergesetz“ wurden den Juden alle noch verbliebenen Bürgerrechte genommen, denn ein Jude konnte nach diesem Gesetz kein Reichsbürger sein. Eines der Nürnberger Gesetze, das „Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre“ verbot Eheschließungenzwischen Juden und „deutschblütigen“ Reichsangehörigen. Für Zuwiderhandlungen, als „Rassenschande“ bezeichnet, wurde Zucht-hausbestrafung angedroht.
In der 45-seitigen Einleitung zum Ahnenpass wird ausführlich auf die vorgenannten Gesetze Bezug genommen und darauf verwiesen, dass die Bestimmungen des Reichserbhofgesetzes noch darüber hinaus gingen und für die Aufnahme in die NSDAP und die SS eine „reinarische Abstammung“ erforderlich sei, „die also frei von jeder fremden (z.B. jüdischen oder negerischen) Blutsbeimischung“ ist. Diese reinarische Herkunft musste bis zum 1. 1. 1800 zurück nachgewiesen werden, und zwar auch für den Ehegatten.
In der Einleitung zum Ahnenpass heißt es unter der Überschrift „Rassegrundsatz“: „Die im nationalsozialistischen Denken verwur-zelte Auffassung, daß es oberste Pflicht eines Volkes ist, seine Rasse, sein Blut von fremden Einflüssen rein zu halten und die in den Volkskörper eingedrungenen fremden Blutseinschläge wieder auszu-merzen, gründet sich auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Erblehre und Rassenforschung.“
Man mag es nicht glauben! Die gewählte Führungsschicht eines sogenannten Volkes der Dichter und Denker, das Menschen wie Beethoven, Goethe und die Gebrüder Alexander und Wilhelm von Humboldt hervorbrachte, erlässt offiziell Rassengesetze, die Juden – die in vielen Bereichen zu den kulturellen Leistungsträgern der Nation zählten – aus der Gesellschaft aussondern, als „Volksschädlinge“ mit „artfremdem Blut“ diffamieren, alle durch die Verfassung garantierten Bürgerrechte nehmen. Die Regierung entkleidet die Juden dann auch noch ihrer Menschenwürde, um sie schließlich zu Millionen fabrikmäßig wie Ungeziefer mit Gift zu vernichten – unfassbar, nicht nachvollziehbar!
Bei der Betrachtung meiner Vorfahren mütterlicher- und väterlicher-seits, die bis um 1800 nachgewiesen sind, handelt es sich durchgängig um ortsfeste Bauern. Die Arnolds lebten in den überschaubaren 200 Jahren in dem Dorf Weinsheim bei Kreuznach an der Nahe als Weinbauern, die Templins in dem Dorf Finkenthal bei Gnoien in Mecklenburg als Ackerbauern. Die meisten der in meinem Ahnenpass aufgeführten Männer und Frauen der beiden Generationen im 19. Jahrhundert hatten zumeist nur eine Lebensspanne von 40 bis 55 Jahren.
Auffällig ist, dass die Kaiserzeit in der Namensgebung der Vornamen deutliche Spuren hinterlassen hat. Sowohl mein Vater, wie auch meine beiden Großväter hießen Wilhelm, die Urgroßmutter mütterlicherseits sogar Wilhelmine. Ein Adolf oder eine Adolfine finden sich glücklicherweise nicht unter den Sprösslingen nach 1930.
Bei der Durchsicht meines Ahnenpasses ist mir deutlich geworden, welch umfangreicher Gen-Cocktail in nur fünf Generationen durch die Familien der jeweiligen Ehefrauen zustande gekommen ist. Das sind in fünf Generationen schon etwa 30 Familien. Aber wie unendlich viele Ahnen waren es vorher, die ihre Anteile zum Gen-Pool beigesteuert haben? Müssen wir doch genau genommen bis zum Bereich der Menschwerdung zurückgehen. Wie unfassbar viel Erbmaterial ist in uns eingeflossen, macht uns so einzigartig? Gemäß meinem Stammbaum haben zu mir sicherlich ein römischer Legionär, ein Wikinger und möglicherweise ein Hunne beigetragen, werden mir doch in diesem sehr überschaubaren Zeitraum schon Dänen, Slaven und offenbar auch Franzosen zugesprochen.
So lässt schon die Betrachtung meiner direkten Vorfahren eine gewisse Vielfalt erkennen. Wenn ich jedoch auch die Nachkommen der Brüder und Schwestern meiner vier Großeltern in Betracht ziehe, dann erweitert sich das Bild außerordentlich. Sie sind bereits für bisher 35 US-amerikanische Abkömmlinge verantwortlich.
Durch die Globalisierung wird eine Vermischung ohne Grenzen immer leichter. Der Enkel meiner Tante in Princeton, New Jersey, hat mit seiner japanischen Frau ein Kind bekommen. Als jahrgangsbester Jura-Diplomand hatte er ein zweisemestriges US-Stipendium für Tokio erhalten. Die Zeit reichte aus, die Tochter seines Professors kennen und lieben zu lernen.
Welch eine Gnade, als Produkt einer gewaltigen Ahnenkette leben zu dürfen! Noch dazu auf diesem so wunderbaren Stern, der unter den Milliarden von Milliarden Himmelskörpern so einzigartig ist, und den wir dennoch aus Habgier und Dummheit möglicherweise weitgehend unbewohnbar machen werden.
Die dänische Komponente
Durch meine Großmutter väter-licherseits, Henriette C. Schmidt, geb. 1866 in Sonderborg, Dänemark, ist in meinen Gencocktail auch ein Gutteil dänischer Beigabe eingeflossen, die sich zurückverfolgen lässt bis 1784. Meine Cousine Ellie aus New York hat sich bei der Verfolgung dieser Linie sehr verdient gemacht. So hat sie einige unserer gemeinsamen dänischen Vorfahren aus dem Dunkel der Vergangenheit in unser Bewusstsein gehoben, und zwar bis zu Andreas Clausen (1784 - 1829) und seiner Frau Sille Margarethe Andersdatter (1791 - 1854). Wenn sie weiter nachgeforscht hätte, wäre sie vermutlich auf Wikinger als Vorfahren gestoßen.
Andreas Clausen wurde in Faustrup, Tyrstrup, 1784 als Sohn des Schmiedes Claus Mikkelsen und dessen Frau Catharine Knudsdatter. geboren. Er war Bauer und Schmied in Odis und verheiratet mit Sille Margarethe Andersdatter aus Stougaard, Dybbol – Island of Als, geboren 1791 als Tochter des Bauern Anders Nissen und dessen Frau Maren Christiansdatter.
Die Geschwister der Familie Schmidt aus Sonderburg, Dänemark.
Von links nach rechts:
Henriette, heiratete Wilhelm Arnold in Hamburg.
Christian, heiratete und lebte in Elmira, NY.
Harald Schmidt, heiratete
Charlotte Bruhn (Tante Lottchen) in Hamburg.
Dora, heiratete Hugo Klapproth und lebte in New Haven, Connecticut.
Großmutter Henriette Christine Bernhardine Schmidt heiratete am 14. 10. 1891 Großvater Wilhelm Arnold
Henriette ca. 1869 mit ihrer MutterHenriettes Vater
Anne Marie Delf und ihrem Vater Claus Clausen Schmidt
Dora Schmidt heiratete 1898 Hugo Klapproth
Sie lebten in New Haven, Connecticut, und waren die Anlaufstelle für die Auswanderung von Dora und Erna Arnold.
Ehepaar Klapproth mit Margarethe Schmidt, der Tochter von Doras Bruder Christian. Sie lebte in Elmira, New York.
Die Nachkommen der Familie Schmidt in den USA
Von den Geschwistern meiner Großmutter, Henriette Arnold, geborene Schmidt, wanderten ihre Schwestern Dora und Christina sowie ihr Bruder Christian in die USA aus. Ihr Bruder Harald und sie selber, Henriette, wanderten nach Deutschland, Hamburg, aus.
Christian SCHMIDT,geb.1856, gest. 21. 3. 1925 in Elmira, NY, heiratete Anna DYNA, geb. 15. 5. 1854 in Bogense, Odense, Dänemark, gest. 25. 5. 1925 in Elmira, NY.
IhrSohnChristian Schmidt JR., geb.1887, gest. 12. 11. 1916 in Gary, Indiana.
IhreTochterMargarethe Schmidt wurde1890, geboren und starb am 29. 1. 1962 in Elmira, NY.
Dora Schmidt,geb. 1873, gest. 6. 10.1951 in Philadelphia, Pennsylvania,.heiratete 1898 Hugo Klaproth aus Lüneburg, gest. 6. 7. 1948 in New Haven, Connecticut.
Sie war bereits mit Hugo Klaproth verheiratet, als sie im Alter von 50 Jahren am 11. September 1923 mit der S. S. „Mongolia“ von Hamburg nach New Haven kam. Ihr Mann wohnte bereits dort in New Haven, Connecticut. Gemäß Einwanderungspapier von Ellis Island war sie bereits im März 1919 durch Heirat US-Bürgerin geworden.
Christina Schmidt,gest. in Westville, Connecticut, verheiratet mit Emil Engel, der mit 24 Jahren 1904 mit der S. S. „Deutschland“ von Hamburg nach New York „segelte“. Im Schiffspapier wird sein Beruf mit Schneider angegeben. Es wird darin ferner festgestellt, dass er die Passage selbst bezahlte, noch über 30 Dollar verfügte, aber keinenFahrschein für die Fahrt zum Bestimmungsort besaß.
Harold Christian Schmidt,geb. 14. 2. 1896 in Hamburg, gest. Juli 1970 in Oak Park, Illinois, war der Sohn von Harald Schmidt, gest. 1945 in Schnackenburg an der Elbe, Niedersachsen, und Charlotte Bruhn (Tante Lottchen), geb.7. 11. 1868, gest. 1954 in Schnackenburg an der Elbe.
Harold Schmidt kam im Alter von 17 Jahren am 24. April 1913 mit der S. S. „Barbarossa“ von Bremen nach New York. In den Einwande-rungspapieren wird seine Barschaft mit 25 Dollars angegeben und als Ziel für die Weiterreise die Adresse seines Onkels Christian Schmidt, Elmira, NY. Das Formular verweist darauf, dass die Fahrkarte für die Weiterfahrt vorhanden war. Es enthält übrigens auch den Hinweis, dass er lesen und schreiben konnte. Das war damals bei den Einwanderern wohl noch nicht so ganz selbstverständlich. Das Formular des „States Immigration Officer at Port of Arrival“ fragte übrigens auch ab, ob der Einwanderer ein Polygamist oder ein Anarchist war.
Harold Schmidt lebte in Chicago und stellte dort als 40-Jähriger am 13. 2. 1937 als Arbeitsloser einen Antrag auf Sozialhilfe. Er war verheiratet mit einer unbekannten Frau.
Sein Sohn Harold E. Schmidt ist 1944 über Deutschland durch Abschuss seines US-Bombenflugzeugs umgekommen.
Harold Schmidt war dann mit einer weiteren unbekannten Frau verheiratet, von der nur ihr Vorname Molly bekannt ist. Aus dieser Ehe entstammt dieTochter Margareth (Margie) Schmidt, die1943 geboren wurde.
Die Nachkommen der Familie Arnold in den USA
Wenn man sich die beiden Stammbäume der Nachkommen der Familie Arnold und der Familie Schmidt in den USA ansieht, kann man den Eindruck gewinnen, dass beide Familien nicht unwesentlich zur Besiedlung der Ostküste der Vereinigten Staaten von Amerika beigetragen haben. Bei einer Auszählung sind es dann doch nicht ganz so viele, aber immerhin haben wir nach jetzigem Stand 37 Blutsverwandte in den USA. Die Zahl kann sich jedoch aufgrund der erheblichen Anzahl von Enkeln und Urenkeln während des Schreibens dieses Buches durchaus schon wieder erhöht haben.
Von der Familie Arnold sind drei Schwestern meines Vaters in die USA ausgewandert:
Dora Arnold,geb. am 29. 3. 1898 in Hamburg, gestorben am 6. 3. 1986 in New York. Sie war die Älteste der drei ausgewanderten Schwestern meines Vaters und „sailed“ als erste am 12. 1. 1924 mit 25 Jahren mit der S. S. „Thuringia“ von Hamburg nach New York. Grund für die Auswanderung wird die katastrophale, hoffnungslose wirtschaftliche Lage mit extrem hoher Arbeitslosigkeit in Deutschland gewesen sein, vor der sich leuchtend das gelobte Land der unbegrenzten Möglichkeiten abhob.
Der Sprung ins Ungewisse war für sie abgefedert, da ihre Tante Dora Schmidt, die Schwester ihrer Mutter, sie zunächst aufnahm. Diese war mit ihrem Mann Hugo Klapproth bereits nach New Haven, Connecticut, ausgewandert.
Dora Arnold scheint nicht das Einverständnis ihrer Eltern für die Auswanderung gehabt zu haben, denn als Heimatadresse gab sie bei der Einwanderungsbehörde nicht die ihrer Eltern an, sondern die ihres Onkels Harald Schmidt, Hamburg, Conventstraße 2, dessen Sohn schon 1913 als 17-Jähriger auswandern musste, da er als Lehrling „iin die Kasse gegriffen“ hatte, wie es hieß. Möglicherweise hat ihr Onkel die Überfahrt bezahlt. In dem Einwanderungspapier heißt es nur, der Onkel habe die Kosten der Passage übernommen, wobei offen bleibt, ob damit ihr Onkel Harald Schmidt in der Heimatadresse gemeint war oder der ebenfalls als Onkel bezeichnete Hugo Klapproth in der Zieladresse, der Mann ihrer Tante Dora.
Die Einwanderungspapiere weisen Dora als „house maid“ aus und halten fest, dass sie 55 Dollar aber keinen Fahrschein für die Weiterfahrt zum Bestimmungsort besaß.
Unsere Tante Dora heiratete John Baptist Miller, geb. 1. 11. 1898, gest. 1972.
Ihre Tochter Charlotte Margaret Millerwurde am 28. 11. 1926 geboren.
Ihr Sohn John Arnold Millerwurde am 12. 8. 1944 geboren. Er heiratete Monica Foster, geb. 23. 11. 1944, gest. 1997.
Ihr Enkelsohn Saari Daun Miller,geb. 29. 9. 1969, heiratete im Januar 1998 Joel Lynch.
Erna Arnold,geb. am 3. 6. 1899 in Hamburg, die Zweitälteste der ausgewanderten drei Schwestern meines Vaters. Sie fuhr mit 27 Jahren am 27. Dezember 1926 zunächst von Hamburg nach Southampton und von dort am 10. 1. 1927 mit dem Schiff S.S. „Lappland“ nach New York. Auch sie ging wie ihre Schwester Dora zunächst zur Tante Dora Klapproth nach New Haven, Connecticut. Im Einwanderungspapier wird als Berufsbezeichnung „Servant“ angegeben. Es wurde ferner in dem Papier festgehalten, dass die Überfahrt von der Tante in New Haven bezahlt wurde.
Zu Tante Erna hatte meine Mutter immer ein besonders enges Verhältnis, sie schrieben sich regelmäßig Briefe. Das war auch gut zu verstehen, denn Tante Erna war im Gegensatz zu ihrer Schwester Grete unkompliziert, unprätentiös und liebenswürdig. Sie besuchte uns zweimal in Hamburg.
Sie heiratete im Alter von 28 Jahren am 2. 6. 1927 in New York den ebenfalls 28-jährigen Karl (Charles) Anton Hamel, geb. am 23. 1. 1899 in Sandweier, heute Stadtteil von Baden-Baden.
Charles war gelernter Koch und besaß in New York 28 das „Central Restaurant – Known For Excellent Food“ in der 1642 Second Avenue Bet 85th & 86th Sts., in dem Erna mitarbeitete. Das Restaurant musste aufgegeben werden, als eine Bank in den Räumen eine Filiale einrichtete. Später arbeitete Tante Erna bis ins hohe Alter im Kaufhaus Gimbels in New York City.
Charles verstarb am 5. 3. 1967 in Bronx, NY. Erna starb mit 96 Jahren am 2. 2. 1996 in Albany, NY.
Ihre Tochter Eleanor (Ellie) Joan Hamel,geboren am 4.2. 1938 in New York, heiratete am 3.3. 1962 Ronald Peter Nielsen, geb. am 23. 2. 1935 in New York.
Cousine Ellie hat uns zweimal in Deutschland besucht, in Hamburg und in Wiesbaden. Wir haben sie als sehr liebenswürdig, intelligent und lebensklug kennen gelernt. Wir hatten zusammen schöne Tage, was auch dadurch begünstigt wurde, dass sie sehr gut Deutsch spricht. Auch die lebhafte Korrespondenz wurde erst möglich, da sie auch sehr gut Deutsch schreibt. Sie hat sich das alles selbst erarbeitet. Das lässt ihre hartnäckige Zielstrebigkeit deutlich werden. Sie hat mir dankens-werterweise die von ihr erarbeiteten Daten zu unseren Verwandten in den USA und Dänemark zur Verfügung gestellt.
Familie Hamel
Erna, Charles (Carl) und Kurt Hamel im Jahre 1932
Kurt Hamel war Berufssoldat
Als 22-Jähriger ging er 1950 in einer der ersten Angriffswellen der US-Interventionstruppen in Südkorea an Land, wurde verwundet und schwer traumatisiert. . .
Ellies Tochter Susan Valerie Nielsen,geb am 21.12 1962 in New York, heiratete am 1.7. 1989 Thomas Eugene Perino, geb. am 23. 12. 1960 in East Islip, NY.
Am 9. 4. 2000 heiratete Susan erneut, und zwar Michael Herbert Goldstein, geb. 30. 10. 1956. Er ist der Sohn von Solomon Goldstein und Constance Borrok.
Susan haben wir kennengelernt, als sie uns mit ihren Eltern besuchte. Sie ist eine bewundernswert tüchtige Frau, die trotz einer qualifi-zierten Volltagstätigkeit im Personalmanagement einer Bank gleich-zeitig zwei minderjährige Söhne großzieht und den Haushalt in ihrem Haus in Huntington, N.Y führt.
Eleanor (Ellie) Nielsen, Ronald (Ron) Nielsen
und Tante Erna (Hamel)
Susan und Michael haben die Söhne Gregory Scott, geb. am 15. 3. in Huntington, NY., undDavid Craig,geb. am 17. 7. 2006 in Huntington, NY.
Ellies Sohn Douglas John Nielsen,geb. am 11. 2. 1969 in Coblesskill, NY. ist Rechtsanwalt und noch unverheiratet.
Ellies Bruder Kurt Harold Hamel,geb. am 27.1. 1932 in New York, heiratete am 8.3. 1952 Virginia Faye Rodgers, geb. am 31. 7. 1933 in Stoney Point, NY.
Besuch in Wiesbaden im Mai 2001: Elke, Frauke, Susan und Ellie
Ellie, Ron, Gregory, Susan, David und Michael
Sein Sohn Kent Scotty Hamel,geb. 5.12. 1964, heiratete am 28. 9. 1991 in San Antonio, Texas, Priscilla Alonzo Cantu, geb. 16.6. 1965.
Seine Enkelin Korey Louisa Hamel wurde am 9. 6. 1993 geboren, seine Enkelin Nicole Lee Hamel am 16. 4. 1995.
Seine Enkeltochter Karen Ann Hamel,geb. 27.10. 1956 in Topeka, Kansas, heiratete am 16. 9. 1977 in San Antonio, Texas, Larry Joseph Voelkel.
Deren Tochter Lauren Rae Voelkel, wurde am 15. 8. 1987 geboren.
Margareth Arnold, geb. 30. 8. 1905 in Hamburg, verstorben am 1. 4. 1981 in New Jersey. Sie war die jüngste der Schwestern meines Vaters und ging als Dritte 1928 mit 22 Jahren in die USA. Ihre Schwester Erna und deren Mann Charles hatten Geld gespart und ihrem Vater ein Ticket geschickt, damit er sie besuchen könne. Da dieser sich dazu nicht in der Lage oder Willens sah, hat er die Passage seinem Sohn, meinen Vater, zur Auswanderung angeboten. Der aber zeigte sich nicht interessiert, denn er hatte in Bonn bei der Post eine feste Anstellung und war gerade frisch verliebt. So bekam seine Schwester Margareth das Ticket für die Ausreise in die USA. Nach ihrer Ankunft in New York wohnte sie zunächst bei ihrer Schwester Erna und deren Mann, bis sie eine Anstellung als Kindermädchen fand. Am 6. 9. 1932 heiratete sie Lawrence Jacobs, geb. am 15. 3. 1900 in Armenien, verstorben am 13. 5. 1991 in New Jersey.
Tante Gretel war eine sehr dominante, durchsetzungsfähige und manchmal etwas schwierige Frau. Sie hat uns mit ihrer Familie einige Male in Berlin und Hamburg besucht. Mit ihrem Mann Larry hat sie auch eine Europareise gemacht, diese aber unter Verzicht auf die skandinavischen Länder in „dem schmutzigen Amsterdam“ abgebro-chen.
Onkel Larry und Tante Gretel
Ihr Mann Larry war Unternehmer. Er betrieb zusammen mit einem Partner eine Gummifabrik, in der u.a. das Gummi für die Mercury-Kapsel hergestellt wurde, die im ersten bemannten Raumfahrtpro-gramm der USA von 1958 bis 1963 verwendet wurde, um einen Menschen im Orbit um die Erde fliegen zu lassen.
Larry war eine Seele von Mensch. Ich hatte den Vorzug jahrelang mit ihm korrespondieren zu können. Er war eine große, reife Persönlichkeit, und Tante Gretel wird schon Recht gehabt haben, wenn sie sagte, dass er bei den Freimaurern in New York die Stellung „gleich hinter dem Präsidenten“ einnahm.
Ihre Tochter Harriet Joan Jacobs,geb. 9.3. 1935 in New York, gestorben 25. 9. 2003 in Princeton, New Jersey.Sie heiratete am 6.4. 1957 in New York den Chemiker Arthur Lyding.
Onkel Larry
Ihr Enkel Christopher Scott Lyding,geb. 11. 2. 1960, heiratete am 31. 8. 1985 in Princeton, New Jersey, die Japanerin Taiko Konno.Ihr Sohn Charles Lyding wurde imSeptember 1997 geboren.
Als ich in den 90er Jahren beim Besuch meiner Cousine Ellie aus New York einmal feststellte, dass es der jüngsten, sehr gut aussehenden Schwester Gretel meines Vaters von seinen drei Schwestern in den USA am besten ergangen sei, da sie einen Millionär geheiratet habe, wurde ich von ihr feinsinnig korrigiert: Gretel habe ihn nicht als Millionär geheiratet, aber sie habe das Potential gesehen.
Onkel Larry und Tante Gretel vor ihrem Haus und Auto
Onkel Larrys Haus in New Jersey
Ingrid, Harriet-Joan, Tante Gretel und mein Vater
Arthur, Harriett-Joan und Christopher Lyding
Arthur und Harriet-Joan mit ihrem Enkel Charles
Christopher Lyding 1978
Ein Großvater, der auf der Walz
in Hamburg hängen blieb
Mein Großvater väterlicherseits, geboren am 15. 5. 1862, war Schneidermeister in Hamburg-Harvestehude. Seine Werkstatt und seine Wohnung lagen in der Hochallee Nr. 27, und zwar im Souterrain. Das war ein Problem für seine fünf Kinder und insbesondere für meinen Vater, denn sie fühlten sich als „Kellerkinder“ ausgegrenzt von den wohlhabenden Mietern ihrer Nachbarschaft. Es kam noch erschwerend hinzu, dass mein Großvater als Uniform-schneider hauptsächlich Berufsoffiziere des kaiserlichen Heeres als Kunden hatte, die ihn oft buchstäblich von oben herab behandelten, wenn sie auf seinem Schnei-dertisch arrogant herumspazierten und meistens am Fall der Hosen etwas auszusetzen hatten. Das verärgerte meinen zum Jähzorn neigenden Großvater oft, der dann seinen Frust aus kleinstem Anlass an meinem Vater ausließ und ihn manches Mal, mit der großen Schneiderbürste nach ihm schlagend, um den Schneidertisch trieb.
Mein Vater, geboren am 23. 11. 1902, hatte es auch sonst nicht leicht in dieser Familie. Während seine vier Schwestern die Schule regelmäßig besuchen konnten, eine von ihnen sogar die Oberschule, musste mein Vater als Hilfskraft in der Schneiderei aushelfen. Er war oft gezwungen, die Schule zu schwänzen, um für seinen Vater Pakete mit den fertigen Schneiderprodukten auszutragen. So war ihm eine höhere Schulbildung verwehrt, was er Zeit seines Lebens nicht verwunden hat. Das war auch der Grund, warum er später sehr darauf achtete, dass mir eine gute Schulbildung ermöglicht wurde. Er sparte sich und seiner Familie das Schulgeld für mich und die Mittel für die Schulbücher sowie für die Klassenreisen buchstäblich vom Munde ab und achtete sehr darauf, dass ich durch Zeitungsaustragen und andere Arten mir Taschengeld zu verdienen, nicht zu sehr von der Arbeit für die Schule abgelenkt wurde. Mit der Begründung, ich müsse mich auf die Schularbeiten konzentrieren, untersagte er mir auch, Mitglied bei den Pfadfindern zu werden. Er glaubte auch, in dieser Organisation militärische Strukturen zu erkennen, die ihm nach den Erfahrungen des Krieges verhasst waren.
Mein Vater war am Ende des ersten Weltkrieges 16 Jahre alt. Ob die wirtschaftlich schwächelnde Situation der Schneiderwerkstatt die Ursache war, dass er sich nicht für das Schneiderhandwerk und die Fortführung der Werkstatt entschied, oder ob es eher eine nach seinen Erfahrungen nachvollziehbare Aversion gegen die Schneiderzunft war, ist mir nicht bekannt. Jedenfalls absolvierte er eine Lehre als Feinmechaniker, die ihm später die Möglichkeit bot, als Telegraphen-handwerker zur Post zu gehen und in einer späteren Phase Beamter im Technischen Dienst der Post zu werden.
Sein Vater kam von einem Weinbauernhof aus Weinsheim an der Nahe, nicht weit von Bad Kreuznach. Dieser Hof lag am Rande des Ortes und es sollen manches Mal Rehe über den Hof gelaufen sein. Mein Vater erzählte gern, dass er, als er in Bonn als Telegraphen-handwerker bei der Post arbeitete, sich mit Freunden auf dem Hof in Weinsheim regelmäßig mit Wein versorgte. Während der Rückfahrt mit der Bahn ergaben sich oft problematische Situationen, weil seine Freunde in ihrer Weinlaune Vertretern der französischen Besatzungs-macht links des Rheines freundschaftlich auf die Stahlhelme schlugen.
Als ich in den siebziger Jahren einmal diesen kleinen Ort Weinsheim mit meiner Frau besuchte, trafen wir einen sehr alten Mann an, der in der Sonne auf einem Stuhl vor seinem Hause saß. Als wir ihn fragten, ob er noch den Schneidergesellen Wilhelm Arnold kenne, sagte er: „Ach der Wilhelm, ja, der ist damals nach Hamburg ausgewandert.“ Mein Großvater war in der Tat als Schneidergeselle auf der Walz nach Hamburg gewandert und nicht zurückgekehrt. Diesen Wandertrieb scheint er an drei seiner Töchter weitergegeben zu haben, denn die sind in den zwanziger Jahren nach Amerika ausgewandert.
Henriette und Wilhelm Arnold
Nach dem Ende des ersten Weltkrieges war mein Großvater 56 Jahre alt. Da viele seiner Kunden im ersten Weltkrieg „im Felde geblieben waren“ und viele andere nach der Auflösung des kaiserlichen Heeres in der Nachkriegszeit arbeitslos verarmt waren, geriet auch seine Schneiderwerktatt in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Im allgemeinen wirtschaftlichen Niedergang der Nachkriegszeit war es ihm nicht möglich, einen neuen Kundenstamm aufzubauen. Da die Werkstatt sich nicht mehr rentierte, gab er sie mit 60 Jahren auf. Ich kenne meinen Opa Arnold nur aus Erzählungen und von Bildern. Als mein Großvater mit 70 Jahren starb, war ich erst 5 ½ Monate alt.
Die Familie Arnold: Henriette Arnold, Wilhelm, genannt Willy, Erna, Margarethe, genannt Gretel, Dora, Olga und Wilhelm Arnold. Der Sohn Valdemar verstarb kurz nach der Geburt.
Eine Dänin als Großmutter väterlicherseits
Großvaters Frau, Henriette Christine Bernhardine Arnold, geb.1866, kaufte sich nach seinem Tod in ein Stift für alte Damen an der Landwehr in Hammerbrook ein, um dort einen ruhigen Lebensabend zu verbringen. Da sie mit 81 Jahren relativ alt geworden ist, habe ich sie noch mit vollem Bewusstsein erlebt. Sie war eine sehr liebe, freundliche, zurückhaltende Frau, die es mit meinem recht robusten Großvater sicherlich nicht leicht hatte. Sie war Dänin aus Sonderburg und lebte mit ihrem Bruder Harald Schmidt in Hamburg, als mein Opa sie im Sonderburg-Klub kennenlernte. Ihre Geschwister Christian, Dora und Christina waren in die USA ausgewandert.
Vor dem zweiten Weltkrieg besuchte ich meine Großmutter mit meinem Vater oft in ihrem Stift. Sie empfing uns dann in ihrem Appartement immer schwarz gekleidet mit einem großen, weißen Spitzentuch auf der Brust, einem sogenannten Jabot.
In ihrem kleinen Appartement lernte ich die Anfänge des Rundfunks kennen. Mein Vater hatte ihr ein kleines Detektorradio gebaut. Man musste sich einen Kopfhörer aufsetzen und vorsichtig eine offene kleine Walze drehen, über die eine feine Stahlfeder gespannt war. Mit etwas Geschick und größter Verwunderung konnte ich dann Sprache und Musik einiger Sender hören.
Dieses Damenstift ging in einer der Bombennächte Ende Juli 1943 in Flammen auf wie praktisch alle anderen Häuser in den Stadtteilen Hamm, Hammerbrook und Hasselbrook, denn dort tobten, durch Flächenbrände verursacht, die berüchtigten Feuerstürme. Bei höchster Temperaturentfaltung, die Glas zum Schmelzen brachte, rissen sie alles mit sich in gewaltige, kaminartige Feuerschlote und raubten den Menschen den Sauerstoff zum Atmen. Oma Arnold hatte das große Glück, dass sie sich in einen Park flüchten konnte, der unmittelbar beim Stift lag und auf dessen Wiesen noch Sauerstoff zum Atmen verblieb.
Sie ist dann nach ihrer Rettung durch Luftschutzkräfte in die Wohnung ihrer Tochter Olga und deren Mann nach Duderstadt im Eichsfeld, südlich des Harzes, evakuiert worden. Dort lebte sie mit ihnen die letzten zehn Jahre bis zu ihrem Tode in sehr beengten Verhältnissen in der kleinen Wohnung eines Fachwerkhauses. Duderstadt ist eine wunderschöne, mittelalterliche Stadt, deren Fachwerkhäuser schön anzusehen sind; nur es lebte sich in ihnen auch fast noch wie im Mittelalter.
Meine Großeltern väterlicherseits gehörten zu den glücklichen Menschen, die im ersten und zweiten Weltkrieg ihr Leben nicht verloren, nicht aus ihrer Heimat vertrieben wurden und keine körperlichen Beeinträchtigungen erfuhren, und dennoch wurde auch ihr Leben durch diese Kriege nachhaltig negativ beeinflusst. Mein Großvater verlor infolge des ersten Weltkrieges seine wirtschaftliche Existenz. Meiner Großmutter blieb durch die Ausbombung in Hamburg der ruhige, selbstbestimmte Lebensabend verwehrt, den sie sich durch den Einkauf in das Damenstift erhofft hatte. In dem engen Zusammenleben in einer zu kleinen mittelalterlichen Wohnung mit ihrer Tochter und deren Mann, die über diese Situation auch keinesfalls erfreut waren, wurden ihre letzten Lebensjahre sicher sehr eingetrübt, was meine Mutter einmal zu der Aussage veranlasste, sie wolle in ihrem Alter auf keinen Fall bei einem ihrer Kinder leben.
Meine Großmutter Henriette Arnold verstarb mit 81 Jahren in Duderstadt, Spiegelbrücke 9, am 8. Dezember 1947.
Oma Arnold mit ihren Kindern Margarethe, Wilhelm und Dora
Tante Dora und Tante Olga 1965 in Duderstadt
Tante Dora und Tante Erna 1975 in New York
Wenden als Großeltern mütterlicherseits
Meine Großeltern mütterlicher-seits hatten einen kleinen Bauernhof in dem sehr alten Weiler Finkenthal, der etwasechs Kilometer südlich von Gnoien an der Landstraße zu Dagun liegt. Der Marktflecken Gnoien befindet sich etwa 30 km südöstlich von Rostock. Das Dorf Finkenthal hat eine sehr alte Geschichte. Sie geht auf eine Gründung durch Wenden, also Sorben, zurück. Auch der Namen „Templin“ meines am 17. 4. 1867 geborenen Großvaters ist sorbischen Ur-sprungs. In der gleichen Region gibt es auch eine kleine Stadt mit dem Namen Templin.
Es war eine andere, märchenhafte Welt, in die ich in den Sommerferien als Fünf- bis Neunjähriger eintauchte, wenn ich mit meiner Schwester und meiner Mutter in den Ferien zu ihren Eltern nach Finkenthal fuhr. Tourismus gab es damals noch nicht, jedenfalls nicht in unserer kleinbürgerlichen Welt. Man fuhr in die „Sommerfrische“ aufs Land zu seinen Verwandten, die fast jeder Städter dort noch hatte. Hamburg wurde oft als Hauptstadt von Mecklenburg bezeichnet, weil der Zuzug aus Mecklenburg besonders groß war.
Es war für mich als Großstädter immer eine Fahrt in eine abgelegene, verwunschene Welt. Das kam schon in der Annäherung mit den Zügen zum Ausdruck. Die Verkehrsmittel wurden nach jedem Umsteigen immer altmodischer und liebenswerter. In Hamburg fuhren wir mit einem modernen Zug ab, der von einer schweren Dampflokomotive gezogen wurde und bei dem jeder Waggon diverse Abteile für jeweils sechs Personen hatte, die alle eine eigene Tür besaßen und durch zwei übereinanderliegende, durchlaufende Trittbretter verbunden waren. Aber schon in Güstrow stiegen wir in einen Zug viel älterer Bauart um, und in Teterow wechselten wir dann in einen Zug aus einer anderen, vergangenen Welt. Er wurde von einer kleinen, alten Dampflokomotive gezogen. Die Waggons besaßen keine eigenen kleinen Abteile, sondern waren durchgängig zwischen ihren beiden Enden, an denen der Zugang jeweils über offene Perrons führte. Die Wagen hatten noch harte Holzsitze und waren mit einem eisernen Ofen mit einem langen Ofenrohr ausgestattet.
Nach der Ankunft in Gnoien wurde es dann noch ländlicher, denn wir wurden von Onkel Walter, dem Bruder meiner Mutter, mit einem von einem Pferd gezogenen, offenen Leiterwagen mit großen, eisenberingten Speichenrädern abgeholt. Platz zum Sitzen gab es nur auf dem Kutschbock für meine Mutter und ihren Bruder, der die Zügel hielt. Wir Kinder machten es uns auf dem Holzboden des Leiterwagens bequem, der aus einem langen Brett bestand, oder lehnten uns an eine der beiden Seitenteile, die wie breite Leitern aussahen, und an jeweils zwei schräg stehende Holmen angelehnt und wohl auch befestigt waren. Sie gaben dem Wagen seinen Namen. Diese Leiterwagen wurden insbesondere für den Transport von Getreide und Heu benutzt.
Die Fahrt durch den Wald und die Felder dauerte nicht allzu lange, und immer wenn wir an eine bestimmte Stelle kamen, an der der Nachbar Westphal, von dem das Pferd ausgeliehen war, einen Acker besaß, schwenkte das Pferd automatisch in den Feldweg ein und musste entsprechend korrigiert werden.
Das Dorf Finkenthal liegt abseits der Landstraße. Eine kurze Stich-straße führt vom Dorf zur Landstraße, die Gnoien mit Dagun verbindet. Das Zentrum des Weilers bildet ein ovaler, unbebauter Anger, der von großen, alten Eichen eingerahmt wird. An diesem Anger liegt der Friedhof, in dem eine kleine Fachwerkkirche von 1750 steht, die auf einem etwa einen Meter hohen Sockel von Findlingen erbaut ist. Auch das kleine Fachwerkhaus der damals einklassigen Schule lag am Anger.
Neben dem Friedhof stand ein großer hufeisenförmiger Gutshof. Die Reihe der Ställe und Scheunen auf der einen Seite und auf der gegenüberliegenden Seite die langgezogenen, einstöckigen Wohnun-gen des Gesindes rahmten das Herrenhaus ein, das zwischen ihnen lag. Das war ein schlichter, zweistöckiger Bau, der nur in der Mitte durch seinen zweiseitigen, mit einem schmiedeeisernen Gitter versehenen Aufgang zur großen Eingangstür etwas aus dem Rahmen fiel. Heute befindet sich hier ein leerer Platz, auf dem lediglich an einer Seite ein kleiner, flacher, fensterloser Bau steht, dessen Funktion nicht erkennbar ist. In seinem kalkigen Weiß wirkt er wie ein Störfaktor am Dorfanger. Die Russen und ihre Nachfolger, die Vertreter des Arbeiter- und Bauernstaates der DDR, haben ganze Arbeit geleistet. An den Gutshof erinnert nichts mehr, selbst die vielen alten Bäume wurden entfernt.
Ich hatte mich mit dem etwa gleichaltrigen Sohn des Gutsbesitzers angefreundet und erlebte mit ihm viele schöne und für mich, der ich aus der Großstadt kam, ungewohnte Dinge. So sah ich, wie der übermächtige, kraftstrotzende Bulle von vier Männern mit Tauen am großen Nasenring gehalten wurde, wenn er aus dem Stall geführt wurde, um eine Kuh zu decken.
Ich habe verwundert gesehen, dass die zum Verzehr vorgesehenen Tauben kopflos noch eine Zeit lang durch die Luft flatterten, nachdem man ihnen mit dem Beil auf dem Holzbock den Kopf abgeschlagen hatte.
Den ammoniakartigen Geruch im Pferdestall habe ich immer als sehr angenehm empfunden. Dort standen vier edle Reitpferde und einige schwere Arbeitspferde.
Die Kuh- und Schweineställe haben mein Interesse weniger wecken können. Aber der Hofhund, ein Münsterländer Jagdhund, hatte immer meine volle Aufmerksamkeit. Wenn der Mähwagen über die Kornfelder fuhr und hinter sich einen Streifen freien Stoppelfeldes mit den Laufröhren der Feldmäuse freilegte, dann sprang der Hund aufgeregt hin und her, um möglichst viele der aufgeschreckten, ihrer Deckung beraubten Mäuse tot zu beißen.
Nach dem Mähen der Getreidefelder, auf denen noch viele schöne rote Mohn- und blaue Kornblumen wuchsen, kam immer ein großes Ungetüm in den Ort, eine Dreschmaschine, die die Ähren vom Stroh befreite, die Ähren drosch, das Korn in Säcke abfüllte und das Stroh in viereckigen, gebundenen Ballen ausspuckte. Der sonore Lärm dieser überdimensionierten Maschine, ihr ganztägiges tiefes, gleichmäßiges Brummen mit eingefügtem Knattern und Zischen bestimmte dann wie Musik für einige Tage den Alltag im Dorf.
Die Strohballen wurden auf den Feldern an der Landstraße zu großen, haushohen Quadern aufgeschichtet. Wir erkletterten sie und funktionierten sie oben zu kleinen Burgen um, in denen wir uns sicher fühlten. Der Versuch mit Dosen und einem Band mit der Besatzung einer anderen Burg zu kommunizieren, gewissermaßen zu telefonieren, ist zu unserer Enttäuschung immer wieder fehlgeschla-gen.
An der dem Gutshof gegenüberliegenden Seite des Angers führt eine unbefestigte Straße in den Wald, umrundet den nördlichen Teil des Dorfes, verlässt den Wald wieder und wird zu einer kurzen, mit Feldsteinen befestigten Straße, an der beidseitig die Siedlungshöfe der Teilerwerbsbauern liegen. Sie mündet dann nach etwa 150 Metern in die Stichstraße ein, die das Dorf mit der Landstraße verbindet. An der dem Dorfteich zugewandten Straßenecke liegt der Hof meiner Großeltern.
Es war und ist ein kleiner Hof. Ein Siedlungshaus mit kleinem, blumengeschmücktem Vorgarten, einem Hofplatz, noch mit Pumpe, der begrenzt wird durch eine Scheune, einen Stall, einen Holzschuppen und den großen, tiefen Garten, der sich an der Stichstraße entlang bis zur Brahmskuhle, dem Dorfteich, hinzieht.
Auf dem Hof lebte meine verwitwete Großmutter und ihr Sohn Walter mit seiner Frau Emma, die meine Schwester Ingrid und ich als sehr unfreundlich und unzufrieden empfanden. Wir versuchten immer, ihr aus dem Wege zu gehen.
Nach dem Einmarsch der Russen wurde Tante Emma wie viele andere Frauen in der sowjetisch besetzten Zone vergewaltigt. Onkel Walter, der das zu verhindern versuchte, wurde von den Russen krankenhausreif geschlagen. Allein in Berlin sollen 200.000 Frauen und Mädchen vergewaltigt worden sein, wobei die Dunkelziffer natürlich sehr hoch ist. Die Mutter meines Schulfreundes Erich erzählte einmal, dass in ihrem Dorf die Frauen abends auf dem Marktplatz in einer Reihe antreten mussten und die Russen sich dann ihr Opfer aussuchten. Solche Praktiken trieben viele Frauen in den Tod.
Meinen Großvater hatte ich nur in sehr jungen Jahren noch erlebt. Er wirkte sehr alt und war von uns Kindern kaum noch ansprechbar. Wenn das Wetter es zuließ, saß er gern stundenlang auf einem Stuhl neben der Hoftür und wärmte sich in der Sonne. Er hatte das Grauen und die Brutalität des Schlachtens in den Grabenkämpfen an der Westfront des 1. Weltkrieges miterlebt.
An meine Großmutter, Anna Templin, geborene Westphal, erinnere ich mich als eine sehr freundliche, liebe Frau, zu der wir Kinder uns immer hingezogen fühlten. Sie litt unter regelmäßigen, starken Kopfschmerzen, gegen die sie immer, wie sie sagte, „ihr weißes Pulver“ einsetzte, das sie in Gnoien vom Apotheker in einem flach gefalteten Papier erhielt. Sie starb leider schon mit 54 Jahren an Krebs. Das war sehr bedrückend, ein schwerer Schatten fiel über das Haus, was auch meine Schwester Ingrid und mich sehr bedrückte. Vor der Beerdigung wurde der Sarg noch einige Tage in der „guten Stube“ aufgebahrt. Während ich sonst immer durch dieses Wohnzimmer auf die Straße ging, nahm ich jetzt lieber den Umweg über den Hof um das Haus herum, weil mir der Weg am Sarg vorbei zu beklemmend war.
Die Bezeichnung „Wohnzimmer“ trugen die „guten Stuben“ bei den Bauern und auch bei vielen Städtern zu Unrecht. Sie wohnten in der Küche. Das Wohnzimmer besaß eine rein repräsentative Funktion. Dort wurde nur gegessen und zusammengesessen, wenn Besuch im Hause war. In der Wohnung meiner Eltern in Hamburg war das glücklicherweise nicht mehr der Fall. Wir wohnten in der „guten Stube“, und mein Vater sprach von den vielen, bei denen es noch nicht der Fall war, immer abschätzig von „Küchenbewohnern“.
Meine Großeltern hatten fünf Kinder. Es waren dies in der Reihenfolge ihrer Geburt Walter, meine Mutter Elsbeth, Grete, Otto und Ilse. Nur Walter, der erstgeborene Sohn, konnte auf dem Hof bleiben und ihn übernehmen. Alle anderen Kinder mussten ihre Heimat in sehr jungen Jahren verlassen, da der Hof sie nicht ernähren konnte; meine Mutter schon mit 16 Jahren. Die Mecklenburger gingen in solchen Fällen nach Rostock, insbesondere aber nach Hamburg, weil dort am ehesten Arbeitsplätze zu finden waren. Die Mädchen gingen meist „in Stellung“, sie verdingten sich als Dienstmädchen in großbürgerlichen Haushalten gegen sehr geringen Lohn, aber gegen Unterkunft und Verpflegung. Durch wachsende Erfahrung konnten sie sich, wie meine Mutter im Hause eines bekannten Juweliers, in der Küche von einer Zugehfrau bis zur „Kaltmamsel“ hocharbeiten, die für die Zubereitung der kalten Speisen verantwortlich war. Nach einigen Jahren wurde meine Mutter zum Mädchen für alles und sogar zum Kindermädchen.
Erste Anlaufstelle für meine Mutter und ihre Geschwister war in Hamburg ihre Tante Martha, eine Schwester meiner Großmutter, die in Hamburg mit einem Taxifahrer verheiratet war und zur Miete in einer Wohnung am Mühlenkamp in Winterhude, nicht unweit der Außenalster, wohnte. Dort gewährte sie den Kindern der Familie Templin so lange Aufenthalt, bis diese eine Anstellung und Unterkunft gefunden hatten.
Meine Großeltern unterhielten in Finkenthal in ihrem Stall zwei Kühe und mehrere Schweine. Wenn die Schweine mittags gefüttert werden sollten, wurden in einem großen Kessel Kartoffeln gekocht. Sobald die Pellkartoffeln dem Kessel entnommen und gestampft, mit etwas Milch und geschrotetem Korn versehen wurden, erklang jedes Mal ein aufgeregter Chor laut grunzender und quiekender Schweine, die sich abdrängten und übereinander kletterten, um sich möglichst gute Plätze an der Futterrinne zu sichern. Damals lachte ich darüber, und erst viele Jahre später merkte ich, dass diese Verhaltensweise sinnbildlich auch im menschlichen Zusammenleben durchaus verbreitet ist.
Regelmäßig schlachtete Onkel Walter eines der Schweine, denn es wurde in der Familie viel Fleisch gegessen. Nach der Schlachtung gab es dann immer eine würzige Blutsuppe mit Graupen. Bald nach dem Schlachten hingen dann auf dem Speicher an der Decke wieder die schmackhaften, würzigen Leberwürste, die nach einem alten Rezept zubereitet wurden, und die unübertroffenen Mettwürste, wie ich sie nie wieder mit diesem feinen, würzigen Geschmack gegessen habe. Auch Schinken und Speckseiten hingen dort in Leinensäcken an den Querbalken auf Abruf. Auf den sauberen Holzdielen des Bodens lagen neben Speck-Mausefallen aufgeschüttete kleine Berge von Weizen, Gerste und Roggen.
Onkel Walter beeindruckte mich immer wieder, wenn er sich zum Frühstück Spiegeleier machte und sich dazu acht Eier in eine große Pfanne schlug, in der einige breite Scheiben Schinkenspeck schmorten. Trotz dieser aus heutiger Sicht ungesunden Ernährung ist er fast siebzig Jahre alt geworden. Er musste allerdings als Teilerwerbsbauer und in seinem Beruf als Maurer immer körperlich hart arbeiten.
Das Einsammeln der von den Hühnern gelegten Eier erwies sich immer als schwierig, denn die vielen Hühner waren nicht dazu zu bewegen, ihre Eier immer an derselben Stelle abzulegen. So gestaltete sich das Suchen als sehr aufwendig. Selbst unter den Büschen, die den Hof begrenzten, scharrten sie kleine Nester in den Sand und legten ihre Eier dort hinein.
Die Enten waren dagegen sehr viel disziplinierter und pflegeleichter. Jeden Morgen sammelten sie sich zur gleichen Zeit und watschelten, mit dem Erpel an der Spitze, eine hinter der anderen im Gänsemarsch, oder besser Entenmarsch, auf dem Fußweg, der am Garten des Grundstückes entlang führte, zu der etwa 80 Meter entfernten „Brahmskuhle“. Das war der Feuerlöschteich, der an den Garten meiner Großeltern angrenzte. Am späten Nachmittag kamen sie dann immer wieder zur gleichen Zeit, eine hinter der anderen, auf dem gleichen Weg zurück. Immer, wenn ich an Finkenthal denke, habe ich auch die kleinen gelben Bällchen der Entenküken vor Augen, die in einem großen mit einem Tuch abgedeckten Korb schnatterten, der auf der äußersten Seite des großen Herdes stand, wo dieser nur noch eine mäßige Wärme verbreitete.
Die Brahmskuhle lag in der Mitte des Dorfes. Der kreisrunde Teich besaß einen Durchmesser von etwa fünfzehn Metern. Mit der Brahmskuhle verbinde ich viele angenehme Erinnerungen. Dort ließ ich mit meinem Freund „Schiffe“ fahren, die wir aus der dicken Borke von Kiefern schnitzten und mit Gänsefedern als Segel versahen. Schwimmen konnten wir noch nicht, aber wir wagten uns mutig auch selbst auf dieses „Meer“ unserer Phantasie mit kleinen Flößen aus Brettern, die wir auf runde Stämme nagelten. Mit großen Bohnenstangen bewegten wir uns stakend fort.
Mit Freunden an der Brahmskuhle
Besonders stolz war ich immer, wenn ich mit dem Sohn des Gutsbesitzers eines der schweren Arbeitspferde des Gutes nach getaner Arbeit zur Tränke in die Brahmskuhle reiten durfte.
Das buschige Ufer des Teiches am Garten meiner Großmutter nutzten wir, um von ihm aus im Schutze von Fliederbeerbüschen über den Zaun in den Garten meiner Großeltern zu klettern. Denn dort in der Tiefe des Gartens verborgen stand ein Birnbaum, der große, besonders saftige Butterbirnen trug.
Unvergesslich ist mir der wochenlange Mecklenburger Landregen, wie es ihn heute in dieser Ausprägung wohl nicht mehr gibt. Tag für Tag, zwei oder drei Wochen lang oder auch länger, fiel im Sommer ein gleichmäßiger, nicht sehr starker Regen. Mit seinen immer gleichen, nicht enden wollenden Geräuschen erzeugte er eine monotone, fast melancholische Stimmung.