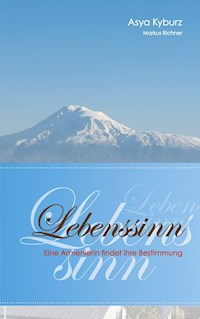
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
2. überarbeitete Auflage Nach Jahren der Unterdrückung flieht Asya mit ihren zwei Söhnen aus Armenien und findet nach einer langen und schrecklichen Flucht in der Schweiz Schutz. Nach einem weiteren, harten Schicksalsschlag findet sie zu einem lebendigen Glauben an Gott. Damit erhält ihr Leben eine Wende, wodurch sie echte Lebensfreude erhält. Schritt für Schritt entdeckt sie ihre Lebensbestimmung. Ihr Leben wurde zu einem Abenteuer, welches heute auch in Armenien viele Menschen bewegt. Lebenssinn: Der Titel dieses Buches ist ein Thema, das weit über die Geschichte von Asya hinausgeht. Auch wenn wir den Weg zum Entdecken echten Lebenssinnes in ihrem Leben sehr gut erkennen können, so wünschen wir uns doch, dass der Leser durch dieses Buch motiviert wird, seine eigene Bestimmung zu suchen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
1. Vorwort
2. Im Wasser
3. Kindheit
4. Jugend
5. Universität
6. Varuschan
8. Die Flucht
9. Ukraine
10. Wir wollen Asyl
11. Empfangszentrum
12. Ausländer in der Schweiz
13. Tiefpunkt
14. Neues Leben
16. Heirat
17. Integration
18. Sinnvolle Beschäftigung
19. Innere Heilutng
21. Beginnender Dienst
22. Der Pfeil ist angekommen
23. Licht in Armenien
1. Vorwort
Die unzähligen Flüchtlingsströme überall auf der Welt bewegen heute viele Gemüter. Zig Millionen Menschen sind an Leib und Leben bedroht oder werden auf unmenschliche Weise schikaniert. Sie alle sind unterwegs, um irgendwo auf dieser Welt einen Ort zu finden, der ihnen Schutz gewährt. Der Mensch sehnt sich aber nach sehr viel mehr als nach äusserer Sicherheit. Frauen und Männer suchen ein Zuhause, einen Ort, wo sie sich sicher und angenommen fühlen können.
Viel zu vielen Flüchtlingen bleibt es verwehrt, ein Zuhause zu finden. Andere hingegen schaffen einen Neuanfang, sehen ihre Kinder und Grosskinder aufwachsen und integrieren sich in ihrem neuen Land. Sie finden eine Arbeitsstelle, die ihnen zu einem angesehenen Wohlstand verhilft und haben nach Jahren sogar die Möglichkeit, ihr Ursprungsland ohne Risiko zu besuchen. Doch haben sie damit wirklich erreicht, was sie sich zutiefst in ihrem Herzen ersehnen?
Die Geschichte von Asya Kyburz beschreibt mehr als eine Flüchtlingsgeschichte. Obwohl ihre Geschichte durchaus bewegend ist, gibt es doch Millionen von Schicksalen, die genauso tragisch sind wie das ihre. Doch etwas macht ihre Geschichte besonders und das vorliegende Buch äusserst lesenswert: Asya hat mehr gefunden als einen sicheren Ort für einen Neuanfang. Sie hat auch weitaus mehr gefunden als ein echtes Zuhause und gute Freunde. Asya hat echte Lebensqualität gefunden! Etwas, wovon sie zuvor nicht einmal zu träumen gewagt hatte.
Am tiefsten Punkt ihres Lebens angekommen, erlebte sie eine unerwartete Wende. Die Geschichte, wie sie zu Heilung, innerer Zufriedenheit und letztlich zu ihrer Lebensbestimmung fand, ist nicht nur für Flüchtlinge und deren Freunde, sondern für alle Menschen, die sich nach dem Sinn des Lebens ausstrecken, eine grosse Inspiration.
Zum Schreiben dieses Buches sass ich stundenlang mit Asya zusammen, liess mir ihre Lebensgeschichte erzählen, stellte kritische und klärende Fragen und versuchte letztlich die richtigen Worte zu finden, um ihrer Geschichte gerecht zu werden. Oft rangen wir gemeinsam um die richtigen Formulierungen und entschieden uns auch immer wieder, gewisse tragische Erlebnisse wegzulassen, welche zum Verstehen ihrer Geschichte keinen zusätzlichen Nutzen gebracht hätten. Es war uns auch ein grosses Anliegen, nicht allzu ausschweifend zu werden und doch dem Wesentlichen genug Raum zu geben. In all diesem Arbeiten war es immer wieder die eine Sache, die mich begeisterte: Es gibt einen Gott, der jeden Menschen liebt und für alle eine einzigartige Bestimmung bereithält. Das Beste, das wir tun können, ist, uns nach diesem Gott auszustrecken und zu staunen, welchen Weg Er uns führen wird.
Lebenssinn: Der Titel dieses Buches ist ein Thema, das weit über die Geschichte von Asya hinausgeht. Auch wenn wir den Weg zum Entdecken echten Lebenssinnes in ihrem Leben sehr gut erkennen können, so wünschen wir uns doch, dass der Leser durch dieses Buch motiviert wird, seine eigene Bestimmung zu suchen.
Markus Richner August 2016
2. Im Wasser
Jahrelang verfolgte er mich, dieser Traum. Oder nein, es war kein Traum. Hierzu war er viel zu real. Es ist eher eine Erinnerung. Doch ist es wirklich eine Erinnerung? Das ist kaum möglich, denn ich sah mich darin als ein neugeborenes Baby.
Interessanterweise sah ich mich immer von aussen. Ich konnte mich in dieser Situation beobachten. Es war eine schreckliche Situation – doch woher kamen diese Bilder?
Ich war im Wasser. Starr vor Schreck! Die Angst lähmte mich. Ich kriegte keine Luft mehr und wusste, dass ich jeden Augenblick sterben würde. Es war, als würde mich das Wasser in die Tiefe ziehen. Unweigerlich hinabreissen in den Tod – und ich konnte nichts dagegen tun. Einfach gar nichts. Es war schrecklich.
Doch plötzlich griff eine starke Hand, die Hand eines Mannes, hinein ins Wasser und ergriff mich. Diese Hand zog mich aus den Fängen des Todes und hinaus aus dem Wasser. Kaum war ich draussen, veränderten sich meine Gefühle sofort. Plötzlich frische Luft, Durchatmen und das wunderschöne Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Angst und Schrecken waren augenblicklich verschwunden und ein tiefer Frieden hatte mich erfüllt.
Eine komische Geschichte. Und doch war und bin ich in gewissem Sinne noch immer davon überzeugt, dass sich diese Begebenheit wirklich zugetragen hat. Bereits als kleines Kind begleitete mich die Erinnerung während vieler Jahre. Sie war so real und gleichzeitig so rätselhaft. Dann verblasste sie, um dann einige Jahre später genauso lebendig wieder zurück in meinem Bewusstsein zu sein.
Wie oft hatte ich mich gefragt, was dieser Traum, Erinnerung oder was auch immer es war, mir sagen wollte. Was war das nur? Konnte es die emotionale Verarbeitung meiner Erinnerung an meine schwierige Geburt sein? Jahre später hörte ich, wie sich meine Grossmutter und auch mein Vater um die Gesundheit und sogar um das Leben meiner Mutter Sorgen machten, als sie mit mir schwanger war. Bereits zuvor musste sie Operationen über sich ergehen lassen und litt noch immer unter ihrer Krankheit. Für das Leben meiner Mutter war ich wirklich ein Risiko. Doch konnte ich mich wirklich an meine Geburt erinnern? Konnte das wirklich möglich sein?
Und weshalb sah ich mich eigentlich von aussen? Für eine Erinnerung ist das sehr untypisch. Aber auch solche Träume sind genau so selten. Trotzdem war ich mir immer sicher, dass es sich bei diesem Baby um mich selbst handelte. Die Angst vor dem Sterben und das Fühlen, wie die Lebenskräfte nachlassen; all dies war nur allzu real.
Oder war es vielleicht eine Erinnerung an eine spätere Erfahrung? Konnte vielleicht ein Unfall passiert sein, als meine Eltern mit mir während meiner ersten Lebensmonate ans Meer gereist waren? Doch eine solche Geschichte konnte von niemandem bestätigt werden.
Jahrelang, bis in mein Erwachsenenalter habe ich mich gefragt, was dies genau war. Ein Traum oder eine Erinnerung? Oder vielleicht doch nur das Produkt meiner kindlichen Fantasie, so unmöglich mir dies zu sein scheint.
Bis heute kann ich nicht genau sagen, was es mit dieser Geschichte auf sich hat. Ich habe keine Ahnung, wie diese Erinnerung in meiner frühkindlichen Zeit in meine Gedanken kam. Doch auch wenn ich darüber noch immer meine Fragen habe, wurde mir diese
„Erinnerung“ zum Bild für mein Leben. Es ist ein Leben, in dem ich mich verloren fühlte und keine Geborgenheit, dafür umso mehr Ängste und Unsicherheit erlebte. Und es ist die Geschichte meines Lebens, in der ich von einer starken Hand gepackt und in Sicherheit gebracht wurde, an einen Ort, wo ich mein wahres Zuhause fand. Und genau diese Geschichte möchte ich erzählen.
3. Kindheit
Ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Auch wenn um mich her viele schlimme Dinge geschahen, erinnere ich mich aber doch fast ausschliesslich an schöne, ja, sehr schöne Dinge. Meine Eltern liebten mich über alles und drückten diese Liebe auch immer wieder auf verschiedene Weise aus.
„Du bist der Motor meines Herzens“, sagte mein Vater oft.
„Wenn du kommst oder ich dich umarme, dann beginnt mein Herz höher zu schlagen.“ Damit drückte er aus, dass ich sein Herz bewegte und somit Grund und Freude seines Lebens sei. Das freute mich immer sehr! Ja, ich liebte es, der Motor des Herzens meines Vaters zu sein.
Auch meine älteren Geschwister, ein Bruder und eine Schwester, liebten mich sehr. Immer nahmen sie mich in ihre Mitte und taten alles, um mich zu verwöhnen, genauso wie meine Eltern. Stets suchte ich die Nähe meiner Mutter – viel mehr als meine Geschwister. Damit ich meinen Willen durchsetzen konnte, begann ich oft einfach zu weinen. Und es funktionierte. Meine Familie war ständig darum besorgt, mich zufrieden zu stellen.
Mein Vater tat alles, damit seine Familie gut versorgt war. Nichts sollte uns fehlen. Das war ihm extrem wichtig. Als Direktor einer Fabrik war er ein angesehener Mann, der sehr wohl genügend Geld verdienen konnte, um seiner Familie viele Annehmlichkeiten zu ermöglichen.
Armenien war damals noch Teil der Sowjetunion und somit ein kommunistisches Land. Auch mein Vater war ein richtiger Kommunist: mit allem was dazugehört. Eigentlich hätte es das System nicht vorgesehen, dass er ein höheres Einkommen erhielt als irgendeiner seiner Angestellten. Doch irgendwie, wie es in jener Zeit halt geschah, nutzte er seine Position aus, um zu mancherlei Extras zu kommen.
Wir hatten eine kleine Wohnung am Stadtrand, wo eher ärmere Leute lebten. Es sollte nicht allzu auffällig sein, dass wir mehr Geld hatten als andere. Trotzdem war unsere Wohnung sehr gut ausgestattet, besser als diejenigen unserer Nachbarn. So hatte mein Vater beispielsweise dafür gesorgt, dass wir immer warmes Wasser hatten.
Vater bestand auch darauf, dass Mutter ihre Arbeit als Architektin aufgab, um ganz für die Familie da zu sein. Für sie war dies nicht so einfach, denn sie liebte ihre Arbeit. Ihre Firma hatte auch wirklich viele sehr schöne Häuser gebaut. Doch wahrscheinlich war es besser so. Und für mich persönlich war es natürlich ein grosser Gewinn, Mutter immer, um mich zu haben.
Die Spannung, in welcher sich mein Vater befand, bekamen sogar wir Kinder zu spüren. Einerseits wollte er seine Familie versorgen und uns alles ermöglichen, was wir uns nur ersehnten. Andererseits musste er stets auf der Hut sein, um nicht etwa durch einen zu grossen Wohlstand aufzufallen.
Doch die Privilegien, die wir als Familie hatten, waren natürlich schon sehr willkommen. Jedes Jahr fuhren wir für einen Monat in die Ferien, manchmal auch länger. Wir reisten ans Meer, lebten in schönen Hotels und genossen unser Zusammensein. Stets waren wir in guten Hotels einquartiert.
Vater sagte immer, es sei nicht gut, wenn wir jemandem zur Last fallen würden. Niemandem wollte er etwas schuldig bleiben. Niemand sollte wegen uns Geld ausgeben müssen. Es mochte Vaters Stolz gewesen sein, selbst für alles aufkommen zu können. Und nach Möglichkeiten hatten wir auch immer die besten Einrichtungsgegenstände. Wir waren auch eine der wenigen Familien, die bereits Anfang der 60er Jahre stolze Besitzer eines Farbfernsehers war.
So schön und unbeschwert meine Kindheit auch war, nahm ich doch immer wieder die dunklen Schatten wahr, die uns umgaben. Meist waren es die Erzählungen meines Vaters, welche eine tiefe Wirkung auf mich hatten. Wahrscheinlich prägten mich diese Geschichten deshalb so stark, weil mein Vater beim Erzählen oft von Gefühlen überwältigt wurde. Es waren Geschichten von Stalin und wie dieser grausame Despot Menschen umbringen liess. Vaters Mutter, meine Grossmutter, kam bei einem mysteriösen Unfall ums Leben.
Einmal erzählte Vater eine Geschichte, die besonders schrecklich war: Stalins Leute zwangen russische Soldaten, deutsche Militäruniformen zu tragen, damit diese fälschlicherweise als Deutsche identifiziert werden würden. Dann gab er ihnen den Befehl, ein russisches Dorf dem Erdboden gleich zu machen und alle Bewohner zu töten. Das eigene Militär, das sich in der Uniform des Feindes tarnte! In der Folge schickte Stalin mehr Truppen, um die angeblichen Deutschen zu schlagen. Auf diese Weise vernichtete Stalin die Zeugen, die ihn wegen der Morde am eigenen Volk hätten blossstellen können. Mein Vater weinte, als er diese Geschichte erzählte. Heute vermute ich, dass er als Augenzeuge dabei gewesen war. Ich frage mich, welche Rolle er dabei gespielt hatte.
Die meisten Armenier waren von einem ausgeprägten Nationalstolz erfüllt. Interessanterweise war mein Vater da ganz anders. Er war sehr weltgewandt. Er sprach viele Sprachen, darunter Russisch, Georgisch, Ukrainisch, Polnisch, Deutsch und Türkisch. Er betonte immer wieder, dass alle Menschen gleich seien und keine Nation einer anderen überlegen sei. Er bemühte sich sogar darum, dass wir Menschen aus unterschiedlichen Nationen oder Religionen respektvoll behandelten. Er duldete es beispielsweise auch nicht, dass wir in der Familie armenisch sprachen, wenn wir Gäste hatten, die diese Sprache nicht beherrschten. Nein, dann mussten wir Russisch sprechen. Ein solches Verhalten war für einen Armenier alles andere als üblich. Diese Einstellung hat mich sehr geprägt und sollte für mein späteres Leben noch eine sehr wertvolle Eigenschaft werden.
Mein Grossvater wurde als Gefangener nach Sibirien verschleppt und mein Vater wuchs an unterschiedlichen Orten in der Sowjetunion auf. Die meiste Zeit seines Lebens verbrachte er ausserhalb Armeniens. Die Beziehung zwischen Vater und Grossvater war sehr schlecht. Grossvater war sehr fordernd und hielt sich nicht an Vereinbarungen. Wahrscheinlich war dies durch seine Geschichte bedingt, dass er sich oft nicht an Dinge erinnern konnte. Vater versuchte stets, seinem Vater alles recht zu machen, aber es war schwierig.
Ich erlebte, dass Vater und Mutter sich echt geliebt haben. Aber es waren wohl zu viele schwere Erlebnisse, die er nie verarbeiten konnte, die ihn ein Stück weit beziehungsunfähig werden liessen.
In meiner Kindheit spielte Grossmutter eine grosse Rolle. Oft war sie bei uns und unterstützte meine Mutter. Da Mutter unter gesundheitlichen Problemen litt, war diese Hilfe nur allzu willkommen. Nach einer Weile, als sich der Zustand von Mutter verschlechterte, zog Grossmutter sogar bei uns ein.
Meine Kindheit verbrachte ich wie auf einer Insel. Rundum war eine dunkle Welt voller Zerstörung und harter Schicksalsschläge. Und mitten darin war ich, mit meiner Familie, und genoss das Leben in vollen Zügen. Für mich war alles einfach wunderbar. Ich durfte ein Instrument erlernen und viele andere schöne Dinge tun. Besonders die Fürsorge meines Vaters liess mich wie eine Prinzessin fühlen. Immer war er besorgt, dass es mir gut ging. Er sorgte für die besten Plätze, wenn wir mit Zug oder Flugzeug unterwegs waren. Hierfür war er auch bereit, zusätzlich zu bezahlen. Oftmals gingen wir in ein Restaurant essen. Dabei achtete Vater sehr darauf, dass wir von schönem, sauberem Geschirr essen konnten. Und wenn er glaubte, dass das Geschirr nicht sauber oder das Essen nicht gut genug für seine Familie sei, konnte er die Bediensteten sogar auffordern, ihre Arbeit noch einmal zu tun.
Es war wirklich sehr schön, das kleine Mädchen meines Vaters zu sein!
Besonders beeindruckten mich auch immer die Besuche in der Kirche. Regelmässig ging ich mit meiner Mutter in die Armenisch Apostolische Kirche, welche in Europa fälschlicherweise oft mit der Orthodoxen Kirche verwechselt wird und wohl gewisse Ähnlichkeiten mit dieser haben mag. Das Ernsthafte und Feierliche sprach mich irgendwie sehr an.
Grossmutter zitierte auch oft aus der Bibel, welche in ihrem Leben eine grosse Bedeutung zu haben schien. Wir waren Christen. Zumindest Grossmutter, Mutter und ich. Vater kam nie mit in die Kirche. Als Kommunist machte man das nicht. Wahrscheinlich war es auch der Wunsch, unerkannt zu bleiben, der meine Eltern dazu bewegte, mich in einem anderen Land, weit weg von zu Hause, zu taufen. Und ich glaube, dass mein Vater bei diesem Anlass dabei war. Ob er damit meiner Mutter eine Freude machen wollte? Oder glaubte er am Ende doch, dass es einen Gott gibt? Er hätte dies mit Sicherheit nicht zugegeben, zumindest nicht öffentlich. Denn schliesslich galt mein Vater als Kommunist. Es kann gut sein, dass meine Taufe gerade deshalb so weit von zu Hause stattfand, damit mein Vater nicht plötzlich von einem Vertreter der Kommunistischen Partei erkannt werden konnte. Ich weiss es nicht.
Doch auch zu Hause hatte Vater keine Einwände, dass Mutter und ich zur Kirche gingen. Er war nur darum besorgt, dass wir nichts taten, was uns gesundheitlich schaden könnte. So sollten wir beispielsweise die Hand des Priesters aus hygienischen Gründen nicht küssen. Beim Empfang der Eucharistie küssten die Leute üblicherweise seine Hand. Da ich Vaters verbietende Stimme immer in mir hörte, vermied ich es stets, die Hand des Priesters zu küssen. Ich tippte seine Hand einfach mit der Nase an.
Uns wurde eine grosse Ehrfurcht vor Gott und allem Heiligen gelehrt. Wir wurden beispielsweise dazu angehalten, einem Kruzifix niemals den Rücken zuzuwenden. Es galt, dem Kruzifix immer das Gesicht zuzuwenden. Wer sich vor das Kruzifix gestellt hatte, musste sich also rückwärtsgehend wieder entfernen.
Ich war getauft und ging regelmässig zur Kirche. Damit war ich Christin. Das war mir bereits als kleines Mädchen klar. Und während der nächsten Jahrzehnte kam es mir nie in den Sinn, diese Tatsache in Frage zu stellen.
4. Jugend
Jeden Morgen ging ich zur Schule, um mich auf mein künftiges Leben vorbereiten zu lassen. Dies war für alle Kinder obligatorisch. Bei uns in Armenien gab es neben der offiziellen aber auch noch andere Schulen, welche wahlweise besucht werden konnten. Es handelte sich dabei um eine Art Akademie, in welchen man sich anmelden musste, um sich in beliebigen Disziplinen zu bilden. Meine Mutter war sehr darauf bedacht, dass wir drei Kinder entsprechend unseren Begabungen und Neigungen gefördert wurden.
Nachdem ich jeweils um 14 Uhr nach Hause kam, ging mein Programm nahtlos weiter. Dreimal in der Woche ging ich zur Musikschule, welche jeweils von 14 Uhr bis 17 Uhr dauerte. Dort lernte ich Klavierspielen. Eigentlich hätte ich lieber Geige gelernt, doch meine Mutter liess dies nicht zu, obwohl ich mich mit einer Prüfung für den Geigenkurs qualifiziert hatte. Also blieb ich beim Klavier. Die Musikschule dauerte sieben Jahre und ich wurde intensiv in Musikgeschichte, Komposition, Gesang und Solfeggio unterrichtet. Jedes Jahr hatte ich Prüfungen, um mich fürs folgende Schuljahr zu qualifizieren.
Nebst der normalen Schule und der Musikschule besuchte ich elf Jahre lang die Tanzschule. Mehrmals pro Woche hatte ich diese Kurse von 18 Uhr bis 21:30 Uhr. Mein Pensum war wirklich gross und heute frage ich mich oft, wie ich all diese Herausforderungen meistern konnte. Doch nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie stellte mein Wochenplan eine Belastung dar. So musste beispielsweise mein Bruder mich immer zum Tanzen und wieder zurückbegleiten. Dies war zu meiner Sicherheit. In Eriwan war es für ein Mädchen unangebracht, abends allein unterwegs zu sein. Es ist verständlich, dass sich mein Bruder auch gegen diese Verpflichtung auflehnte. Schliesslich glaubte er, Besseres zu tun zu haben, als mich jede Woche an mehreren Abenden heim begleiten zu müssen.
Im Gegensatz zu westlichen Ländern wurden Aktivitäten wie Musik oder Tanzen in Armenien nicht etwa als angenehme Freizeitgestaltung betrachtet, sondern als eine Investition für die Zukunft. Es war klar, dass durch diese Aktivitäten eine Weichenstellung für die Zukunft gelegt würde. In der ganzen Sowjetunion investierten sich die Kinder nicht etwa zu ihrem privaten Nutzen in diese Dinge, sondern sollten ihre erlernten Fähigkeiten dann auch der Gesellschaft zur Verfügung stellen. Jedem Kind wurde das Ziel vorgeben, diese Disziplin später professionell zu verfolgen.
Über Jahre hinweg, waren meine Aktivitäten so zeitraubend, dass ich für meine Hausaufgaben oft keine Zeit fand. Ich erinnere mich, dass meine Mutter und auch meine zwei Geschwister meine Hausaufgaben erledigten. Mehrmals weckte mich meine Mutter sehr früh am Morgen, um mit mir den Stoff durchzugehen, welcher in der Prüfung am selben Tag abgefragt werden würde. Ich hatte einfach keine Zeit zum Lernen gefunden.
Es gab auch Aktivitäten, welche für alle Kinder obligatorisch waren. So musste ich zum Beispiel lernen, mit Kalaschnikows zu schiessen. Eine Fertigkeit, welche ich am Ende ziemlich gut beherrschte. Sechs Tage pro Woche hatten wir Schule, die offiziell um acht Uhr begann. Wir mussten uns aber schon um halb sieben zum Sporttraining einfinden. Normalerweise trainierten wir dabei Leichtathletik, Volleyball und vieles andere.
Vor den Nationalfeiertagen wurde uns in dieser Zeit jeweils beigebracht, wie wir in Formation und Gleichschritt gehen mussten. Gemeinsames Bewegen im Gleichschritt, Tragen von Flaggen und viele andere Dinge mussten bis ins letzte Detail eingeübt werden. Diese Trainings dauerten oft Monate, bis die Lehrer glaubten, dass wir ein genügend gutes Bild für die Öffentlichkeit abgeben würden. Nicht nur in Armenien, sondern in der ganzen Sowjetunion waren derartige Präsentationen üblich. In riesigen Veranstaltungen zogen die einzelnen Schulen dann an hohen Staatspersonen vorbei und stellten dabei die Disziplin, Grösse und Fähigkeit der jeweiligen Schule zur Schau. Es konnte durchaus vorkommen, dass der sowjetische Parteivorsitzende dadurch gewürdigt wurde. Das Aufmarschieren vor hohen kommunistischen Funktionären und besonders auch vor dem damaligen Staatsoberhaupt, dem Ersten Sekretär Leonid Breschnew, blieb mir in lebendiger Erinnerung. Von der ersten Klasse an musste ich am Sportunterricht teilnehmen und ab der fünften Klasse in der Formation mitmarschieren.
Grundsätzlich herrschte in unseren Schulen sehr viel Disziplin. Es war üblich, dass wir Kinder geschlagen wurden – und dies nicht nur als Strafe. Manchmal wurden Schüler mit Schlägen zu höheren Leistungen angetrieben. Einmal hatte mich meine Russischlehrerin mit aller Kraft auf den Kopf geschlagen. Damit war dann aber doch eine Grenze überschritten und meine Eltern schalteten sich ein, um die Lehrerin in ihre Schranken zu weisen. Die Intervention zeigte Wirkung. Die Lehrerin erhielt die Kündigung.
Einmal kam ich mit ein paar Freundinnen einige Minuten zu spät zum Unterricht. Der Direktor stellte uns zur Rede. Wir mussten uns an die Wand stellen und seine Tiraden über uns ergehen lassen. Drohend stellte er sich vor mich hin und fauchte mich an:
„Was ist das für eine Kleidung? Du trägst ja gar nicht schwarz!“
In den Schulen in Armenien herrschte ein strenger Dresscode. Wir mussten einen schwarzen Rock und ein weisses Hemd tragen. Der Rock erregte nun den Zorn des Direktors. Erschrocken blickte ich auf mein Kleidungsstück: Es war schwarz. So nahm ich all meinen Mut zusammen und hielt dem Direktor entgegen: „Aber… das Kleid ist doch schwarz.“
„Was? Du wagst es, mir zu widersprechen!“ donnerte er mich an und holte mit der Hand zum Schlag aus. Schnell wich ich zur Seite und schlug dabei mit dem Kopf an der Wand an. Ich spürte, wie eine Wut in mir hochkam. Das war einfach nicht richtig. Ich durfte nicht für etwas bestraft werden, das ich gar nicht verschuldet hatte.
Und ich hörte ihn sagen: „Was fällt dir ein! Ich will deinen Vater sprechen.“
Als ich meinem Vater von diesem Vorfall berichtete, kam er dem Wunsch des Direktors nach und traf sich mit ihm zu einem längeren Gespräch. Er beschwerte sich bei dem Direktor über dessen Verhalten mir gegenüber, stiess jedoch auf taube Ohren. Es wurde mir befohlen, das zweifelhafte Kleidungsstück, welches durchaus der Kleiderordnung entsprach, abzulegen.
In der Folge hatte ich aber immer wieder meine Auseinandersetzungen mit dem Direktor. Mein Widerstand mag ihn provoziert haben, genauso wie ich von seinen ungerechten Behandlungen zutiefst angewidert war.
Der Direktor der Schule hatte seine eigenen Methoden, den Schülern Disziplin beizubringen. Wenn beispielsweise Mädchen nicht im Unterricht erschienen, rief er deren Eltern an und behauptete, dass sie sich mit Jungs im Wald herumtreiben und sich zu unsittlichen Handlungen hinreissen lassen würden. Als er diese Masche einmal mehr abziehen wollte, geriet er in Erklärungsnotstand. Während er nämlich der Mutter des abwesenden Mädchens von deren angeblichen Herumtreiben berichtete, stand dieses unmittelbar neben der telefonierenden Mutter.
„Wie können Sie es wagen, so schlechte und unwahre Dinge über meine Tochter zu erzählen“, protestierte diese sehr erzürnt.
„Sie steht direkt neben mir und hat mit all Ihren Anschuldigungen nichts zu tun. Sie ist krank und konnte deshalb am Unterricht heute nicht teilnehmen. Was Sie da tun, ist nichts anderes als Verleumdung!“ Da blieb dem Direktor nur noch übrig, sich für das „Missverständnis“ zu entschuldigen. Doch jetzt kamen seine vielen anderen Verleumdungen und Schikanen ans Licht, und als Konsequenz musste er seine Stellung in dieser Schule aufgeben.
Es versteht sich von selbst, dass ich nicht jeden Tag Zeit zum Spielen fand. Diese Zeiten genoss ich dann aber immer in vollen Zügen. Mit anderen Kindern spielten wir zwischen den Häusern, hüpften herum. Meist waren es einfache Spiele ohne teures Spielzeug, welche uns stundenlang vergnügt sein liessen. Die Gemeinschaft mit Kameradinnen genoss ich sehr. Die Pausen zwischen den Schulstunden waren mir besonders lieb. Das waren hervorragende Gelegenheiten für uns Mädchen, uns auszutauschen, zusammen zu essen und auch viel zu lachen. Da meine Eltern wohlhabend waren, genoss ich auch für die Freizeitgestaltung etliche Privilegien. Bereits als wir klein waren, nahmen uns meine Eltern mit zu Konzerten oder ins Theater. Auch der Besuch von Kinos war mir schon früh vertraut. Ich liebte es über alles, wenn wir uns als Familie zu solchen Ereignissen aufmachten. Das waren immer wieder echte Highlights!
Als ich grösser wurde, bezahlte mein Vater auch dafür, dass ich mit Kameradinnen ins Theater oder ins Kino gehen konnte. Und natürlich besuchten wir leidenschaftlich gerne Konzerte. Da mir Musik sehr viel bedeutete, genoss ich es über alles, hochkarätigen Musikern zu lauschen.
In der Musikschule war ich sehr eifrig und wahrscheinlich liegt mir die Musik auch von Natur aus bereits im Blut. Jedenfalls entdeckte meine Lehrerin ein Talent in mir, das sie letztlich dazu bewog, mir den Weg zu öffnen. Ich sollte an einem grösseren öffentlichen Konzert einen Beitrag leisten. Nebst anderen jugendlichen Musikern, allesamt deutlich älter als ich, durfte ich auftreten. Ich war damals erst in der vierten Klasse. Das war eine sehr grosse Ehre. Meine Mutter kaufte mir für diesen Anlass ein spezielles, in meinen Augen extrem schönes Kleid. Der Tag des Konzerts kam – ich war sehr, sehr aufgeregt. Drei Stücke hatte ich auf dem Klavier vorzutragen und ich hatte grosses Lampenfieber. Doch es klappte und ich war sehr erleichtert. Und als die Leute dann stürmisch applaudierten, war all meine Unsicherheit und Nervosität vergessen.
Was ich nicht wusste war, dass eine Frau von der Zeitung unter den Zuhörern war, die eine Rezension des Konzertes schreiben sollte. Meine Mutter und auch andere waren über ihr Kommen informiert, hatten aber wohlweislich darauf verzichtet, es mir zu sagen. Das war bestimmt besser so, denn hätte ich es gewusst, wäre ich noch viel nervöser gewesen.
Wir alle staunten nicht schlecht, als mein Name am folgenden Tag in der Zeitung abgedruckt war. Es wurde über das kleine Mädchen, Asya Hovsepyan berichtet, welches drei Stücke hervorragend und fehlerfrei vorgetragen hatte. Ich war sehr stolz!
Meine Musiklehrerin war zuweilen sehr streng. Doch sie hat mir nicht nur beigebracht, ein Instrument zu spielen, sondern auch vor Menschen aufzutreten. Diese Schule war für mein Leben sehr hilfreich und heute bin ich der Lehrerin für ihren Einsatz sehr dankbar.
5. Universität
Mit Wehmut gab ich meine Karriere als Tänzerin auf. All die Jahre hindurch hatte ich das Tanzen über alles geliebt. Doch jetzt war es einfach zu viel. Meine Familie übte immer mehr Druck auf mich aus, dass ich mein riesiges Engagement, welches für alle eine Belastung darstellte, doch endlich reduzieren sollte. Ich hatte mich für ein Studium an der Universität entschieden und musste wohl oder übel einsehen, dass ich schlichtweg nicht in der Lage war, die Zeit für die Tanzkurse weiterhin aufzubringen.
Mein Traum war es, ein Biologiestudium zu absolvieren. Zu Ende meines letzten Schuljahres zeigte sich aber, dass meine Schulnoten nicht gut genug waren. Die Anforderungen für Biologie waren, im Vergleich mit anderen Disziplinen, extrem hoch. Ich war sehr enttäuscht. Sorgfältig hatte ich mich bereits auf dieses Studium vorbereitet, mir einen gründlichen Überblick verschafft und mich auch schon als Biologin gesehen. Doch daraus wurde nichts. Ich hatte aber keinen Plan B, keine Vorstellung, was ich stattdessen studieren könnte.





























