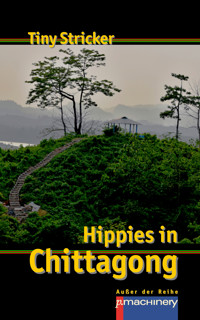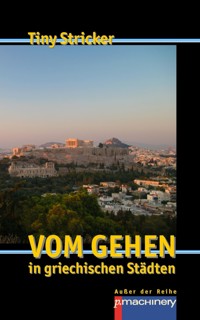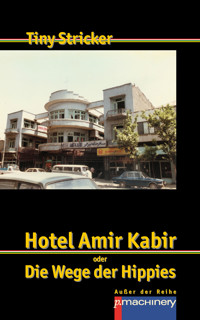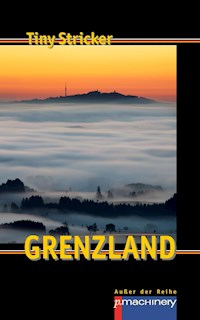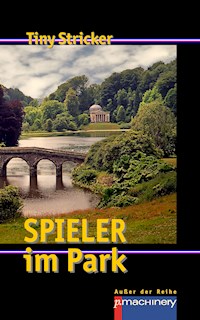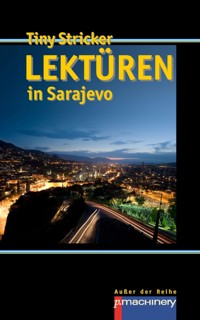
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: p.machinery
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch ist eine Hommage an Sarajevo und das Land Bosnien-Herzegowina, eine Nahtstelle der Kulturen im Herzen des Balkans. Heinrich "Tiny" Stricker, der fünf Jahre dort lebte und arbeitete, besuchte besondere Orte, bekannte und unbekannte, die osmanische Altstadt von Sarajevo natürlich, aber auch Derwisch-Tekken und denkwürdige Cafés oder das "Kino Bosna", wo der ursprüngliche Sevdah, der Balkanblues, gespielt wird. Er versteht es meisterhaft, Atmosphären und Stimmungen einzufangen, macht Lust, dieses eindrucksvolle, aber lange Zeit schwer zugängliche und immer noch zerrissene Land neu zu entdecken. Dazu liest er antike und orientalische Texte, die wie weise Kommentare klingen und wie von selbst überleiten zur Hauptsache: der "Lektüre" von Stadt und Land. Tiny Stricker wurde bekannt durch Romane wie "Trip Generation" und "Soultime", aber auch sein Reisebuch "Vom Gehen in griechischen Städten" ist schon Kultlektüre geworden. Die "Werkausgabe Tiny Stricker" präsentiert seine Klassiker und seine neuesten Werke in einer überarbeiteten Neu- und einer exklusiven Erstausgabe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Tiny Stricker
LEKTÜREN IN SARAJEVO
Werkausgabe Tiny Stricker
Band 7
Außer der Reihe 14
Tiny Stricker
LEKTÜREN IN SARAJEVO
Werkausgabe Tiny Stricker
Band 7
Außer der Reihe 14
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© dieser Ausgabe: September 2015
p.machinery Michael Haitel
Deutsche Erstveröffentlichung
Titelbild: Sarajevo, Bleu!, photocase.de
Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda, Xlendi
Lektorat: Michael Haitel
Herstellung: global:epropaganda, Xlendi
Verlag: p.machinery Michael Haitel
Ammergauer Str. 11, 82418 Murnau am Staffelsee
www.pmachinery.de
ISBN der Printausgaben:
978 3 95765 040 5 (Paperback)
978 3 95765 041 2 (Hardcover)
Ein Vorspiel
Im Januar war ich für eine Nacht und einen halben Tag in Sarajevo gewesen. Wir waren mit gewaltiger Verzögerung wegen Schneefall aus Zagreb angekommen und fuhren, ohne die Stadt richtig wahrzunehmen, unter viel Gerede vom Flughafen direkt zum Seminar, das sofort losging. So plötzlich war die Ankunft, dass mir bei der Begrüßung der Name der Gastgeberin entfiel und ich sogar beim Namen der Stadt überlegen musste.
Mitten in der Nacht schaute ich aus dem Fenster des alten Hotel Europa, jetzt mit Touchscreen und anderen modernen Geräten ausgestattet, hinaus auf die verschneite, im Mondlicht daliegende Stadt. Man sah die große Moschee, den gedeckten Basar, den Uhrturm, der eine versunkene Zeit anzeigte, darüber die Glitzerketten der Berge … Sarajevo war in diesem Augenblick buchstäblich märchenhaft schön, man hätte hinausfliegen können. Das Bild ging unter in den Träumen, die ja auf Reisen besonders heftig sind, und am anderen Morgen begann wieder das Seminar mit seiner eigenen, alles überlagernden Wichtigkeit.
Gegen Mittag war die Veranstaltung zu Ende, und es blieb noch eine Stunde Zeit, sich freizumachen und »wegen eines Souvenirs« in die Stadt hinein zu laufen, bevor man zum Flughafen aufbrach. In der Basarstraße löste sich die Gruppe auf, da jedem etwas anderes gefiel. Ich erstand ein Kaffeetässchen und eine alte Postkarte und kam damit in den Vorhof der großen Moschee, die ich in der Mondnacht gesehen hatte. Durch den Schnee waren alle Gebäude miteinander verbunden, alles wirkte wie ein einziger, lang gestreckter Palast.
Ein Junge von fünf oder sechs Jahren thronte auf einem der kleinen Schneeberge im Hof neben dem Brunnen, und man sah ihm an, dass er ganz in seiner Traumwelt gefangen war, wobei »gefangen« eigentlich der falsche Ausdruck war, »darin aufgehend« wäre viel richtiger. Jedenfalls war er für die Außenwelt nicht verfügbar, man konnte dicht an ihm vorbeigehen, ohne dass er einen bemerkte. Der Schnee schien ihm ein formbares Märchenelement zu sein und die Vorhalle der Moschee mit ihren Säulen, Malereien und prächtigen Teppichen eine zauberhafte Anlage. Im Basar selbst waren wegen des Wetters nicht viele Menschen unterwegs, aber ein paar Zigeuner, die einen mangels anderer Besucher fast ansprangen. Auch dies betonte jedoch die märchenhafte Atmosphäre.
Ich weiß nicht, was mir in dieser Stunde durch den Kopf ging, jedenfalls war kurz darauf eine Stelle in Sarajevo ausgeschrieben. Da es hieß, dass die Stelle längst vergeben sei, bewarb ich mich mehr nebenbei darauf und dachte schon bald nicht mehr daran. Drei Monate später befanden wir uns auf Wohnungssuche in Sarajevo.
Die Ankunft – ein Zustand
Die Rubaijat des Omar Khajjam sind Vierzeiler. Oft »Sinnsprüche« genannt, bezeichnen sie doch eher Gedichte. Die ersten beiden Zeilen sind gereimt, erzeugen einen Gleichklang, eine scheinbare Gültigkeit, die Wiederkehr des Gleichen (dies noch konventioneller in der Übersetzung, denn gereimte Übersetzungen in der Absicht, geschmeidig zu sein, klingen fast immer gefällig konventionell). Die dritte Zeile ist wie ein Riss, ungereimt, ein neuer Gedanke, quer gestellt zum bisherigen Lauf der Dinge. Die vierte kehrt zum Reim zurück, aber jetzt verändert, integriert das Neue in das Leben.
Hinzu kommt, jedes Gedicht, jeder Vierzeiler steht für sich, bildet eine in sich geschlossene Monade, gewissermaßen von Leere umflossen. Die Sammlungen sind nach Zufallsprinzipien, z. B. alphabetisch geordnet (obwohl es Gedichte gibt, die sich aufeinander beziehen, ja sich gegenseitig umkehren). Nie sind sie thematisch arrangiert wie westliche Ausgaben Omar Khajjams. Auch diese Vereinzelung bedeutet ein Innehalten, kein vorschnelles Einordnen und »Ablegen« in irgendeine Thematik, sondern ein Nachdenken um des Gegenstands willen.
Text 130 der Insel-Sammlung mag als Beispiel dienen:
»Ich trinke nicht aus bloßer Lust am Zechen,
noch um des Korans Lehre zu durchbrechen,
nur um des Nichtseins kurze Illusion! –
Das ist der Grund, aus dem die Weisen zechen.«
Das Nichtsein, Nichtverhaftetsein in der Zeit, ihrer Hetze und Verplanung ist das Ziel dieser Verse.
Am frühen Abend des ersten Tages in Sarajevo, kurz nachdem wir uns gerade erschöpft niedergelegt hatten, ertönte plötzlich, aus einer Moschee direkt vor dem kleinen Hotel, der Muezzin, so laut, dass es uns fast aus den Betten trug, weithin tremolierend, aufsteigend, gefolgt, um eine winzige Zeitspanne versetzt, von anderen Muezzinstimmen im Talkessel und die Hänge hinauf, sich öffnend wie ein reich verzierter Kelch oder eine in hohen Bögen ausschwingende Rankenarchitektur, sodass wir minutenlang in diesem hallenden, zitternden Klang schwebend über der Stadt hingen.
Es war eine eigenartige Ankunft in Sarajevo gewesen. Alles sei bestens vorbereitet, hatte es geheißen. Ein Taxifahrer sollte uns mit einem großen Schild am Flughafen erwarten. Dementsprechend unvorbereitet waren wir angereist. Aber niemand war da. Wir hatten nur eine vage Adresse, von der wir wussten, dass sie an diesem Tag nicht besetzt war. Schließlich überließen wir uns einem Taxifahrer, der sich aus dem Schatten des Flughafens löste, einem langen, hageren, älteren Typ mit besenartigem Schnurrbart.
Wir sprachen kein Bosnisch, er weder Deutsch noch Englisch. »No problem, no problem«, wiederholte er (anscheinend die einzigen beiden Worte Englisch, die er kannte), in einer Art von Singsang, wie eine Amme, die Kinder beschwichtigt. Er ließ sich die Adresse geben und telefonierte mit seinem Handy mit irgendwelchem Wachpersonal. »No problem«, sagte er wieder und schließlich in ironischer Selbstübersteigerung »Balkan no problem«. Wir mussten alle drei herzhaft lachen, dass das Auto schaukelte. Später dachte ich, dass sich in diesem Moment alles beruhigte. In Ruhe betrachtete ich eine ländliche Ecke, an der wir vorbeifuhren und die mir ganz vertraut vorkam.
Elvir und Narcis
Finley zitiert gleich am Anfang seines Buchs eine simple Bemerkung von Aristoteles: »Oligarchie ist die Herrschaft zum Nutzen der Reichen, Demokratie die zum Nutzen der Armen …« Moses I. Finley war einer der Kulte gewesen, die aus unserer Zeit in Griechenland stammten. Das »Politische Leben in der antiken Welt« war aber zunächst eine Enttäuschung, nicht die allgemeine Abhandlung, die ich mir erhofft hatte, sondern eine Folge von Vorträgen für ein spezielles Publikum, voll inhaltlicher Sprünge, um das Thema nicht zu leicht und eingängig erscheinen zu lassen. In den Fußnoten findet eine kleine Schlacht zwischen Cambridge und Oxford statt. Dennoch las ich das Buch, das ich in einem Antiquariat gefunden hatte, mit einer gewissen Hartnäckigkeit gegen die ansteigende Sommerhitze, anstatt mich pflichtbewusst auf Sarajevo vorzubereiten.
Elvir und Narcis, unsere beiden Wohnungsmakler, mit denen wir fast eine Woche durch die Stadt fuhren, verhielten sich bald wie Reiche, bald wie Arme. In teuren Wohnungen, die sie mit uns betraten, benahmen sie sich wie Vertreter der vermögenden Klasse, redeten von Import und Export, beklagten die unklaren Besitzverhältnisse etc., in einfachen Häusern und vollends draußen auf den Straßen fühlten sie sich wieder als Arme und träumten vom Sozialismus.
Außerdem schienen sie, vielleicht unbewusst, gut verteilte Rollen zu spielen.
Narcis, der Beifahrer, ein hochgewachsener, feinfühliger Mensch, machte fast nichts. Wie Phaidros schien er hauptsächlich für die Schönheit oder die Betrachtung des Schönen zuständig. Er konnte die Wagentür aufreißen (seine einzige wirkliche Tätigkeit) und in eleganter Fortführung dieser Geste mit unterdrücktem »Look!« oder »How nice«, als wäre er selbst überrascht, die Heimstatt vor einem gleichsam ausbreiten, als eine Wunscherfüllung darbieten.
Er stotterte leicht. Dies wirkte aber eher als vornehme Zurückhaltung, bisweilen auch als Innehalten, Kontemplation, Ehrfurcht geradezu vor einem Stück Garten, einem Rosenspalier oder einem Ausblick über die Stadt. Auch die Worte, die er so aussprach, als würde er die Stimme im letzten Augenblick geheimnisvoll dämpfen, erschienen dadurch empfindsamer und kostbarer.
Wie er zum Beispiel, als der raue Hauswirt etwas von Kabelfernsehen murmelte, in den Raum hinein feierlich »Arte« sprach! Unnötig zu sagen, dass das Kabelfernsehen hier alle möglichen Sender, aber niemals »Arte« enthielt.
Elvir, untersetzt, mit struppigen Haaren, war das Gegenteil, der aktive, vorwärtsdrängende Part. Er fuhr das Auto, parkte und wendete ächzend in den engsten Gassen, telefonierte ständig, hantierte mit dem Schlüsselbund. Statt Kontemplation verkörperte er das pralle Leben, sagte Sätze wie »Der Sommer dauert hier fünf Monate« oder »Die Cafés sind mein Büro«. Wenn Narcis das Geschäft zu sehr aufhielt durch ästhetische Betrachtungen, sprach er hart von Wohnungsnotstand, schwieriger Jahreszeit, vorletztem Angebot etc. Auch Heizung, Wasser (alles, was später nicht richtig funktionierte) waren sein Thema.
Dennoch hatte Narcis die wichtigere Rolle. Er schien zu wissen, dass der Bezug einer Wohnung in einer fremden Stadt letztlich von Stimmungen abhängt. So konnte er kleine Begeisterungen mittragen, wie ein Feuer anfachen – einmal, nachdem er einen Seitenblick von meiner Frau bemerkt hatte, ließ er den Vermieter eine gelbe Rose abschneiden und sie ihr bringen, was fast zur Anmietung geführt hätte –, aber auch seine eigenen Gefühle mitteilen, indem er z. B. voll echter Inbrunst herausbrachte: »Oh, I love this kind of house.«
Draußen in den schmutzigen, verregneten Straßen (denn obwohl Elvir von Sommer und hohen Temperaturen sprach, war es oft unwirtlich und regnete fast ununterbrochen) bildeten die beiden wieder eine Einheit, stimmten ihr Klagelied an über das untergegangene Jugoslawien. Sie deuteten auf die verblichenen Schilder einstmals großer Unternehmen, die im ganzen sozialistischen Orient bekannt gewesen waren.
Mahalas und andere Zeitkapseln
Vielleicht lernt man die Stadt nie wieder so gut kennen wie bei der Wohnungssuche. Dies gilt umso mehr für Sarajevo, das trotz Korso und Straßencafés eine Stadt der Innerlichkeit, des inwendigen Lebens ist. Man geht in ein schäbiges Hochhaus mit Einschüssen, fährt in einem zittrigen Lift durch ein heruntergekommenes Treppenhaus voller Graffiti und betritt plötzlich eine schön gestaltete Wohnung. Auch war es gut, dass wir zu diesem Zeitpunkt von den Mythen, die die Stadt umgaben, noch wenig wussten.
Ähnlich den alten orientalischen Städten ist Sarajevo nichts als eine ins Land hineinragende Längsachse, um die sich die Gebäude gruppieren. Gleichzeitig ist es eine Zeitachse, zuerst im engen Talkessel das osmanische Sarajevo, dann Österreich-Ungarn und schließlich Jugoslawien … Bei der Wohnungssuche lernten wir die Teile kennen. »It’s a longitudinal city with time capsules«, sagte der Student mit besonderem Eifer, als er uns das Haus seiner Tante zeigte, die nach Australien ausgewandert war, und ich sehe noch, wie Narcis, der jetzt das Feld ganz dem jungen Fürsprecher überließ, dazu in Gedanken versunken durch das Haus lief.
Es war das erste Haus im alten türkischen Teil, das wir sahen, in der »Mahala«, wie man sagte (eigentlich sind die Mahalas kleine Gemeinschaften mit eigener Moschee, früher auch eigenem Barbier, eigenem Hamam).
Es hatte einen ummauerten Vorgarten und ein winziges türkisches Häuschen mit Kegeldach wie ein Zaubertürmchen als Nebengebäude oder Zutat bei sich. Die Räume im Obergeschoss waren zeltartig, direkt unter dem schrägen Dach, und die Holzträger darin wie Zeltstangen. Das gesamte Anwesen machte von außen einen beruhigenden, angenehm schläfrigen Eindruck, aber innen war man plötzlich ganz wach, hatte von überall geschützte Ausblicke auf die Gasse und über die Stadt.
Beinahe hätten wir es genommen, aber die Vormieterin sagte, dass es unbeheizbar sei. So suchten wir weiter.
Wir sahen auch die alten österreichischen Häuser mit großen Wohnungen und ausladendem Treppenhaus. Diese waren besonders bewegend. Die Zeit schien darin stehen geblieben zu sein. »Es ist aus dem Jahre 1913 …«, sagte die Frau inmitten von schweren altdeutschen, mit reichen Schnitzereien verzierten Möbeln, die nicht zu transportieren waren. Was genau das Bewegende an diesen Wohnungen war, ist nicht leicht zu sagen, vielleicht, dass sie das Ende einer Welt darstellten, aber auch in einem selbst tiefe Erinnerungen auslösten.
Das Restaurant »Kibe«
Menander war ein anderer Kult, den wir aus Griechenland mitgebracht hatten. Damals las ich ihn wieder, um eine Brücke zu bauen, vielleicht auch, um die innere Heiterkeit dieser Maskenspiele zu erlangen. Endlich hatte ich den »Dyskolos« gefunden, in der alten Ausgabe von Max Treu, kurz nach der Entdeckung des Papyrus entstanden. Treu schreibt im Nachwort, dass damals ein »Raunen« durch die Fachwelt ging, dass man das Werk doch nicht für die »große Kunst« hielt, die man erwartet hatte. Tatsächlich ist es ein Frühwerk, gröber als die sensiblen späteren Stücke, aber auch heftiger: ein höhnischer Abgesang auf die Polis und das Athen dieser Zeit. »Geht doch in eure Wandelhallen«, ruft Knemon, der völlig verarmte freie Bürger den jungen Lebemännern zu, die nun das Feld beherrschen. Die Ohnmacht des Einzelnen drückt sich darin aus, aber auch seine Wut, sein Aufbegehren gegen die neue gesellschaftliche Ordnung, denn die Zeit der direkten politischen Teilhabe ist vorbei, eine Ära der Globalisierung hat begonnen, des sich schnell und ungehemmt akkumulierenden Kapitals …
Gleichzeitig steht das Werk der alten Theaterwirklichkeit näher, zeigt noch viel stärker ihre Verwandlungskraft. Der Parasit erschrickt, als er Knemon im Hintergrund poltern hört, verschwindet und steht kurz darauf als Knemon selbst mit neuer Maske auf der Bühne.
Auch das Restaurant »Kibe«, und darin besteht die Verbindung zu Menander, repräsentierte eine Theaterwelt. Nach drei Tagen Wohnungssuche in Sarajevo hatte uns eine gewisse Mutlosigkeit befallen. Nicht nur war es schwierig, ja nahezu aussichtslos, in dieser kurzen Frist eine geeignete Wohnung zu finden, auch die Stadt setzte uns zu. Die Kriegsschäden, der Müll, der sichtbare Verfall einstmals schöner Gebäude, all dies kann sehr verstörend wirken. In diesem Tief, das einer Krise ähnelte, nahm uns eine Bekannte ins »Kibe« mit. Das »Kibe« ist ein Mythos, noch während des Krieges gegründet (damals gab es meist nicht viel, ein paar Eier, einen Korb mit Äpfeln, alles wurde friedlich geteilt). Es ist hoch über dem alten türkischen Teil gelegen und bietet einen herrlichen Rundblick über die Stadt.
»Was willst du essen?«, fragte der Kellner auf Deutsch, und es war kein Straßen-Du, sondern eher die beschwörende Anrede des Eingeweihten eines Kults oder von Mysterien (»Procul, o procul este profani«, schien er gleichzeitig zu sagen). Dabei spitzte er den Mund wie ein Schauspieler, der dem Publikum einen schönen Auftritt schuldet.
Bei jeder Bedienung schaute er vorsichtig aus dem Fenster. Er schien auf etwas zu warten, den Moment abzupassen, in dem die trübe, dahinsinkende Dämmerung umschlug in funkelnde Nacht. Endlich war es soweit, und ein befriedigtes Lächeln überzog sein Gesicht (es war, als ob sich ein Vorhang öffnete). Nach und nach gingen im weiten Rund die Lichter an, darüber zwischen Regenschleiern vereinzelte, blasse Sterne. Man meinte, in den vom Wasser glitzernden Wolken zu schweben, dies noch betont durch die Musik, die jetzt dazukam, zwei ältere Sänger mit Gitarren, die wehmütige Weisen erklingen ließen.
Als wir wieder gingen, fragte unsere Bekannte den Kellner sehr anspruchsvoll, fast herrisch nach Visitenkärtchen, die dem Restaurant offenbar ausgegangen waren. Statt der Kärtchen drückte er jedem von uns ein Äpfelchen in die Hand, was irgendwie bewegend war. »Ich weiß, du kommst wieder«, sagte er zu meiner Frau, und mir fiel auf, dass er nie den Plural benutzte, die Nähe war ihm viel wichtiger. Wir liefen über die Straßen und Gassen, die nun talwärts fließende nächtliche Strömungen waren, leichtfüßig in die Stadt hinab.
Später las ich Dohms »Mageiros«, über die Rolle des Kochs in der griechischen Komödie, der sich selbst als Priester, Arzt oder auch als Schüler Epikurs oder Demokrits sah, von den anderen aber wegen seines gesellschaftlichen Stands verachtet wurde.
Das Haus in der Altstadt
Wirklich fanden wir am letzten Tag unseres Aufenthalts, als wir die Hoffnung fast schon aufgegeben hatten, eine passende Unterkunft. Ich erinnere mich, dass wir alle wie erlöst auf der Veranda standen: meine Frau und ich, Elvir, der bereits einen Vertrag hervorzauberte, der begeisterte Narcis und der Vermieter.
Da das Wort »ruže« in dessen Namen vorkam, übersetzte ihn Narcis verklärend ungefähr mit »Freund der Rosen«. Der Vermieter selbst schien das Gegenbild zu dieser lieblichen Bezeichnung zu sein, ein stämmiger Riese mit kahl geschorenem Kopf, weit offenem Hemd mit Goldkettchen auf der Brust und am Handgelenk, zumindest dem äußeren Anschein nach der Urtyp des Paten. Dennoch strahlte er bei der romantischen Erklärung seines Namens durch Narcis.
Um uns her das alte Ćurčić-Viertel (wie wir später erfuhren), es war der erste schöne Tag in der Woche, Katzen schliefen auf Mäuerchen, die von Holunderbüschen überragt wurden, überall schräge, weit vorragende Dächer, die Beschütztheit ausdrückten und als Kontrast dazu feingliedrige Minarette, die die Frühsommerwolken streiften.
Das Hotel Kovači
Den ganzen Monat Juli über wohnte ich im Hotel Kovači, da meine Frau noch in Deutschland zu tun hatte und wir das Haus erst im September beziehen wollten. Das Kovači war ein angenehmer Stützpunkt, ganz in der Nähe des Basars gelegen, sparsam mit einfachen modernen Möbeln und alten Kelims ausgestattet, und vielleicht genoss ich diese Kombination und den erkennbaren Minimalismus damals besonders, eine Offenheit für das Neue war damit verbunden, das durch die Buntheit der Teppiche einen fantastischen Untergrund gewann.
Meist waren Einzelgäste anwesend: ein Zimmer weiter ein Türke, dessen lange Telefongespräche mit Istanbul und Ankara laut in die rückwärtige Gasse hinaushallten, eine junge Frau, offenbar NGO-Abgesandte, die sich schon morgens hinter ihrem Laptop verbarg, ein Fotograf, mit dem ich mich anfreundete …
Eine Zeit lang war das kleine Hotel von zwei italienischen Urlaubspaaren mittleren Alters dominiert. Die eine Frau redete unaufhörlich, während er fast gar nichts mehr sagte, stattdessen mit den Dingen spielte, zum Beispiel einer Taschenlampe, die er zärtlich anfasste, oder aber bedeutungsvoll die Wand anstarrte, als hütete sie ein Geheimnis. Die einzige größere Verbindung schien das Auto zu sein, »la macchina«, das sie immer wieder beschworen und um das sie sich rührend kümmerten. Warum sie länger in dieser Stadt blieben, war unklar, eine gewisse Urlaubsstagnation schien eingetreten zu sein (das zweite Ehepaar machte mechanisch alles mit), jedenfalls absolvierten sie pflichtgemäß alle angesagten Sehenswürdigkeiten, z. B. das Tunnel-Museum, was mich dazu brachte, diese Besichtigungen auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.
Der Wirt war freundlich, sprach aber außer ein paar Brocken weder Englisch noch Deutsch, verwirrte mich nur dadurch, dass er manchmal lächelnd mit einem seltsam klingenden Wort an den Tisch trat, das ich dann z. B. als »Spiegelei« entzifferte. Dies und ein paar freudige Blicke, die er mir während der häufigen Übertragungen von Länderspielen mit Deutschland zuwarf, waren fast die einzige Kommunikation mit ihm und seiner Familie.
Umso mehr überließ ich mich der Beobachtung, was wiederum der falsche Ausdruck ist, ich schaute einfach ohne besonderen Bezugspunkt um mich (tagsüber war ich ganz von der neuen Arbeit in Anspruch genommen). Es kam hinzu, dass ich für den langen Zeitraum nur das Nötigste eingepackt hatte und also gar keine Bücher mitführte, ich ergab mich sozusagen ganz der Lektüre der Stadt.
Besonders schön war der Blick während des Frühstücks aus dem Fenster (beim ersten bosnischen Kaffee, der ungewohnt rau und aufreizend schmeckte), neben der Moschee standen wie so oft zwei schlanke Pappeln, die die kerzengerade Aufwärtsbewegung des Minaretts auf lebendige Weise wiederholten, aber auch das Sonnenlicht filterten und zitternd über die Straße warfen. Die Bewohner des Kovači-Viertels, die um diese Uhrzeit nach und nach über die Straße herabstiegen, waren dadurch in ein besonderes, sie wie in einem Film umschmeichelndes Licht getaucht, und es wirkte wie eine Prozession oder ein Prozessionsspiel, das ich nicht müde wurde, jeden Tag erneut zu beobachten.