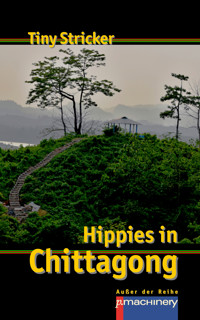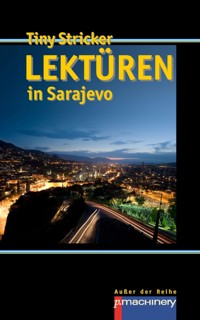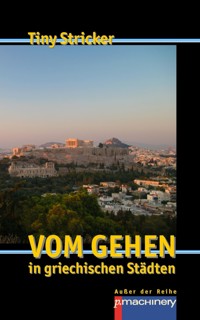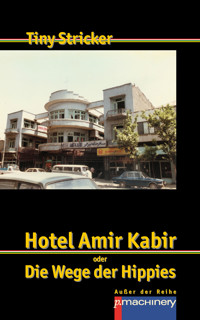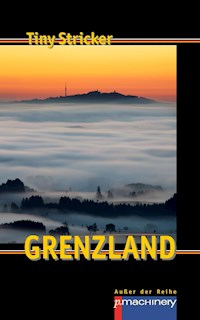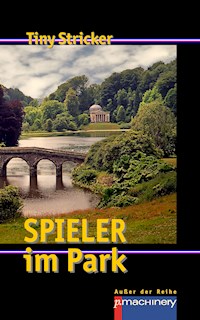6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: p.machinery
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Tiny Stricker fährt U-Bahn, beschäftigt sich mit Gesten, Blicken, Worten, Stimmungen, Codes und Gesichtern, aber eigentlich ist er auf der Suche nach der "Seele" der Stadt. Zwischendurch steigt er zur Oberfläche auf, nimmt die Jahreszeiten wahr, sieht seine Umgebung mit neuen Augen. Auch spontane Reisen unternimmt er, die mit seiner Suche zusammenhängen, gelangt auf diese Weise bis nach Weimar oder Sarajevo. Ein Großstadtbrevier unserer Tage ist entstanden, gleichzeitig ein andersartiges München-Buch. Tiny Stricker wurde bekannt durch Werke wie "Trip Generation" und "Spaghetti Junction", die das Unterwegssein zum Thema hatten, und auch diese U-Bahn-Odyssee ist im Grunde eine "Roadnovel", ein ausschweifender Reiseroman.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 232
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Tiny Stricker
U-BAHN-REITER
Werkausgabe Tiny Stricker
Band 11
Außer der Reihe 52
Tiny Stricker
U-BAHN-REITER
Werkausgabe Tiny Stricker
Band 11
Außer der Reihe 52
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© dieser Ausgabe: August 2020
p.machinery Michael Haitel
Titelbild: Martin Falbisoner: Der Münchner U-Bahnhof Westfriedhof, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda
Korrektorat & Lektorat: Michael Haitel
Herstellung: global:epropaganda
Verlag: p.machinery Michael Haitel
Norderweg 31, 25887 Winnert
www.pmachinery.de
ISBN der Paperbackausgabe: 978 3 95765 206 5
ISBN der Hardcoverausgabe: 978 3 95765 207 2
ISBN dieser E-Book-Ausgabe: 978 3 95765 884 5
.
The apparition of these faces in the crowd;
Petals on a wet, black bough.
Ezra Pound, In a Station of the Metro
Passagiere
U-Bahn-Fahrten, manchmal und zu bestimmten Stunden war es wirklich ein Eintauchen in eine andere Welt, eine Art Eleusis, einen Raum der Seele, die Stationen schon verwunschene, überwachsene Tempel … Natürlich muss die Rush Hour vorbei sein, eine gewisse Einsamkeit muss sich in den Ecken, im milden Licht der Abteile ausbreiten. An der Station gibt es dann nur wenige Wartende, die plötzlich Zeit für sich haben. Man schlendert auf der Plattform dahin, die noch oberhalb liegt, vielleicht von Abendnebel oder feinem Regen umgeben. Auf der Tafel erscheint die Endstation, die man nie erreicht, was aber nur beruhigend ist, mehr ein vertrautes Zeichen als ein konkreter Ort.
Die Einfahrt in die unterirdische Welt, die schnell vorbeisausenden Lichter, flackernden Stäbe erinnern an den Wisch-Effekt in asiatischen Filmen, wenn die Handlung plötzlich, was typisch ist, in eine andere Zeit zurückspringt und eine jähe Nachdenklichkeit erzeugt, ein augenblickliches Über-den-Zeiten-Stehen, das viel zu schnell wieder verschwindet.
Aber die Bahn ist jetzt ein Schutzraum, man überlässt sich dem Fahren oder richtiger selbstständigen Fließen, fühlt sich getragen, von gewöhnlichen Beschäftigungen entbunden. Ein Mädchen macht ihr Handy an, dessen heller Schein ihr Gesicht umstrahlt (wie eine Lampe am Fenster), sie lächelt über eine Botschaft, die Verkniffenheit, die Masken des Tages fallen von ihr ab … Ein anderes Mädchen cremt sich die Hände ein, um noch leichter, geschmeidiger über ihr Smartphone wie über ein winziges Instrument gleiten zu können, ihre rot lackierten Nägel entwickeln eine wirbelnde Ornamentik dabei, eine eigene Hexerei. Sogar die Werbemails ruft sie auf, entführen sie doch in eine angenehme Welt von Kleidung und Schönheit.
In der Ecke sitzt ein Japaner, er wirkt vereinzelt, asketisch-abgeklärt, ein Jünger des Zen, wie es scheint. Auch durch die große Brille mit dickem Rand, die seine Augen hervorhebt und die Abgeklärtheit (eine buddhistische Form der Leere, wie man denkt). Es ist aber nur ein Ausdruck höchster Konzentration, die sich allerdings erst bei völliger Entspannung ergibt. Auf seinem Smartphone nämlich hat er ein Spiel aufgeschlagen und, an die Mittelsäule gelehnt, sehe ich, dass er mit größter Geschicklichkeit eine Martial-Arts-Figur, die Drehungen und kühne Sprünge vollführt, durch eine von Angreifern und Detonationen erfüllte nächtliche Landschaft steuert. Der Hintergrund dazu ist sehr schön: ein Hokusai-Comic, Vollmond zwischen Fudschi-Bergen, ein Bild der Ruhe und Harmonie.
Vielleicht gibt ihm das Spiel Sicherheit, denkt man, vermittelt ihm das Gefühl, all die Anforderungen der neuen Umwelt (denn er kam von der Studentenstadt her) auf spielerische Weise zu bewältigen, seine Einsamkeit, die ja die Martial-Arts-Figur verkörpert, positiv zu sehen. Allein schon der sichtbare Erfolg, die erreichten Punktzahlen beim Spiel, die steigende Tendenz müssen ihn aufbauen (oder zeigt es ihm, dass es überall auf der Welt nur auf die gleichen Dinge ankommt: Geschicklichkeit, Beobachtung, Entschlossenheit …).
Die Personen sind hier auf eigenartige Weise »bei sich«, geben sich dadurch auch preis, verletzlich, wie sie sind. Manchmal hat man den Eindruck, dass sie im Geiste bereits ihre Wohnungen betreten oder sich, wobei sie den Moment hinauszögern, auf der Schwelle befinden.
Einmal sah ich eine Migrantin, vom Übergangslicht beim Verlassen der Station besonders beleuchtet (wie in einem etwas gefühlvollen Film, in dem gerade die eigentliche Erzählung einsetzt). Sie stammte der ganzen Erscheinung nach aus dem ehemaligen Ostblock, war wohlfrisiert und herausgeputzt wie oft aus diesen Ländern. Ihr Exodus lag also schon einige Zeit zurück … Dennoch: Die große Einkaufstasche neben ihr auf dem Sitz wirkte plötzlich wie ein Gepäckstück, das Fenster, aus dem sie flüchtig sah, war eindeutig ein Zugfenster, hinzu kamen das Rütteln der Bahn beim Anfahren, die zurückbleibenden Leute auf der Station, jetzt die schemenhaft vorbeigleitende Draußenwelt, all das erinnerte sie vielleicht an einen nächtlichen Aufbruch oder Zwischenaufenthalt. Jedenfalls musste ihr die U-Bahn-Passage, und es war sinnfällig, in diesen Momenten wie ein Transit, ein Fortwirken ihrer Reise (oder eine immer noch vorübergehende Wohnstätte) vorkommen. Ihr Gesichtsausdruck schwankte zwischen Hoffnung auf die Zukunft und Besorgnis hin und her, zwischen Versunkenheit und plötzlichem Um-sich-Schauen.
Migrantenkinder haben es sicher nicht leicht, müssen sich rasch, ja vorschnell an ihre neue Umgebung anpassen. Aber sie wissen auch um ihre Macht gegenüber den Älteren, beherrschen die Sprache, die »richtigen Verhaltensweisen« früher und besser als die Erwachsenen. Tatsächlich hörte ich ein kleines, vier- oder fünfjähriges Mädchen mehrmals streng ihre Mutter korrigieren, die »Ü-Bahn« statt »U-Bahn« sagte.
Es ist auch eine emotionale Macht. Die Migranten hängen an der Familie, dem engen, vertrauten Kreis, der ihre Insel darstellt … Ein Junge von drei oder vier Jahren beschloss plötzlich, diese Macht auszuüben, und fing an zu schreien, wegen irgendeiner sogar für ihn selbst lächerlichen Nichtigkeit. Allem Anschein nach nutzte er das Publikum der U-Bahn, das »volle Haus«, das sich ihm anbot. Die junge Mutter, die das fremde Publikum besonders fürchtete, streichelte ihn und redete zärtlich auf ihn ein, auf Bosnisch, das ungeheuer weich und verschlungen sein kann (aber es war auch eine Emigranten-Weichheit, die Sprache der »Insel«), was offenbar seinen Wünschen entsprach. Als sie sich von ihm abwandte, begann er gleich erneut zu zetern, und sie schenkte ihm sofort wieder ihre volle Aufmerksamkeit, verbarg ihn mit ihrem schützenden Körper geradezu vor den anderen. Es war ganz leicht für ihn.
Einmal saß ich im Englischen Garten auf einer Bank in einer Art Halbschlaf, wie es zuweilen geschieht, in diesem Fall bewirkt durch die Monotonie eines hin und her gehenden Ballspiels zweier Kinder auf dem Rasen vor mir. Ihre Großmutter auf der nächsten Bank rief ihnen immer wieder etwas zu, in einer fremden Sprache, die ich nicht kannte. Aber die Kinder, zwei Jungen, antworteten ihr entweder gar nicht oder nur mit möglichst ruppigen deutschen Ausdrücken. Sie legte eine immer größere Gefühlsseligkeit in ihre Rufe, lockte auch mit heimischen Leckereien, doch die beiden Jungen blieben mit der ihnen eigenen kindlichen Grausamkeit hart, genierten sich wahrscheinlich auch für sie, und man konnte spüren, dass es ihr wehtat, wie sie ihre Sprache, eigentlich ihre ganze Kultur, die sie aufrechterhalten wollte, ignorierten, ja von sich stießen.
Natürlich beherrschen die Migrantenkinder auch das »Code-Switching«, das Hin- und Herwechseln zwischen den Sprachen und Verhaltensmustern, oder vielmehr: Es schlummert in ihnen, und oft erst später, in der Pubertät, setzen sie es gezielt ein, wenn sie anders sein wollen, auch nicht zu offen gegenüber der Welt, die sie umringt und die sie nun nicht mehr als »liebe Kinder« betrachtet.
An der Studentenstadt steige ich aus und bemerke nach dem U-Bahn-Dunkel den Frühling noch viel stärker als sonst. Es ist aber auch ein Spiel, das ich mit mir spiele, ich steigere mich in eine Überraschung hinein … Das Flüsschen, über das ich gehe, über eine innere Zugbrücke gleichsam, ist jetzt ein glitzernder Gebirgsbach, der die jungfräuliche Natur der Bergtäler in sich trägt. Manchmal sieht man Stelzvögel mit langem Gefieder, die auf einem Stein rasten, während der Bach wie vorüberfliegt. Welche Aufregung ist jetzt in den Bäumen!
Worte
Der türkische Friseur, zu dem ich gehe, ist der schweigsamste der ganzen Stadt. Vielleicht ist es sein Gegenmittel gegen die Stadt, oder er will zeigen, dass es auch den »anderen« Friseur, den nicht-redseligen gibt. Schon, wenn man eintritt, kein Wort. Es ist wie eine Kirche. Wozu Worte, denkt man, die Dinge sprechen für sich. Man nimmt auf einem leeren Stuhl Platz, versteht sofort die ganze Anordnung des Raums. Die Magazine, die herumliegen, wie »Gala«, sind ausweislich Friseurzeitschriften (sagen nur »Hier ist Friseur«), vermutlich liest er sie nie.
Wenn man drankommt, macht er lediglich eine Geste, deutet mit einer gewissen Förmlichkeit auf den Frisierstuhl vor ihm. Ein Hauch von Würde zieht in den Alltag ein oder kehrt dahin zurück, wie am Hof des Padischahs laufen die Zeremonien von selbst ab, Winke genügen.
Wenn man bei ihm sitzt, verharrt er, tritt leicht zurück. Es bedeutet, dass man jetzt sprechen (vielleicht auch zuerst im Spiegel das ganze Ausmaß seiner derzeitig schrecklichen Frisur betrachten) soll. Man teilt vage mit, was einem zur Wiederherstellung seines Haarstils vorschwebt. »Aber kürzer«, sagte er etwas mürrisch. Es sind die einzigen zwei Wörter (am Ende kommen noch zwei ausgewählte weitere hinzu), und erst später ahnt man, dass es eine sprachliche Glanzleistung war, hat er doch Ziel und Zweck seiner Tätigkeit wie in einem Sinnspruch darin zusammengefasst. Er beginnt sein Werk, und man sieht sogleich, dass er ein absoluter Meister, ein wahrer König seines Fachs ist (daher auch das Schweigen, die Ehrfurcht unter den Wartenden). Ich schließe die Augen, einerseits aus Wohlgefühl, andererseits, weil ich nicht will, dass mir bei seiner hohen Kunstfertigkeit Schnippel in die Augen fallen.
Wenn ich blinzle, sehe ich, dass er seine Tätigkeit so mühelos, ja schwebend leicht beherrscht, dass er sich gar nicht mehr darauf konzentrieren muss, sondern stattdessen in den Spiegel schaut. Die eigene perfekte Frisur befriedigt ihn, die zunehmend grauen Strähnen, die dunklen Ringe um die Augen weniger. Es ist wie ein kleiner philosophischer Dialog mit sich selbst, vielleicht auch mit dem Kunden. Sobald er fertig ist, schwenkt er wie bei einem rituellen Akt den kreisrunden Spiegel hinter einem hin und her. Es ist das Zeichen, dass man sich erheben darf. Man zahlt (der Preis ist ja außen angeschrieben), und beim Trinkgeld nennt er das dritte Wort: »Danke.« Er sagt noch »tschüs«, bewusst nicht »Wiederschaun« oder »Wiedersehn«, und gerade diese letzten beiden Worte gewinnen durch das vorherige Schweigen an Wert (die völlig einheimische Aussprache seiner insgesamt vier Wörter verrät auch, dass er der deutschen Sprache in jeder Hinsicht mächtig ist). Besonders das »Tschüs« hat jetzt einen freundschaftlichen, fast emotionalen Unterton, und man verlässt das Geschäft in guter Stimmung nicht als Fremder, sondern als Bekannter des Chefs.
Insgesamt jedoch nimmt das Gerede stark zu. Ein Mädchen sitzt in der U-Bahn und spricht laut in ihr Drahttelefon, das heißt, in die Luft, offenbar mit einem Freund oder Verehrer, sie kokettiert oder neckt sich mit ihm und vollführt ein entsprechendes Mienenspiel dazu. Alles wirkt sehr komisch, weil ja kein Gegenüber vorhanden ist, nur ein fremdes, anderes Mädchen, das demütig in ihr Handy schaut. Vielleicht ist die Mimik bei der Telefonierenden sogar noch stärker als im direkten Gespräch, weil ihr Partner nicht anwesend ist, sie kommentiert nämlich auch das, was er sagt, schneidet Grimassen, verdreht heftig die Augen etc. Wie bei einer Komödie, die sich hinter Hecken in einem Theaterpark abspielt, sucht sie den Publikumsbezug, und je größer das Publikum ist – hier das ganze Abteil –, umso befriedigter erscheint sie. Es ist eine Art Rausch der Kommunikation, intim-privat und öffentlich zugleich, gerade von der dauernden Grenzüberschreitung geht ein besonderer Reiz aus.
In der gleichen U-Bahn ein paar Stationen weiter (das Mädchen hat inzwischen die U-Bahn verlassen, auch beim Aussteigen noch weiterredend, und das mühelose Weitersprechen bei wechselnden Schauplätzen wie in einem Theater oder flüssigen Film genießt sie ebenso als neue Freiheit wie den Auftritt in der U-Bahn vorher) steigen zwei Deutsche mit einer Chinesin ein. Die Chinesin spricht sehr schön Deutsch, man muss aber genau hinhören, weil sie eine ganz andere Intonation hat, die Sprache ist wie ein fließendes, ineinandergleitendes Gewebe, bestimmte Wörter sind so schwach betont, dass sie wie hinter einem Wandschirm gesprochen sind.
Das Hinhören wird jedoch belohnt, weil sie Sätze konstruiert, die wie kleine wohlgebaute Türme sind. Auch die Wortwahl ist »reich«, da sie nicht nur alltägliche, sondern auch ungewöhnliche Wörter benutzt, anscheinend um ihre deutschen Bekannten damit zu erfreuen. Diese antworten allerdings nur in kurzen, hingeworfenen Repliken (was vielleicht auch am Thema liegt, denn die Chinesin versucht, ein paar Unterschiede zwischen Taiwanesisch und Mandarin zu erklären). Und doch, wie abgenutzt, wie arm wirken diese deutschen Antworten, die oft nur Satzfragmente sind, im Vergleich zu der Mühe, die sich die Chinesin gibt! Warum kümmern wir uns so wenig um unsere Sprache?
Die Chinesin erzählt, dass sie in einen Deutschkurs geht, aber dass die Stufe anscheinend für sie zu niedrig sei. »Ich fühle, dass ich im Kindergarten bin«, sagt sie. Ich erinnere mich jetzt an eine frühere chinesische Bekannte, die ganz poetisch klingende deutsche Wörter wie »Ohrenschmaus« oder »Stelldichein« gebrauchte, was vermutlich mit ihrer blumigen, heimischen Ausdrucksweise zu tun hatte. Sie meinte aber auch, denn sie hatte eine romantische Büchervorstellung von Deutschland, dass dies charakteristische deutsche Wörter wären, die wir allerdings vor den Fremden etwas verborgen halten und erst bei näherer Bekanntschaft oder im gehobenen Gespräch benutzen würden.
Abends wiederholt im Englischen Garten, und zwar im alten Forstteil, zu dem es mich hinzieht und über dem zu dieser Zeit stets ein vielstimmiger Vogelgesang schwebt. Die Abmessungen der Höhe scheinen durch die Laute der einzelnen Vögel, die man kaum sieht, fühlbar, und wenn die Dämmerung wie eine Woge daherschwimmt und alle festen Konturen aufhebt, die Bodenflächen verwischt, meint man, sich selbst zu erheben, zumal der Chor jetzt noch einmal anschwillt. Später, wenn man auf der großen Wiese ist, verklingt er, und man sinkt langsam, leichten Herzens wieder herab.
Gegenstände
Einmal sah ich eine ältere Dame in der U-Bahn mit einer Lampe, die sie anscheinend auf einem Trödelmarkt erstanden hatte. Es war Samstagnachmittag, und sie war umgeben von Leuten mit Einkaufstüten, auf denen die Namen von Marken oder Geschäften prangten. Die Leute dokumentierten damit etwas oder sandten Signale aus, dass sie nämlich mit der heutigen Zeit übereinstimmten, die Warenwelt bejahten und beherrschten und »obenauf« seien. Die alte, schon etwas angestaubte Lampe schien geradezu um Nachsicht zu bitten, inmitten der feinen, korrekten und jederzeit vorzeigbaren Taschen und Tüten. Mit ihren verträumten Perlenfransen und dem Schirm, der aus Blütenblättern bestand, wirkte sie sentimental und deplatziert, überzeugte auch nicht als besonders wertvoll, und doch gehörte ihr die ganze Sorge der Frau.
Sie hatte sich extra auf einen Eckplatz gesetzt, um die Lampe etwas abseits und sicher abstellen zu können. Es war aber auch ein gefährlicher Platz, weil ständig Leute daran vorbeigingen und sie die Lampe hin und her schieben musste, was sie wie Streicheln ausführte. In den kurzen Momenten, in denen sie nicht besorgt war, überzog jedoch eine stille Freude ihr Gesicht, eine Art Vorfreude (fast schon ein vorweggenommener Widerschein der Lampe). Vielleicht malte sie sich aus, wie sie die Lampe herausputzen, ihre ursprüngliche Schönheit wiederherstellen würde. Es lag aber manchmal auch etwas anderes in ihrem Gesichtsausdruck, ein gewisser Stolz oder eine Vornehmheit gegenüber den anderen, das Bewusstsein, dass sie etwas Besonderes mit sich führte, einen wirklichen Fund, der ja, da er die Kraft hatte, ihr Heim zu bereichern, doch eine Abart von Aladins Wunderlampe war.
Die meisten Leute halten in der U-Bahn einfach ihr Handy oder Smartphone hoch. Es ist ein Zeichen der Vereinzelung, weil sie sich damit abmelden aus dem Raum, und doch bilden sie in gewisser Weise eine Gruppierung. Wie sie so dasitzen, alle mit ähnlichem Gerät und in der gleichen Haltung, scheinen sie miteinander verbunden zu sein oder ein eigenartiges schweigendes Spiel zusammen zu betreiben. Die Migranten, vor allem die neuesten, halten ebenso ihr Gerät hoch. Natürlich ist es für sie eine »Lifeline«, eine Verbindung zu der zurückgelassenen Welt, die dadurch in die unmittelbare Nähe gerückt, aber auch täuschend wird. Gleichzeitig reihen sie sich durch das ausgestreckte Gerät, das wie ein vorgezeigter Ausweis ist, auch ein unter die anderen, wirken gewöhnlich, finden eine vorübergehende Zugehörigkeit in dieser Bahn, die automatisch und zuversichtlich dahingleitet.
Oft starren die Handybenutzer wie gebannt auf ihr Gerät, als würden sie etwas suchen oder als müssten sie eine Folge von Codes durchdringen, um weiterzukommen. Vielleicht ist es die Kürze und Vorläufigkeit der Nachrichten, die sie weitersuchen lässt, oder sie suchen eine besonders schöne positive Nachricht oder eine, die die schlechten Zeitungsnachrichten wieder auslöscht.
Die Bücherleser scheinen tiefer und vollständiger in ihrem Medium zu versinken, überlassen sich ihm wie einem untergründigen Strom, der sie schon seit einiger Zeit sicher trägt. In der Regel halten sie den Titel des Buches versteckt, einige haben den Umschlag ihrer Lektüre sogar sorgfältig eingebunden, und dieses Verborgensein ist wichtig für den Fluchtraum, für seine Undurchdringlichkeit. Wahrscheinlich sind die Krimileser noch stärker absorbiert in ihre Geschichte, jedenfalls halten sie die Bücher noch näher an sich. Manchmal schauen sie allerdings auch auf und meinen etwas zu entdecken, genau wie in der Handlung, die sie gerade mit großer Anspannung verfolgen. Die Cover ihrer Bücher, die sie nicht einwickeln, weil sie ephemerer Natur sind, tragen kräftigere Farben, Schwarz, Tiefblau oder Rot, was auf eine größere Leidenschaft hinzudeuten scheint, und es fällt auf, dass sie oft mit der Kleidung der Leser harmonieren, wodurch die Identifikation mit dem Buchgeschehen und seinen Helden sicher noch verstärkt wird.
Wie schön sind alleinreisende Kinder in der U-Bahn mit Büchern (die bei ihnen immer größer wirken)! Eigentlich scheinen sie eher die Fährte dieser Bücher zu verfolgen als irgendeinen Weg durch die Stadt. Ich beobachtete ein Mädchen von vielleicht zwölf Jahren, das sehr ziel- und selbstbewusst, aber auch in einer Form von Selbstvergessenheit zu einem freien Platz hinlief und ihr dickes Buch aufschlug. Als sie einmal hochblickte, enthüllte sich auch der Titel des Werks: »Das schwarze Buch der Geheimnisse«.
Ich mag diese Übergangszeit sehr. »Wenn Regen, den April uns schenkt, des Märzes Dürre bis zur Wurzel tränkt.« Sogar die Plastiktüten hoch oben in den Ästen sehen jetzt gut aus, weil sie die Macht des Windes anzeigen. Eigentlich haben sie etwas von flatternden Tempelfahnen. Die nackten, kahlen Stämme mit einzelnen Blütensträuchern dazwischen, die irgendwie zu schweben scheinen und noch ungehindert ihre ganze Schönheit ausbreiten. Die Sichtbarkeit der Vögel auch, der Amsel zum Beispiel, die in einem schneeweißen Blütenbaum sitzt und mit rührender Unschuld ihr Lied singt.
Orte
Kurz nach Ostern fahren wir los. Um die Warteschlange bei Salzburg zu vermeiden, nehmen wir einen kleinen Grenzübergang und versuchen, von dort eine Tangente hinüber nach Villach zu finden. Gleichzeitig freuen wir uns auf Orte wie St. Johann und Zell am See, die einen romantischen Klang haben und uns wie von Kindheit an vertraut vorkommen.
Schon am Anfang verfahren wir uns aber heftig, weil uns ein älterer Tankstellenbesitzer eine Abzweigung beschreibt, die es in dieser Form längst nicht mehr gibt. Auch die Orte selbst sind kaum kenntlich, zumindest an ihrer Peripherie, die wir passieren, sehen sie alle gleich aus, ein Niemandsland aus Kreisverkehren, Waschstraßen, Fitnessoasen etc. Vielleicht bewahren sie aber in ihrem verborgenen Inneren noch ihre Eigentümlichkeit. Durch die Gleichartigkeit jedenfalls ist die Orientierung schwierig, man hat das Gefühl, gar nicht richtig vorwärtszukommen. In der Toilette einer schon etwas ramponierten Tankstelle sehen wir ein Paar Schuhe mit sehr hohen Absätzen, das eine müde gewordene Frau, immerhin treuherzig nebeneinandergestellt, dort einfach zurückgelassen hat.
Nach fast drei Stunden kommen wir endlich zur Autobahn und sind froh, darauf entlanggleiten zu können. Am Übergang nach Slowenien allerdings wieder Grenzkontrollen. Bled erreichen wir abends gerade noch rechtzeitig, um die Silberflut des Sees zu sehen und das Schloss, das weltentrückt hoch oben vor den Schneebergen liegt. Später wird es tatsächlich von den Wolken, die die Berge auszuatmen scheinen, davongetragen. Im etwas schwermütigen Abendlicht erscheint auch das Inselchen mit der Kirche, von dem gerade die letzten Boote zurückkehren.
Nach der beschwerlichen, langen Fahrt ist alles wie ein spätes Geschenk, und wir wissen nicht, was wir zuerst tun sollen. Auf der Terrasse unserer Pension sitzt ein japanisches Pärchen, das anscheinend aus der irrealen Atmosphäre des Grand Hotels nebenan herübergeflüchtet ist und sich ganz dem Anblick des Sees widmet. Während er eine Kamera mit großem Objektiv auf- und absetzt, schaut sie (die ein T-Shirt mit Text trägt, auf dem ich die Worte »More love« entziffern kann) nur auf den See hinaus. Später, als wir am Ufer entlangspazieren, sehen wir sie wieder. Er fotografiert immer neue Objekte, die offenbar dieser Reise Wirklichkeit einhauchen sollen – sicher ist es eine teure Europareise, vielleicht sogar die Flitterwochenreise –, da stürzt sie plötzlich davon und rennt wütend die Treppe zum Grand Hotel hinauf. Vor dem märchenhaften Hintergrund wirkt es überdeutlich, fast wie eine Parabel.
Am nächsten Morgen ist die Uferpromenade bevölkert von chinesischen Touristen. Allem Anschein nach ist die Stätte zu dieser Jahreszeit eine wesentliche Station ihrer Traumreisen. Tatsächlich ist der See an einem Frühlingsmorgen von besonderer Schönheit. Die Büsche am Ufer sind von weißen Anemonen umringt, die die hervorquellende Pracht der Gewächse noch hervorheben, Forsythien senken ihr Gold ins Wasser, die Knospen der Bäume scheinen auf eine sehnsüchtige Art auf die Weite des Sees hinaus ausgerichtet zu sein.
Durch die chinesischen Besucher liegt zudem ein Hauch von Fernost über der Szenerie (in der Tat passen die chinesischen Damen mit ihren stark geschminkten, blassen Gesichtern gut zu den Blütenbüschen). Die Boote, die zur Insel hinübergleiten, sind jetzt voll mit chinesischen Gruppen besetzt und ähneln, vor allem wenn Rufe hin und her fliegen, Lustbarken auf einem chinesischen See.
Auf dem Uferweg kommen uns neue Gruppen entgegen. Viele haben Selfie-Stäbe dabei und machen von sich selbst Fotos neben einem Baum oder einem Strauch am See. Meine Freundin findet das unheimlich, da sie ja nur sich selbst anlächeln, das Lächeln also jegliche zwischenmenschliche Bedeutung verloren hat. Auch die Landschaft, die nur noch benutzt wird, tue ihr leid, sagt meine Freundin. Ich beobachte eine Chinesin, die systematisch in etwa zwei Meter Abstand alles abfotografiert, auch mich, der ich gerade mit einem Gepäckstück durch die Tür der Pension trete. Ich versuche zu lächeln, aber sie nimmt mich, wie alles andere, vermutlich kaum wahr.
Als wir in Plitvice ankommen, geht gerade die Sonne in dem riesigen Waldgebiet unter, die Wasserfälle rauschen talwärts, alles zieht einen hinein, und so laufe ich zum Naturpark hinunter. Der freundliche Wärter lässt mich noch ein, obwohl das Kartenhäuschen schon geschlossen ist. Die Hänge sind jetzt mit Alpenveilchen übersät, was ebenfalls ein Hinabgleiten bewirkt (in unserem Führer tragen sie den Namen oder eigentlich fürstlichen Titel Cyclamen purpurascens, man sieht aber auch eine weiße, scheue Art, die sich eng in kleinen Gruppen aneinanderdrängt).
In Plitvice bleiben wir wie meistens zwei Tage. Es ist wie ein minimaler Kuraufenthalt, den man manchmal nötig hat, um wieder zu sich zu finden. Die Abfolge der beiden Übernachtungen ist wichtig, die eine Art von Balance herstellen, aber natürlich auch der »freie« Tag dazwischen, der mehr oder weniger aus gedankenverlorenem Nichtstun besteht, umgeben von Vogelgezwitscher und dem gleichmäßigen Rauschen der Wasserfälle. Zuletzt waren wir vor anderthalb Jahren hier gewesen, als wir aus Bosnien zurückkehrten. Ein längerer Lebensabschnitt ging zu Ende, der neue war noch nicht richtig greifbar, und vielleicht brauchten wir deshalb das »Ritual der zwei Nächte« besonders.
Es war Anfang Dezember, nur noch ein Parkhotel geöffnet, auch dieses weitgehend leer, und wenn man aus dem Fenster blickte, starrte man in fast undurchdringlichen Nebel, was die Einsamkeit, aber auch die Naturverbundenheit noch erhöhte. Ein schweigsamer Bootsführer, der stoisch seinen Dienst versah, fuhr uns an unserem »freien Tag« zum unsichtbaren anderen Ufer hinüber, und wir stiegen zu den Oberen Seen hinauf, die gänzlich verlassen waren. Durch die geringe Sicht wirkte die Natur riesenhaft und urtümlich: die mächtigen Baumstämme, die auf eine undeutliche Wasserfläche hinausragten, das flüsternde, mannshohe Schilf, das gerade noch das Ufer ankündigte … Es war ein Zauberwald, und wir wunderten uns daher nicht, als uns tief im Inneren zwei Japanerinnen entgegenkamen, die wie in einem Manga gekleidet waren und Einkaufstüten aus Tokio mit sich führten. Die beiden unterhielten sich prächtig, benahmen sich fast übermäßig gelöst, was vielleicht an dem Nebel lag, der alle geografischen Grenzen ausgelöscht hatte. Es war wirklich gleichgültig, wo man sich genau befand.
Auf der Bootsanlegestelle, jetzt eine Insel oder ein Floß im Grau, trafen wir einen Landsmann von ihnen, einen hageren, hochgeschossenen Einzelgänger, der eine Kamera mit auffällig großem Objektiv umhängen hatte, was irgendwie rührend war, da ihm das Gerät an diesem Tag ja gar nichts nützte, lediglich ein Symbol für seine Suche darstellte. Bei der Rückfahrt auf dem schweigenden Boot war er außer uns der einzige Passagier und auch abends im nur schwach beheizten Speisesaal der einzige weitere Anwesende. Er hatte wieder die Kamera dabei und machte ein paar Aufnahmen, wandte sich gewissermaßen neuen Themen zu. Dann legte er sie neben sich auf den Tisch, und es sah aus, als ob sie, während er aß, weiterhin Eindrücke für ihn festhielt.
Am nächsten Morgen war der Saal gut geheizt und voll mit Leuten. Eine Parteiversammlung der regionalen HDZ, wie wir bald feststellten. An den Frühstückstischen saßen jetzt Herren mit Anzug und Krawatte, die meisten überdurchschnittlich groß und stattlich, auch einige aufwendig frisierte Damen, die irgendeine Diät einhielten und von den Herren wegen ihrer Geziertheit hofiert wurden. Die höheren Parteikader stießen verspätet und schon etwas gereizt dazu, was offenbar zu ihrer politischen Aura gehörte. Sie redeten ungeniert, da sie uns für gewöhnliche Touristen hielten. Die Erfolge der HDZ im benachbarten, zerrissenen Bosnien-Herzegowina waren das große Thema. Man konnte in Kroatien herrlich damit Stimmung machen, ohne im Land irgendeine Leistung erbringen zu müssen. Es war pure Psychopolitik.
In Sarajewo herrscht der Status quo, die »Impasse«, ein Wort viel zu vornehm, um die bedrückende Lage zu beschreiben. Das Dayton-Abkommen hat durch die Zugeständnisse an die Volksgruppen die ethnonationalen Parteien gestärkt, die seitdem triumphieren und das Land in einem Zustand der Unregierbarkeit halten. Es sollte eine vorläufige »Ordnung« sein, aber inzwischen kümmern sich die Internationalen kaum mehr darum, und die lokalen Politiker hüten sich, irgendetwas zu verändern, das ihnen Macht und feste Pfründe garantiert.
Die Leute, die wir treffen, sind allerdings herzlich wie ehedem, und kurzfristig verfolge ich die Theorie, dass diese Herzlichkeit im umgekehrten Verhältnis zur politischen Situation stehe. Man erlebt dann aber auch Gegenbeispiele, das heißt Menschen, die sich immer mehr dem System oder dem Charakter des Systems anpassen.
In unserem Hotelzimmer sehen wir abends den Sender CNN. (Er beherrscht das Haus, läuft schon zum Frühstück, und die Sprecher kommen uns bald wie Mitglieder einer Ersatzregierung vor.) Eine Dame mit blonden Lockenwellen berichtet sehr ungnädig über die Flüchtlingskrise in Europa. Darauf wird ein Reporter mit kahl geschorenem Kopf, wodurch er hart-realistisch wirkt, eingeblendet, der von einer »marriage of convenience between Erdogan and Merkel« redet. »So, it’s a marriage of convenience« fasst die Blondgelockte warnend und hochmütig alles noch mal zusammen.
Wir schalten auf PinkTV um, in dem eine Seifenoper läuft, mit nagelneuen Häusern und ebensolchen Autos sowie gut frisierten Leuten mit falschen Gefühlen. Die Emotionen in diesen schrecklichen, wie aus einem Katalog eingerichteten Häusern (kitschige Gemälde an den Wänden, meterlange Sideboards) sind völlig übertrieben. Eine blondierte Frau fängt an zu weinen (man denkt zuerst wegen ihrer Frisur), weil ihre Gegenspielerin, eine Schwarzhaarige, natürlich temperamentvoller ist und viel stärker in ihrer Argumentation.
Nach drei Tagen Sonne heftige Regenfälle, Bergdauerregen wie oft in Sarajewo … Im Innenhof des Landesmuseums, der gleichzeitig ein botanischer Garten ist, scheint der Frühlingsregen wie konserviert. Ein Wirbel aus Tropfen und Blütenblättern geht über die Rasenflächen, die vor Feuchtigkeit leuchten, hernieder, fällt in die kleinen Teiche, in denen die Tropfen ein glucksendes Konzert geben … Wie lange war diese schöne Stätte aus ideologischen Gründen (weil es eine gesamtstaatliche Einrichtung war und sich »Landesmuseum« nannte) geschlossen! Sogar die anmutigen Gestalten auf den griechischen Vasen scheinen wie aus einer Haft befreit. »It was closed for three years«, sagt die Dame an der Kasse, und es liegt so viel Schwermut in dem einen Satz, dass sie gar nichts hinzufügen muss. Wir kaufen ein paar Postkarten mit unschuldigen Aufnahmen von Pflanzen aus dem Botanischen Garten (zum Beispiel drei Glockenblumen vor grün schimmerndem, leicht erregtem Hintergrund, wobei die Dreizahl die Märchenhaftigkeit noch betont). Als wir die Karten später umdrehen, sehen wir, dass sie noch aus dem Jahr der Olympischen Spiele, also von 1984, sind.
Split wächst auf eine subtropische Art … Discounter, Reklamewände, neue futuristische Wohnblocks, dazwischen Schilfbiotope … Das archäologische Museum ist ein Ruheort wegen der wenigen Besucher, die sich hierher verirren, wegen der abgeklärten, alten Objekte, aber auch der Geschichten des Wärters. Er erzählt die gleiche Geschichte wie vor drei Jahren (eine Katze streicht dazu durch das Museum), von seiner Deutschlehrerin, bei der sie das ganze Deutsch in einem Jahr lernen sollten. »You must learn, learn, learn, she said.« Der Gegensatz sei die Französischlehrerin gewesen, sechsundzwanzig Jahre alt, Minirock. »Oh, how we learnt!«
Mit Italienisch hätte er gar keine Probleme gehabt, es sei einfach da, »it’s the Mediterranean«. Plötzlich kommt er auf die Ausgrabungen zu sprechen, er erregt sich, seit zehn Jahren sei fast nichts mehr geschehen. »Now we have democracy, they destroy everything!«
Im Museumsgarten klettert eine Smaragdeidechse langsam eine Zypresse hoch, Vogelgezwitscher erhebt sich über den Palmen, wie hochgeworfen durch die rauschenden Fächer, eine »Ara«, ein Votivaltar zwischen Buchsbaumsträuchern, deren Duft wie eine Droge ist, die Verzierungen selbst blütenhaft – was für eine Oase in dieser quirligen Stadt!
Abends gehen wir immer in das gleiche Vorstadtlokal, das wir von früher her kennen. Meine Freundin redet Kroatisch mit dem Kellner, ich radebreche an geeigneten Stellen dazu, und bald entwickelt sich ein persönliches Verhältnis, zumal noch keine Saison ist und nur wenige Gäste vorbeikommen. Das Meer beginnt direkt vor dem Fenster, der Wind streichelt die Tamarisken, und vor allem wenn draußen auf den Booten die Lichter angehen, meint man, selbst in einem kleinen, schaukelnden Ausflugsdampfer zu sitzen, der hinausfährt. Dieses Gefühl zusammen mit den stets erklingenden, süßen kroatischen Liedern verstärkt noch die Verbindung mit dem Kellner. Er eilt sogleich fliegenden Schrittes herbei, umsorgt uns wie müde Wanderer, beschreibt einheimische Speisen, dass einem das Wasser im Mund zusammenläuft, zelebriert beim Auftragen, bringt Nachtisch »vom Haus« etc. Ein Zustand höchster, allseitiger Zufriedenheit stellt sich regelmäßig ein, die schwellenden Lieder hallen in die glitzernde Nacht hinaus, und als wir dem Kellner eines Abends sagen müssen, dass wir am nächsten Tag abreisen, ist er ganz entgeistert, fast bestürzt. Er geht noch mit hinaus vor die Türe, obwohl draußen der »Jugo«, der Südwind, bläst, dass man davonfliegt, und er nur ein dünnes, weißes Kellnerhemd anhat, und drückt uns die Hände, eigentlich hält er sie fest, sichtlich traurig, dass die schöne, gemeinsame Zeit schon wieder zu Ende ist.