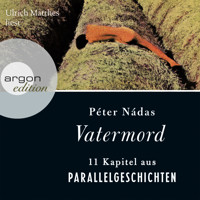29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Vor dem Schreiben liegt das Nichtschreiben – die Berührung mit der Realität, die für Péter Nádas viele Bezirke, Räume, Dimensionen umfasst. Ohne täglich von neuem all dessen innezuwerden, was sich im Bewusstsein drängt, von den Träumen, Alltagsbeobachtungen und ästhetischen Erfahrungen bis zu den verstörenden Nachrichten, könnte er nicht beginnen. Diese unverzichtbare Übung hat, neben seinen Meisterwerken der Erzählkunst, Betrachtungen zu Kunst und Literatur sowie große Abhandlungen hervorgebracht, in denen Nádas historische Verwerfungen und Abgründe des Menschlichen ausleuchtet. "Leni weint" versammelt die wichtigsten dieser Essays aus den Jahren 1989 bis 2014 - ein Vierteljahrhundert, das mit einem politischen Aufbruch in die Freiheit begann und mit dem Rückfall in den aggressiven Populismus endete. Wie es dazu kommen konnte, dass die Bürger Ungarns und anderer osteuropäischer Staaten heute wieder autoritär und nationalistisch regiert werden, wie sehr die Gründe in den Katastrophen des 20. Jahrhunderts, aber auch in globalen Entwicklungen zu suchen sind, das entwickelt Nádas mit Scharfsinn und Leidenschaft. Seine Kunst, das literarische Subjekt zum Schauplatz der Epoche zu machen, schließt das Nachdenken über anthropologische und moralische Fragen, über Wahrheit und Lüge, Kunst und Verbrechen, Vertrauen und Täuschung ein. Ob es um eine traumatische Erfahrung Leni Riefenstahls, "Hitlers Hofkünstlerin", geht, um die osteuropäische Schattenwirtschaft oder um die Folgen des 11. Septembers - intellektuelles Engagement und literarische Sensibilität gehören zusammen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 671
Ähnliche
Péter Nádas
Leni weint
Essays
Aus dem Ungarischen von Akos Doma, Heinrich Eisterer, Heike Flemming, Ruth Futaky, Zsuzsanna Gahse, Hildegard Grosche, András Hecker, Andrea Ikker, Lacy Kornitzer, Ilma Rakusa und Timea Tankó
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Vor dem Schreiben liegt das Nichtschreiben – die Berührung mit der Realität, die für Péter Nádas viele Bezirke, Räume, Dimensionen umfasst. Ohne täglich von neuem all dessen innezuwerden, was sich im Bewusstsein drängt, von den Träumen, Alltagsbeobachtungen und ästhetischen Erfahrungen bis zu den verstörenden Nachrichten, könnte er nicht beginnen.
Diese unverzichtbare Übung hat, neben seinen Meisterwerken der Erzählkunst, Betrachtungen zu Kunst und Literatur sowie große Abhandlungen hervorgebracht, in denen Nádas historische Verwerfungen und Abgründe des Menschlichen ausleuchtet. «Leni weint» versammelt die wichtigsten dieser Essays aus den Jahren 1989 bis 2014 – ein Vierteljahrhundert, das mit einem politischen Aufbruch in die Freiheit begann und mit dem Rückfall in den aggressiven Populismus endete. Wie es dazu kommen konnte, dass die Bürger Ungarns und anderer osteuropäischer Staaten heute wieder autoritär und nationalistisch regiert werden, wie sehr die Gründe in den Katastrophen des 20. Jahrhunderts, aber auch in globalen Entwicklungen zu suchen sind, das entwickelt Nádas mit Scharfsinn und Leidenschaft.
Seine Kunst, das literarische Subjekt zum Schauplatz der Epoche zu machen, schließt das Nachdenken über anthropologische und moralische Fragen, über Wahrheit und Lüge, Kunst und Verbrechen, Vertrauen und Täuschung ein. Ob es um eine traumatische Erfahrung Leni Riefenstahls, «Hitlers Hofkünstlerin», geht, um die osteuropäische Schattenwirtschaft oder um die Folgen des 11. Septembers – intellektuelles Engagement und literarische Sensibilität gehören zusammen.
Über Péter Nádas
Péter Nádas, 1942 in Budapest geboren, ist Fotograf und Schriftsteller. Bis 1977 verhinderte die ungarische Zensur das Erscheinen seines ersten Romans «Ende eines Familienromans» (dt. 1979). Sein «Buch der Erinnerung» (dt. 1991) erhielt zahlreiche internationale Literaturpreise. Zuletzt erschienen der große Roman «Parallelgeschichten» und seine Memoiren eines Erzählers: «Aufleuchtende Details».
Unter anderem wurde Nádas mit dem Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur (1991), dem Kossuth-Preis (1992), dem Leipziger Buchpreis für Europäische Verständigung (1995) und dem Franz-Kafka-Literaturpreis (2003) ausgezeichnet. 2014 wurde ihm der Würth-Preis für Europäische Literatur verliehen. Péter Nádas lebt in Budapest und Gombosszeg.
Behutsame Ortsbestimmung
Ausgehend von der genauen Betrachtung eines einzelnen Wildbirnenbaums
Seit ich in der Nähe dieses gigantischen Wildbirnenbaums lebe, brauche ich mich nicht mehr fortzubewegen, um in die Ferne zu sehen oder in die Zeit zurückzublicken.
Die Zweige der Wildbirne sind dicht mit kleinen runden bauchigen Blättern bewachsen, glänzend und hart wie Rindsleder. Ihre belaubten Äste neigen sich bis zur Erde, die Hauptäste stemmen die ebenmäßige Kugelkrone gegen den Himmel, schirmen die Hitze ab, dämpfen das Licht, lassen die Niederschläge abprallen.
Auch anderswo im Landstrich Göcsej, auf seinen Hügeln, an den Südosthängen der langgestreckten Höhenzüge, findet man vereinzelte Wildbirnenbäume. Von Ende August bis Anfang Oktober werfen sie zu Unmengen ihre herben Früchte ab und bedecken damit die magere Erde. Die Einheimischen verarbeiten das Fallobst zu Schnaps und Essig, und beides ist von unvergleichlicher Qualität.
Seine Fruchtbarkeit ist das Verderben des Wildbirnenbaums.
Nach schweren Wolkenbrüchen, wenn Bäume und Pflanzen keine Feuchtigkeit mehr aufnehmen, können die Hauptäste das Gewicht der Früchte nicht länger tragen und brechen. Solche Sommerkatastrophen verwüsten die Laubkronen, sie werden verwundbar, aber selbst in diesem zerrauften Zustand, immer stärker verwitternd, halten sie sich jahrhundertelang. Unser gigantischer Wildbirnenbaum hat seine ebenmäßige Krone bewahrt. Arbores excelsae, wie es in der Fachsprache der Forstwissenschaft heißt, ein hervorragendes Exemplar seiner Gattung. Wenn auch einmal, an einem dösigen Sommernachmittag, ein gewaltiges Krachen die Stille zerriss und gleichzeitig der Boden unter mir schmerzlich aufstöhnte. Ich rannte hinaus, um zu sehen, was geschehen war, abgebrochen lag da ein mächtiger Seitenast. Auf den ersten Blick konnte ich gar nicht ermessen, welche Tragödie sich ereignet hatte. Als wäre ihm ein Arm abgerissen. Ich zersägte ihn, im Herbst wurde er in unserem Kachelofen zu Wärme. Seitdem bekümmert mich, dass er fehlt. Ich versuche den Baum so anzuschauen, dass ich seine Wunde nicht sehe. Im Laufe eines Jahrzehnts hat das Laub anderer Äste die Lücke in der Krone auch fast wieder gefüllt. Beinahe möchte ich sagen, unser Wildbirnenbaum weiß wohl, was er wann tun muss. Allmählich stellt er die Vollkommenheit wieder her, zumindest den Anschein der Vollkommenheit.
Zum zweiten Mal schreibe ich unser Wildbirnenbaum, obwohl ich ihn niemals als Eigentum betrachtet habe. Eher ist es umgekehrt. Ich empfinde es als besonderes Glück, seit zwei Jahrzehnten in seiner Nähe leben und ihn in voller Blütenpracht, dicht belaubt oder über Monate ganz kahl sehen zu dürfen, wenn ich von meiner Arbeit aufblicke.
Wie die ältesten Bewohner erzählen, hat sich das Dorf schon zu ihrer Jugend an Sommerabenden, wenn die Hitze nicht weichen wollte, unter dem Baum versammelt. Demnach muss er bereits vor achtzig Jahren eine beachtliche Größe gehabt haben. Solange wir keinen Zaun hatten, kamen die Alten zur Dämmerstunde mit ihrem Bier und setzten sich an unseren weißen Gartentisch unter dem Baum, und wenn die Nacht hereinbrach, unterhielten sie sich, leise, immer noch. Man muss dazu wissen, dass die Temperatur unter einer so großen Wildbirne auch in der drückendsten Sommerhitze erträglich bleibt. Inzwischen lebt von diesen Alten keiner mehr.
Ergänzend möchte ich sagen, dass die Einheimischen unter dem, was sie Dorf nennen, nicht einfach den Ort mit seinem geographischen Namen verstehen. Sie gebrauchen das Wort im Sinne von Welt, ähnlich wie die Franzosen, wenn sie von tout le monde sprechen. Das Dorf ist gleichbedeutend mit tout le monde, wer jedoch außerhalb dieses Umfelds lebt, zählt natürlich nicht dazu. Damit halten sie es ein wenig so wie die Spartaner, die Lesbier, die Athener und die übrigen Griechen, die alle, die keine Griechen waren, für Barbaren hielten. Oder zumindest für animalische Wesen, die nichts von ihren Göttern wussten und nicht ihre Sprache sprachen, mithin keine Menschen waren. Oder so wie jenes aus deutschen, polnischen, ungarischen, tschechischen und italienischen Söldnern zusammengetrommelte Heer, das einst unweit des Dorfes gegen die furchterregenden Türken kämpfen sollte. Die Krieger der verschiedenen Nationalitäten wurden in der Nacht vor der Schlacht von so heftigem Zorn ergriffen, dass sie mit ihren Waffen übereinander herfielen. Sie konnten es nicht ertragen, dass die anderen anstelle normaler Rede eher tierische Laute von sich gaben und die Sprache normaler Menschen nicht verstanden. So metzelten sie sich gegenseitig nieder, schlugen einander in die Flucht und verschafften damit dem gefürchteten Feind freie Bahn, der dann für viele Jahrhunderte fast alles verwüstete.
Bei uns gehören die Bewohner naher Dörfer zur vorhandenen Welt dazu, die Bewohner entfernterer Dörfer nicht.
Wahrscheinlich verhält sich das so, weil nach langwierigen, komplizierten, geheimen und öffentlichen Abstimmungsmanövern alle im Dorf ganz plötzlich etwas in gleicher Weise tun müssen, während andere in anderen Dörfern fraglos etwas ganz anderes anders und zu einer anderen Zeit erledigen müssen, und das definiert den Unterschied. Wenn das Dorf die Zeit zum Kartoffelsetzen oder zur Maisernte gekommen sieht, steht außer Frage, dass jeder Kartoffeln setzen oder Mais ernten muss, und also setzt das Dorf Kartoffeln oder erntet Mais. Lange habe ich diese koordinierten und wetterabhängigen Aktivitäten mit Befremden beobachtet, doch mit meinen Alleingängen immer das Nachsehen gehabt. Tue ich etwas nicht so und nicht dann, wie und wann das Dorf es tut, mache ich mir im physischen Sinne des Wortes das Leben schwer. Was das Verhältnis von Himmel und Erde, von Boden und Niederschlag angeht, kann auch das Dorf auf nichts anderes setzen als auf Wahrscheinlichkeit. Nur dass keine abweichende Meinung eines Einzelnen es daran hindert, sich dieser Wahrscheinlichkeit zu unterwerfen. Es ist ein so tiefer und auf alle Lebensphänomene ausgedehnter Zwang, dass sich ihm das an individuelle Entscheidungen gewöhnte Bewusstsein nur schwer unterordnen kann.
Wenn das Dorf etwas tut oder wahrnimmt, dann haben weder die Handlung noch die Wahrnehmung ein Subjekt; eine Person beziehungsweise die an der Handlung oder Wahrnehmung beteiligten Personen werden rituell vom kollektiven Bewusstsein verschlungen. Heute setzt das Dorf Kartoffeln. Natürlich gibt es immer tonangebende Leute, die auf die langwierige, kompliziert und geheimnisvoll vorbereitete Entscheidung wahrscheinlich größeren Einfluss gehabt haben als andere, nachdem sie aber einmal gefallen ist, unterwerfen sich ihr ausnahmslos alle, und die Rolle einer einzelnen Person hat keine Bedeutung mehr. Egal, ob ihre Einschätzung richtig oder falsch gewesen ist. Im Laufe von zwanzig Jahren habe ich in Zusammenhang mit den gemeinsamen Entscheidungen noch nie von einem nachträglichen Vorwurf gehört. Es wird höchstens vermerkt, dass es in diesem Jahr so, in einem anderen Jahr anders gemacht worden ist. Die Verantwortung dafür wird nicht mit dem Namen einer Person verknüpft, auch nicht mit dem eigenen – selbst im Falle augenfälliger Versäumnisse nicht. Die Dinge sind schon im Universum geregelt, und sie geschehen auch so.
Bei mir hat es mindestens zehn Jahre gedauert, bis ich akzeptiert habe, dass ich beim Mähen auch bei größter Hitze eine lange Hose und ein langärmeliges Hemd tragen und das Hemd bis zum Kragen zuknöpfen muss. Wer es anders macht, kann seine Körpertemperatur nicht richtig regulieren, der Schweiß erkaltet auf der Haut, die Bremsen peinigen ihn zu Tode.
Der Begriff Dorf hat jedoch noch einen weiter gefassten, abstrakteren Sinn. Er umfasst nicht nur alle, die zu uns gehören, ihre Wahrnehmungen und Handlungen, alle, die uns durch Blutsbande nahestehen samt ihrem Tun oder Lassen, sondern auch den vollkommen kollektiven Bewusstseinsinhalt, an dem jeder teilhat. Außerhalb des Dorfwissens existiert kein Wissen.
Ich will eine Geschichte erzählen, um diesen Wortgebrauch zu erhellen beziehungsweise die unanfechtbare und wasserdichte Vorstellung von der Welt, die dahintersteht.
Im Zweiten Weltkrieg ging die Front mehrmals über diese Gegend hinweg. Einmal, als die Russen dabei waren, die Deutschen zu vertreiben, desertierten sechs deutsche Soldaten von ihrer Einheit und versteckten sich in einem nahe gelegenen Weinberg auf dem Dachboden des Kelterhauses. Nicht dass sie sich gerne ergeben hätten, aber sie hatten genug vom Krieg. Das Dorf respektierte ihren Entschluss und versteckte sie sechs Jahre lang. Was nicht heißt, dass sie sechs Jahre lang nicht vom Dachboden herunterkonnten, im Gegenteil, sie lebten und arbeiteten draußen auf den Feldern wie alle anderen auch. Im ersten Frühling verletzte sich einer der Soldaten mit dem Pflug am Fuß, bekam eine Blutvergiftung, hohes Fieber und starb innerhalb weniger Tage. Das Dorf wusste, dass der Mann mit dem Tode rang, dennoch holte niemand einen Arzt. Der in einer entfernten Ortschaft lebende Bezirksarzt zählte nicht zum Dorf. Auch der Pfarrer nicht, deswegen wurde der Tote ohne Pfarrer beerdigt.
Das undurchdringliche und wasserdichte Weltverständnis, das den einen Deutschen das Leben kostete, machte jedoch die anderen fünf so unverletzlich und frei, dass sie nach kurzer Zeit nicht nur bei ortsansässigen Landwirten arbeiteten, sondern auch in benachbarten Dörfern als Tagelöhner beschäftigt waren. Dem stand nichts im Wege, denn die Bewohner der benachbarten Dörfer sind ebenfalls tout le monde, und über das, was jeder weiß, muss nicht geredet werden, und jemand anderer kann es tatsächlich nicht wissen. Deswegen meine Feststellung, dass ich in einer Gegend lebe, wo die Menschen in prämodernen Begriffen denken.
In den dunkelsten Jahren des Kalten Krieges, als die ganze ungarische Gesellschaft von einem unglaublichen Netz von Spitzeln und Geheimagenten überzogen war, genossen die fünf deutschen Männer nicht nur vollkommenen Schutz; eines schönen Tages, als sie ihr Heimweh nicht mehr bezähmen konnten, brachten die Einheimischen sie sogar über die nahe gelegene österreichische Grenze. Über Stacheldraht, über Minenfelder, den gefürchteten Eisernen Vorhang hinweg.
Man bekommt das Gefühl, dass das Leben hier nicht aus persönlichen Erlebnissen, nicht aus Erinnern und Vergessen, sondern aus tiefem Schweigen besteht.
Was auch verständlich ist, sind doch die mit individuellem Bewusstsein gesegneten Menschen gezwungen, immer etwas mehr zu sagen, als sie wissen, während man in einem prämodernen Umfeld als Einzelner wesentlich weniger sagt, als jeder weiß.
In dieser von Wäldern durchzogenen stillen Gegend, an deren westlichem Rand die Landstraße immer noch dort verläuft, wo die Römer sie einst erbaut haben und die lateinischen Namen der Provinzstädte so dauerhaft sind wie der Spitzname eines nahen Bekannten, schlägt die Erde starke und regelmäßige Wellen. Asphaltierte Straßen wurden erst von englischen und amerikanischen Ölgesellschaften in den dreißiger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts angelegt, als Geologen in den Tiefen dieser schön gewellten Erde große Ölvorkommen entdeckten. Die Straßen folgen größtenteils dem Verlauf der ehemaligen Fahrwege, sie steigen aus den von unbedeutenden Bächen durchzogenen Tälern zu den Hügeln auf, um sich dann behutsam in ein anderes Tal hinabzusenken, wo zwischen Weiden und Hainbuchen ebenso Schilf, Teichsimse, Dotterblume und Wasserschwertlilie auf den Bulten wachsen und ein ebensolches namenloses Bächlein dahinplätschert. Täler und Hügel ziehen sich von Nordwesten nach Südosten. Die Dämmerung hüllt sie in dichten Dunst, den erst der nächste Morgen lichtet. Eine düstere Landschaft, deren heutige Formation nicht durch die Erdbewegungen und nicht durch die Fluten des einstigen Meeres, sondern durch die von den Alpen herabgleitenden Schnee- und Eismassen am Ende der Eiszeit entstanden ist. Wer auf einer Anhöhe innehält und in die Richtung blickt, wo er die sanfte Adria und die Halbinsel Istrien vermutet, vernimmt noch etwas von dem zehntausend Jahre anhaltenden unheimlichen Knirschen und Poltern der Moräne. Oder zumindest lassen die physischen Gegebenheiten der Landschaft ihn den unheimlichen Klang und das Maß des einstigen Zerstörens und Aufbauens erahnen.
Die kleinen Ortschaften auf den Hügelkuppen liegen so nah beieinander, dass das Dorf nicht nur die Glocken herüberläuten hört, dank deren es weiß, dass jemand gestorben ist, jemand zu Grabe getragen, eine Hochzeit abgehalten, in einer weiter entfernten Kirche ein Neugeborenes getauft wird oder dass es einfach nur Mittag, Abend oder Morgen geworden ist und das Leben danach gleichmäßig und ereignislos in den gewohnten Bahnen weiterläuft; bei klarem Wetter sind zwischen Zwetschgen- und Apfelbäumen sogar die ersten Häuser zu erkennen.
Nicht nur das Wissen, auch das Hören und Sehen funktioniert auf der Ebene des entpersönlichten Kollektivs. Man hört und sieht gemeinsam. Immer von neuem überrascht es mich zutiefst, dass es genügt, wenn jemand neue, noch nie gezeigte Kleider trägt, um nicht mehr erkannt zu werden. Plötzlich versteht man, dass die Menschen im Zeitalter vor der Individualisierung tatsächlich durch Verkleidung zu täuschen waren. Mehr noch, kommt ein Fremder ins Dorf, sind die Einheimischen unfähig, sein Alter einzuschätzen. Sie haben dafür keinen Blick, wahrscheinlich weil sie ihr Augenmerk nicht auf das Äußere, sondern auf den Charakter, die Eigenschaften richten. Im Hinblick auf das äußere Erscheinungsbild können sie sich gegebenenfalls auch völlig konträr verhalten. Obwohl sie allen Fremden gegenüber auf eine maßlose, geradezu peinliche Weise misstrauisch sind, lassen sie gleichzeitig jeden, der Anzug und Krawatte trägt und irgendein Papier vorweist, ohne Bedenken ins Haus. Dementsprechend geben sich Schleichdiebe als Steuerbeamte oder Landmesser aus. Der Trick gelingt immer. Jedem Fremdwort schreiben die Dorfbewohner eine zu seinem Klang passende Bedeutung zu und bauen es so in ihre Sprache ein. Sie unterscheiden nur Grundfarben, Gelb, Rot, Blau, weshalb Farben braun genannt werden, die anderswo Lila, Ocker oder Beige heißen. Dunkelbraun, Dunkelgrau oder Dunkelblau gelten auch im Kleidergeschäft der nahen Kleinstadt als Schwarz. Falls jemand bezweifelt, dass differenziertes Farbempfinden nicht auf einer naturgegebenen menschlichen Fähigkeit, sondern auf Übereinkunft beruht und sich manchmal sogar aus lokalen Konventionen herleitet, hier kann er sich davon überzeugen.
Die Kenntnis dieser tiefsitzenden prämodernen Eigenschaften hilft uns zu verstehen, warum diese Region den tödlichen Versuchungen der europäischen Geschichte – Nationalsozialismus, Faschismus und Bolschewismus – erlegen ist. Da tritt plötzlich einer auf und spricht, persönliche Intentionen verfolgend, im Namen eines kollektiven Bewusstseins. Für das prämoderne Bewusstsein ist die persönliche Intention hinter der Deklaration jedoch nicht erkennbar.
Wenn irgendwo Rauch aufsteigt, weiß das Dorf, wer Feuer gemacht hat, riecht das Dorf, was er verbrennt. Die Welt ist überschaubar, ein jeder im Auge zu behalten. Jemanden, der über das im Auge zu Behaltende hinausgeht, kann sich das Dorf nicht vorstellen.
Als im Frühling 1990 jeder Bürger der frisch gegründeten Republik erstmals frei wählen konnte, bat mich der Gemeindevorsteher, ihm doch zu sagen, wen das Dorf wählen solle. Er kam wie einer, den das Dorf geschickt hat. In der Tat war er vom Dorf geschickt worden, denn soweit das Auge reicht und noch ein gutes Stück weiter, hatte kein Mensch irgendeine Ahnung vom Sinn und Inhalt politischer Freiheit. Vielleicht in ein paar fernen Großstädten, Prag, Warschau, Wien, Berlin oder Budapest, doch auch dort nur einige wenige. Die Diktatur war ja 1989 auch nicht zusammengebrochen, weil die Völker Ost- und Mitteleuropas allmählich zu der Überzeugung gelangt wären, die Weltordnung der liberalen Demokratie und der Marktwirtschaft sei doch besser und gerechter als die des real existierenden Sozialismus oder des noch nie realisierten Kommunismus, da sie dem Einzelnen eine größere Portion Glück bietet. Schön wäre es, wäre es so gewesen. Doch die Wahrheit ist, dass die Völker Ost- und Mitteleuropas, dem Gebot ihres animalischen Egoismus und Überlebenstriebs gehorchend, hartnäckig auf einem Minimum an Privateigentum und Selbstbestimmung bestanden; dass sie darauf bestanden, sich zu beschaffen oder wiederzubeschaffen, was ihnen zusteht. In dieser Absicht hatten sie gemeinsam jenes System untergraben, das danach strebte, dem uralten menschlichen Hang zur Kollektivität und dem mindestens ebenso alten Wunsch, dass der Mensch gleich sei, schon hier auf Erden, dank Diktatur, Terror, Massenmord, der rigiden Beschränkung von Rede-, Versammlungs- und Pressefreiheit, eine märchenhafte Form zu verleihen.
Hätte ich dem Gemeindevorsteher gesagt, wen das Dorf wählen soll, dann hätte es seine Stimme zweifellos der Partei oder dem Kandidaten gegeben, denen ich meine gab, ich habe es aber nicht gesagt. Nicht dass ich die Verantwortung des ausgesprochenen Wortes gescheut hätte. Sondern weil ich vom ersten Moment an die Auffassung, die ich mir selbst von politischer Freiheit und Demokratie gebildet hatte, nicht verleugnen wollte. Ich habe lieber kurz dargelegt, welche Anschauungen die einzelnen Kandidaten meiner persönlichen Meinung nach vertreten und mit welchem Vor- oder Nachteil das Dorf demgemäß im Zusammenhang mit welchem Kandidaten zu rechnen hätte. Währenddessen sah ich dem Gemeindevorsteher an, dass er mein Verhalten als Zurückweisung empfand und meinem Vortrag seiner Enttäuschung wegen nur teilweise folgen konnte. Unmutig ging er davon, sozusagen unverrichteter Dinge, mit mehr Zweifeln beladen, als er gekommen war. Es war mir immer noch lieber, als wenn ich ihn auf seiner magischen und mythischen Bewusstseinsebene erreicht und so getan hätte, als sei ich ein Schamane, der ihm Dinge sagen kann, die anderen vorauszusehen nicht möglich sind. Inzwischen ist auch er tot, und noch heute erfüllt mich ein Gefühl von Zufriedenheit, dass ich ihn zwar enttäuscht, ihm aber hinsichtlich des Grundcharakters der Demokratie nichts vorgemacht habe.
Das Dorf musste die Erfahrung machen, dass es zum ersten Mal in seiner Geschichte nicht mehr über eine unanfechtbare, von den Ereignissen der Außenwelt wasserdicht abgeschlossene Meinung verfügen kann. Jeder muss einzeln über seine persönliche Meinung entscheiden, was diese Meinung natürlich höchst fragil und das persönliche Leben höchst gefährlich macht.
In jenen heißen Sommernächten, von denen die Dorfältesten erzählen, hat man unter der Wildbirne leise gesungen. Alle, die es erzählen, betonen, leise.
Das Dorf hat leise gesungen.
Sicherlich wollte das Dorf die Nacht nicht ungebührlich stören.
Die Mentalität der Einheimischen weist bis heute starke magische und mythische Bewusstseinsinhalte auf, obgleich die Welt um sie herum offenkundig in eine ganz andere Richtung geht. Ich werde ein paar leichter verständliche Beispiele anführen, damit wir uns diese eigenartige Spaltung klarmachen können.
Die Einheimischen wissen zum Beispiel, dass die Menschen sich anderswo grüßen, da sie auch auswärts arbeiten gehen, doch innerhalb des Dorfes ist der Gruß nach wie vor unbekannt. Auch die Bewohner der umliegenden Dörfer grüßen sich nicht. Sie verabschieden sich auch nicht voneinander. Wenn sich Nachbarn, Verwandte oder Bekannte auf der Straße oder im Bus begegnen, fangen sie statt eines Grußes auf der Stelle zu sprechen an und reden so lange, bis der andere außer Hörweite ist. Alles andere wäre unhöflich. Sie fragen auch nicht, wie es um das werte Befinden steht. Höfliche Erkundigungen dieser Art erregen bei ihnen eher Betroffenheit und Schrecken. Hinsichtlich des täglichen Seelen- und Körperzustands gibt es nämlich keine abstrakten Reflexionen, obgleich sie gerne und ausführlich über die qualvollsten Krankheiten berichten und stolz die Blessuren an ihren Körpern vorzeigen. Womöglich schlagen sie die Röcke hoch und schieben die Hosen herunter, um zu demonstrieren, dass sie trotz allem überlebt haben. Während des Gesprächs hören sie einander nicht zu, der Dialog ist ihnen unbekannt. Sie haben keine Meinung zu diesem und jenem, sondern reden unausgesetzt, erzählen eine einzige große Geschichte. Sind mehrere zur Stelle, dann reden sie sozusagen parallel übereinander hinweg, manchmal zu dritt oder zu viert, als sprächen sie ihre unpersönlichen Monologe auf ein einziges, endloses Tonband. In solchen Fällen entsteht ein fürchterliches Stimmengewirr, trotzdem registrieren sie die Behauptungen und Äußerungen in den Erzählungen der anderen genau, analysieren und interpretieren sie vom Standpunkt des kollektiven Bewusstseins und fügen sie dann an entsprechender Stelle in die große Chronologie der Dorfgeschichte ein.
Es ist nicht möglich, die Behauptungen und Äußerungen aufgrund späterer Erkenntnisse oder früherer Trugschlüsse zu korrigieren. Das wird nicht toleriert, und es wird auch gar nicht erst versucht. Der Vorgang der Korrektur ist vollkommen unbekannt, deswegen ist es nicht nur nicht möglich, Missverständnisse aufzuklären, es ist auch nicht möglich, unbekannte Begriffe einzuführen oder falsch verstandene Begriffe zu berichtigen. Wahrscheinlich ist es nicht möglich, weil das Zeitempfinden und die örtliche Zeitrechnung anders sind. Damit sich im kollektiven Bewusstsein etwas ändert, bräuchte es wahrscheinlich noch die Erfahrung mehrerer hundert Jahre, die von der eigenständigen Äußerung eines Einzelnen nicht ersetzt werden kann. Die Eigenart des Zeitempfindens geht auch daraus hervor, dass es in der großen dorfgeschichtlichen Erzählung zwar Tage gibt und an diesen dicht aufeinanderfolgende Ereignisse, doch wie bei den antiken Geschichtsschreibern keine Jahreszahlen.
Es wird stets viel gemeinsam gearbeitet. Man arbeitet in möglichst großem Kreis, die ganze Familie arbeitet mit den Angehörigen anderer Familien zusammen, mit denen sie aus irgendwelchen Gründen in eine wirtschaftliche Verbindung treten muss. Während der Arbeit wird unaufhörlich geredet, zuweilen anhaltend geschrien, da beim Gerede unter freiem Himmel beträchtliche Entfernungen zu überbrücken sind. Die Lautstärke übertrifft immer die individuelle Notwendigkeit. Für fremde Ohren klingt das wie ein sonderbares Arbeitslied, das jeder, den gemeinsamen Rhythmus einhaltend, mit erhobener Stimme sich selbst vorträgt. Als müsste sich jeder andauernd den Sinn der gemeinsamen Arbeit bestätigen.
Über den Wert des Geldes ist jeder genauestens im Bilde, über den Zusammenhang von Geld und Arbeit nicht weniger. Im internen Leben des Dorfes ist Geld trotzdem kein Zahlungsmittel, und daher lässt sich der Wert der hier verrichteten Arbeit wohl kaum in Geld ausdrücken. Wenn jemand von auswärts kommt, um eine Arbeit zu verrichten, wird er bezahlt, innerhalb der Dorfgrenzen aber macht bis auf den heutigen Tag niemand irgendetwas für Geld. Ein außenstehender Beobachter erhält natürlich selten Einblick in diese Naturalwirtschaft. Es wird Tauschhandel mit Materialien, Naturalien und Arbeit betrieben, der Marktwert der Transaktionen aber wird nicht von äußeren Faktoren, sondern von den jahrhunderteweit zurückgehenden inneren Marktbedingungen bestimmt. Die mit Geld oder Geldmarkt nichts zu tun haben. Merkwürdigerweise auch dann nicht, wenn es sich um Waren handelt, die für Geld erworben wurden. Wie etwa Backsteine, Dachziegel, Brunnenringe oder Betonträger, die im internen Kurs durch Arbeit, Naturalien oder irgendwelche anderen Güter ablösbar werden, wenn auch keinesfalls für jeden.
Man behält nicht nur über Jahrzehnte hinweg im Gedächtnis, wer wem wann was gegeben und im Tausch dafür bekommen hat beziehungsweise schuldet, sondern diese Tauschhandelsakte prägen auch das Verhältnis von Familien und Personen untereinander entscheidender als irgendetwas sonst. Dieses dem Fremden unbekannte und unüberschaubare System von Interessen ist irgendwann in grauer Vergangenheit entstanden und geht einer nicht absehbaren Zukunft entgegen. Und da somit der Wert von Beziehungen wesentlich höher ist als der Wert einzelner Dinge und die einzelnen Dinge wiederum nicht in kommerzielle Werte konvertierbar oder in Geld einwechselbar sind, gibt es innerhalb der Dorfgrenzen keine Forderungen und Schulden im klassischen Sinn. Wenn ich etwas bekommen habe, ist es unausbleiblich, dafür auch zu geben, doch das auf gegenseitigem Vertrauen beruhende, niemals schriftlich fixierte Geschäft kann so lange auf Eis gelegt werden, bis der Partner etwas braucht, das ich ihm geben kann. Weder hat es der eine eilig, die virtuelle Forderung zu begleichen, noch der andere, die virtuelle Schuld einzutreiben, er macht gar keine Anstalten dazu, im Gegenteil, er will ja gar nichts Gleichwertiges zurückbekommen. Anscheinend liegt diesen Geschäften die Erfahrung zugrunde, je mehr Schuldner jemand in Reserve hat und je ansehnlicher die Schuld, umso größer seine Chancen, in Notlagen Hilfe zu bekommen. Was vor wenigen Jahrzehnten noch Voraussetzung zum Überleben war.
Natürlich sind auch Betrug, Diebstahl und Gewalt, Willkür und sexuelle Exzesse keine unbekannten Phänomene. Für diese Fälle gibt es Sanktionen und für diese wieder verschiedene Abstufungen, jedoch erinnern weder Verfahren noch Strafe an Verfahren und Strafen, wie sie in den verschiedensten modernen Gesellschaften oder schon in den näher liegenden Städten üblich sind. Schon allein deswegen nicht, weil man Betrüger, Diebe, Gewalttäter oder Verrückte nicht aus dem Dorf entfernen kann. Das ginge nur mit behördlicher Hilfe, doch im Laufe von zwanzig Jahren ist dergleichen nicht vorgekommen, und soweit man den Erzählungen glauben darf, auch früher nicht. In zwanzig Jahren habe auch ich den Eindruck gewonnen, dass kein Dorf ohne ein paar Verrückte existieren kann, es zumindest immer einen Dieb geben muss. Der Diebstahl gemahnt zumindest daran, dass man auch selbst nichts anderes ist als ein fürchterlicher Parasit am Leib der Natur und mit seinen heimlichen Passionen eine ziemliche Last auf dem Rücken der Gesellschaft. Es gibt Übergeschnappte, Diebe, verirrte Schafe, sie alle sind Angehörige von Familien, die in engen verwandtschaftlichen Beziehungen zu anderen Familien stehen, die aber nicht nur untereinander, sondern mit allen anderen enge Beziehungen des Gebens und Nehmens unterhalten.
Eigentlich wäre nichts zu machen, das Dorf muss jedoch im Interesse von Ruhe und Ordnung etwas tun.
Wenn ein außergewöhnlicher Vorfall das Dorf erschüttert, wird zuerst ein schnelles Abstimmungsverfahren eingeleitet. Aus der Notwendigkeit dieser Prozedur wird rückblickend verständlich, warum jeder ständig über alles und jedes Bescheid wissen muss. Wer war wo, wer hat was gesehen, was ist wann und wo geschehen. Solche Fragen muss in diesen bedrohlichen Stunden jeder beantworten. Aus den Antworten ergibt sich selbst dann noch ein Bild, wenn keiner etwas gesehen hat, denn jeder kennt die Gewohnheiten von jedem, und so wird in diesem Fall das Ausschlussverfahren angewendet. Der Verdächtige ist schnell ausgemacht, im Allgemeinen ein Rückfalltäter. Was wiederum das Dorf nur in der Überzeugung bestärkt, dass Verbrechen unvermeidlich sind und man höchstens das Ausmaß des Schadens begrenzen kann. Welche Person gemeint ist, teilt man sich untereinander durch allgemeine Andeutungen mit, so dass der Name nicht ausgesprochen werden muss. Die äußerste Grenze des Namhaftmachens ist erreicht, wenn man sagt: «Ich weiß es, aber ich sage nicht, an wen ich denke. Du weißt es ja selbst.» Und so ist es wirklich. Per Ausschlussverfahren weiß es das Dorf, aber es weiß es, als hätte es dieses Wissen vom ersten Augenblick an gehabt. Jeder weiß, um wen es sich handelt, obwohl niemand seinen Namen ausgesprochen hat.
Mit der Verurteilung wartet man so lange, bis eine größere Gruppe mit dem Verdächtigen an einem Ort versammelt ist. In seiner Gegenwart tragen sie das Geschehene vor und beobachten ihn. Entsetzliche Augenblicke. Und das ist noch die mildeste Strafe. Es gibt die Prügelstrafe, es gibt die regelmäßige Prügelstrafe, es gibt das Anzünden der Scheune und das Anzünden des Hauses, und es gibt Mord. Einer ist zufällig in den Brunnen gefallen. Als ich vor vierzig Jahren zum ersten Mal in das Dorf kam, habe ich selbst noch den verkohlten Dachstuhl eines Hauses gesehen.
Über die schwereren Strafen sprechen sie auch untereinander nicht. Als drückendes Schweigen, als schwarze Löcher leben sie in der großen Erzählung fort.
Ich kann nicht sagen, dass das Dorf tot ist. Es lebt. Allerdings haben sich in den letzten Jahren die Lebensbedingungen grundlegend verändert, ein Teil der Bevölkerung ist abgewandert, die Abgeschlossenheit hat sich beträchtlich gelockert. Seit langem gibt es keine so schweren Delikte mehr, dass das Dorf zu den am strengsten verschwiegenen Mitteln greifen müsste. Bei der Vollstreckung einer verbalen Verurteilung dagegen bin ich selbst noch Zeuge gewesen.
Während der langen Jahre der Diktatur hatte sich dank dieses Systems familiärer, die Geldwirtschaft außer Kraft setzender Beziehungen, das schwere Sanktionen kennt, eine sogenannte zweite Wirtschaft oder auch Schattenwirtschaft aufgebaut, durch die die Gesellschaften Ost- und Mitteleuropas imstande waren, die auf den gemeinsamem Besitz von Produktionsmitteln gegründete Planwirtschaft nicht nur zu umgehen, sondern sie sich regelrecht dienstbar zu machen. Wodurch sie zwar über Jahrzehnte den Glauben an die Notwendigkeit und Heiligkeit des Privateigentums verteidigten, paradoxerweise jedoch den kollektivistischen Charakter ihres Denkens vertieften. Im kollektiven Bewusstsein wurden, wenn auch aus der Not heraus, Betrug und Diebstahl in den Rang von einhellig akzeptierten natürlichen Phänomenen erhoben. Das kollektive Bewusstsein betrachtete es nicht länger als Vergehen, Genossenschaften und Staatsbetriebe, die wichtigsten Institutionen des kollektiven Besitzes, zu bestehlen und zu betrügen. Im Gegenteil, das kollektive Bewusstsein billigte es und ermunterte dazu. Wenn ich die Gemeinwirtschaft bestohlen habe, dann habe ich als mutiger und freier Mensch gehandelt, denn ich habe mir im Namen von jedermann Genugtuung verschafft für all das, was im Namen der Kollektivität gegen mich verübt worden ist, beziehungsweise ich habe mir etwas von dem zurückgeholt, was mir gehören könnte oder tatsächlich gehört hat. Die allgemeinen ethischen Barrieren, die zum Schutz des öffentlichen Eigentums errichtet worden sind, lösten sich im kollektiven Bewusstsein buchstäblich auf. Im zwanzigsten Jahr der Diktatur fragte niemand mehr danach, ob wenigstens eine nominelle Rechtfertigung für sein Handeln vorhanden war, jeder nahm sich, was er sah und wegschleppen konnte, und das hat sich als ethisch anerkanntes, politisch sogar wünschenswertes Verhalten im kollektiven Bewusstsein festgeschrieben. Die demokratische Wende hat die Grundstruktur des gesellschaftlichen Bewusstseins nicht verändert. Binnen weniger Jahre wurden zwar Privatisierung und Reprivatisierung vollzogen, doch das konnte den am Gleichheitsprinzip orientierten, in den Jahren der Diktatur erheblich vertieften Kollektivismus dieser Gesellschaften nicht befriedigen, wie es andererseits nicht verhindern konnte, dass die früher fundierte Wirtschafts- und Bewusstseinsstruktur in Form einer die ganze Gesellschaft durchdringenden Korruption weiterwirkt. Was das Funktionieren der Demokratie gefährdet oder unmöglich macht.
Von der Betrachtung des Birnbaums ausgehend, ist die Geschichte des Dorfes auch deshalb so gut überschaubar, weil von großen Ereignissen, alles umwälzenden Veränderungen kein Nachhall bleibt.
Als hätte Giuseppe Tomasi di Lampedusa eigenhändig über jede Toreinfahrt geschrieben: «Es muss sich sehr viel ändern, damit alles beim Alten bleibt.»
Der erste richtige Lärm, den ich hier in der Nacht hörte, war das Dröhnen von Flugzeugen, riesigen Transportmaschinen über uns, die unterwegs in den Kosovokrieg waren. Seit Frieden herrscht, ist wieder Stille.
Unter dem großen Wildbirnenbaum wurde manchmal zum Gesang musiziert, leise, erzählt man. Wahrscheinlich gab man mit solcher uralten Rücksicht auf die Nacht den Göttern zu verstehen, dass man sich nicht leichtfertig vergnügte und die erdgeschichtliche Stille nicht stören wollte. Damals gab es im Dorf nur ein einziges brauchbares Musikinstrument, einen Kontrabass, den ein Heimkehrer nach dem Ende des Ersten Weltkriegs von der italienischen Front mitgebracht hatte. Aber niemand erinnert sich mehr, mit welchem Musikinstrument der Gesang vorher begleitet wurde.
Man stelle sich den tiefen Klang des Kontrabasses, den Gesang der vielen gleichstimmigen Kehlen, das Schreien der Eulen und das Zirpen der Grillen in der reglosen Sommernacht vor.
Wenn nur Mond und Sterne die Szenerie beleuchten.
In dieser Gegend kannte man früher keine Zäune, die Gemüsegärten wurden durch Hecken vor streunenden Tieren geschützt. Die Häuser wurden aus Pfählen erbaut, mit Lehm verputzt und abgedichtet.
Die letzte Hexe ist erst Ende des achtzehnten Jahrhunderts bei lebendigem Leibe verbrannt worden.
Bis Ende des neunzehnten Jahrhunderts war der Schornstein unbekannt, der Rauch vom Herd zog durch eine Öffnung über der Küchentür ab.
Die Elektrifizierung wurde Mitte der sechziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts durchgeführt.
Als ich als junger Mann zum ersten Mal hierherkam, ging der Tag im Dorf bereits mit der Dämmerung zu Ende, in den Küchen leuchtete nur das Herdfeuer, kein Petroleum, kein Öllämpchen. Auch heute noch begeben sich die sparsameren oder geizigeren Alten, sobald es dunkel wird, langsam zur Ruhe. Durch die Landschaft eilt auch kein Zug, der Fremdgeräusche erzeugen und die überflüssige Vorstellung erwecken könnte, er würde einen hier heraus- und in ferne Welten bringen. Ende des neunzehnten Jahrhunderts, als das Eisenbahnnetz der österreichisch-ungarischen Monarchie den verschiedenen Wirtschaftsinteressen entsprechend seine endgültige Form erhielt, setzte die katholische Kirche durch, dass die Bahnlinie nicht bis in diese Gegend verlegt wurde – sie hoffte, dadurch die Ordnung der Sitten aufrechtzuerhalten. Seither gibt es keinen Bahnanschluss. Nur die Wälder des Fürsten Esterházy wurden durch eine Schmalspurbahn mit der fernen Hauptstrecke verbunden.
Wie ein Märchenspielzeug in einer Modelllandschaft tuckert sie bis heute mit Brennholz beladen an den stillen Waldrändern entlang.
Es dürfte unbezweifelbar sein, dass sich das Dorf in den warmen Sommernächten unter dem großen Wildbirnenbaum der rituellen Kontemplation hingab, gewissermaßen dem kollektiven Bewusstseinsinhalt Rechnung trug. Und wer sich dies vergegenwärtigt, blickt in eine Zeit von tausend Jahren vor dem Christentum zurück. Das in dieser Gegend in Wirklichkeit erst achthundert Jahre alt ist. Nach der Landnahme lebte in den hiesigen Siedlungen ein Geschlecht, das lange Zeit auch durch Anwendung brutalster Methoden nicht mit den Institutionen des christlichen Königtums auszusöhnen war. In diesem westlichen Grenzgebiet des ungarischen Königreichs, das Palisaden und Erdwälle unpassierbar machten und wo die tüchtigsten Burgsassen von den frühmittelalterlichen Königen von ihrer Dienstpflicht befreit und in den Adelsstand erhoben wurden, haben sich die alten Gebräuche und Götter noch über zweihundert Jahre lang erhalten. Sie werfen ihre Schatten bis in die Gegenwart und stehen den Seelen der hier Lebenden näher, als diese wahrhaben wollen.
Was in der Geschichte der europäischen Christenheit nicht ohne Beispiel ist. Weitaus größere, bedeutendere Gebiete sind über längere Zeiten heidnisch geblieben, und Spuren dieser Jahrhunderte haben sich auf der geistigen Landkarte des Kontinents bis heute als Unterschiede im Entwicklungsstand erhalten.
Oben im fernen Norden zum Beispiel, in den weiten bewaldeten Gebieten zwischen der Nordsee und den bis heute unberührten Masurischen Seen, zwischen Weichsel und Memel, wo einst die Pruzzen, Prussen oder, mit ihrem heute üblichen Namen, die Preußen lebten, hat sich etwas ganz Ähnliches abgespielt. Die Bekehrung der Preußen hatte der Prager Bischof Adalbert zu seiner Sache gemacht, der auch bei der Bekehrung der Ungarn eine wichtige Rolle spielte. Es lohnt sich, seine Lebensgeschichte kurz zu rekapitulieren, weil darin Verbindungen und Zusammenhänge sichtbar werden, die schon vor Urzeiten das Leben innerhalb jener größeren geographischen Einheit bestimmten, welche der zeitgenössische politische Sprachgebrauch gern von «Europa» abtrennt und mit dem Begriff Mittel- oder manchmal Osteuropa belegt, manchmal auch mit beiden zugleich, obschon er die Grenzen Europas nicht lokalisieren kann oder zu lokalisieren wagt, trotz der unerlässlichen Anstrengung, sie zu definieren.
Würde sich jemand dieser schwierigen Aufgabe unterziehen, dann müsste er zunächst angeben, wo sich das Zentrum des Kontinents befindet und was im Verhältnis dazu als Peripherie gelten soll. Dazu aber müsste man den historischen Begriff Europas erst einmal aus dem Kontext nationalistischer und kolonialistischer Mythologien verschiedener Provenienz befreien, um die Geschichte des Kontinents als deren Wechselwirkung und Beziehung, als einen komplizierten und vielseitigen Prozess der Akkulturisation zu beschreiben. Dann aber würde klar werden, dass geographische Begriffe zu eng sind, um die Geschichte und Kultur Europas darzustellen. Die Religionsgeschichte Russlands zum Beispiel unterscheidet sich tiefgreifend von der Geschichte der europäischen Länder, die keine Verbindung zum byzantinischen Christentum hatten, während sich die Geschichte seiner Kunst, Philosophie und Mentalität nicht als Spezifikum aus ihr herauslösen lässt; während der europäische Kontinent geographischen Begriffen nach am Ural endet, endet doch die europäische Geschichte nicht dort. Geistreicher als die Willkür geographischer Begriffe war Metternichs Bemerkung im Jahr 1814. Auf dem Wiener Kongress, auf dem die Gesandten der europäischen Monarchien über das Schicksal des Kontinents entschieden, befand er, «Europa endet bei der Wiener Landstraße». Dahinter beginnt der Balkan, wo bekanntlich keine menschlichen Wesen leben.
Doch wie dem auch sei, jener treffliche Mann namens Adalbert, der 955 als Graf von Libice das Licht der Welt erblickte und mit knapp dreißig das Prager Bistum unter der Bedingung übernahm, ausreichende Machtbefugnisse zum Ergreifen außerordentlicher Maßnahmen zu erhalten, um den Sittenverfall aufzuhalten und die gute Ordnung wiederherzustellen, sah nach wenigen Jahren ein, dass seine Maßnahmen zu nichts führten. Aus seiner Geschichte wird evident, was Adalbert unter dem Niedergang sittlicher Normen verstand. Dass eine Dame aus einer vornehmen Familie ihren Ehemann betrog, noch dazu mit dem Priester, der ihr Beichtvater war, gehörte nicht dazu. Mit derart banalen Vorkommnissen gab er sich nicht ab. In Zorn versetzte ihn vielmehr, dass der Ehemann seine Gemahlin nach heidnischem Brauch selbst hinrichten wollte, was nicht nur die Mitglieder beider Familien, sondern ganz Prag für rechtskonform befanden.
Adalbert hielt die kollektive heidnische Regression für unsittlich. Wie überhaupt die prämoderne Regression vom Standpunkt der Demokratie nicht der günstigste Nährboden ist. Sie verringert den Wirkungsgrad der demokratischen Institutionen erheblich.
Adalbert ließ die Dame von seinen Dienern rauben und in ein Nonnenkloster sperren. Er rechnete nicht damit, dass auch unter den Bräuten Christi Anhängerinnen der heidnischen Riten waren und es der vornehmen Familie daher nicht schwerfiel, den Aufenthaltsort der Dame zu erkunden. Die Diener der Familie raubten das sündige Weib zurück, und so konnte der Ehemann es zur größten Zufriedenheit aller eigenhändig abschlachten. Aus Angst vor dem Volkszorn verließ Adalbert seinen Bischofsstuhl und suchte mit seinem Gefolge bei den heidnischen Ungarn Zuflucht, wo er sich mehr Erfolg erhoffte. Er hatte durch seine Gesandten erfahren, Geisa, der Fürst der ungarischen Stämme, zeige sich bereit, den christlichen Glauben anzunehmen. 994 trifft Adalbert am Sitz des ungarischen Fürsten ein, wo es ihm gelingt, mehrere ungarische Edelleute zu taufen, wir wissen allerdings nicht, wie lange er sich hielt. Wir wissen hingegen, dass er seinen Hofkaplan Astrik zurückließ, der in Missionsangelegenheiten Ratgeber am Hof des ersten ungarischen Königs wurde und im Frühling 1001 mit einer Huldigungsabordnung zu Papst Silvester II. nach Rom aufbrach.
Zu dieser Zeit weilte der arme, verjagte Adalbert schon nicht mehr unter uns Lebenden.
Von seinem weiteren Schicksal wissen wir nur, dass er sich kurze Zeit im fernen Norden, am Hofe des Herzogs Boleslaw, aufhielt, und vermutlich war er dem Ruf des polnischen Herzogs nicht nur gefolgt, um endlich die heidnischen Preußen zu bekehren, sondern weil man am Prager Hof nichts von seiner Rückkehr auf den Bischofsstuhl wissen wollte.
Seit das größte Bauwerk des Kalten Krieges, die Berliner Mauer, gefallen ist und jene Länder wieder zugänglich sind, die, eingezwängt zwischen den starken europäischen Demokratien und der russischen Diktatur, bis dahin ein isoliertes Dasein fristeten, haben Scharen andächtig staunender Touristen und agiler Unternehmer die von der menschlichen Zivilisation unberührte, von dunklen Wäldern und kristallklaren Seen bedeckte polnische Landschaft wiederentdeckt, wo Bischof Adalbert samt seinem Gefolge von den heidnischen Preußen umgebracht wurde. Nur vermöge eines hohen Lösegeldes gelang es Herzog Boleslaw, den Leichnam des Bischofs in seinen Besitz zu bringen, um ihn den Regeln seiner neuen Religion gemäß beizusetzen. Danach jedoch mussten noch mehr als zweihundert Jahre ins Land gehen, bis die polnischen Herzöge es wagten, an die gewaltsame Bekehrung der preußischen Nachbarn überhaupt nur zu denken. Schließlich einigte sich Herzog Konrad 1226 in Palästina mit dem Großmeister des Deutschen Ordens, der beim römisch-deutschen Kaiser und beim Papst um Bestätigung bat, dass er für seine missionarische und kolonisierende Unternehmung auch wirklich in den Besitz des Kulmerlands und Preußens käme, wie ihm der polnische Herzog versprochen hatte. Ein halbes Jahrhundert dauerte der im Namen christlicher Nächstenliebe geführte blutige Missionskrieg. Von solchen alten Zeiten schweigt selbst unser gigantischer Wildbirnenbaum.
Nicht weit von ihm entfernt gibt es jedoch eine uralte Edelkastanie, die von Forstkundigen auf achthundert Jahre geschätzt wird. Jedes Jahr pilgere ich mehrere Male zu ihr. An einem stillen Waldrand steht sie, auf der Kuppe eines Hügels.
Vermutlich war sie gerade zu der Zeit zum Baum herangewachsen, als die Bekehrung der Einheimischen endlich gelang. Was in dieser Gegend nicht viele konkrete Spuren hinterlassen hat. In Lebensgewohnheiten oder Redensarten findet sich kaum ein Hinweis. Man ruft Jesus Christus oder die Jungfrau Maria nicht an, betet nicht zu ihnen, lästert sie nicht, allenfalls führt man Gott im Munde, wenn jemand in Schwierigkeiten ist. Von den Siedlungen, die sich auf den Hügeln ducken, hat bis heute nicht jede eine Kirche, wofür die große Armut nicht unbedingt als Erklärung reicht. Bis heute aber wird die Messe noch in jenen drei kleinen Kirchen abgehalten, deren Fundamente von den Missionaren des frühen Mittelalters gelegt worden sind. Auch eine Kapelle oder ein Kreuz am Wegrand gibt es im weiten Umkreis kaum. Viel Zeit dürfte in diesen uralten Siedlungen zur Befestigung des Christentums nicht gewesen sein, noch dürften die Methoden, mit denen die Nächstenliebe vertieft wurde, hinreichend überzeugt haben. Allenfalls Grabsteine und aus Holz gezimmerte Glockentürme erinnern daran, dass hier Christen leben.
Als dann das erste frei gewählte ungarische Parlament das Verhältnis von Staat und Kirche gesetzlich regelte und diese zum ersten Mal in ihrer Geschichte einander nicht mehr über- oder unter-, sondern nebengeordnet waren, wollte ich einem Nachbarn, einem älteren Mann, mit dem ich im Bus saß, meine Freude darüber kundtun. Er schwieg lange. Dann antwortete er bekümmert, ihm wäre es nicht lieb, wenn seine Enkelkinder am Sonntag mit Gendarmen zur Kirche gebracht würden, wie es einst mit ihm geschehen war.
Die Namen der Siedlungen sind immer aus zwei Wörtern zusammengesetzt, einem Familiennamen und einer die Art der Besiedelung bezeichnenden Beifügung, altungarisch in der Bedeutung von Rodung beziehungsweise Sitz oder Niederlassung: Eck, Egg. Jedes Dorf ist ursprünglich ein Sitz oder die Niederlassung einer Adelsfamilie. Dort leben die Nachfahren jener zum Grenzschutz verpflichteten Burgsassen, die 1178 zur Belohnung für ihren jahrhundertelangen Dienst und ihre erfolgreiche Bekehrung von König Béla III. beziehungsweise einige Jahrzehnte später von Andreas II. von ihrer Dienstpflicht befreit und geadelt wurden. Die Namen mancher Adelsfamilien verweisen nicht auf ungarische, sondern auf türkische, kumanische, slawische oder sogar wallonische Herkunft. Es ist auch bekannt, dass sie heute nicht mehr genau da leben, wo sich ihre Ahnen niederließen. Ursprünglich lagen die Dörfer nicht auf den Hügelkämmen, sondern in den breiten Tälern, an den leicht ansteigenden Hängen neben den Bächen. Wie sich aus Ausgrabungen, die Ende des neunzehnten Jahrhunderts durchgeführt wurden, aus neueren Untersuchungen und der Auswertung der sichergestellten Funde ergibt, gehen diese alten Siedlungen jedoch noch auf viel frühere Zeiten zurück. Steinwerkzeuge und Tonscherben belegen, dass sich die ältesten Ureinwohner den Ort bereits im Neolithikum zur Besiedelung ausgewählt haben. Auf dem Gebiet des nächstgelegenen Nachbardorfes wurden Gegenstände aus dem Boden geholt, die von einer bedeutenden Kultur der Kupferzeit zeugen, unter anderem der Torso einer großen, reich verzierten Frauenstatue und Goldmünzen, die ein ganzes Tongefäß füllten. Die Siedlungen blieben auch während der frühen und späten Bronzezeit und der Eisenzeit bewohnt, später hinterließ die für lange Zeit hier lebende keltische Bevölkerung ihre Spuren. Die römischen Eroberer fanden noch keltische Siedlungen vor, Feuerstätten von Siedlern italischer Herkunft sind erhalten. Es folgten Wellen awarischer, vereinzelter germanischer, mährischer, fränkischer und schließlich slawischer Besiedlung. Ich habe selbst noch Tonscherben aus der Römerzeit gefunden. Sie kommen beim Pflügen oder Jäten zum Vorschein oder werden vom Regen ausgeschwemmt. Die über mehrere tausend Jahre durchgehend bewohnte Stelle an den Hängen neben dem Bach ist auch ohne besondere archäologische Kenntnisse auszumachen. Sie ist kahl und auffällig eben geblieben und von einer andersartigen Vegetation umgeben.
Diese bis in die Frühgeschichte zurückreichende Kontinuität wurde von den türkischen Eroberern unterbrochen. Den Bewohnern der Adelsniederlassungen im Umkreis blieb nichts anderes übrig, als sich von der Nähe des Wassers auf die sichereren Hügel zurückzuziehen, die damals noch Wald bedeckte. Die Wege folgten im frühen Mittelalter dem Lauf der Bäche, und diese Spurenlinie ist im Frühling ebenso sichtbar wie im Herbst, wenn die Vegetation des Sommers sie noch nicht oder nicht mehr verdeckt. Die umherstreifenden Türken fielen auf diesen Wegen in die Dörfer ein, trieben das Vieh fort, leerten die mit Feldfrüchten gefüllten Gefäße und raubten die Kinder als Sklaven. Selbst wenn sie die Schilfdächer der Häuser, die kaum größer waren als Hütten, nicht in Brand steckten –, das alles war für die Überlebenden gleichbedeutend mit dem Hungertod im Winter. Auch den Dörfern auf den Hügeln gelang es während der anderthalb Jahrhunderte der türkischen Okkupation kaum zu überleben. Als die Armee des österreichischen Kaisers die Türken Ende des siebzehnten Jahrhunderts endlich auf den Balkan zurückdrängen konnte, zählte das Dorf gerade noch siebzehn Seelen. Diese siebzehn Menschen bewahrten dann unter den großen Bäumen noch etwas von dem tausendjährigen Wissen, von dem auch ich mir noch einiges aneignen konnte.
Ich weiß noch, dass mitten auf meinem Hof unter dem großen Wildbirnenbaum das Dorf in warmen Sommernächten leise sang, und dieses Wissen habe nunmehr auch ich weitergegeben, jetzt aber gibt es keine auserwählten Bäume mehr, und auch das Dorf singt nicht mehr.
Deutsch von Heinrich Eisterer
In der Körperwärme der Schriftlichkeit
Europa, die mit ihrem auf phönizischen Ursprung hindeutenden Namen aus dem Dunkel prähistorischer Zeit hervortritt und bei Hesiod als eine der vierzig älteren Töchter von Tethys und Okeanos und eine der vier Frauen von Zeus erwähnt wird, Europa liest und schreibt natürlich nicht. Die Bewohner jenes Kontinents, der ihren Namen trägt, sind der Ansicht, dass jeder, der schreiben gelernt hat, auch schreiben kann. Vermutlich hindert sie dieser peinliche Irrglaube daran, es jemals wirklich zu lernen. Europa ist seit ewigen Zeiten ein in seiner Bestialität dösendes, dummköpfiges Ungeheuer. Zuweilen stöhnt es auf seinem stinkenden, zwischen die großen Meere gezwängten Lager, faucht, wälzt sich grimmig hin und her.
In manchen Sagen wird behauptet, Europas Atem dufte nach Safran. Rubens malt sie rüde als fettes Weib, das sich im Augenblick der Entführung mit einem Leopardenfell bedeckt. Immer schon hatte Europa mehr Fett und Gold als brauchbares Wissen. Europa ist seit Urzeiten Analphabetin und wird es bis ans Ende der Zeiten bleiben. Da hilft es auch nichts, dass einzelne Individuen schreiben können und manche sogar lesen. Vielleicht ist es nicht überflüssig zu erwähnen, dass das Wort Analphabet sich im Griechischen auf Personen bezieht, die nicht nur der Schrift unkundig, sondern auch in der Gerichtsbarkeit unwissend sind. Unfähig, Verträge zu schließen und vor Gericht ihr Recht zu verteidigen. Schnaubende Haustiere. Schon in der Antike dürften ein solches prähistorisches Wesen oder ein solcher Zustand eine ziemliche Last, ein Klotz am Bein der Gesellschaft gewesen sein. Das Gericht konnte als Grundlage seines Urteils nur jene Umstände berücksichtigen, die von den streitenden Parteien schriftlich vorgelegt wurden. Quod non est in actis, non est in mundo. Was nicht aktenkundig ist, existiert nicht.
Was natürlich bedeutet, dass es vor der Antike einen Urzustand gab, in dem das Reden zum Dasein vollauf genügte. Ich aber schreibe. Das Individuum hat sich zweifellos mittels der Schriftlichkeit aus dem Urschleim herausgearbeitet. Seit mehr als vierzig Jahren setze ich mich jeden Morgen zehn vor acht an meinen mit handgeschriebenen Blättern bedeckten Tisch. Wer hat schon ein vergleichbares Mittel, um dem anderen von seiner Existenz Mitteilung zu machen. Obzwar sich auch mit Schreiben nicht mehr von der Persönlichkeit wiedergeben lässt, als es eine halbwegs gelungene Skizze vermag. Die Körperwärme teilt sich durch Berührung mit. Wenn es nicht gelingt, einander wenigstens skizzenhaft von der Körperwärme des eigenen Seins Mitteilung zu machen, bleibt unser aller Dasein taub und blind, unempfänglich für soziale und körperliche Berührung, dann sinken wir alle wie ein Mann ins Chaos zurück. Was bereits des Öfteren geschehen ist in der schreckensvollen Geschichte Europas und zweifellos auch noch weiterhin geschehen wird.
Damit es nicht geschehe, müsste sich jeder jeden Tag selbst aus dem Urschleim der eigenen Dumpfheit herausarbeiten.
Wer von diesem erfolglosen oder erfolgreichen Geschäft täglich schreibend Rechenschaft gibt, in dem keimt nach ein paar Jahrzehnten womöglich die Hoffnung auf, dass er das Schreiben vor seinem Tode doch noch lernen wird.
Das Schreibenlernen kann man nicht mit Schreiben beginnen. Ich selbst zum Beispiel nehme nach dem Schreiben jeden Nachmittag das Nichtschreiben auf; um am nächsten Tag schreiben zu können, muss ich jeden Tag erfahren, wo die Grenze zwischen meiner Realität und der Realität meines Schreibens liegt. Naturgemäß verschiebt sich diese Grenze täglich. Was immer ich sonst noch tue oder nicht tue, alles muss im Hinblick auf das Schreiben geschehen. Ich darf mich nicht zu spät und nicht zu früh hinlegen, und ich muss darauf achten, wie tief ich die unvermeidbaren Einwirkungen anderer im Schlaf oder Wachen eindringen lasse. Ob sie bis ins Knochenmark gehen oder bereits in der Epidermis steckenbleiben. In jüngeren Jahren habe ich beispielsweise so schlafen gelernt, dass ich meine Träume schon während des Träumens deute und beim Aufwachen so in meinem Bewusstsein verankere, dass ich sie später nicht vergessen kann. Die Realität des Traumes soll in der Realität des Schreibens ihren Platz finden. Am Rande des Wahnsinns beginnt man die Struktur des eigenen Bewusstseins zu erkennen, und das ist wichtig, um die anderen verstehen zu können. Schon allein deswegen, weil man die gemeinsame Muttersprache, die am nächsten Tag Material und Gegenstand des Schreibens sein wird, ohne den Sprachgebrauch der anderen nicht verstehen kann.
Seither verbringe ich jeden Morgen die erste Stunde in klassischer Analyse, mit der Zergliederung und Neuordnung des Bewusstseinsinhalts. Ich knüpfe da an, wo die Mönche am Ende des Mittelalters aufgehört haben. Wenn mich jemand bei solchen Gelegenheiten beobachtet, sieht er einen, der sich zwingt, nichts zu tun, blöde aus dem Fenster glotzt und jeden Tag fast das Gleiche sehen muss. Während sich draußen die Leute abzuhetzen beginnen, herrscht bei mir die größtmögliche Ereignislosigkeit. Die vielen kleinen Nuancen der Betrachtung erhellen mit der Zeit vieles. Aber nicht alles und nicht von selbst.
Durch die absichtslose Betrachtung erweist sich der menschliche Bewusstseinsinhalt als so üppig und reich an Details, dass ein einzelner Mensch zu seiner Aufarbeitung mehrere Leben benötigen würde.
Im Nachdenken über sich selbst gibt es keinen Moment, an dem man nicht aus sich heraustreten müsste. So ist man gezwungen, alles in den Konditional zu setzen und sein Denken in einem System von Parallelverbindungen weiterlaufen zu lassen. Was allenfalls von einem Computer zu leisten wäre. Als hätte man sich während des Nachdenkens ununterbrochen abzufragen, ob andere denken, was ich denke; oder umgekehrt, ob ich denke, was andere sich anderer wegen zu denken gezwungen sehen.
Man hat noch gar nicht zu schreiben begonnen und weiß schon, dass man nicht zu Ende kommen wird, weil man nicht zu Ende kommen kann, das braucht einen aber nicht aus dem Konzept zu bringen. Man kann das Ganze getrost wieder von vorn anfangen und dann noch einmal von vorn. Der Sprachgebrauch fremder Personen enthält Hinweise auf den fremden Bewusstseinsinhalt, und die verschiedenen sprachlichen Zeichen liefern zumindest die Umrisse der Struktur eines anderen Denkens. Doch es ist schwer, auf diesem Weg Anfangs- und Endpunkte fürs Schreiben zu finden. Weil es sie nicht gibt. Von dieser Erkenntnis wird man nur in jungen Jahren gelähmt. Das eigene Leben und das Leben anderer besteht, o Graus, aus ewigen Wiederholungen. Woraus sollte es sonst bestehen. Man isst, entleert sich, macht Liebe und alles wieder von vorn. Nach Anfang und Ende haben schon andere gesucht. Wenn Gott nicht zu finden ist und auch keine Erklärung für den Mangel, dann genügt es vielleicht, die Wiederholungen zu erkennen, auszuwerten und zu den eigentümlichen Wiederholungen der anderen in Beziehung zu setzen. So erhält man doch einen kleinen Einblick in die Natur der Schöpfung. Und wenn man jeden Morgen einiges davon schafft und es gelingt, sich mit dem Ergebnis selbst noch ein wenig zu überraschen, dann kann man mit diesem Wissen langsam an das am Vortag verlassene Manuskript herangehen.
Für mich ist wichtig, dass es seit Jahrzehnten mit der Hand geschrieben wird und an der Handschrift sogleich Unterschiede, Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen zwischen all den vorangegangen Tagen und dem heutigen zu sehen sind. Diese Ebenen muss ein Schreibender erkennen können. Was auf dem Typoskript oder am Bildschirm nie möglich sein wird. Das Manuskript eröffnet eine Einsicht, die niemand wahrnehmen möchte. Man erblickt etwas, das nach sofortiger Korrektur verlangt. Mit Korrekturen lässt sich die Qualität des Manuskripts verbessern oder verschlechtern, doch was das Schriftbild des Vortages angeht, da ist nichts zu machen. Ob befriedigt oder unbefriedigt, man hat es als die einzige Realität zur Kenntnis zu nehmen.
Das Schriftbild ist persönlich, die persönliche Schreibweise wiederum ist in eine größere Tradition eingebettet, die kontinentale Eigenheiten, aber keine kontinentalen Grenzen kennt. Meine eigene Schreibweise ist zwar stark eingebunden in ein Geflecht von geheimen Beziehungen und komplizierten Zusammenhängen der europäischen Literatur, doch diese geheimen Beziehungen folgen ja gerade ihrer Natur, wenn sie die ethnischen, sprachlichen, religiösen und nationalen Grenzen überschreiten. Sie überschreiten sie selbst dann, wenn sich der Kontinent in das Schwert seiner eigenen ethnischen, sprachlichen, religiösen und nationalen Unterschiede stürzt und in einen prähistorischen Zustand zurücksinkt.
Deutsch von Heinrich Eisterer
Großes weihnachtliches Morden
In zwei aufeinanderfolgenden Nächten habe ich mir zweimal bis zu Ende angesehen, wie der ehemalige rumänische Staatspräsident und seine Frau zum Tode verurteilt und hingerichtet wurden. Es waren zwei verschiedene Dokumentarfilme, aber zur Darstellung des rituellen Geschehens wurde natürlich dasselbe Filmmaterial verwendet, daher unterschieden sie sich in ihrer Wirkung kaum.
Diese Filme haben wieder moralische und ästhetische Grundfragen in mir wachgerufen, auf die ich in den vergangenen zehn Jahren keine Antwort gefunden hatte. Mit kühlem Kopf beobachtete ich mich dabei, die Ermordung eines Despoten zu genießen. Ich nahm zur Kenntnis, dass ich mich für diesen Genuss im Grunde schämen müsste, was ich aber nicht tat. In mir war kein Erbarmen, und ich empfand auch kein Mitleid mit dem Ehepaar.
Ich bin ein Anhänger von rechtmäßigen Urteilen. Trotzdem schwieg mein Gewissen gleichgültig. Ich bin kein Anhänger der Todesstrafe. Dennoch hat die Brutalität des Vorgehens mein moralisches Empfinden nicht verletzt. Aus dem stillschweigenden Bewusstsein, dass ich gegen diese himmelschreiend rechtlose und dilettantische Komödie Einspruch erheben müsste, es aber keinen Einspruch gab, beziehungsweise dass es in mir eine zweite, das Recht einfordernde humane Person geben müsste, die sich gegen meine moralische Gleichgültigkeit und ästhetische Anspruchslosigkeit verwahrt, es aber eine solche Instanz nicht gab: aus diesem Bewusstsein erwuchs eine eigentümliche Leere.
Der niedrige Genuss liegt in gefährlicher Nähe zum edlen Vergnügen. Vielleicht ist das so, weil wir für die beiden unterschiedlichen Arten der Lust keine gesonderten Nervenstränge haben. Auch Lust und Schmerz können sich berühren. Nicht nur beim Menschen, auch beim Tier. Jede Lust beschleunigt den Atem und bringt ihn zugleich ins Stocken, sie erzeugt die Empfindung, als sei der Kreislauf für Bruchteile von Sekunden unterbrochen. Das Gefühl wollüstigen Erstickens vernebelt das Bewusstsein. Das ist der Physiologie aller Säugetiere gemeinsam. Die Verlaufskurve heftiger politischer Erregungen oder religiöser Ekstasen unterscheidet sich kaum von der steigenden Kurve beim Liebesakt. Das moralische Urteilsvermögen setzt aus, die Selbstreflexion pausiert. Nicht nur in den Extremitäten, auch in den Lenden und im Bauch, in den Eingeweiden und in der Ring- und Schließmuskulatur kommt Spannung auf. Auch wenn jemand einen Despoten ermordet oder wenn man zuschaut, wie andere einen Despoten ermorden. Konträre, krampfartige Muskelkontraktionen und Muskelspannungen. Deshalb sind die politischen oder religiösen Ekstasen der Massen ein so überwältigender Anblick. Deshalb ist die Hysterie der Masse so furchterregend. Letztlich ist es eine Entscheidungsfrage, was man öffentlich und was man heimlich tut. Verängstigte Hunde werden starr, in ihrer Freude lassen sie winselnd Wasser, vor Wut sträubt sich ihnen das Fell. Der Kriminologie ist dieses Phänomen bekannt. Diebe, Räuber und Mörder urinieren häufig in der lustvollen Erregung vor der Tat und ejakulieren, während sie die Tat begehen.
Unter normalen Umständen wird man die zur niedrigen Lust gehörenden Affekte und Emotionen streng überwachen. Das hat gute Gründe. Wenn der Mensch die empfindlichen, verletzlichen Grenzen zwischen Hass und Liebe, zwischen Niedrigem und Edlem nicht wahrt, wenn er das intime System der Physiologie nicht ausschließlich der edleren Lust vorbehält, wird er sofort vom Chaos der Verdächtigungen, der Rache, des unbesiegbaren Verlangens nach Genugtuung, der Gier, des Neids, der Selbstsucht, der Eitelkeit und der Raffgier verschlungen. Und manchmal nicht nur er allein. Es genügt eine einzige zur Hysterie neigende Person, um die anderen mit in den Abgrund zu reißen. Jugoslawien ist auf diese Weise verschlungen worden. Die Ukraine, Russland, Ungarn, Rumänien, die Slowakei und Kroatien sind nur von einer dünn gewordenen Haut davor geschützt.
Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer, die unkontrollierten Phantasien des Hasses aber Vampire. Von der Gefahr, die man für sich selbst bedeutet, können einen nur die letzten, wach und nüchtern gebliebenen Bereiche der Vernunft zurückhalten.
Als hätte man befürchten müssen, dass sie aus dem kahlen Saal fliehen, hatte man das verängstigte Ehepaar zwischen zwei Tische mit Stahlbeinen und die Wand gedrängt. Vielleicht war es kalt in dem Raum, oder die uniformierten Mitglieder des Standgerichts hatten den Despoten nicht erlaubt, die Mäntel abzulegen. Sie hatten es eilig. Sie mussten die Sache so schnell wie möglich hinter sich bringen. Eine gesetzliche Vollmacht besaßen sie nicht. Und auch wenn sie eine gehabt hätten, sie wollten die beiden abschlachten, wie sie ihre heißgeliebten und gern gekraulten Säue am frühen Wintermorgen abschlachten. Auch politische Erwägungen spielten eine Rolle. Solange die Despoten noch lebten, war jeder Restaurationsversuch legitim, und das wiederum hätte für die Mörder das Ende bedeutet. Wer wen zuerst tötet, darum ging es hier. Elena Ceauşescu trug einen pelzgefütterten hellen Mantel. Sie hatte ihn eng um sich gezogen, so schützte sie sich. Sie fror, aber wahrscheinlich eher aus Angst. Obgleich man nicht behaupten könnte, sie sei nicht bis zuletzt beherrscht geblieben. Sie wusste, was ihr bevorstand, und sie sagte es auch.
Nicolae Ceauşescus Selbstbeherrschung funktionierte weniger gut. Obwohl er das bevorstehende Ende nicht gleich erkannte. Ich bin mir sicher, dass ihn nicht nur seine grundsätzliche Beschränktheit vor dieser Einsicht bewahrte. Der damals Einundsiebzigjährige war vierundvierzig Jahre lang Mitglied des Zentralkomitees gewesen. Zu lange, um sich auch nur einen einzigen noch funktionsfähigen Flecken im Hirn erhalten zu haben. János Kádár hatte niemand umbringen wollen, doch in der Stunde der Wahrheit konnte er den Verstand vor dem Wahnsinn schützen, indem er sich in den dunklen Abgrund des Altersschwachsinns warf. Ceauşescu blickte nur seine Frau an, rollte seine schlauen kleinen Augen und grinste gequält vor Nervosität, seiner Miene war anzusehen, dass er nicht begriff, was da vor sich ging und wie er Herr der Lage werden könnte.
Er trug einen schweren dunkelgrauen Wintermantel. Wahrscheinlich gab es in einer Geheimklausel des Warschauer Pakts eine Vorschrift, das Tragen dieser traurigen, unförmigen Wintermäntel betreffend. János Kádár war der größte Mantel zugewiesen worden, auch Frau Kádár bekam einen ziemlich großen. Schiwkow einen zu kleinen. Husák einen völlig verschnittenen. Man trug dazu große dunkle Hüte. An dem unglückseligen Tag hatte sich das rumänische Staatsoberhaupt eine Pelzmütze auf den Kopf gesetzt. Und um dem Beispiel seiner Frau zu folgen, die sich besser im Griff hatte, stützte er sich mit dem Arm auf dem Tisch auf und klammerte sich an seine Pelzmütze, knautschte und drückte sie. Er schaute auf die Uhr, ob nicht bald jemand zu ihrer Rettung herbeigeeilt käme. Er betrachtete die Uhr, als ob er sich im Stillen sagte, nun ja, ich verstehe nicht, aber die richtige Parteikonferenz wird schon noch beginnen.
Der Kameramann holte mal die beiden Ceauşescus ins Bild, mal die Mitglieder des Standgerichts. Nirgendwo fand er einen Punkt im Raum, von dem aus er alle Teilnehmer gleichzeitig hätte sehen können. Aber Nahaufnahmen konnte er auch von niemandem machen. Zudem wackelte, zuckte, zitterte die Kamera in seinen Händen, während er sich damit unentschlossen drehte. Nicht nur weil er von seiner Arbeit nichts verstand, sondern weil er seinen Schrecken und seine Rachegelüste nicht im Zaum halten konnte. Er brachte seine persönlichen Gefühle nicht mit seiner Aufgabe in Einklang.
Es ist der perfekte Dilettantismus, der diesem Film ästhetische Vollendung verleiht. Man kann ihn schneiden, wie man will, es ändert nichts. Alle Gegenstände, Licht, Darsteller, Stimmen, Requisiten in diesem Film sind niederträchtig, hässlich und dilettantisch. Die Fenster sind verdunkelt, eine Tür ist nicht zu sehen. Aus Diktaturen gibt es kein Entrinnen. Wir wissen seither nicht genau, wo wir stehen. Auch der Kameramann kann da nicht heraus, dazu müsste ihm noch irgendetwas anderes außer dem Mord in den Sinn kommen. Die Freiheit wird niemandem geschenkt. Der Kameramann identifiziert sich mit den heftigen Gefühlsausbrüchen der zitternden Mitglieder des Standgerichts, und wir folgen den unberechenbaren Schwenks seiner Kamera. Gemeinsam mit dem Standgericht könnten wir den Durchbruch der Gerechtigkeit erleben, eine kathartische Erkenntnis wäre die Folge. Doch das geschieht nicht. Die beiden Despoten werden im Zeichen kleinlicher Rachegelüste zum Tode verurteilt.
Anders hätte es auch nicht kommen können, denn die Richter und die Despoten gleichen sich bis in die Sprache hinein. Sie sind gleich dumm, gleich hässlich, ungebildet, grob und banal. Was aber vom Standpunkt der Wahrheit das Wichtigste ist: Ihrem Benehmen und ihren Worten fehlt das, was einem Menschen Würde verleiht. Und eine Wahrheit ohne Würde hat man noch nie gesehen.
Inzwischen ist ein Jahrzehnt vergangen. Während ich den würdelosen Kamerabewegungen folge, hin- und herschweifend zwischen Menschen, die ihre Würde verloren haben und nichts verstehen, habe ich gar nicht gemerkt, dass meine Erregung, meine Befriedigung und die Lust nicht meinem Wunsch nach Wahrheit, sondern nach Rache entspringen. Die Sache ist noch peinlicher. Despoten gehen immer ohne Würde in den Tod, aber diese beiden bezähmen zumindest ihre Angst. Die Mitglieder des Gerichts jedoch fürchten nicht nur, kaum Zeit genug zu haben, die beiden umzubringen, wobei sie dann selbst von anderen niedergemetzelt würden; noch schlimmer ist ihre Furcht, zwei solche Giganten umbringen zu müssen. Sie können sich nicht von der Vorstellung ihrer Zwergenhaftigkeit befreien. So unbefangen haben wir uns noch nie in der Weltgeschichte gesehen.