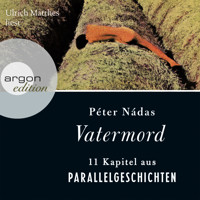14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Zwei Aufsätze und eine Vorlesung: Der Autor und Fotograf Péter Nádas denkt über das Schreiben und über das Sehen nach. Schreiben als Beruf, der längste und titelgebende Text, spürt den verwendeten, vor allem aber auch den nicht verwendeten Wörtern nach. Nádas nennt es «stumme Poetik»: das, was nicht oder nicht mehr im Text steht, die Auslassungen, gestrichene Passagen. Wie trete ich in einen Text ein? Wie verlasse ich ihn wieder? Wie ist das Verhältnis von Beschreibung und Dialog, von Raum und Zeit? Um die Gliederung von Raum und Zeit geht es auch in dem Aufsatz Haydn im Plattenbau. Ein Exkurs zu Joseph Haydn am Hof der Fürsten Esterházy mündet in einen sehr persönlichen Nachruf auf den Freund Péter Esterházy. Der dritte Text In den Farben der Dunkelheit befasst sich mit dem Wechsel vom analogen zum digitalen Bild, dem die Plastizität von Licht und Schatten fehlt, die Tiefe, das Drama. Die sich hieran anschließenden Gedanken haben für Nádas ebenfalls mit seinem Schreiben zu tun. Einer der großen Schriftsteller der europäischen Gegenwartsliteratur gibt Einblicke in sein Handwerk, sein Werk, und lehrt uns, Bekanntes mit neuem Blick zu sehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 86
Ähnliche
Péter Nádas
Schreiben als Beruf
Über dieses Buch
Zwei Aufsätze und eine Vorlesung: Der Autor und Fotograf Péter Nádas denkt über das Schreiben und über das Sehen nach.
Schreiben als Beruf, der längste und titelgebende Text, spürt den verwendeten, vor allem aber auch den nicht verwendeten Wörtern nach. Nádas nennt es «stumme Poetik»: das, was nicht oder nicht mehr im Text steht, die Auslassungen, gestrichene Passagen. Wie trete ich in einen Text ein? Wie verlasse ich ihn wieder? Wie ist das Verhältnis von Beschreibung und Dialog, von Raum und Zeit? Um die Gliederung von Raum und Zeit geht es auch in dem Aufsatz Haydn im Plattenbau. Ein Exkurs zu Joseph Haydn am Hof der Fürsten Esterházy mündet in einen sehr persönlichen Nachruf auf den Freund Péter Esterházy. Der dritte Text In den Farben der Dunkelheit befasst sich mit dem Wechsel vom analogen zum digitalen Bild, dem die Plastizität von Licht und Schatten fehlt, die Tiefe, das Drama. Die sich hieran anschließenden Gedanken haben für Nádas ebenfalls mit seinem Schreiben zu tun.
Einer der großen Schriftsteller der europäischen Gegenwartsliteratur gibt Einblicke in sein Handwerk, sein Werk, und lehrt uns, Bekanntes mit neuem Blick zu sehen.
Vita
Péter Nádas, 1942 in Budapest geboren, ist Fotograf und Schriftsteller. Bis 1977 verhinderte die ungarische Zensur das Erscheinen seines ersten Romans «Ende eines Familienromans» (dt. 1979). Sein «Buch der Erinnerung» (dt. 1991) erhielt zahlreiche internationale Literaturpreise. Unter anderem wurde Nádas mit dem Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur, dem Kossuth-Preis, dem Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung, dem Franz-Kafka-Literaturpreis sowie dem Verdienstorden der Republik Ungarn und dem Würth-Preis für Europäische Literatur ausgezeichnet. Péter Nádas lebt in Budapest und Gombosszeg.
Christina Viragh, geboren 1953 in Budapest, lebt als Autorin und Übersetzerin in Rom. Sie ist korrespondierendes Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und übersetzte u.a. Dezső Kosztolányi, Imre Kertész und Henri Alain-Fournier. 2009 erhielt sie das Zuger Übersetzer-Stipendium. Ausgezeichnet mit dem Übersetzerpreis der Leipziger Buchmesse, dem Europäischen Übersetzerpreis und, zusammen mit Péter Nádas, dem Brücke-Berlin-Preis.
Heinrich Eisterer, geboren 1960, begann nach einem Studium der Germanistik und Finno-Ugristik und einer Dolmetscherausbildung in Wien mit dem Übersetzen. Er wurde für seine Arbeit vielfach ausgezeichnet, so mit dem Österreichischen Staatspreis für Übersetzung. Neben Péter Nádas hat er u.a. Imre Kertész und Sándor Márai ins Deutsche übertragen.
Impressum
Schreiben als Beruf, entstanden im Auftrag des Kunstvereins Wien. Aus dem Ungarischen von Christina Viragh.
Haydn im Plattenbau, entstanden im Auftrag der Joseph Haydn Stiftung Basel für das Projekt Haydn2032, zuerst erschienen online in Republik, Zürich, 2021. Aus dem Ungarischen von Christina Viragh.
In den Farben der Dunkelheit, zuerst erschienen im Journal der Künste der Akademie der Künste, Berlin, 2020. Aus dem Ungarischen von Heinrich Eisterer.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2022
Copyright © 2022 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Copyright © 2020, 2021, 2022 by Péter Nádas
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Bild vom Autor
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-644-01575-3
www.rowohlt.de
Haydn im Plattenbau
Aus dem Plattenbau am Stadtrand, wo wir wohnten, vom achten Stock oben, sah man bis in die unendliche ungarische Einöde, die Puszta hinüber.
Nicht etwa, dass sie mit Leere gleichbedeutend ist, bei Weitem nicht, die Puszta hat eine reiche Flora und Fauna. Die verbreitetste Pflanze ist die Trespe, und in den Löchern dieses uralten, abgewetzten gelben Teppichs wachsen, gezählt habe ich sie zwar nicht, aber gut und gern weitere tausend Pflanzen, die Frühlings-Adonisröschen, das violette Kleine Knabenkraut, die Bastard-Schwertlilie, im Buschwerk der Sumpffarn, keine Angst, ich werde nicht alle aufzählen, auch wenn ich hier das gesamte Inventar der Pusztabotanik vor mir habe. Also, nicht einmal in der Einöde ist es öd und leer. Und wo Wasser durch die Oberfläche bricht und Quelle eines Bächleins oder einer kleinen Wasserader wird, um dann mit flachländischer Unverzagtheit in irgendeine Richtung zu rinnen, entstehen richtige Haine, Gruppierungen von Stieleichen, von Pappeln, die bei jedem Lufthauch silbrig aufblitzen, von kurzlebigen Birken, das Ganze gesäumt von einem Ensemble aus Weißdorn, Sanddorn und dem gelb blühenden Geißklee, als folgte es dem Plan eines Landschaftsarchitekten. Große Herren bauen sich an solchen lieblichen Orten ihre Sommerschlösschen.
Nicht einmal da, wo wirklich nur das Nichts gedeiht, bleiben Leerstellen. Das sogenannte Natürliche, das Haydn, zumindest am Anfang seiner Laufbahn, so lebhaft erfasst und verfolgt, kennt zwar die Lücke zwischen zwei Tönen, wie denn nicht, aber Leere ist auch ihm fremd. Diese wird sogleich ausgefüllt, aufgefüllt, bewohnt, organisiert. Die Pause hat eine größere Masse als die Töne. Mit der Leere mögen sich die Malerei, die Physik herumschlagen. Haydn operiert mit der Symmetrie gegen die Stille, geht mit dem Harmoniebedürfnis gegen die Lücke an. Das ist die große Lektion des Klassizismus, dieses streng Symmetrische, Zuverlässige, fast schon kasernenhaft Disziplinierte. Die Welt selbst ist ja nichts als Wiederholung und Variation. Haydn entführt uns ins leicht theatralisch, leicht ironisch aufgefasste Unendliche. Der Wind bläst Sand darauf, der auch nicht aus nichts besteht, sondern aus Siliziumkristallen. Man hört das Geriesel, die Partikel klackern gegeneinander. Mein lieber Freund Péter Esterházy hingegen brüllt in meinem wohlgepflegten, von mir selbst angelegten riesigen Garten, als ich ihn zu einem Rundgang einlade und er mit eigenen Augen sehen kann, wie schön mein auf den Hügelabhang gepflanzter Mischwald gedeiht, er hasse die Natur.
Ich hasse die Natur.
Was soll man da sagen, dann hasse sie eben, mein Bester.
Mit Verliebten lasse ich mich nicht auf Diskussionen ein.
Er sei Teil von nichts, brüllt er zwischen die schlanken Setzlinge hinein.
Ein Schwärmer, das bist du, Péter Esterházy.
Denn dort, wo auf der ungarischen Puszta, dem einstmaligen Meeresboden, wirklich nichts wächst, fast nichts, praktisch nichts, schlagen nach mehreren Jahrmillionen immer noch die Salzblumen des Meeresbodens aus. Mangels Leere können sie nicht anders. Sie wissen nicht mehr, wohin mit sich selbst. So sehr nicht, dass der gequälte Boden unter ihnen nicht einmal mehr sichtbar ist, sie decken ihn in dicker Schicht, so viele sind es.
Exakt so viele, wie es kein Wasser gibt. Die vielen Salzblumen gehen den Gesetzen der Kristallisierung folgend gleichmäßig ineinander über. Auf die Art sprießen bei dir die vielen barocken Satzblumen der Intelligenz, du neunmalkluger Esterházy. Und du kannst in meinem Wäldchen noch so gegen deine Natur anbrüllen, wenn du ja doch in deiner Vergangenheit und Zukunft schwelgst.
So habe ich, falls man mich richtig versteht, in diesen ersten neun Absätzen nebenbei vorgeführt, auf welche Art längere und kürzere Sätze rhythmisch aufeinanderfolgen, auf welche Art ich mit ihnen Raum und Zeit gliedere, auf welche Art ich den Zeitstrom aufhalte, auf welche Art und wann ich etwas weiterführe, auf welche Art ich vor und zurück verweise, auf welche Art ich Symmetrie und Asymmetrie herstelle, auf welche Art meine Akzente steigen und fallen, auf welche Art die Aussage abgestumpft oder verschärft wird, also, auf welche Art man aus Wörtern und Bezügen das Thema aufbaut und woran man die Melodie der Muttersprache festmacht. Auf welche Art man etwas aus der Alltagssprache höher hebt, auf welche Art man das Hochgeschraubte, das Literarische, das Obszöne verwendet, beziehungsweise wie man mit dem allem das nächstgrößere Strukturelement der Textkomposition herausarbeitet, den Absatz.
In einem Prosatext baut sich die Aussage aus Absätzen auf. In der Aussage muss auch enthalten sein, was nicht auf dem Papier steht. So entsteht das harmonische Gesamt von Klang, Intervall und Bedeutung.
Um die Wahrheit zu sagen, ich habe als junger Mann bei Meister Haydn Kontrapunkt studiert.
Dort das System der Tongruppen, hier die Bedeutungsvermehrung, die sehr schwer in einer einzigen Tonart zu halten ist. Obendrein ist nur ein Teil der in Tonarten gegliederten Bedeutungen auf der Partitur notiert. Der Rest entsteht meinem Gehör entsprechend in der Materie meines Geistes.
Womit ich nur sagen will, dass die Verwendung der Sprachmusik etwas viel Persönlicheres ist als die der grammatikalisch korrekten Aussage. Nichts gegen die Korrektheit und nichts gegen die Aussage, nur muss man das Übergewicht der stummen Poetik im Auge behalten. Das hat mir Herr Haydn tüchtig eingebläut. In seine Stunden ging ich hier im Plattenbau. Ich brauchte sie nicht einmal zu bezahlen. Dankbar bin ich auch nicht. Zuvor war ich zu Bartók gegangen, maßlos viel zu Beethoven, maßvoll zu Mozart, Bach kommt dann einiges später und hört nicht auf. Vorher musste ich noch lange Jahre zu Gluck, zu Wagner.
Wenn man so im Lauf der Jahre da oben im achten Stock auf einen der Häuserfabrik-Balkone hinaustrat, konnte man durchaus lustvoll auf die jenseits der Eisenbahnschienen gelegenen näheren und ferneren Höfe des mit Einfamilienhäusern aufgefüllten Straßennetzes hinunterblicken. Dahinter hörte die Stadt dann wirklich auf.
Es gab kahle, es gab üppigere, es gab gepflegte und peinlich verlotterte Höfe. Sie waren nicht dafür geschaffen, dass man von oben im Plattenbau in sie hineinstarrte. In den meisten Höfen stand ein ausladender Nussbaum. Diese wunderschönen Nussbäume, die im Zeichen des geborgenen Familienlebens seit rund sechzig Jahren hier wuchsen, wurden etwas später von einer Kraftmaschine an den Stämmen gepackt und so lange geschüttelt, mitsamt ihrem dichten Laub geschüttelt, bis sie alle aus dem Boden herausgedreht waren. Die Leichen wurden auf Zügen abtransportiert. Die Einfamilienhäuser bescheidenen Ausmaßes und mäßiger Ansprüche wurden abgerissen. Verblüfft starrte man von oben in die leeren Kellermägen. Und doch sind es nicht die gottverfluchten Zerstörungsexperten von Städteplanern, die sagen, was ästhetisch besehen einen Wert hat, sondern ich sage es, mit Sätzen, die meinem musikalischen Musterbuch und der Musikalität meiner Muttersprache entspringen.
Ich füge meine Wörter so eng aneinander, dass niemand Klang und Bedeutung meiner Sätze trennen kann. Auch darüber haben Esterházy und ich einmal gesprochen, dass im Text nicht nur Satzteile und Sätze, die dastehen, eine Bedeutung haben, sondern auch die, die wir aus irgendeinem Grund gestrichen haben. Anstelle des Gestrichenen bleibt das Nichts erhalten. Was dem Text eine beispiellose Sicherheit gibt.
Wie schön bin ich herangewachsen, sagt der Pilz zu sich, wie prächtig ist mein Hut, wie reich werde ich meine Sporen ausstreuen.
Es gibt auch keine Gnade.
Keine Vergebung.
Natürlich kommt heute mein Freund zu spät.