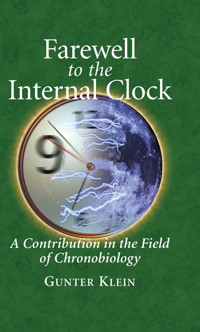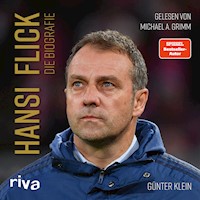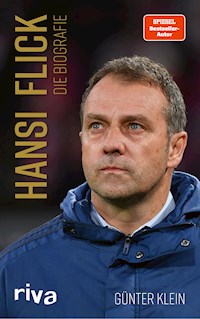15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Riva
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Leon Draisaitl zählt zu den besten Eishockeyspielern der Welt. Seit über einem Jahrzehnt läuft der Deutsche nun schon für die kanadischen Edmonton Oilers in der stärksten Liga der Welt auf und wird in Nordamerika längst als Superstar gefeiert. Und das nicht ohne Grund: Der »Dirk Nowitzki des Eishockeys« erzielt eine Höchstleistung nach der anderen. Als erster deutscher Eishockeyprofi setzt er 2020 als erfolgreichster Scorer eine Bestmarke und wird zum wertvollsten Spieler der NHL gewählt, in Deutschland im selben Jahr zum Sportler des Jahres. Sechsmal schon hat der gebürtige Kölner mehr als 100 Scorerpunkte erreicht, viermal mehr als 50 Tore pro Saison geschossen. Der erfahrene Sportjournalist und Eishockeykenner Günter Klein beleuchtet die größten Momente des Ausnahmesportlers – von den Anfängen beim Kölner EC bis zum Topverdiener der NHL. Und er gibt einen Ausblick auf Draisaitls größtes Ziel: den Stanley Cup nach Edmonton zurückzuholen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 239
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buchvorderseite
Titelseite
GÜNTER KLEIN
LEON DRAISAITL
DIE BIOGRAFIE
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
Wichtiger Hinweis
Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.
Originalausgabe
1. Auflage 2025
© 2025 by riva Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Redaktion: Ulrich Korn
Umschlaggestaltung: Karina Braun
Umschlagabbildung: AdobeStock/Olex Runda, siam4510; IMAGO/Gary A. Vasquez; Imagn Images
Satz: abavo GmbH, Buchloe
eBook: ePUBoo.com
ISBN druck 978-3-7423-2833-5
ISBN ebook (EPUB, Mobi) 978-3-7453-2630-7
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.rivaverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Inhalt
Vorwort von Marco Sturm
Kapitel 1Peter und der Penalty
Kapitel 2Eine Jugend in Eishockey-Deutschland
Kapitel 3Eine Eishockey-Jugend in Kanada
Kapitel 4Draft Day
Kapitel 5Die Öl-Stadt
Kapitel 637 Spiele
Kapitel 7Die Degradierung
Kapitel 8Der Junge vom anderen Stern
Kapitel 9Der Tag, der alles verändert
Kapitel 10Ein Tor für die Ewigkeit
Kapitel 11Team Europa
Kapitel 12Der Ironman
Kapitel 13Prozente und Millionen
Kapitel 14Das Karrierejahr
Kapitel 15Leon für Deutschland
Kapitel 16Eine Trophy von Gretzky
Kapitel 17Die Geburt des Playoff-Monsters
Kapitel 18Leon und die Medien
Kapitel 19Kategorie Superstar
Kapitel 20Spiel sieben
Kapitel 21Der McDavid-und-Draisaitl-Effekt
Kapitel 22Oiler für immer
Kapitel 23Wo soll das enden?
Danksagung und Quellen
Vorwort von Marco Sturm
Ich kann mich noch sehr gut an das Jahr 2016 erinnern. Im Mai war meine erste Weltmeisterschaft als deutscher Bundestrainer, sie fand in Russland statt. Leon Draisaitl, ein junger Spieler, gehörte zu meinem Team, er spielte ein gutes Turnier. Aber er war von sich enttäuscht. Er wollte derjenige sein, der den Unterschied ausmacht, und das war er damals noch nicht. Das hat ihn wahnsinnig gemacht.
Drei Monate später haben wir uns für die Olympia-Qualifikation wiedergetroffen – und in diesem Sommer hatte er einen Riesenschub erlebt. In der Pause! Seine Schritte nach vorn, so kann ich im Rückblick sagen, erfolgten nicht nur jedes Jahr, sondern oft sogar Monat für Monat. Bei unserer geglückten Olympia-Qualifikation war Leon schon ein Star, und später wurde er zum Superstar. Ich hatte das Vergnügen, seine Entwicklung in der Nationalmannschaft ein paar Jahre mitverfolgen zu können. Wie er heute spielt und auftritt, ist für mich keine Überraschung. Ich halte ihn für den besten Eishockeyspieler der Welt.
Um ehrlich zu sein: Bemerkt habe ich Leon erst, als er im Juniorenalter in Kanada spielte. Ich kannte seinen Vater Peter, gemeinsam hatten wir 1998 in Nagano im deutschen Olympiateam gespielt. Leons Nachwuchsweg in Deutschland habe ich noch nicht mitbekommen. Aber als er mit 16 nach Kanada wechselte, sah man, dass er etwas Besonderes ist. Er musste in einer Liga bestehen, in der teilweise vogelwild gespielt wird und in der es Europäer doppelt schwer haben, weil man sie für soft hält und ihnen nicht zutraut, die Härte anzunehmen. Doch er wollte auch in diesem Umfeld der Beste sein. Diesen Drang haben nicht viele, und das kannst du nicht lernen. Leon hat das in sich – unabhängig von der Liga.
Leon ist einer, der sich richtig pushen kann. Er würde am liebsten 60 Minuten auf dem Eis stehen und hasst es, wenn er zum Wechsel fahren muss. Ich weiß es von den Trainern seiner Anfangszeit, dass sie Probleme mit Leons Ausstrahlung hatten, die er an den Tag legte, wenn es nicht so richtig lief. Er musste lernen, ausgeglichen zu wirken; das hat ein paar Jahre gedauert. Heute ist er ein kompletter Spieler. Leon hat den Drive, in einem Spiel auf höchstem Niveau über 25 Minuten zu gehen.
Was ich in der NHL als Co-Trainer bei der gegnerischen Mannschaft, den Los Angeles Kings, erfahren habe: Wenn er auf dem Eis ist, kann immer etwas passieren. Auch das haben nur wenige Spieler: etwa Leons Teamgefährte in Edmonton, Connor McDavid, und Nathan MacKinnon in Colorado. Leon ist einfach ein unglaublicher Spieler.
Was ich etwas schade finde: In Deutschland wird ihm noch zu wenig Aufmerksamkeit entgegengebracht. Leon könnte natürlich mehr machen in der Öffentlichkeit, aber er ist ein zurückhaltender Typ, jemand, der sich nicht aufdrängt.
Rein sportlich hat er die Extraklasse, die Dirk Nowitzki im Basketball verkörperte. Und wir haben keinen Fußballer, der so gut ist wie Leon im Eishockey.
Fragt man den allgemeinen Sportfan in Deutschland nach Leon Draisaitl, wird er sagen: »Ja, das ist ein guter Spieler.« Ich sage: Nein, er ist der Beste.
Marco Sturm wurde 1978 in Dingolfing geboren. In der Deutschen Eishockey Liga spielte er für den EV Landshut. Als 19-Jähriger wechselte er in die NHL, ist noch immer der deutsche Spieler mit den meisten Einsätzen in der nordamerikanischen Profiliga (1006 für San Jose Sharks, Boston Bruins, Los Angeles Kings, Washington Capitals, Vancouver Canucks, Florida Panthers). Lediglich Leon Draisaitl erzielte mehr Scorerpunkte als Sturm. Von 2015 bis 2018 war Marco Sturm deutscher Bundestrainer. Höhepunkt seiner Amtszeit: Olympiasilber 2018 in Pyeongchang. Ende 2018 wurde er Assistant Coach bei den Los Angeles Kings, 2022 übernahm er das Cheftraineramt bei Ontario Reign, dem Farmteam der Kings.
Kapitel 1
Peter und der Penalty
»Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.« Das war der Satz, den alle erwarteten, die am Abend des 18. Februar 1992 ihren Fernseher einschalteten. 20 Uhr, die unumstößliche Zeit für die Lage der Welt. Bonn, Berlin, Washington, Moskau, Peking.
Doch um 20 Uhr ertönte im Ersten nicht die vertraute Fanfare, es kam kein Nachrichtensprecher ins Bild. Es lief: ein Eishockeyspiel.
Es waren Olympische Winterspiele im französischen Albertville. In der Eishalle von Méribel hatte um 17 Uhr das Viertelfinale zwischen Kanada und Deutschland begonnen. Bei normalem Verlauf hätte es um 19:30 Uhr zu Ende sein müssen. Eindeutiger konnte die Verteilung der Rollen nicht sein. Kanada als Mutterland des Eishockeys war der Favorit.
Doch das Spiel verlief nicht so, wie die seit Jahrzehnten festgefügte Hierarchie es vorsah. Die Deutschen lagen sogar einmal mit 2 : 1 in Führung, und nach 60 Minuten, der regulären Spielzeit, stand es 3 : 3. Bei einem Unentschieden gibt es eine Verlängerung von maximal zehn Minuten. Fällt ein Tor, ist das Match entschieden. Für den Sieger ist es der Sudden Victory, für den Verlierer der Sudden Death.
Es fiel kein Tor. Die Partie war netto 70 Minuten alt und brutto mit all den Pausen zur Eisaufbereitung und den Unterbrechungen bei drei Stunden angelangt. Zum ersten Mal in der Geschichte olympischer Eishockeyturniere ging es in ein Penaltyschießen. Es wurde 20 Uhr, und hier war das Erste Deutsche Fernsehen mit Eishockey live, weil die Sportfans es dem Sender nicht verziehen hätten, hätte er die Übertragung abgebrochen. Zudem musste das, was sich gerade an Dramatik auf dem Eis abspielte, doch auch für das vorrangig politisch interessierte Tagesschau-Publikum von Interesse sein. Eine sich anbahnende Sporthistorie ist ebenfalls relevantes Tagesgeschehen.
In einem Penaltyschießen werden fünf Akteure pro Team benannt. Haben sie alle aufs Tor geschossen und steht auf der Ergebnistafel immer noch ein Remis, entscheidet der nächste Schuss. Nach fünf Durchgängen stand es 2 : 2.
Franz Reindl, früherer Nationalspieler, später im Deutschen Eishockey-Bund in verschiedenen Funktionen bis zum Präsidenten tätig, stand 1992 als Co-Trainer an der Bande. Chefcoach Dr. Luděk Bukač hatte ihm den Auftrag erteilt: »Teile die Schützen für das Penaltyschießen ein, wenn es dazu kommt.« Reindl erinnert sich: »Mit Peter hatte ich nur Blickkontakt. In seinen Augen leuchtete Selbstsicherheit. Es war keine Frage, dass wir ihn nominieren.«
Kanada gegen Deutschland, Penaltyschießen, die sechste Runde. Für Kanada trat an: Eric Lindros, 18 Jahre alt, er war schon als Teenager eine Berühmtheit. Lindros überwand den deutschen Goalie Helmut de Raaf. Das bedeutete: Deutschland musste nun treffen, der Peter musste treffen, Peter Draisaitl. Der mit seinen Augen gesprochen hatte: Ich will es, ich kann es.
Peter Draisaitl lief in hohem Tempo auf den kanadischen Keeper Sean Burke zu. Er wollte sich nicht verzocken, sondern zog ab. »Ich wollte ihm durch die Beine schießen«, sagte er später. Das glückte ihm auch. Doch Burke machte eine Bewegung zur Seite, riss die mächtigen Beinschienen nach oben, für einen Augenblick war der Puck nicht zu sehen. Doch dann kam er zwischen den Beinen hervor, sprang hochkant dem Tor entgegen. Die Scheibe hoppelte, legte sich zur Seite, verlor an Schwung, folgte den Gesetzen der Physik und blieb auf der Torlinie liegen. Der Puck – Material schwarzes Hartgummi, Durchmesser 3 Zoll oder 7,62 Zentimeter, Gewicht zwischen 156 und 170 Gramm – hatte gegen die deutsche Mannschaft entschieden. Kanada war im Halbfinale, Deutschland ausgeschieden.
Für Franz Reindl ist der Moment »unvergesslich bis heute«. Da kriechen die Gedanken wieder in den Kopf: Was wäre noch möglich gewesen in Albertville auf Basis einer Sensation gegen Kanada? Dann hätte man nicht bis Pyeongchang warten müssen, denn 26 Jahre nach Albertville gewannen die Deutschen in Südkorea die Silbermedaille.
Doch schon am nächsten Tag wusste man mit Blick auf das deutsche Eishockey, dass es in den französischen Alpen zwar kein Edelmetall gewonnen hatte, aber Aufmerksamkeit. Das Spiel wirkte weit über die üblichen Fankreise hinaus. Das Penaltyschießen hatten 9,99 Millionen Menschen in Deutschland gesehen. Eine gigantische Zahl, natürlich bedingt dadurch, dass die Laufkundschaft der Tagesschau mit dabei war. Millionen verfolgten das Drama im Radio. Eddie Körper, der legendäre WDR-Reporter, kommentierte so mitreißend, dass Autofahrer nicht mehr in der Lage waren, sich auf den Straßenverkehr zu konzentrieren, sie suchten den nächsten Parkplatz auf. Der Puck, der auf der Linie verhungert war, das Ausmaß an Unglückseligkeit – diese Geschichte nahm das ganze Land mit. Und wer es nicht gesehen hatte, dem wurde es erzählt.
»Auch wenn der Puck nicht drin war – diese Szene hat das deutsche Eishockey in seiner Entwicklung beeinflusst«, ist sich Franz Reindl sicher. »Es ist selten, dass man durch ein Nichttor eine solche Bekanntheit erlangt wie er«, sagt er und meint Peter Draisaitl.
Denn das war ab sofort seine Geschichte. Für die Eishockey-Interessierten war Peter Draisaitl schon lange eine feste Größe, nun klang sein Name weit über die Blase hinaus. Dreiseidel, Draisaitl – egal: der mit dem Penalty, der eine Umdrehung davon entfernt war, eine Nation zu beglücken.
Der Name geriet nie in Vergessenheit. »Immer wenn Olympische Spiele anstehen, werde ich darauf angesprochen«, sagt Peter Draisaitl. 20 Jahre nach Albertville wurde der Name Draisaitl wieder öfter genannt und nicht nur zu nahenden olympischen Anlässen. Aber jetzt ging es um Leon Draisaitl, Peters Sohn, geboren 1995. Und Leons Geschichte wurde in einem noch frühen Stadium so groß, dass Peter 2016 über seinen 20-jährigen Junior sagte: »Er hat, was ich niemals hatte.«
Aber klar: Die Geschichte von Leon Draisaitl gäbe es nicht ohne Vater Peter.
Peter wurde 1965 in Karviná in der Tschechoslowakei geboren, seine Familie gehörte der deutschen Minderheit an. So wie Erich Kühnhackl, der der bekannteste deutsche Eishockeyspieler des 20. Jahrhunderts war und mit seiner Statur, den langen Haaren und seiner spektakulären Spielweise weit über die Karriere hinaus zu einer Marke wurde. Kühnhackl siedelte Ende der 1960er-Jahre mit seinen Eltern nach Landshut über. Die Draisaitls wollten ebenfalls auf die andere Seite des Eisernen Vorhangs. In der Prager Zeitung erzählte Peter fast 40 Jahre später von den gewaltigen Veränderungen in seinem Leben als 13-Jähriger, nachdem die Eltern (»Sie wollten raus aus dem System«) sich zur Flucht über Jugoslawien und Österreich entschieden hatten: »Das Leben, das wir bis dahin kannten, war abrupt beendet und wir mussten uns komplett neu ausrichten. Wir haben anfangs überhaupt nicht kapiert, wo wir gelandet sind. Wir hatten gar nichts.«
Peter hatte seinen Sport, das Eishockey. Er war unübersehbar ein Talent. Und landete in der Nähe von Mannheim.
Harold Kreis, der 2023 deutscher Bundestrainer wurde, war Spieler in Mannheim, als Peter Draisaitl zu der Mannschaft stieß, die zu den besten in Deutschland gehörte. 1980 war der Mannheimer ERC Deutscher Meister geworden, das Team hatte ein Gerüst an Deutschkanadiern, die der Verein per Zeitungsannoncen in Nordamerika ausfindig gemacht hatte – Harold Kreis war einer von ihnen. Man möchte meinen, Peter Draisaitl könnte es mit seinem tschechischen Hintergrund schwer gehabt haben in einer kanadisch geprägten Community, doch dem war nicht so, versichert Harold Kreis: »Er war ein ruhiger Zeitgenosse, es war einfach, Kontakt zu ihm zu knüpfen. In Peter Obresa und Marcus Kuhl, Stürmer wie er, fand er gleich zwei Kumpels. Peter war nicht vorlaut, sondern auf unaufdringliche Art selbstbewusst, und auf dem Eis hatte er eine stabile Ausstrahlung in seiner Spielweise.« Franz Reindl spielte mit Peter Draisaitl in der Nationalmannschaft und befand: »Er war ein besonderer Spieler, technisch versiert und ein bisschen anders als die anderen. Er war wahnsinnig geschickt darin, seine Mitspieler einzusetzen.«
Sein Förderer war Ladislav Olejník, Trainer in Mannheim. Auch er kam aus der CˇSSR, die gemeinsame Eishockeyschule schuf eine spezielle Verbindung zum Center (Mittelstürmer) Peter Draisaitl. »Olejník war sein größter Fan, er konnte das nicht verbergen«, wusste Franz Reindl, »das war für die anderen nicht so lustig.« Harold Kreis schätzte das Element, das Draisaitl unter Olejníks Obhut in Mannheim einbrachte: »Technisch stark, mehr Scheibenkontrolle und Positionswechsel – wir waren teilweise sehr geradlinig.«
In die National Hockey League, die NHL, zog es Draisaitl nicht. In seiner Welt kam diese mythische Profiliga gar nicht vor. Nur vereinzelt wagten deutsche Spieler einen Wechsel in die knallharte Liga, meist blieb es bei bewundernder Distanz. Franz Reindl bekam regelmäßig Videokassetten mit Highlights aus Übersee und reichte sie in der Nationalmannschaft herum, und als die deutsche Nationalmannschaft zum Canada Cup 1984 eingeladen wurde, befürchtete er, »dass die Kanadier rückwärts schneller laufen werden als wir vorwärts«. Die deutsche Bundesliga, in der ein Star besser verdienen konnte als ein Mitläufer in der NHL, war ein Wohlfühl-Resort, das man nicht leichtfertig verließ. Peter Draisaitl hatte ein gutes und geregeltes Leben. Er hatte sich darin perfekt eingerichtet, wechselte zweimal vom Mannheimer ERC zu den Kölner Haien und war Stammkraft in der deutschen Nationalmannschaft. 1994 wurde die Bundesliga umgewandelt in die Deutsche Eishockey Liga (DEL), und Peter Draisaitl stand in der Blüte seiner Jahre. Er gehörte zu den Topscorern.
Sein Leben sollte auch nach der Spielerzeit, die für ihn mit 36 Jahren bei den Revierlöwen Oberhausen endete, voller Eishockey sein. Peter Draisaitl wurde Trainer. Auf Leon hatte das die positive Auswirkung, dass er sich in den Eishockeykabinen der Vereine bewegte, bei denen der Vater Trainer war.
Peter Draisaitls Trainerkarriere verlief unruhiger als seine Spielerlaufbahn. Nach gut zehn Jahren hatte er in Deutschland sieben Stationen hinter sich, coachte anschließend in Tschechien und der Slowakei und musste die Sprache seiner Kindheit reaktivieren. Höhepunkt seines Wirkens als Trainer war nicht ein Titel, sondern ein Freundschaftsspiel, das er 2018 als Coach der Kölner Haie gegen die Edmonton Oilers mit ihrem Starspieler Leon Draisaitl bestreiten durfte.
Vater und Sohn begegneten sich auf Augenhöhe. »Die Kölner sollen einen sehr guten Trainer haben«, unkte Edmontons Superstar Connor McDavid. »Für Leon habe ich keinen Plan, wir müssen auf McDavid achten«, sagte Peter Draisaitl.
Draisaitl versus Draisaitl, die kanadischen Medien berauschten sich an der Konstellation. Und sie kamen auf den Penalty bei den Olympischen Winterspielen von 1992 zu sprechen.
Peter Draisaitl lächelte, erinnerte an die alten Holzschläger aus den frühen 1990er-Jahren und verwies darauf, dass die Spieler inzwischen Hightechgeräte aus Carbon benutzen, mit denen ganz anders geschossen werden kann. »Mit einem Schläger von heute«, sagte er, »hätte ich den Penalty verwandelt.«
Kapitel 2
Eine Jugend in Eishockey-Deutschland
Die ersten »Leon Draisaitl«-Chöre erklangen im September 1998 auf einer Bühne am Essener Baldeneysee. Leon war noch keine drei Jahre alt, und sein Vater nahm ihn mit zur Teampräsentation der Moskitos Essen. Sein neuer Klub, ein Zweitligist, der durch diverse wirtschaftliche Turbulenzen gegangen war. Es sollte aufwärts gehen, man investierte, und Peter Draisaitl, mit 33 in gesetztem Alter, sollte die Leitfigur werden.
Ein großer Name, der Empfang war euphorisch. Die Anhängerschaft war im ausklingenden Sommer schon im Eishockey-Betriebsmodus und sang: »Wir sind die besten Fans der Liga!« Peter Draisaitl trug Jeans und einen blauen Blouson, er winkte in die Menge. Neben ihm ein kleiner blonder Junge. »Wen haben wir denn da noch auf der Bühne?«, fragte der Moderator. »Das kann er selbst sagen«, meinte Peter. Doch der Junge drückte sich verlegen weg, als ihm das Mikrofon hingehalten wurde. Also musste der Vater aufklären: »Das ist der Leon.« Sofort stand der Gedanke im Raum: Leon Draisaitl, in ferner Zukunft mal Center der Moskitos Essen? Die Fans stiegen auf die Vision sofort ein: »Le-on, Le-on, Le-on«. Der Moderator forderte den Gefeierten auf, doch einmal kurz zu winken. Leon stand irritiert vor der Menge an Menschen zu seinen Füßen und verschwand lieber hinter den Beinen seines Vaters. Die Szene wurde ihm später bei einem Auftritt in der ARD-Sportschau vorgespielt, Leon bekannte, daran keine Erinnerung zu haben.
Es ist kein ferner Gedanke, dass die Kinder von Eishockeyspielern einmal in die Fußstapfen ihrer Väter treten. Die Sportart ist in Deutschland stets von überschaubarer Größe gewesen. Da es hierzulande an Hallen und Eisflächen mangelt, sind der Verbreitung des Sports Grenzen gesetzt, doch in der Nische ist eine starke Identifikation entstanden mit dem, was man tut. Viele einst aktive Spieler blieben ihrem Sport verbunden, sei es als Nachwuchstrainer, als Funktionär oder mindestens als geneigter Konsument. Sprang das Interesse auf die eigenen Kinder über, förderten sie es. Die zweite Generation hatte im Eishockey dann stets die besseren Startchancen, wusste die erste Generation doch genau, worauf es ankam.
Peter Draisaitls Leben war um das Eishockey herum aufgebaut. So konnte es nicht verwundern, dass eines der ersten Fotos von Leon, das den Weg in die Öffentlichkeit fand, ihn ohne Hose, aber mit einem Eishockeyschläger in der Hand zeigt. Sein Interesse ergab sich, gedrängt wurde er nicht. »Meine Eltern waren sehr entspannt«, erzählte er 2022 im Podcast Einfach mal Luppen der Fußballer Toni und Felix Kroos, »im tiefen Herzen hat mein Vater sich schon gefreut, dass es mit Eishockey geklappt hat.«
Wobei: Es gab eine Unterbrechung. Mit sieben, acht Jahren wollte Leon Draisaitl mit Eishockey nichts zu tun haben, die aufwendige Anziehprozedur vor jedem Training hatte ihn genervt. Beim Fußball ging das alles schneller. Also kickte er eine Saison bei Viktoria Köln, einem der großen Klubs der Stadt.
Bis sich der Beckenbauer-Moment ereignete. Den Lebensweg des größten deutschen Fußballers bestimmte ein Vorfall in seiner Jugend. Beckenbauer, Spieler des SC 1906 München, wollte eigentlich zum TSV 1860 wechseln, doch in einem Spiel gegen die Sechziger bekam er von seinem Gegenspieler eine Ohrfeige verpasst. Daraufhin schloss er sich trotzig dem FC Bayern München an – der zum bestimmenden Verein in Deutschland avancierte.
Leon Draisaitl musste eine Missachtung bei Viktoria Köln erfahren. »Wir hatten eine Trainerin, und sie ließ nicht mich einen Freistoß schießen, sondern ihren Sohn.« Er empfand das als große Ungerechtigkeit und zog die Konsequenz: zurück zum Eishockey. Eine Fußballjugendtrainerin hatte also ohne Absicht dafür gesorgt, dass dem Eishockey in Deutschland ein Spieler zugeführt wurde, der zum Besten werden sollte, den es je hervorbrachte.
Leon spielte also wieder Eishockey, bei den Kölner Haien, und war glücklich. Er hatte seine Freunde im Nachwuchs der Haie. Vor allem die Tiffels-Brüder, Dominik und Frederik. Doch wer im Eishockey gut wird, weckt Begehrlichkeiten. Und so begann das ambitionierteste Nachwuchsprojekt, die Jungadler Mannheim, sich für die Tiffels-Brüder zu interessieren. Nicht aber für Leon Draisaitl.
In Mannheim engagierte sich Dietmar Hopp, der Mitgründer der Software-Schmiede SAP. Er hatte die TSG 1899 Hoffenheim, seinen Fußball-Heimatverein, 2008 in die Bundesliga gebracht. Im Eishockey führte Daniel Hopp, der Sohn, die Geschäfte. Investiert wurde jedoch nicht nur in die Adler, die Profimannschaft in der DEL. Man verstand sich auch als Anlaufstelle für die größten Talente im Land und wollte für sie eine Umgebung schaffen, in der sie so gut werden konnten wie die veranlagten Spieler in den typischen Eishockey-Nationen im Osten und Norden Europas. Diese Ambitionen führten zu einem Mann, der die Hingabe entwickelte für diese Herausforderung: Helmut de Raaf. In den 1980er- und 1990er-Jahren war er deutscher Nationaltorhüter gewesen – eines seiner Spiele war das Olympia-Viertelfinale 1992 gegen Kanada mit dem Peter-Draisaitl-Penalty , und mit Köln und Düsseldorf hatte er Titel um Titel gewonnen.
De Raaf warb um Dominik und Frederik Tiffels. Sie waren bereit, nach Mannheim zu wechseln, sagten jedoch auch: »Wir hätten da aber noch einen.« Leon Draisaitl.
Helmut de Raaf reagierte zögerlich. Er wusste um die spezielle Verbindung der Familie Draisaitl zu Köln. Leons Mutter Sandra stammte aus der Domstadt, für Peter, mit dem er zusammengespielt hatte, war Köln die Homebase geworden, von der aus er zu seinen Jobs als Trainer an anderen Orten aufbrach. Und Leon war am Rhein geboren worden, er wuchs auf als »Kölsche Jung«. Für Mannheim entschied er sich mit schwerem und zweifelndem Herzen. Helmut de Raaf hatte den Eindruck, »dass er mitgekommen ist, weil sein bester Freund gegangen ist«. Leon Draisaitl war 13 und hin- und hergerissen zwischen klarer Sichtweise und Emotion. »In Sachen Juniorenprogramm war Mannheim das Beste, wir hatten viel bessere Möglichkeiten beim Training, waren viel auf Reisen, haben dauernd in Kanada und in Skandinavien gespielt.« Doch er spürte, »dass es vor allem für meine Mutter schwer war, mich gehen zu lassen«.
Als er schon ein Star bei den Edmonton Oilers war, schilderte er der kanadischen Autorin Lorna Schultz Nicholson, die ein auf die Lesebedürfnisse von Kindern ausgerichtetes Buch über ihn schrieb, wie sehr ihn in den ersten Nächten in der Mannheimer Gastfamilie das Heimweh nach Köln plagte. Zum Glück war da noch ein anderer junger Spieler in seinem Alter, der bei denselben Herbergseltern untergekommen war: Dominik Kahun. Gemeinsam sollten sie bei den Jungadlern Maßstäbe setzen. Aber dafür mussten sie Geduld aufbringen.
Helmut de Raafs erster und untrüglicher Eindruck von Leon Draisaitl war: »Er hatte die Hände und das Auge fürs Spiel, er verstand es. Aber läuferisch war er nicht so gut, er befand sich im Wachstum und hatte Probleme mit der Geschwindigkeit.« Deshalb ging die Karriere in Mannheim langsamer voran, als Leon sich das erhofft hatte.
In Köln war er mit 12 Jahren schon in die U16 geholt worden. In dieser Altersklasse und der Schüler-Bundesliga musste er auch in Mannheim spielen, obwohl er schon 14, später dann 15 war. Für die nächste Stufe, die Deutsche Nachwuchsliga DNL, befand de Raaf ihn noch nicht für reif. Was seine Entscheidung für Leon Draisaitl und den gleichermaßen betroffenen Dominik Kahun bedeutete, war ihm bewusst: »Das ist nicht einfach, wenn Spieler, die das gleiche Alter haben, nach oben gehen und man selbst nicht dabei ist.« Dominik und Frederik Tiffels spielten DNL, Leon nicht. Er und Kahun durften mit der DNL-Mannschaft zwar trainieren, doch spielen nur mit den Schülern. De Raaf hatte sie sechs Testspiele mit der DNL-Truppe bestreiten lassen, aber sie punkteten nicht. In der jüngeren Gruppe taten sie es allerdings wie wild.
Die Zahlen waren imposant: Leon – inklusive der Playoffs 31 Spiele, dabei 56 Tore und 58 Vorlagen, die zu Treffern führten. Dominik Kahun – 59 Tore, 78 Assists, noch eindrucksvoller sogar. Doch de Raaf glaubte: Da geht noch mehr.
Vor der Saison 2010/11 führte er ein Gespräch mit Draisaitl und Kahun. »Ihr braucht klare Ziele«, sagte er. Die beiden Spieler erwiderten: »Wir wollen 200 Scorerpunkte.« Helmut de Raaf musste einräumen, »dass ich kurz gestockt habe«. Kahun ging dann mit 237 Punkten aus der Saison, Draisaitl mit 223. »Da sah man, um was es ihnen ging«, so ein zufriedener Helmut de Raaf. »Dominik war der Motor, Leon hat das Spiel geführt.«
Die Überlegenheit der Jungadler Mannheim im deutschen Schüler-Eishockey war nahezu absurd. Axel Kammerer, der mit Peter Draisaitl schon in der deutschen Juniorennationalmannschaft gespielt hatte und dessen Sohn Maximilian ein knappes Jahr jünger ist als Leon Draisaitl, hat die Konstellation noch vor Augen: »Mannheim hat alle Gegner zweistellig weggehauen, auch Bad Tölz, wo Maxi spielte. Für Tölz wiederum waren nur die Duelle mit Landshut ausgeglichen, gegen alle anderen gab es zweistellige Siege.« Die Schüler-Bundesliga war eine Dreiklassengesellschaft.
»Mit 14, 15 ist Leon schon massiv ins Auge gestochen«, sagt Franz Reindl. Beim Deutschen Eishockey-Bund war aus dem Co-Trainer der Nationalmannschaft von den Jahren 1991 bis 1994 der Sportdirektor und Generalsekretär geworden, zu dessen Zuständigkeiten es auch gehörte, die Weltmeisterschaften zu organisieren, die Deutschland zugesprochen bekam (2001, 2010 und 2017 mit Frankreich als Co-Ausrichter). Reindl hatte immer einen Blick fürs große Ganze und eine Vision, dass es international um mehr gehen sollte als nur um das Überleben in der höchsten WM-Gruppe. Reindl, selbst Gewinner der Bronzemedaille von Innsbruck 1976, wollte erreichen, dass man sich nicht verstecken muss vor Finnen und Tschechen und dass man auch in der Lage ist, Russen und Kanadier zu schlagen bei einer WM oder bei Olympia. »Der DEB hatte begonnen, Scoutinglisten zu erstellen, wie es die NHL tat – Leon ist schon in Köln und mehr noch in Mannheim mit seinen gigantischen Zahlen aufgefallen«, so Reindl. Der DEB berief ihn in die U16-Nationalmannschaft, die jüngste Altersstufe.
Obwohl der junge Eishockeyspieler Leon Draisaitl an Konturen gewann, war Helmut de Raaf nicht vollends zufrieden mit seiner Entwicklung. Der Trainer nahm einen jungen Kerl wahr, der im Spiel aufging, nicht aber im Training. »Am Anfang war Leon schwierig«, blickt er zurück, »er war nicht der Trainingsfleißigste, wenn es um Athletik ging, von den Pflichtaufgaben Laufen und Krafttraining musste man ihn sehr überzeugen.« Wie motiviert man Leon, sodass er von sich aus mehr arbeitet? Vor diese Aufgabe sah de Raaf sich gestellt.
Und dann ereignete sich Wundersames. Aus dem Sommer 2011 kam ein Leon Draisaitl zurück, der de Raaf und seinen finnischen Assistenten Petteri Väkiparta verblüffte: »Leon fragte nach einem Extraprogramm. Wir merkten, dass ein Umdenken stattgefunden hatte, er über seine Grenzen hinauskommen wollte. Petteri und ich waren sprachlos nach diesem Gespräch, wir hatten einen ganz anderen Menschen erlebt. Leon war über den Sommer erwachsen geworden.« Leon formulierte sein Ziel: Er wolle in die NHL.
»Leon sprühte vor Ehrgeiz und Energie«, bemerkte auch Franz Reindl, wenn er als DEB-Sportdirektor bei den Lehrgängen der U-Nationalmannschaften im Bundesleistungszentrum in Füssen zusah. »Er hat sich im Training nicht hinten angestellt bei den Übungen, er ist sofort eingesprungen, wenn ein anderer ausfiel, er hat die höhere Belastung hingenommen.« Draisaitl stieg auf von der U16 in die U17 und nahm gleich noch die U18 mit. Und in Mannheim gehörte er endgültig und unwiderruflich der DNL-Truppe an. »Da hat er dann ein ganzes Jahr lang seine Klasse gezeigt«, lobt Helmut de Raaf. Die Jungadler gewannen 2012 die Deutsche Meisterschaft, in der Finalserie zog man um von der kleinen Halle in die große SAP Arena, es kamen 8000 Zuschauer. Auch die Profimannschaft der Adler fand sich ein, und de Raaf nahm als Coach an der Bande wahr, »wie ein Raunen durch die DEL-Mannschaft ging, als Leon aus der neutralen Zone einen Rückhandpass gegen die Bewegung gespielt hat«. Die Fachleute erkannten, dass da ein Bengel von 16 Jahren war, in dessen Kopf Eishockey auf einem Niveau stattfand, das sie selbst trotz ihrer Meriten nie erreicht hatten.
Zum Genie, das in Leon schlummerte, war das Strebsame gekommen. Draisaitl saugte alles auf, was er über Eishockey lernen konnte. Mannheim war dafür the place to be. Denn Helmut de Raaf als Leiter der Nachwuchsakademie nutzte die Mittel, die ihm zur Verfügung standen. Eine Maßnahme: Er ließ Impulse von außen zu, lud Referenten ein, die einen anderen Blickwinkel vermittelten.
Einer war Jay Woodcroft, ein ehemaliger kanadischer Center mit einer unscheinbaren Karriere in den nordamerikanischen Universitätsligen und einem Abschlussjahr (2004/05) als Torjäger in Deutschlands dritter Liga, in Stuttgart. Als Trainer war Woodcroft aber in höheren Sphären unterwegs. Nach Stuttgart ging es auf direktem Weg in die NHL: Woodcroft wurde Videocoach bei den Detroit Red Wings und nach drei Jahren Assistenztrainer bei den San Jose Sharks. Mit dieser Reputation hielt er mit Helmut de Raaf in Mannheim ein Camp für die Jungadler ab, dabei fiel sein Auge auf Leon Draisaitl. In Kanada ist diese frühe Bekanntschaft der beiden unbekannt geblieben. Für Leon war es ein wertvoller Kontakt. In seiner zweiten Saison in der NHL (2015/16), bei den Edmonton Oilers, war Woodcroft Co-Trainer. De Raaf: »Jay sagte, er werde sich um Leon kümmern. Er war seine schützende Hand. In der NHL braucht man sie, sonst fällt man schnell durchs Raster.« 2022 wurde Woodcroft sogar Cheftrainer in Edmonton, ein weiteres Mal war Leon Draisaitl sein Spieler.
Ein richtiger Weltstar des Eishockeys, den de Raaf für einige Tage nach Mannheim lotste, war Pavel Datsyuk. Ein Russe und eines von 30 Mitgliedern im »Triple Gold Club«, einem virtuellen Zirkel von Spielern, die die drei wichtigsten Trophäen des Eishockeys gewinnen konnten: den Stanley Cup, Olympiagold, den WM-Titel. Man muss, um das zu schaffen, in zwei Welten