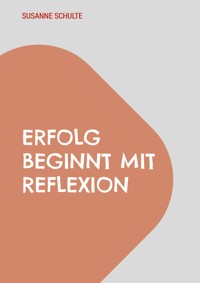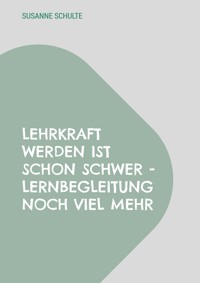9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Welches sind die richtigen Lernstrategien für den Studienerfolg? Wie kann die Selbstlernkompetenz von Studierenden gefördert werden? Mit diesen beiden zentralen Fragen setzen sich die Autoren auseinander! Es wird diskutiert, welche grundsätzlichen Komponenten der Selbstlernkompetenz für alle Studierenden bedeutsam sind und wie sich individuelle Unterschiede bei der Lehrkonzeption berücksichtigen lassen. Das Ziel besteht in der Stärkung der individuellen Selbstlernkompetenz und der Nutzung neuer digitaler Lernformen. Dies soll über gesteuerte Selbstreflektion und Selbsterkenntnis erfolgen und geeignete Anwendungen sollen geübt werden. Auch die Frage, ob es eines separaten Lehrangebotes bedarf oder besser in die Re-gellehrveranstaltungen integriert werden sollten, wird diskutiert. Darüber hinaus wird ein Lehrkonzept zur Integration in die Regelvorlesung konzipiert und getestet. Letztlich wird die Bedeutung von Kompetenzvermittlung diskutiert und ein Ausblick gegeben. Basierend auf diesen Grundlagen werden Konzepte des agilen Lernens und Lehrens diskutiert und hiermit ein Focus auf die Aktivierung der Studierenden gelegt. Zudem werden einige digitale Anwendungen beispielhaft genannt, die zur Unterstüt-zung der Selbstlernkompetenz eingesetzt werden können. Hierbei steht die Integration neuer digitaler Hilfestellungen im Vordergrund, um das Gesamtziel einer individuellen Entwicklung der Lernkompetenz zu unterstützen und zu ergänzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 84
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Frau Dr. Susanne Schulte, Diplom-Psychologin mit Schwerpunkt in der Arbeits-, Personal- und Organisationspsychologie promovierte an der Bergischen Universität Wuppertal zum Thema der barrierefreien Testverfahren für Menschen mit Behinderung. Die Themen der Didaktik begleiten sie seit dem Studium auf vielfältige Weise in Seminaren, Trainings und Hochschullehre. Seit 1997 arbeitet sie im Personalbereich der Stadt Köln, langjährig im dortigen Institut für Personalentwicklung und Eignungsprüfung. Heute ist sie beratend als Stabsstelle für alle Themenbereiche im Arbeitsfeld der Personalauswahl, Personalentwicklung und Ausbildung zuständig. Sie ist seit mehreren Jahren Dozentin für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Fresenius. Den Masterstudiengang Human Resources Management am Standort Düsseldorf leitet sie seit 2019. Zudem unterrichtet Sie Studierende an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW. Zu ihren Forschungsinteressen zählt das Arbeitsfeld der Personal- und Organisationspsychologie.
Dr. Christoph Hermsen, Hochschuldozent für Rechnungswesen und Controlling an der Hochschule Fresenius, Forschungsschwerpunkte: Cloudbasiertes Prozessmanagement, Steuerung globaler Unternehmen und digitales Immobilienmanagement/M&A, Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Duisburg-Essen mit anschließender Promotion an der Universität St. Gallen, Schweiz. Über 25 Jahre Führungs-/ und Managementerfahrung in produzierenden, internationalen Industrieunternehmen, mehrjähriger Auslandsaufenthalt in den USA und umfangreiche Auslandseinsätze in Nordamerika, Asien und Osteuropa.
Welches sind die richtigen Lernstrategien für den Studienerfolg?
Wie kann die Lernkompetenz von Studierenden durch die Hochschule gefördert werden?
Mit diesen beiden zentralen Fragen setzen sich die Autoren auseinander, um Möglichkeiten und Akteure zu identifizieren. Es wird diskutiert, welche grundsätzlichen Komponenten der Lernkompetenz für alle Studierenden bedeutsam sind und wie sich individuelle Unterschiede bei der Lehrkonzeption berücksichtigen lassen. Das Ziel besteht in der Stärkung der individuellen Lernkompetenz und der Nutzung neuer digitaler Lernformate. Dies soll über gesteuerte Selbstreflektion und Selbsterkenntnis erfolgen und in geeigneten Anwendungen geübt werden. Auch die Frage, welche Rolle die Studierenden und die Lehrenden wie auch die Hochschulen selbst einnehmen sollten, wird diskutiert.
Basierend auf diesen Grundlagen werden Konzepte des agilen Lernens und Lehrens diskutiert und der Fokus auf die Aktivierung der Studierenden gelegt.
Zudem werden einige digitale Anwendungen beispielhaft genannt, die zur Unterstützung der Lernkompetenz eingesetzt werden können. Hierbei steht die Integration neuer digitaler Medien im Vordergrund, um das Gesamtziel einer individuellen Entwicklung der Lernkompetenz zu unterstützen und zu ergänzen.
Darüber hinaus wird ein Konzept zur hochschulweiten Einführung agiler und digitaler Lern- und Lehrformate vorgestellt. Hierzu werden grundlegende Themen zur Lernkompetenz mit agilen Methoden verheiratet. Zur Unterstützung der Selbstreflektion der Studierenden wird das standardisierte Inventar zur Erfassung von Lernstrategien im Studium (LIST, Wild, K.-P. & Schiefele, U., 1994) eingesetzt.
Letztlich wird die Bedeutung von Kompetenzvermittlung diskutiert und ein Ausblick gegeben.
Inhaltsverzeichnis
Bedarf an Lernkompetenz
1.1 Veränderte Anforderungen in Schule und Beruf
1.2 Ansätze für ein Lerntraining
1.3 Agile Lern- und Lehransätze als Chance
Grundlegende Ansätze zum Lernen und zum Studienerfolg
2.1 Schlüsselkompetenzen für das Studium
2.1.1 Sozialkompetenz
2.1.2 Selbstkompetenz
2.1.3 Methodenkompetenz
2.1.4 Sachkompetenz
2.2 Faktoren selbstgesteuerten Lernen als Erfolgsfaktor
2.2.1 Metakognitiven Aspekte des Lernens
2.2.2 Kognitive Verarbeitung von Informationen
2.2.3 Motivationale Faktoren des Lernens
2.2.4 Weitere Faktoren des Lernens
2.3 Verschiedene Lerntypen oder verschiedene Lernansätze?
2.4 Fragebogen zur Erfassung von Lernstrategien im Studium (LIST)
Ausgewählte Lerntechniken für Studierende
3.1 Lerndokumentation
3.1.1 Mitschriften erstellen
3.1.2 Nachträgliche Ausarbeitungen
3.2 Lesetechniken
3.2.1 Die SQ3R-Lesemethode
3.2.2 Hörbücher als auditiver Lernansatz
3.3 Lernbilder
3.3.1 Flussdiagramme als visueller Lernansatz
3.3.2 Entscheidungsbaum als visueller Lernansatz
3.3.3 Mind-Mapping als visueller Lernansatz
3.4 Frage- und Antwortkarten
3.5 Gruppentechniken als kommunikativer Lernansatz
3.5.1 Lean Coffee nach Benson und Lightsmith
3.5.2 Brain Hackathon
3.5.3 Working out Loud (WOL) nach Stepper (2015)
3.5.4 Brain writing nach der 6-3-5 Methode
3.6 Planungstechniken
3.6.1 Aufgabenplan
3.6.2 Aufgabenpriorisierung mit der ABC-Regel und Kanban
3.6.3 Zeitmanagement
3.6.4 Arbeitsplatzgestaltung als vorbereitende Aufgabe
Lehrveranstaltungen für verschiedene Lernansätze von Studierenden konzipieren
4.1 Entwicklung von Lehreinheiten mittels Constructive Alignement
4.2 Ziel einer Lehreinheit ist immer auch die Stärkung der Lernkompetenz
4.2.1 Learning Nuggets
4.2.2 Scrum von Sutherland und Schwaber
4.2.3 Kanban Boards
4.3 Berücksichtigung verschiedener Lernansätze
4.3.1 Flipped Classroom
4.3.2 Moocs
4.3.3 Game based Learning
4.3.4 Design Thinking
Mit Scrum und Design Thinking zur agilen Hochschule
5.1 Entwicklung von individuellen Zielen von Studierenden
5.2 Umsetzung der Lern- und Lehrkonzepte mittels Design Thinking
5.3 Einführende Inhalte zur Lernkompetenz
Ergebnisse der Selbstbeschreibungen in einem Anwendungsfall
6.1 Skala Organisation
6.2 Skala Elaboration
6.3 Skala Kritisches Prüfen
6.4 Skala Wiederholen
6.5 Skala Metakognitive Strategien
6.6 Skala Anstrengung
6.7 Skala Aufmerksamkeit
6.8 Skala Zeitmanagement
6.9 Skala Lernumgebung
6.10 Skala Lernen mit Studienkollegen
6.11 Skala Literatur
Die Zukunft der Hochschullehre bleibt spannend
Literatur- und Quellenverzeichnis
Anhang
Fragebogen
Abbildungsverzeichnis
Abb.: 1: Aktivitätsschleifen von Lehrenden und Studierenden im agilen Lehr-/Lernprozess
Abb.: 2: Die Komponenten des selbstgesteuerten Lernens (Darstellung als Mindmap)
Abb.: 3: Die metakognitiven Aspekte des Lernens
Abb.: 4: Die kognitive Verarbeitung von Informationen
Abb.: 5: Die motivationalen Faktoren des Lernens
Abb.: 6: Weitere Faktoren des Lernens
Abb.: 7: Cluster von Lerntechniken
Abb.: 8: Struktur des Kreativbogens für ein Brainwriting mit 6 Personen bzw. Runden
Abb.: 9: Das Modell des Constructive Alignements
Abb.: 10: Taxonomiestufen der Learning Outcomes
Abb.: 11: Vorgehen bei der Konzeption von Lehrveranstaltungen
Abb.: 12: Die fünf Ereignisse in Scrum-Prozessen
Abb.: 13: Der Scrum-Prozess im Überblick
Abb.: 14: Der Problemraum und der Lösungsraum im Design Thinking Prozess
Abb.: 15: Auszug aus „Vergleich von verschiedenen Prozessmodellen im Design Thinking"
Abb.: 16: Ein modellhafter Ablaufplan für den geplanten Scrum Prozess
Abb.: 17: Der Problemraum im Design Thinking Prozess
Abb.: 18: Der Lösungsraum im Design Thinking Prozess
Abb.: 19: Faktoren, welche auf die Selbstlernkompetenz wirken
Abb.: 20: Von Studierenden benannte bisher genutzte Lernstrategien
Abb.: 21: Überblick über verschiedene Lernstrategien in Anlehnung an die Kategorisierung durch LIST
Abb.: 22: Überblick über verschiedene Lernansätze
Abb.: 23: Sammlung verschiedenen Lernansätze durch Studierende und Zuordnung zu den Lernansätzen
Abb.: 24: Prozentuale Erreichung der maximalen Kennwerte des Inventares LIST
Abb.: 25: Verteilungswerte in den einzelnen Skalen der Liste
Abb.: 26: Häufigkeiten in den einzelnen Items der Skale Metakognitive Strategien
1 Bedarf an Lernkompetenz
Die Erkenntnis „Früher war alles besser" ist bereits viele Generationen alt und resultiert damals wie heute aus einem sehr subjektiven Wahrnehmungseffekt. Gefolgt von Hypothesen wie „Damals mussten wir noch richtig lernen" und Tatsachen wie „Früher gab es keine Taschenrechner im Mathematikunterricht" verklären wir mit Hilfe des Rückschaufehlers die Sicht auf die Vergangenheit. Auch wenn die Menschheit hier immer wieder in die eigene Falle tappt, bleibt die Erkenntnis, dass die Veränderung der Gesellschaft, der Wirtschaftsstrukturen und auch der Lernstrukturen, nicht nur zuletzt durch dem Bologna Prozess, zu veränderten Anforderungen geführt hat.
Neue technologische Entwicklungen, insbesondere im Rahmen der Digitalisierung, erlauben darüber hinaus neue Lern-, Übungs- und Kommunikationsformen in der Aus- und Weiterbildung, die in der Vergangenheit nicht realisierbar waren.
1.1 Veränderte Anforderungen in Schule und Beruf
Gesellschaftlich individualisieren wir uns in Europa zunehmend, der Einzelne wird bedeutsamer und mit seinen Bedürfnissen gesehen. Viele Arbeitgeber werben mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Mobile und digitalisierte Arbeit soll uns ermöglichen, dort zu arbeiten, wo wir wollen. Neben den vielen beworbenen Vorteilen sind jedoch die Anforderungen an die Mitarbeitenden ein entscheidender Erfolgsfaktor. Mobile Arbeit bedarf insbesondere der Fähigkeit zur Selbstmotivation, Selbstorganisation und Selbststeuerung sowie Selbstkontrolle. Denn die Freiheit durch Digitalisierung, jederzeit Zugriff auf umfangreiche Daten-Netzwerke zu gewährleisten und beliebig kommunizieren zu können, stellt Anforderungen an die Nutzenden, um sich nicht in der Vielfalt des Möglichen zu verlieren.
Das World Wide Web bietet uns einen bisher noch nie da gewesenen und im Wesentlichen einfachen Zugang zu einer Fülle von Wissen. Viele Wissensfragen, für die früher Enzyklopädien angeschafft wurden, lassen sich mit einem Klick beantworten. Ratgeber aus dem Web unterstützen unsere Entscheidungen. Das alles ist in kürzester Zeit möglich, zumindest wenn die Technologien beherrscht werden und die Strukturen erkannt sind.
Mit der steten Verfügbarkeit von Wissen sinkt dessen Stellenwert. Gleichzeitig werden andere Fähigkeiten, darunter die Selbstorganisation, bedeutsamer.
Der Dienstleistungsgedanke erfordert soziale Kompetenzen sowie situationsgebundene Problemlösefähigkeit und die Bereitschaft wie Fähigkeit zur Reflexion von sich und anderen.
Die Veränderungen in der Arbeitswelt fordern zunehmend fachübergreifende und interdisziplinäre Zusammenarbeit, auch im internationalen Umfeld. Hierfür wird Sozialkompetenz benötigt. Flache Hierarchien benötigen Selbstorganisation und Selbststeuerung. Durch die Globalisierung erhalten interkulturelle Kompetenzen und Fremdsprachenkenntnisse zunehmend Bedeutung. Ebenso gehören Flexibilität und Mobilität zu den grundlegenden Anforderungen.
Vor diesem Hintergrund geht es bei der Lernkompetenz, als eine von mehreren Schlüsselkompetenzen, um viel mehr als nur das Studium. Diese Schlüsselkompetenz unterstützt den Erfolg im Studium und darüber hinaus in der späteren Berufstätigkeit.
Aber selbst im Studium werden Lehrinhalte zunehmend digitalisiert. In der klassischen Vorlesung werden Inhalte von Professoren jedes Semester aufs Neue vorgetragen, während die Studierenden die Inhalte mitschrieben, um sie anschließend Zuhause auszuarbeiten und zu vertiefen. Digitale Lehre verschiebt den Wissensinput in der Regel in die Hand der Studierenden, die den Inhalt selbstorganisiert und angeleitet mittels der zur Verfügung gestellten Medien erarbeiten sollen, um anschließend in der Lehrveranstaltung Fragen zu klären und praktische Anwendungen gemeinsam zu üben. Die digitalisierte Lehre fordert somit dem Studierenden in erheblichen Umfang Selbstlernkompetenzen ab. Die klassische Vorlesung verwandelt sich in eine aktive Lernumgebung.
Darüber hinaus sind umfangreiche Formen der digitalen Kommunikation mit direkten und unmittelbaren Feedbackmöglichkeiten einsetzbar. Eine individuelle Lernstandmessung wird für jeden einzelnen Studierenden (auch anonym) möglich und kann individuell Defizite aufzeigen, um diese nachzuarbeiten. Dies, gepaart mit einem unterstützenden Selbstlerncoaching, stellt einen Schlüsselparameter für die Selbststeuerung dar.
Deshalb stellt sich die Frage, wie Lernkompetenz in optimaler Weise durch die Hochschule direkt und indirekt gefördert werden kann. Grundsätzlich gibt es drei Optionen: Entweder in speziellen Seminaren und Kursen, welche zusätzlich angeboten werden.