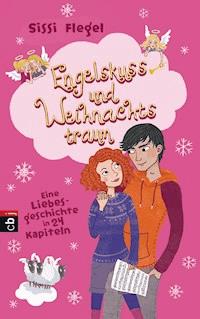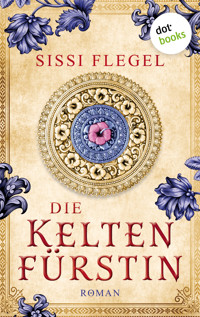Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Tschüss Liebeskummer, hallo Abenteuer: Der Jugendroman "Liebe, List & Andenzauber" von Erfolgsautorin Sissi Flegel jetzt als eBook bei dotbooks. Endlich Ablenkung vom Liebeskummer! Nachdem ihre große Liebe Rory aus heiterem Himmel Schluss gemacht hat, schwört sich Mimi, Jungs von nun an die kalte Schulter zu zeigen und sich auf gar keinen Fall mehr zu verlieben. Da kommt es gerade recht, dass sie ihre Tante bei einer Recherchereise begleiten soll: Wanderungen in schwindelerregender Höhe, gefährliche Fahrten durch die Atacama-Wüste – und immer an ihrer Seite der verdammt gutaussehende Student Carlos. Doch selbst er kann Mimi nicht von ihrem Entschluss abbringen – nein, wirklich nicht ... oder etwa doch? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Jugendroman "Liebe, List & Andenzauber" von Erfolgsautorin Sissi Flegel. Für Leser ab 12 Jahren. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Endlich Ablenkung vom Liebeskummer! Nachdem ihre große Liebe Rory aus heiterem Himmel Schluss gemacht hat, schwört sich Mimi, Jungs von nun an die kalte Schulter zu zeigen und sich auf gar keinen Fall mehr zu verlieben. Da kommt es gerade recht, dass sie ihre Tante bei einer Recherchereise begleiten soll: Wanderungen in schwindelerregender Höhe, gefährliche Fahrten durch die Atacama-Wüste – und immer an ihrer Seite der verdammt gutaussehende Student Carlos. Doch selbst er kann Mimi nicht von ihrem Entschluss abbringen – nein, wirklich nicht ... oder etwa doch?
Über die Autorin:
Sissi Flegel, Jahrgang 1944, hat neben ihren Romanen für erwachsene Leser sehr erfolgreich zahlreiche Kinder- und Jugendbücher veröffentlicht, die in 14 Sprachen erschienen sind und mehrfach preisgekrönt wurden. Die Autorin ist verheiratet und lebt in der Nähe von Stuttgart.
Die Autorin im Internet: www.sissi-flegel.de
Die bei dotbooks erschienenen Mädchenbücher von Sissi Flegel findet ihr am Ende dieses Buches.
***
eBook-Neuausgabe Oktober 2016
Copyright © der Originalausgabe 2002 Thienemann Verlag
(Thienemann Verlag GmbH), Stuttgart/Wien
Copyright © der Neuausgabe 2016 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung einer Fotografie von Lena-Marie Starčevič und Mia Schütz, sowie shutterstock/Nalaleana (Hintergrund)
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95824-736-9
***
Damit der Lesespaß sofort weitergeht, empfehlen wir dir gern weitere Bücher aus unserem Programm. Schick einfach eine eMail mit dem Stichwort Liebe, List & Andenzauber an: [email protected]
Gerne informieren wir dich über unsere aktuellen Neuerscheinungen – melde dich einfach für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html
Besuch uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.twitter.com/dotbooks_verlag
instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Sissi Flegel
Liebe, List & Andenzauber
Roman
dotbooks.
Die rote Karte
Wir landeten in Chiles Hauptstadt Santiago. Das Flugzeug setzte auf und rollte die Landebahn entlang. Ich öffnete den Gurt, stand auf und griff in meine Hosentasche. Darin befanden sich der Pass, die entsetzliche Mail und die rote Karte. Auf der stand:
ZUM TEUFEL MIT DER LIEBE!
MEIN HERZ IST FUTSCH!
AB JETZT BIN ICH NUR NOCH FIES UND GEMEIN!
Ich nickte grimmig. Natürlich kannte ich die Mail längst auswendig. Trotzdem zog ich auch sie aus der Tasche und las sie noch einmal:
»Liebe Mimi,
wir sehen uns nie wieder. Es ist aus.
Ich wünsche dir alles Gute. Rory.«
Ich schluckte. Die wenigen Worte taten verdammt weh, selbst jetzt noch nach einem knappen Monat. Das Ende einer großen Liebe tut immer weh. Aber wenn es so abrupt kommt, so ohne Vorwarnung und so kurz vor einem lang ersehnten Treffen in Paris, ist es absolut vernichtend.
Als ich die Mail erhalten hatte, war ich am Boden zerstört. Ich aß nichts mehr. Die Schule? Konnte mir gestohlen bleiben. Freundinnen, alte Kumpel? Waren mir lästig. Ständig fragte ich mich, weshalb Rory keinen Grund für seine Mail angab. Warum war alles aus? Warum? Warum? Ich bombardierte ihn mit meinen Mails. Umsonst. Er hatte die Adresse geändert, auch die Telefon- und Handynummer stimmte nicht mehr. Ich war völlig hilflos und verzweifelt.
An diesem Punkt traten die Tanten in Aktion.
Nicki, meine ältere Schwester, und ich sind nämlich Vollwaisen. Als unsere Eltern – beide waren Geologen – kurz nach meiner Geburt bei einem Verkehrsunfall in der Türkei ums Leben kamen, haben uns unsere Tanten sofort zu sich genommen. Seitdem sind sie unsere Eltern und wir eine große glückliche Familie, der das Reisen im Blut steckt. Tante Anne ist Reisejournalistin und Fotografin. Tante Lise kümmerte sich schon immer um das große Haus und den Garten und schreibt Artikel zu so topaktuellen Themen wie »Geranien im Herbst«, »Was tun, wenn Stiefmütterchen trauern« und »Die ultimative Art, Bratkartoffeln zuzubereiten«.
Wir lieben unsere Tanten. Als ich nach Empfang der Mail nur noch heulend und schluchzend jammerte: »Ich werde nie wieder lachen. Ich werde leiden und mich nie wieder verlieben. Das Leben ist eine einzige Katastrophe!«, haben sie einen Plan ausgeheckt, wie nur sie ihn aushecken können.
»Rorys Verhalten ist ein Schock für dich. Wahrscheinlich leidet er genauso wie du, Mimi, aber was ihn zum Abbruch eurer Beziehung brachte, kann und will er wohl nicht sagen. So, wie wir es sehen, kommst du nur mithilfe starker neuer Erlebnisse darüber hinweg«, sagte Tante Lise.
Tante Anne nickte. »Deshalb begleitest du mich auf meiner nächsten Reise. Ich hab schon alles abgeklärt; du schreibst einen Artikel über den Trip für unsere ›Tagespost‹. Das gibt Geld, damit finanzierst du deinen Flug. Der gekürzte Artikel wird in deiner Schulzeitung veröffentlicht. Das ist der Preis für drei zusätzliche Ferientage, die dir der Schulleiter genehmigt. Damit ist auch dein Klassenlehrer einverstanden.«
»Na, was sagst du dazu?«, fragte Tante Lise munter.
Ich war fassungslos. »Ich will nicht fort! Ich will nichts sehen und nichts hören, ich will nur meine Ruhe!«, heulte ich los. »Ich leide!«
»Das ist nicht zu übersehen«, entgegnete Tante Anne. »Aber kannst du uns verraten, wie lange du leiden willst?«
»Bis an mein Lebensende!«
»Bist du wahnsinnig? Das ist der Kerl nicht wert!«, entgegnete Tante Lise empört. »Ich meine, du solltest –«
Ich hielt mir die Ohren zu und rannte in mein Zimmer.
Tante Anne riss die Tür auf und streckte den Kopf rein. »Du gehst mit mir auf die Reise, und wenn ich dich gefesselt und geknebelt auf dem Gepäckwagen ins Flugzeug transportieren muss. Basta!«
Rums, war die Tür zu.
Ich sprang auf. »Ich begleite dich nicht! Überhaupt: Wohin geht's denn?«, brüllte ich auf den Gang hinaus.
»Ab in die Wüste!«
»Na super!«
Jetzt knallte ich die Tür zu. Ich warf mich mit Karacho auf mein Bett. »In die Wüste! Na klar, wohin sonst?«, knurrte ich. Eine kleine Abenteuerfahrt zu fröhlichen, gefräßigen Krokodilen und munteren Piranhas im Amazonas hätte mich wegen der damit verbundenen akuten Lebensgefahr vielleicht reizen können. Aber keine Wüste der Welt war trostloser als meine gegenwärtige Lage, und schwitzen konnte ich im Bett. Also warum sollte ich auch noch in eine Ödnis fahren, wo ich mich doch bereits in einer solchen befand? Ich schüttelte den Kopf und zog ein frisches Taschentuch aus der Packung.
Wüste … also ehrlich … echt abartig … Mit einem Satz war ich wieder an der Tür. »In welche Wüste? Die Gobi? Die Sahara?«
»Die Atacama ist es.«
»Die – was?« Von der hatte ich noch nicht mal den Namen gehört. »Wo liegt die denn?«
»Im Norden Chiles. In Südamerika.«
Jetzt stellte sich Tante Lise neben ihre Schwester. »Ich schlage vor, du putzt dir die Nase und kämmst dich; derweil koche ich uns einen guten starken Tee.«
Tante Anne und ich grinsten uns an. Natürlich wollte ich eigentlich nicht fröhlich grinsen. Aber Tante Lises Tee war so gut wie die Friedenspfeife der Apachen und erzielte dieselbe Wirkung: Eine gemeinsame Teestunde beseitigte jeden Streit.
Tante Anne glühte vor Stolz. »Ich hab einen neuen Auftrag«, erklärte sie. »Es ist ein super-super-su-per Auftrag, er ist spannend und bringt Geld –«
»Und er ist nicht ungefährlich«, ergänzte Tante Lise.
»Da, wo Peru, Bolivien und Chile Zusammenstößen, liegt die Atacama. In den Anden. In 4.500 Meter über dem Meeresspiegel. Die Zugspitze, höchster Berg Deutschlands, ist 2.962 Meter hoch, der höchste Berg Europas, der Montblanc, immerhin 4.810. Nicht schlecht, was?«
»Kann man da noch ohne Sauerstoffmaske atmen?«, erkundigte ich mich interessiert. Ich hatte schließlich mit meinem Leben abgeschlossen, und wenn ich mitginge und die Sauerstoffmaske nicht exakt auf die Nase setzen würde, wäre die Wüste so wirkungsvoll wie ein gieriger Piranha-Schwarm.
Tante Anne schien meine Gedanken gelesen zu haben. »Nichts da! Die Höhe ist völlig ungefährlich, wenn man sich akklimatisiert hat!«
»Worin besteht dann die Gefahr? Sind es Banditen? Ist es der Drogenhandel?«
»Die Vulkane sind es. Und die Erdbeben; durchschnittlich 500 pro Jahr.«
»Waaas?« Ich rechnete blitzschnell nach. Ein Jahr hat 365 Tage. 500 Erdbeben pro Jahr machte eineinhalb Erdbeben pro Tag! Ich riss entsetzt die Augen auf: »Das ist ja schlimmer als in Japan!«
»Nicht unbedingt. Nicht alle Beben sind gefährlich. Die meisten sind so schwach, dass sie der Mensch nicht mal bemerkt.«
»Trotzdem …« Vor Erdbeben hatte ich Respekt. Na klar, ich hatte mit der Liebe in meinem Leben abgeschlossen, aber das hieß noch lange nicht, dass ich ein über meinem Kopf zusammenkrachendes Haus herbeisehnte.
Wieder hatte Tante Anne meine Gedanken gelesen. »Es gibt keine Häuser, die über dir zusammenkrachen können, Mimi. Da, wo wir hinfahren, gibt es entweder gar nichts, weil dort nichts wächst, oder einstöckige, leicht zusammengefügte Gebäude, Bretterbuden und Lehmhütten.«
»Und was tust du da?«
»Ich fahre durch die Wüste, schreibe einen Bericht über das, was ich sehe und beobachte und mache Fotos. Übrigens, Manfred kommt auch mit.«
Manfred war ein Kollege, der sie häufig auf ihren Reisen begleitete. Ich mochte ihn sehr. Er war zwar schon reichlich betagt, mindestens fünfzig und drüber, außerdem Kettenraucher und mit fünf Kindern gesegnet, aber er machte immer den Eindruck, als sei er cool und durch nichts aus der Ruhe zu bringen.
Das Ende vom Lied war jedenfalls, dass wir drei nach Chile flogen. Alles war so schnell gegangen, dass ich mich, neben der Schule mit all den vielen Klassenarbeiten vor Ostern, nicht oder zumindest kaum auf die Atacama-Wüste hatte vorbereiten können. Das war schade. Aber andererseits war nun alles, was ich erleben würde, eine tolle Überraschung.
Jetzt waren wir also in Santiago und strebten gerade der Passkontrolle zu.
Sobald es möglich war, zündete sich Manfred eine Zigarette an. Er hustete erbärmlich.
»Du musst endlich mit dem Rauchen aufhören«, sagte Tante Anne streng.
»Gleich nach der Reise«, meinte er keuchend. »Hab's meinem Arzt versprochen.«
Nach der Passkontrolle und nachdem wir unser Gepäck vom Band genommen hatten, bestiegen wir einen kleinen Inlandflieger und düsten ab nach Arica, der nördlichsten Stadt Chiles. Dort streckten wir unsere winterweißen Gesichter in die strahlende Mittagssonne und hatten zwei Stunden Zeit, uns die Stadt anzusehen.
Diese war einmal so reich gewesen, dass die Einwohner bei Eiffel, demselben, der den Pariser Eiffelturm baute, eine Kirche und ein Zollgebäude bestellt hatten. Die Gebäude wurden in Frankreich konstruiert, abmontiert und Stück für Stück auf dem Seeweg hierher transportiert und aufgebaut.
Ganz in der Nähe der Kirche befand sich der Fischmarkt. Wie bei uns die Katzen, so spazierten hier unzählige Pelikane zwischen den Ständen umher, ließen die langen Schnäbel klappern und bettelten um Fischreste. Fast stolperte ich über ein besonders auffälliges Tier: Dieser Pelikan hatte wohl vor langer Zeit seinen Flügel gebrochen, nun ragte ein einzelner blanker Knochen kerzengerade aus dem Gefieder. Fliegen konnte er nicht mehr, dafür war er aber zum Maskottchen der Fischhändler geworden. Kein anderer bekam nämlich so viel zugeworfen wie er.
Später bummelten wir durch eine Straße voller Buden mit landestypischen Produkten: kratzige handgestrickte Pullover, knallbunte Figürchen, Ledergürtel – ich konnte mich für nichts entscheiden, ich war von den vielen Flugstunden noch so benommen, dass mir das Schauen reichte.
Tante Anne und Manfred wurden unruhig. »Zeit fürs Auto, nicht wahr?«
Ich wusste, dass wir hier in Arica Carlos treffen würden. Carlos hieß der Mann, der in den kommenden zwei Wochen unser Fahrer und ortskundiger Begleiter sein würde, und natürlich stellte ich mir einen älteren Herrn von mindestens dreißig Jahren vor.
Wir sammelten unser Gepäck ein und warteten. Die Trauer-Mail steckte noch in meiner Hosentasche. Immer wenn ich die Hand reinschob, knisterte das Papier und erinnerte mich an die Botschaft. Ich schluckte schwer. Verdammt, eigentlich sollte ich jetzt in Paris sein – und Rory neben mir stehen! Und ich sollte die herrlichsten Tage meines Lebens verbringen! In Paris, der Stadt der Liebe!
Stattdessen starrte ich auf den Pelikan, aus dem der blanke Knochen herausragte, und kämpfte mal wieder mit den Tränen. Allein war ich, und allein würde ich bleiben, schwor ich mir. Fies würde ich sein, eklig und gemein. In der Schule würde ich streben ohne Ende. Dann würde ich Karriere machen, bis ich die berühmteste Reisejournalistin aller Zeiten wäre. So. Ich hob den Fotoapparat hoch und knipste schon mal den Pelikan. Jeder berühmte Reisejournalist hat schließlich klein angefangen. Ein zerrupfter, aber dennoch tapfer dem Leben die Stirn bietender Pelikan war nicht der langweiligste Start, dachte ich und knipste gleich noch eine Ansammlung leicht vergammelter Fischköpfe.
»Alphonso heißt der Arme. Er ist eine Berühmtheit in Arica«, sagte jemand neben mir.
Ich schnellte hoch. »Haben Sie mich erschreckt!«
»Tut mir Leid, das wollte ich nicht. Ich bin Carlos.«
»Ich … ich bin Mimi«, stammelte ich. Mich einfach so von hinten anzusprechen, dachte ich wütend. Ich schaute ihn mir genauer an: Carlos sah besser aus als jeder Mann, der bisher von einem Reklameplakat auf mich heruntergelächelt hatte.
Gebräunte Haut, dunkle Augen, schwarze, lockige Haare – der totale Latin-Lover-Typ! Meine Freundinnen hätten sich sofort seine Handynummer geben lassen, aber ich hatte dieses Thema ja für immer und alle Zeiten abgeschlossen. Fies würde ich sein und gemein, und keiner – schon gar nicht einer, der so unverschämt gut aussah wie Carlos – konnte etwas Nettes von mir erwarten. So!
»Ich habe einen älteren, versierten, verlässlichen Menschen angefordert. Das Geologische Institut von Santiago versicherte mir hoch und heilig, den Besten auszuwählen. Sind Sie nicht ein wenig jung für die Aufgabe?« Meine Tante Anne hielt nichts von diplomatischen Umwegen.
»Ich bin der Beste!« Breitbeinig stand er da, die Hände steckten tief in den Hosentaschen, er grinste herausfordernd.
Tante Anne grinste zurück. Ich kannte sie: Ein fröhliches Grinsen weckt ihr Misstrauen. »Na, mal sehen«, sagte sie und zog ihm sämtliche Informationen, die für sie wichtig waren, in null Komma nichts aus der Nase.
Carlos' Vorfahren waren Deutsche, lebten aber seit einigen Generationen in Chile. Deshalb studierte er auch in Deutschland und verbrachte nur ein »Gastsemester« in seiner Heimat.
»Ich kenne die Atacama genauer als den Schwarzwald«, erklärte er stolz.
»Na, wenn Sie nur mal kurz über den Schwarzwald drübergeflogen sind, heißt das gar nichts«, meldete sich Manfred zu Wort.
»Drübergeflogen?«, wiederholte Carlos empört. »Ich studiere in Freiburg, ich fahre Ski im Winter und im Sommer wandere ich im –«
»Wir kennen den Schwarzwald«, winkte meine Tante ab. »Außer Ski können Sie auch Auto fahren, nehme ich an. Also los, worauf warten wir noch? Wo steht das Auto? Ist der Tank voll? Haben Sie genügend Wasser besorgt?«
Carlos hob die Hände und verdrehte die Augen. »Wir halten noch kurz an der Tankstelle.«
Jetzt verdrehte Tante Anne die Augen. »Ich weiß, was das im Klartext heißt. Er hat das Auto nur aus der Garage gefahren.«
So war es auch. Wir überquerten die Straße und standen wenig später vor dem Fahrzeug, das uns durch Chiles Norden transportieren sollte.
Es war ein blauer Kleinbus. Das einzig Auffällige daran war ein großer, herzförmiger, knallroter Aufkleber an der Seite. »It's my baby Thildal«, stand in pinkfarbenen Buchstaben darauf.
Am Stadtrand hielt Carlos vor der einzigen Tankstelle weit und breit. Es dauerte, bis er in aller Seelenruhe die Reifen gecheckt, den Tank gefüllt, Wasser für die Scheibenwischanlage nachgegossen, Vorräte für uns alle besorgt und einige gemütliche Schwätzchen gehalten hatte.
»Endlich!«, rief meine Tante, als er nach einer guten Stunde erklärte, nun seien alle Vorbereitungen getroffen.
Sie und Manfred nahmen vorne neben Carlos Platz, ich machte es mir auf dem Rücksitz bequem. Einmal sah Carlos in den Rückspiegel, unsere Augen trafen sich und ich merkte, wie ich rot anlief. Sofort fuhr meine Hand in meine Hosentasche, ich fühlte die rote Karte und Rorys Abschiedsmail. »Ich bin nur noch fies, gemein und böse«, murmelte ich und schloss die Augen.
Der Strich durch die Rechnung
Irgendwann schlief ich ein – und wachte auf, als Thilda, unser Bus, zum Stehen kam.
Wir befanden uns in einer Mondlandschaft: Geröll und hellbraune Sandhügel, so weit das Auge reichte, und Ruinen, die einmal runde, aus Stein gefügte Behausungen gewesen waren. Über allem wölbte sich ein strahlend blauer, wolkenloser Himmel.
»Das ist eine verlassene Inkasiedlung«, erklärte meine Tante mit höchster Begeisterung. »Und weißt du, weshalb die Inkas ausgerechnet an dieser Stelle siedelten?«
»Wahrscheinlich suchten sie die unverfälschte Natur«, antwortete ich gähnend.
Manfred schüttelte den Kopf, wieherte, hustete und keuchte: »Sie wollten im Zentrum des Geschehens sitzen und Handel treiben.«
»Hier? Du nimmst mich auf den Arm, Manfred!«
»Schau dich um«, forderte er mich auf.
Nach wenigen Augenblicken ging mir ein Licht auf. Mit den Augen folgte ich einem schmalen, kaum erkenntlichen Pfad bis dahin, wo die Berge mit dem Horizont verschmolzen. Dieser Pfad wand sich unseren Hügel hinauf, senkte sich auf der anderen Seite in ein geröllbedecktes Flussbett, folgte diesem und verlor sich in der Weite.
»Eine alte Handelsstraße? Etwa so wie die Seidenstraße?«
»Mmm«, machte er, weil er gerade eine Zigarette anzündete.
Carlos lehnte an einer Mauer. »Das ist der uralte Weg von der Küste über die Anden«, erklärte er und machte eine weit ausholende Armbewegung. »Getrockneter Fisch gegen getrocknete Kokablätter. Was glaubst du, welchen Wert ein nettes kleines Fischfilet auf 4.000 Meter Höhe hatte!«
»Und die Kokablätter?«
»Na, die waren bei den Zusammenkünften von damals auch nicht unwillkommen«, spottete er und grinste so richtig unverschämt. »Allerdings muss man lange kauen, um ein bisschen high zu werden.«
»So? Du sprichst wohl aus eigener Erfahrung, was?« Ich grinste ebenso unverschämt zurück.
»Klar. Was sonst?«
Am liebsten hätte ich ihm die Zunge rausgestreckt. Stattdessen nahm ich mein Notizbuch zur Hand und schrieb: Handelsstraße Inkas. Kokablätter und Trocken fisch.
Carlos hatte mich beobachtet. »Schreibst du Tagebuch?«
»Nein«, antwortete ich hochnäsig. »Ich sammle Material für einen Artikel. Hab einen Auftrag von unserer Tageszeitung.«
Er zog die linke Augenbraue hoch. »Beachtlich. So jung und schon Reporterin.«
Ich sagte nichts darauf.
Im Wagen döste ich wieder ein und schreckte auf, als die Bremsen quietschten. »Zweites Kapitel aus der Inka-Geschichte?«, fragte ich schläfrig.
»Nein, diesmal ist's was Biologisches. Kakteen. Woran erinnern sie dich?«, wollte Tante Anne wissen und knipste, was das Zeug hielt.
»An riesige, vielarmige Kerzenleuchter«, hätte ich sagen sollen, damit sie »Deshalb heißen sie Kandelaber-Kakteen« hätte antworten können. Stattdessen murmelte ich was von »absoluter Scheußlichkeit« und dass so eine Kandelaberkaktee noch nicht mal einen Trostpreis bei einer Pflanzen-Misswahl ergattern würde.
Die Straße schraubte sich die Berge hoch, und dann, viele Serpentinen später, hielt Carlos erneut.
»Für heute haben wir unser Ziel erreicht. Hier liegt Putre. Wir befinden uns 3.500 Meter über dem Meeresspiegel.«
Tatsächlich. Da waren Häuser. Und Bäume. Und Felder, terrassenförmig angelegt, mit schiefen, krummen Rändern. Unglaublich, wie das Grün leuchtete.
»Die Inkas haben die Felder angelegt. Sehr einfallsreich, jeder Tropfen Wasser wird ausgenutzt, alles ist bis ins Einzelne durchdacht«, erklärte er, und dabei klang seine Stimme richtig ehrfürchtig. Er fuhr ganz langsam durch den kleinen Ort, über eine Brücke und einen Feldweg hoch bis zur »Hosteria Los Vicunas«.
Mir kam sie ziemlich schlicht vor. Ein Zimmer reihte sich nämlich ans andere, davor zog sich eine Art überdachte Terrasse entlang, und dann gab es noch ein zentrales Gebäude mit der Küche und dem Gastraum.
An diesem Abend schlug der Jetlag voll zu. Ich wankte ins Restaurant, schaufelte halb schlafend einen Eintopf in mich hinein und ging schnellstens ins Bett.
Am nächsten Morgen wachte ich ausgeschlafen auf, war vergnügt und voller Tatendrang – bis mein Blick auf die rote Karte auf dem Nachtkästchen fiel.
Mit einem Schlag kam der ganze Jammer wieder über mich. Rory! Paris! Paris im Frühling, die Bäume im Bois de Boulogne, die Seine, die großen Avenuen, die interessanten Geschäfte! Mit Rory, meiner großen Liebe, hatte ich den Frühling in Paris feiern wollen!
Ich kroch aus dem Bett und öffnete die Vorhänge.
Nichts als Wüste pur: braune, verbrannte Erde, braune Hügel, hellbraune Berge, kaum Steine, nichts Grünes, schon gar nichts Blühendes, eine tote Landschaft …
Ich lehnte den Kopf an die Scheibe und heulte.
Jemand klopfte mit den Fingerspitzen ans Fenster, ich zuckte zusammen und machte gleichzeitig einen Satz rückwärts ins Zimmer: Carlos, der einzige Mensch, den ich in Chile kannte – ausgerechnet der musste mich in dieser Verfassung ertappen. Wie peinlich! Und noch dazu in diesem lächerlichen Shirt, das ich als Nachthemd trug! Sch…! Ich rannte ins Bad und knallte die Tür hinter mir zu. Mit zitternden Fingern drehte ich die Dusche auf. Aber nur ein dünnes, lauwarmes Rinnsal lief an mir herunter. Auch das noch. Ich seifte mich ein und hatte eine Ewigkeit damit zu tun, den Schaum abzuwaschen.
Jammernd und vor mich hin schimpfend zog ich Jeans, Hemd und Turnschuhe an, stopfte die Abschiedsmail und die rote Karte in die Hosentasche, nahm mir vor, fies und gemein zu sein, und war endlich bereit, in den Gastraum zu gehen.
Tante Anne und Manfred kamen gerade von einer ausgiebigen Fototour zurück.
»Das Licht war absolut einmalig«, schwärmte meine Tante. »Was hab ich jetzt für einen Hunger!«
Ich linste vorsichtig in den Raum. Kaum zu glauben: Carlos war nicht da! Sofort besserte sich meine Laune. Manfred drückte seine Zigarette aus, wir setzten uns an ein breites Fenster, das uns den vollen Blick auf die Wüste gestattete, und schauten uns um. Thermoskannen mit lauwarmem Wasser, Körbchen mit allerlei Teebeuteln, Brot, Marmelade. Das war's.
»Könnte schlimmer sein«, stellte Tante Anne fest und griff zu.
Manfred verweigerte das Essen; er behauptete, so früh am Morgen noch keinen Hunger zu haben, was meine Tante zu einem »So kenne ich dich gar nicht!« bewog.
An einem langen Tisch in der Ecke saßen mindestens dreißig Oldies in abgetragenen Safariklamotten. Jeder hatte einen Notizblock und einen Bleistift in der Hand, einer las einen Begriff oder ein Wort aus einem dicken Buch vor, einige hielten den Stift in die Höhe, notierten etwas, dann kam das nächste Wort und so weiter.
»Was tun die denn?«, fragte ich interessiert.
Manfred grinste spöttisch. »Das sind ›Birdwatcher‹, Leute, die sich an den entlegensten Stellen der Welt treffen, vor Sonnenaufgang in die Wildnis marschieren und abhaken, welchen seltenen Vogel sie hören oder sogar sehen. Wer die meisten Häkchen hat, ist Sieger. Schummeln gilt nicht.«
»Was? Die sammeln Vögel wie andere Leute Autogrammkarten von Fußballspielern oder so?«
»Mhm. Darf man hier rauchen?«
»Nein, das darf man nicht«, sagte eine Stimme hinter mir. »Schmeckt's?«
Die Frage ignorierte ich. Da erschien eine Hand und legte ein winziges, ziemlich mickriges, gelbes Blümchen auf meinen Teller.
Ich verschluckte mich. Eigentlich hätte ich cool und hochnäsig sagen müssen: »Wohl der örtlichen Gärtnerei einen Besuch abgestattet? Grandioses Angebot an exotischen Gewächsen, was?« Aber wenn man mit dem Husten kämpft und nach Atem ringt, kann man einfach nichts sagen. Das ist unfair. Also würgte und keuchte ich noch ein bisschen, während Tante Anne sagte: »Wie nett von Ihnen, Carlos! So aufmerksam!«, dann wurde sie ungemütlich und drängte zum Aufbruch. »Alles klar? In zehn Minuten geht's los!«
Carlos sagte nichts davon, dass er mich heulend und in einem unmöglichen Hemd gesehen hatte. Das fand ich anständig.
Wir packten Fotoausrüstung, warme Jacken und Proviant ein und saßen zehn Minuten später in unserem Kleinbus. Die erste Fahrt hinauf in die Berge begann.
Ich hatte mein Notizbuch auf den Knien, um alle überwältigenden Eindrücke mit heißer Feder festzuhalten. Denkste. Links braune Hügel, rechts braune Hügel. Rechts braune Hügel, links braune Hügel. Nach und nach gehen die braunen Hügel in eine Art braune wellige Hochebene über.
Ich seufzte tief und stellte fest, dass ich unter akuter Schreibhemmung litt. Daher verschob ich meine literarischen Anstrengungen auf den Abend und dachte an Rory.
Vor den braunen Hügeln erschien Rorys Gesicht, Rory am Strand, Rory in der Disco, Rory an unserem letzten Abend. Verdammt, schon wieder kamen mir die Tränen! Ich schniefte und schluckte und putzte mir die Nase.
Carlos sah in den Rückspiegel. »Wir fahren«, sagte er, »auf eine Höhe von 4.500 Metern. Manche Menschen vertragen die dünne Luft nicht, sie bekommen Kopfweh, sie werden müde und ihnen wird übel.«
Tante Anne lachte. »Kein Problem für uns. Manfred und ich waren schon oft in ähnlichen Höhen, und Mimi ist jung und gesund.«
Carlos schaute wieder in den Rückspiegel. Er nickte zufrieden. »Ich hab die Tour schon mehrmals gemacht«, meinte er. »Noch nie ist jemandem dabei schlecht geworden.«
»Na prima. Wie beruhigend«, antwortete ich und befühlte meine rote Karte. Du bist fies und gemein, Mimi, vergiss das nicht, ermahnte ich mich und schaute mal wieder aus dem Fenster. Inzwischen war die wellige Hochebene nicht mehr wellig, sondern tatsächlich eben. Den Horizont verzierten schneebedeckte Kegel, allesamt Vulkane, von denen einer mächtig rauchte. Carlos hielt am Straßenrand an.
»Passhöhe 4.400 Meter«, las ich auf einem Schild. Bahn frei für die Höhenkrankheit!
Wir stiegen aus. Obwohl die Sonne vom wolkenlosen Himmel knallte, war es ziemlich kalt.
Manfred zündete sich wieder eine Zigarette an, dann hängte er sich seinen Fotoapparat um und stiefelte los. Tante Anne setzte sich auf einen Felsbrocken; sie sah sich um, seufzte und meinte: »Also diese Landschaft muss man mögen. Wenn ich die mit einem lieblichen Flusstal bei uns vergleiche … Mimi, ich weiß nicht, es fällt mir schwer, sie schön zu finden.«
»Musst du sie denn schön finden?«, fragte ich zurück. »Ich finde es hier grässlich.«
»Ich auch«, entgegnete sie. »Aber warte mal; in meinem Reiseführer über Chiles Norden habe ich etwas Kluges gelesen.«
Sie rannte zwei, drei Schritte zum Bus, hielt inne und jammerte: »Mein Gott, wie kurzatmig man in dieser Höhe wird. Na, vielleicht ist's auch das Alter!«
Tante Anne setzte sich neben mich und las vor: »Zwischen dem Ozean und der großen Mauer der Anden erstreckt sich ein scheinbar endloser Wüstenstreifen aus braunem Sand, aus Felsen und Bergen. Er ist absoluter und schrecklicher in seiner Nacktheit als die Sahara … Der Anblick dieser grausamen Wüste bedrückt den Geist durch seine grenzenlose Verlassenheit …«
Carlos nickte. »Anfangs sagt das jeder«, stimmte er Tante Anne zu. »Aber wartet ab, bis ihr ein, zwei Tage hier seid. Dann bekommt ihr ein Gefühl dafür, wie großartig es hier oben ist. Fahren wir weiter?«
»O. k. Wo ist Manfred?«
Wir sahen uns um. Manfred war wie vom Erdboden verschwunden. Komisch. Wir warteten, dann machten wir uns auf die Suche, jeder ging in eine andere Richtung. Wir riefen ihn, wir spähten hinter jeden Stein und Felsen und wir entfernten uns immer weiter vom Bus.
Ich stellte fest, dass ich entweder nur gehen oder »Manfred! Wo bist du?« rufen konnte. Für beides zusammen reichte die Puste nicht.
Endlich kehrte ich um. Auf dem Rückweg sah ich etwas Farbiges am Boden. Das konnte nur Manfred sein: Ob er einen seit der Kreidezeit ausgestorbenen Käfer entdeckt hatte und ihn fangen wollte?
Ich grinste; Manfred traute ich alles zu. Aber warum hatte er auf unser Rufen nicht geantwortet?
»Hallo, Manfred, was hast du denn entdeckt?«
Er antwortete immer noch nicht.
Ich ging auf ihn zu, mein Herz begann schmerzhaft zu pochen.
»Manfred? Ist dir schlecht?«
»Hä? Was sagst zu?«, keuchte er. »Schlecht? Nein, nicht schlecht; nur ein bisschen schwindlig und kurzatmig. Ich hab mich zum Ausruhen auf den …«
Die letzten Worte schenkte er sich. Sein Kopf kippte weg. Er schlief.
Ich rüttelte ihn an der Schulter. »Wach auf, Manfred. Hast du die Höhenkrankheit?«
»Wie? Was? Höhenkrankheit? Quatsch. Muss noch der Jetlag sein.«
Er rappelte sich mühsam auf. Vor dem Auto zündete er sich noch eine Zigarette an.
Carlos, der inzwischen wieder da war, nahm sie ihm missbilligend aus der Hand. »Das ist überhaupt nicht gesund hier oben.«
Manfred sagte störrisch: »Pure Luft bekommt meinen Lungen nicht«, aber dann setzte er sich doch in den Bus.
Tante Anne kam auch zurück, wir stiegen ein und fuhren weiter.
Wenige Kilometer später hielt Carlos vor einem Schlagbaum, dem Checkpoint am Eingang zu einem der Nationalparks. Aus der Hütte kam ein Carabinero, fragte nach unserem Fahrtziel, notierte dieses und die Uhrzeit, dann konnten wir passieren.
»Warum macht er das?«, fragte ich verwundert.
»Hier oben halten sich so wenig Leute auf – es gibt keine Siedlungen und schon gar nicht das, was man Fremdenverkehr nennt –, dass jemand, der 'ne Panne hat –«
»– ziemlich verloren ist«, ergänzte Tante Anne. »Und sollte einer dieser rauchenden Vulkane ausbrechen oder die Erde beben, sind unsere Angaben der einzige Anhaltspunkt zu unserer Rettung. Jedenfalls, solange dem Carabinero nichts geschieht.«
»Na prima«, murmelte ich. »Hoffentlich sind die Fotos das Abenteuer wert.« Eigentlich wollte ich ja nur fies und gemein sein, aber auf Mont-Blanc-Höhe und mit der Wahrscheinlichkeit von eineinhalb Erdbeben pro Tag hat man wenig Möglichkeiten, fies und gemein zu sein.