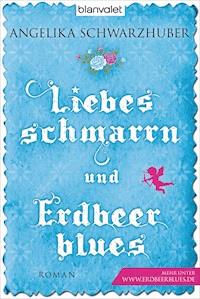
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Traumprinz gesucht, Bayer gefunden
Michi ist ihr Traummann – bis er »Ich liebe dich« zu ihr sagt. Genauer: »I hob mi fei sakrisch in di valiabt«. Lene rennt kopflos davon und kommt zu dem Schluss: Auf Bayerisch gibt es Liebe nicht! Diese Theorie schlägt nicht nur im niederbayerischen Passau hohe Wellen und beschert Lene mehrere Männer, die ihr das Gegenteil beweisen wollen. Da ist Karl Huber, der Sprachwissenschaftler, der die bayerische Kultur durch diesen »Schmarrn« gefährdet sieht. Ernesto, der Spanier, der so schön »Te quiero« sagen kann. Und immer noch oder schon wieder Michi, der zu ihr zurückwill. Doch was will Lene?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 389
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
ANGELIKA SCHWARZHUBER
Roman
Für meine ElternElfriede und Maximilian
Lenes Kurzanleitung zum Lesen der Geschichte:
»Obwohl ich im Alltag normalerweise im Dialekt meiner niederbayerischen Heimat spreche, ist zum allgemeinen Verständnis die Geschichte selbstverständlich in der hochdeutschen Sprache geschrieben. Es war jedoch unumgänglich, einige Ausdrücke und Dialoge im bairischen Wortlaut wiederzugeben. Für alle Menschen jenseits des Weißwurstäquators und einheimische Nichtbayern findet sich im Umschlag eine alphabetische Übersetzung der bairischen Begriffe in Hochdeutsch.«
Kapitel 1
»Wenn du jetzt gehst …« Mehr hörte ich nicht mehr. Die Tür des Fahrstuhls schloss sich, und ich machte die Augen zu.
Ich muss zu Claudia! Sofort!, dachte ich aufgeregt.
»Lene? Geht’s dir nicht gut?«
Erschrocken riss ich die Augen auf. Verdammt, ich hatte nicht mal bemerkt, dass noch jemand auf dem Weg zur Tiefgarage war. Dr. Heribert König. Mein Zahnarzt, seit ich denken kann. Er hatte seine Praxis gleich neben Michaels Kanzlei im vierten Stock.
»O doch, doch … Mir geht’s prächtig, Herr Doktor.«
Ein Blick in den Spiegel des Aufzugs, und mir war klar: Sollte Dr. König mir tatsächlich glauben, dann würde er in Zukunft ein Sexmonster in mir sehen. Im günstigsten Fall eine sehr aufgeschlossene junge Frau.
Meine rotbraune Lockenmähne war wild zerzaust. Der rosa Lippenstift verschmiert und – o nein! Der farblich zum Lippenstift passende neue BH hing halb aus meiner Handtasche, in die ich ihn eilig gestopft hatte, bevor ich aus Michaels Büro geflüchtet war. Jetzt war es auch schon egal, dass ich die Bluse mit der Naht nach außen trug. Ich setzte mein breitestes Lächeln auf, um Dr. König von der Handtasche abzulenken. Schließlich war er immer sehr stolz auf meine prachtvollen Beißerchen, die er mit viel Draht von Zahnstellung »windschief« in ein Gebiss verwandelt hatte, für das jedes Model gestorben wäre. Puh. Es funktionierte. Dr. König sah nicht nach unten, bis der BH gänzlich in der Tasche verschwunden war. Bevor ich meine Haare so unauffällig wie möglich zurechtzupfen konnte, waren wir auch schon in der Tiefgarage angekommen.
Erleichtert verabschiedete ich mich und trippelte in den todschicken, aber völlig unbequemen neuen Sandalen zu meinem Wagen. Im Rücken spürte ich Dr. Königs Blicke. Ob ich mich jemals wieder unbefangen auf seinen Behandlungsstuhl setzen konnte? Der Gedanke an die ungewisse Zukunft meines Gebisses wurde rasch von der Erinnerung an die Erlebnisse der vergangenen halben Stunde verdrängt. Alles war schrecklich! Ich musste dringend zu Claudia.
Claudia Zanolla war meine beste Freundin. Wir arbeiteten für dieselbe Zeitung. Sie in der Lokalredaktion und ich in der Anzeigenannahme. Kennengelernt hatten wir uns auf den Tag genau am 13. Mai vor vier Jahren, als wir beide in der kleinen Kaffeeküche der Redaktion standen und jede einen Kuchen für die Kollegen anschnitt. Amüsiert stellten wir fest, dass wir Geburtstag hatten. Den fünfzigsten. Wenn wir ihre vierundzwanzig und meine sechsundzwanzig Lenze zusammenzählten. Da wir beide für den Abend nichts geplant hatten, verabredeten wir uns spontan ins Simone, eine kleine, aber feine Bar in den engen Gässchen der Passauer Altstadt, auf ein Glas Prosecco. Aus einem Gläschen wurden zwei Flaschen – für jede –, und wir hatten viel Spaß. Claudia ließ mich in diesem Zustand nicht mehr nach Hause fahren, und so verbrachte ich die Nacht auf dem grauen Ledersofa in ihrer Wohnung.
Auf genau diesem Sofa saß Claudia jetzt und schaute mir geduldig zu, wie ich, unruhig wie ein Raubtier vor der Fütterung, barfuß auf und ab tigerte. Sie kannte mich gut genug, um abzuwarten, und nippte an einer Tasse Ingwerwasser. Die kleinen Figuren, die Claudia von ihren Reisen in aller Herren Länder mit nach Hause brachte und die nahezu jeden freien Zentimeter ihrer Wohnung belagerten, schienen mich zu beobachten. Als ob die stummen kleinen Zeugen unserer Frauengeschichten es nicht erwarten konnten, den neuesten Klatsch über mein Liebesleben zu hören. Eines der Eskimofigürchen auf dem Bücherregal schaute mich so ungeduldig an, dass ich mein Schweigen endlich brach.
»Es ist was ziemlich schiefgelaufen!«
»Wie hast du es diesmal vermasselt?« Claudia war nicht überrascht. Warum auch? Es war ja nichts Neues. Ich war praktisch eine Meisterin darin, etwas zu vermasseln. Dabei war es meistens gar nicht meine Schuld, wie ich fand. Und diesmal schon gar nicht. Aber ob sie das verstand? Ich wand mich innerlich.
»Lene! Mach’s nicht so spannend!«
»Also. Er hat gesagt …« Ich konnte nicht.
»Was? Dass deine Oberschenkel zu dick sind?«
»Nein!«, rief ich empört. Ich ging ja wohl nicht umsonst regelmäßig ins Fitnessstudio, seit ich mit Michi zusammen war, und hatte mir inzwischen fast fünf Kilos abgestrampelt. Meine Schenkel waren zwar nicht perfekt, aber zumindest alltagstauglich. Allerdings wirkten neben Claudias Gazellen-Beinen auch Normaloschenkel wie meine wie die eines grauen Dickhäuters.
»Hat er dich … auch … betrogen?« Claudias Ton wurde ein wenig weicher, mitfühlender. Sie hatte ja schon einiges mit mir erlebt.
»Nein! Hat er nicht.« Zumindest wusste ich nichts davon.
»Ja was denn dann?« Jetzt wurde sie schon etwas ungeduldiger, und der Blick des Eskimos war frostig geworden.
»Er hat gesagt …«
Ich holte tief Luft und sprach die Worte genau im Wortlaut und bairischen Dialekt meines Freundes Michi aus: »I hab mi sakrisch in di valiabt!«
Ich merkte genau, wie Claudias Mundwinkel zuckten. Sie verkniff sich ein Lachen.
»Das ist doch super!«
»Aber man sagt doch nicht: I hab mi sakrisch in di valiabt!«, protestierte ich.
Claudia schaute mich amüsiert an.
»Nun ja. Wir sind hier in Passau. Und Passau ist in Bayern. Und in Bayern spricht man eben bairisch!«
Das musste ausgerechnet sie sagen. Claudia war gebürtige Italienerin und als Teenager mit ihren Eltern nach Deutschland gekommen. Sie sprach inzwischen ein perfektes Hochdeutsch mit einem entzückenden sizilianischen Akzent.
»Wie soll er es denn sonst sagen?«, hakte sie nach.
»Ach, ich weiß auch nicht. Anders halt!«
Der Blick des Eskimos war inzwischen eisig. Mit so was hatte er sicher nicht gerechnet.
»Du erzählst mir jetzt, was los ist. Was wirklich los ist. Sofort!«
Ich drehte den verschnupften Eskimo mit dem Gesicht zum Buchrücken des ersten Harry-Potter-Bandes und ließ mich in den Sessel plumpsen. Und ich legte los. Mein Freund Michi und ich waren für den Abend zur Vernissage seines Mandanten Severin Bayerl eingeladen. »Kreationen in Kreditkarten«, so das etwas dümmliche Thema. Ich hatte auf die Ausstellung so viel Lust wie auf einen Besuch beim Steuerberater. Aber Michi zuliebe hatte ich zugesagt und mich dafür so richtig chic gemacht. So wie Michi das gefiel. »Zieh dich doch ein wenig femininer an«, hatte er mich in der letzten Zeit immer öfter gebeten. In Männersprache übersetzt heißt das so viel wie: »Röcke kürzer, Absätze höher und Ausschnitt tiefer.« Vor allem das mit dem Dekolleté war ihm wichtig. Sehr wichtig sogar, weil das meinen herrlichen Busen betone, meinte er. Mein Busen. Auf den konnte ich stolz sein. Das sagten die Männer immer. Denn der pralle Inhalt von Körbchengröße 75D war völlig echt!
Als ich in Michis Kanzlei kam, um ihn abzuholen, waren seine Bürodamen schon alle weg. Mein neues Outfit gefiel ihm. Richtig gut gefiel es ihm. Vor allem die neue Bluse mit dem tiefen Ausschnitt. Jedenfalls war unser Begrüßungskuss außer Kontrolle geraten, und plötzlich lag ich halb nackt auf dem Tisch im Besprechungszimmer.
Ich unterbrach meine Schilderung. Es war mir doch ein wenig peinlich, darüber zu reden. Doch Claudia ließ nicht locker.
»Und dann? Jetzt erzähl schon!«, forderte sie mich auf. Seitdem sie nach zweijähriger Jo-Jo-Beziehung mit einem Universitätsprofessor der Philosophischen Fakultät wieder Single war, nahm sie noch mehr Anteil an meinen Männergeschichten.
Die Figürchen um uns herum schienen den Atem anzuhalten. Meine Stimme wurde leiser, ich flüsterte fast.
»Er hörte auf, mich zu küssen … und schaute mich seltsam an.«
»Wie seltsam?« Sie wollte aber auch immer alles ganz genau wissen.
»Seltsam eben. Dann sagte er diese Worte.« Ich sparte es mir, sie zu wiederholen.
»Und dann?« Claudia war sichtlich gespannt.
»Was und dann? Das war es dann. Ich bin vom Tisch runter, hab mich angezogen, und jetzt bin ich hier.«
Die Sache mit Dr. König im Fahrstuhl ließ ich aus. Claudia war ohnehin bei einem anderen Zahnklempner.
»Lene! Das kann doch nicht dein Ernst sein?! Dieser Mann hat dir heute gesagt, dass er dich liebt, und du lässt ihn einfach stehen?«
»Ja, aber so sagt man das nicht!«
»Hast du sonst keine Probleme?« Claudia schüttelte den Kopf. Sie wollte mich irgendwie nicht verstehen.
»Es hat sich angehört, als ob ich einer von seinen Schafkopfbrüdern wäre«, rechtfertigte ich mich. »Sepp, des gfreit mi fei sakrisch, dass du de Oide jetz ghaut hast«, ahmte ich in tiefer Stimmlage die Unterhaltung der Männer beim Kartenspielen nach.
Wobei es sich beim »Oide haun« nicht um einen tätlichen Übergriff auf die Ehefrau, sondern um das Einkassieren der Eichel-Sau beim inoffiziellen bayerischen Nationalspiel, dem Schafkopfen, handelte.
»Jetzt mach aber halblang, Lene. Michi ist schließlich alles andere als ein Stammtischbruder.«
Da musste ich ihr recht geben. Michi war ein wirklich gut aussehender Mann und als Anwalt für Vertragsrecht sehr erfolgreich. Warum er sich ausgerechnet mit mir eingelassen hatte, war mir heute noch ein Rätsel. Es war vor einem halben Jahr, als er lässig in seinem schicken Anzug in die Anzeigenabteilung der Zeitung geschlendert kam und eine Annonce für seine Kanzlei aufgab: »Freundliche, flexible Bürohilfe gesucht.« Mir blieb bei seinem Anblick fast die Luft weg. Und meine Konzentrationsfähigkeit glich der einer adipösen Seiltänzerin mit Gleichgewichtsstörungen, als er mich mit seinen eisblauen Augen anlächelte und sich dabei eine schwarze Haarsträhne aus dem Gesicht strich. Meine Güte, was für ein Mann! Für einen kurzen Moment überlegte ich sogar selbst, mich bei ihm zu bewerben. Ich wurde nervös, als er beim Ausfüllen des Anzeigentextes mit mir flirtete. So nervös, dass ich seine Telefonnummer mit der eines anderen Kunden verwechselte. Der suchte auch Mitarbeiterinnen. Allerdings unterschieden sich sowohl die Arbeitszeiten als auch das Tätigkeitsprofil dieser Damen mehr als deutlich. Sie durften ihre Arbeit überwiegend in horizontaler Lage ausüben – hauptsächlich nachts.
Als herauskam, dass ich das verbockt hatte, gab es von meinem Chef eine ordentliche Standpauke. Ich wollte das natürlich wiedergutmachen und fuhr zu den Inserenten, um mich persönlich zu entschuldigen. Noch immer wurde ich rot, wenn ich an das breite Grinsen des Saunaklubbetreibers dachte, als ich mit einer Flasche des guten Verlagshausweins, der gewöhnlich nur zu Weihnachten an Großkunden verschenkt wurde, bei ihm auftauchte. Dabei hatte er meinem Chef bereits drei kostenlose Anzeigen abgeschwatzt. Und dann kam der Hammer: Der Boss des Arabian Nights hatte mir doch allen Ernstes einen Job in seinem Etablissement angeboten. Er sah großes Potenzial in mir. Vor allem in meinem appetitlichen Vorbau, von dem er kaum seinen Blick wenden konnte. Falls ich jemals über eine berufliche Veränderung nachdenken sollte, genüge ein Anruf und wir wären im Geschäft, meinte er augenzwinkernd und leckte sich dabei lüstern über die Lippen.
»Meine Telefonnummer hast du ja, Schätzchen. Aber pass auf, dass du sie nicht wieder vertauschst.«
Er lachte schallend. Der Mann hatte immerhin Sinn für Humor. Vielleicht wäre er gar kein so übler Chef? Mein Abteilungsleiter war ja manchmal schon ein wenig trocken. Ob es im Klub auch Weihnachtsgeld gab? Und Mutterschutz und Erziehungsurlaub? Es hätte mich auch sehr interessiert, ob man sich an Brückentagen freinehmen durfte. Ich ersparte es mir aber dann doch, ihn danach zu fragen. Ein Blick in die abgeklärten Gesichter der Damen, die an der Theke auf Kundschaft warteten, genügte, um zu erkennen, dass es hier nicht viel zu lachen gab.
Und dann stand ich auch nicht so wirklich auf rote Ledersofas und Reizwäsche als Arbeitsbekleidung. Nein, dieser Beruf war eindeutig nicht für mich geeignet. So freundlich es mir möglich war, schlug ich sein gut gemeintes Jobangebot aus.
Rechtsanwalt Michael Sommer hatte mich erst ein wenig zappeln lassen, bis ich bemerkte, dass er mich mit seinem strengen Blick nur necken wollte. Noch für denselben Abend hatte er mich zum Essen eingeladen. Anschließend teilten wir brüderlich den guten Verlagswein. Meine Entschuldigung nahm er entgegen und erklärte mir allen Ernstes, dass ich durch meinen Fehler eine Seele vor dem Fegefeuer gerettet hatte. Die neue Bürohilfe war eine der jungen Frauen, die sich eigentlich für den unmoralischen Job im Saunaklub bewerben wollte. Michi hatte die hübsche Blondine – Sabine ihr Name – auf Anhieb sympathisch gefunden. Sie war freundlich und flexibel. Und sie war eine Hilfe im Büro. Erst gestern hatte er sie vor meinen Augen als beste Sekretärin gelobt, die er je hatte. Das beruhigte mich. Sehr sogar. Allerdings fragte ich mich, ob stattdessen im Saunaklub eine der Bürokraftanwärterinnen gelandet war. Und ob meine Seele zukünftig im Fegefeuer dafür schmoren musste.
Insgeheim beschäftigte mich auch die Frage, ob ich im Arabian Nights wirklich eine so steile Karriere gemacht hätte, wie der Boss dort es mir prophezeit hatte. Doch mir schwante, dass ich das niemals herausfinden würde.
»Wie sagst du denn einem Mann, dass du ihn liebst?«, riss Claudia mich aus meinen Gedanken.
»Ich … also, ich sage, nun ich …«, stotterte ich herum und starrte zur Kommode. Und erstarrte. Das konnte doch nicht möglich sein! Der kleine Eskimo stand wieder mit dem Gesicht zu uns, sein Blick unterkühlter denn je. Claudia musste ihn umgedreht haben, ohne dass ich es mitbekommen hatte.
»Was jetzt?« Claudia ließ nicht locker.
»Ich, ich … jetzt fällt mir auf die Schnelle nichts ein.«
Sie schaute mich ungläubig an. Ich schaute ungläubig zurück. Mir fiel tatsächlich nichts ein.
»Ich weiß, dass du deine letzten Beziehungen alle verbockt hast, aber sag jetzt nicht, dass du noch nie zu einem Mann gesagt hast, dass du ihn liebst?«
»Natürlich hab ich das schon mal zu einem Mann gesagt«, protestierte ich heftig und lachte auf. Was dachte sie denn von mir?
»Zu wem?« Ihre Frage kam schnell. Und sie war sehr direkt.
»Zu … äh …« Ich überlegte. Vier Monate vor Michi war ich drei Monate mit Daniel zusammen. Er war ganz nett, aber irgendwie kein Mann zum Lieben. Vor allem deshalb nicht, weil er zu anderen Frauen genauso nett war wie zu mir. In jeder Hinsicht.
Davor gab es Tittengrabscher-Eugen – nein, zu ihm hatte ich es auch nicht gesagt. Und vor ihm war da Johannes. Ihm wollte ich es sagen, aber da war mir meine Cousine Tina zuvorgekommen. Und dann war noch …
»Tim!« Ich wusste es doch! Tim hatte ich gesagt, dass ich ihn liebe. Nun, eigentlich hatte ich es nicht gesagt, sondern auf einen Zettel geschrieben. Mit mindestens neunundneunzig Herzchen drum herum. Aber das musste ich Claudia nicht unbedingt auf die Nase binden.
»Tim?« Claudia grinste amüsiert. »Du meinst jetzt aber nicht den Tim, in den du als Sechzehnjährige verschossen warst und der sich letztes Jahr für den Job in der Sportredaktion beworben hatte?«
»Äh, doch, ja, ja, doch.« Jedes Mal, wenn ich nur an ihn dachte, löste das bei mir ein unkontrollierbares Stottern aus. Tim. Er hatte damals nicht auf meine herzige Liebesnachricht reagiert. Wie ich später erfuhr, war er mit einer älteren Cabriofahrerin – sie war einundzwanzig und damit drei ganze Jahre älter als er – losgezogen.
Als er letzten Herbst mit seinem unwiderstehlichen Piratencharme das Büro in der Redaktion betrat, war ich sprachlos. Buchstäblich. Doch auch diesmal war uns Amor nicht gewogen. Nicht Tim wurde eingestellt, sondern der Sohn eines Freundes eines Onkels unseres Chefredakteurs. Und das, bevor ich die Möglichkeit hatte, überhaupt ein Wort mit Tim zu wechseln. Mein Traum von einer zweiten Chance war schneller zerplatzt, als man mit aufgespritzten Lippen einen Luftballon aufblasen konnte. Ich seufzte.
»Du musst das wieder ausbügeln, Lene. Geh sofort zu dieser Vernissage und sag Michael, dass du ihn auch liebst. Und dass du vorhin einfach nur kalte Füße bekommen hast.«
»Nein. Das mach ich nicht!« Ich schüttelte heftig den Kopf.
»Lene! Einen Mann wie ihn findest du nicht so schnell wieder.«
»Ich kann nicht …«
»Warum nicht?«
»Er war ziemlich sauer, als ich einfach so davon bin«, gestand ich kleinlaut.
»Warum wundert mich das nicht?« Claudia seufzte. Sie nahm meine Hände, sah mich streng an.
»Süße, worauf willst du eigentlich warten? Michi ist ein toller Mann, und er liebt dich. Was willst du mehr? Geh da hin und bring es wieder in Ordnung!«
»Aber ich kann doch jetzt nicht einfach so da aufkreuzen.« Allein beim Gedanken daran bekam ich Bauchgrummeln.
»Und wie du kannst!« Sie zog mich aus dem Sessel hoch und drückte mir mein Täschchen in die Hand.
»Zieh deinen Lippenstift nach, leg Parfum auf, und ich ruf inzwischen ein Taxi.« Schon hatte sie das Telefon in der Hand und wählte die Nummer. Claudia war schon immer ein Mann der Tat im Körper einer zierlichen dunkelhaarigen Frau. Der Eskimo grinste mich eiskalt an. Sobald Claudia mir den Rücken zudrehte, packte ich den kleinen Kerl und stopfte ihn in meine Handtasche.
Die Party war bereits voll im Gange, als ich den angesagten Klub Butts betrat. Im Hintergrund lief Musik von LaBrassBanda. Da stand ich normalerweise total drauf. Hierher passte der Sound jedoch so wenig wie ein Lebkuchen ins Osternest. In kleinen Gruppen unterhielten sich chic gekleidete Gäste, von denen ich die meisten aus dem Lokalteil unserer Zeitung kannte. Sie nippten an Getränken in scheckkartengroßen Plastikgefäßen, verziert mit dem Konterfei von Severin Bayerl. Vermögend, wie er war, konnte er sich solche Extravaganzen leisten.
Von Michi war nichts zu sehen. Was mich gar nicht so unglücklich machte. Da ohnehin niemand Notiz von mir nahm, beschloss ich, so schnell wie möglich wieder zu verschwinden. In dem Moment drückte mir eine der ausnahmslos blonden Bedienungen ein Getränk in die Hand. Na gut. Wenn ich schon mal hier war … Ich bemühte mich, den stechenden Blick des Künstlers auf dem Becher zu ignorieren, und nahm einen kräftigen Schluck. Hmm. Schmeckte ungewöhnlich, aber richtig fein.
»Was ist das denn?« Ich musste fast schreien, damit die Bedienung mich verstand. Sie zuckte mit den Schultern.
»Keine Ahnung. Irgendwas mit Schampus und so Beeren aus Südamerika.«
Sie gab mir ein weiteres Becherchen, bevor sie in Richtung Theke verschwand. Ich schaute mich um. Das Licht im Raum war ziemlich heruntergedimmt. Nur die Ausstellungsstücke waren mit grellen Neonscheinwerfern beleuchtet. Etwas abseits interviewte Lissy Bormann, eine unserer freien Mitarbeiterinnen, den wie immer auf jugendlich getrimmten Künstler Severin. Sein Sohn Alwin stand neben den beiden und versuchte vergeblich, sich in die Unterhaltung einzubringen. Alwin war ein halbes Jahr mein Banknachbar in der vierten Klasse gewesen und eigentlich eine gute Seele. Wenn er nur nicht immer krampfhaft versucht hätte, in die Fußstapfen seines exzentrischen Vaters zu treten. Das war unmöglich und Alwin leider – oder glücklicherweise – nur ein müder Abklatsch des Alten. Jetzt hatte er mich entdeckt und winkte mir über die anderen Gäste hinweg zu, was bei seiner Größe von fast zwei Metern kein Problem darstellte. Ich winkte freundlich zurück. Irgendwie mochten wir uns.
Severin erklärte Lissy inzwischen seine Scheckkarten-Werke, wobei er eindrucksvoll gestikulierte. Das Plastikgeld war aufgeschlitzt und zu seltsamen Gebilden zusammengesteckt. Ich konnte nicht viel damit anfangen. Einzig die Frage, ob das einmal alle seine eigenen Kärtchen waren, fand ich spannend. Ich beneidete Lissy nicht. Kein einfacher Job, sowohl über die Werke als auch über den Künstler zu schreiben, über den ohnehin in den letzten Jahrzehnten schon alles geschrieben worden war.
Ich beschloss spontan, mir noch ein weiteres Becherchen mit dem köstlichen Getränk vom Tablett einer Bedienung zu nehmen, da zog der vertraute Duft von Michi und Davidoff Hot Water in meine Nase.
»Lene!?«
Ich drehte mich um. Michi stand hinter mir.
»Was machst du denn hier?«, fragte er verwundert. Neben ihm Sabine.
Moment! Was machte die denn hier? Scheinbar war sie noch flexibler, als ich dachte. Auch abends. Außerordentlich flexibel und freundlich. Zu Michi. In meine Richtung wirkte ihr Lächeln etwas kühl und erinnerte mich an den kleinen Eskimo, der in den Tiefen meiner Tasche schlummerte. Dabei hatte sie ihren Job nur mir zu verdanken.
Plötzlich war ich glücklich, Michi zu sehen. Sehr glücklich sogar. Er sah einfach umwerfend aus, und ich war froh, dass Claudia mich hergeschickt hatte. Ich würde alles wieder in Ordnung bringen, und Sabine durfte Feierabend machen.
»Michi, bitte, können wir kurz reden? Nur wir beide?«
»Ich weiß nicht, ob das eine so gute Idee ist.« Er lächelte zwar, aber es war die Sorte von Lächeln, die er immer dann aufsetzte, wenn er eigentlich nicht lächeln wollte.
Er war eindeutig eingeschnappt. Und ich konnte das sogar verstehen. So, wie ich ihn heute behandelt hatte, das steckt wohl kein Mann so schnell weg. Aber aufgeben kam nicht infrage! Ich überlegte krampfhaft, wie ich ihn doch noch überreden konnte, da fiel sein Blick auf meinen Ausschnitt. Oder besser gesagt, in meinen Ausschnitt. Augenblicklich wurden seine Gesichtszüge weicher. Das war die Gelegenheit! Wenn nicht jetzt, wann dann?
»Bitte. Nur eine Minute, Michi!« Er lächelte plötzlich. Sein echtes Lächeln. Mir fiel ein zentnerschwerer Stein vom Herzen. Und ich wusste, dass jetzt alles gut werden würde.
»Na gut, Lene … Sabine, entschuldige uns bitte kurz.«
»Du wolltest mir doch was zu trinken besorgen, Michael«, wandte sie schmollend ein. Sabine hatte offensichtlich etwas dagegen, dass wir eine Minute allein miteinander verbrachten.
»Hier. Nimm das. Schmeckt ausgezeichnet!« Ich drückte ihr meinen Becher in die Hand und folgte Michael. Die bösen Blicke, die sie mir hinterhersandte, spürte ich wie Messerstiche in meinem Rücken.
Wir gingen in ein Nebenzimmer und schreckten dort eine ältere Dame und einen jungen Mann auf, die wild miteinander geschmust hatten. Ich wusste, dass die beiden glücklich verheiratet waren, allerdings nicht miteinander. Mit glühenden Wangen und dem Versuch einer abstrusen Erklärung flohen sie aus dem Raum. Endlich waren Michi und ich alleine. Ich hatte Mühe, ein nervöses Kichern zu unterdrücken. Doch ein Blick in seine Augen genügte, und das Lachen blieb mir im Hals stecken.
»Ich bin gespannt, was du mir zu sagen hast, Lene.« Mit verschränkten Armen stand er vor mir und schaute mich mit strengem Anwaltsblick an, der seine Wirkung im Gerichtssaal sicherlich nicht verfehlte. Jetzt durfte ich bloß nichts Falsches sagen.
»Es tut mir leid, was heute passiert ist, Michi.« Das war doch schon mal ein guter Einstieg, fand ich. Trotzdem fiel es mir schwer, ihm in die Augen zu sehen.
»Noch nie hat mich eine Frau einfach so stehen lassen.«
Hörte ich da einen Hauch »Beleidigte Leberwurst« heraus? Und war ich tatsächlich die Erste, die ihn mit offener Hose hat stehen lassen? Oder schummelten Männer in solchen Dingen, um den Frauen ein schlechtes Gewissen zu machen? Allerdings hätte es mir auch nicht gefallen, wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre.
»Bitte verzeih mir. Aber weißt du …«
»Was weiß ich?«
Tja, was wusste er? Genau das fragte ich mich in diesem Moment selbst.
Er sah mich mit einem Blick an, den ich nicht deuten konnte. Gott, war das schwierig! Ich hatte keinen Schimmer, wie ich ihm erklären sollte, was mit mir los war. So richtig verstand ich es ja auch nicht.
»Lene!?«
Ich musste es mit einer anderen Taktik versuchen, frei nach dem Motto: Reden ist Silber, Küssen ist Gold. Super Idee, wie ich fand, und auf die Schnelle die einzige, die ich hatte. Gedacht – getan. Ich drückte mich eng an ihn, legte meine Hände auf seinen Po und begann, ihn verführerisch zu küssen. Grandiose Strategie, wie sich sofort herausstellte. Michi packte mich und erwiderte meinen Kuss wild und voller Leidenschaft.
Wir waren wieder genau da angelangt, wo wir heute schon einmal waren. Er konnte die Finger nicht von mir lassen und … Mooooment! Wir waren genau da angelangt, wo wir schon waren? Meine Nackenhaare begannen, sich um einen Stehplatz zu raufen. Das bedeutete … Ich wusste, was gleich kommen würde. Er löste sich von mir. Sah mich an. Mit genau dem seltsamen Blick. Wie schon gehabt.
»Lene … Lene, du verruggte Hehna … Du machst mi ganz narrisch. I hab mi echt sakrisch in di valiabt.« Ich schluckte. Er liebte mich. Warum konnte er mir das nicht anders sagen, verdammt noch mal?! Michi schaute mich erwartungsvoll an.
»Jetzt reiß dich zusammen, Lene! Und pack die Gelegenheit beim Schopf«, würde Claudia nun sagen. Und sie hätte recht. Da stand der Mann, mit dem alles möglich war, was ich mir immer schon erträumt hatte. Er sah gut aus, war vermögend, und mit ihm konnte ich eine große Familie gründen. Zumindest ging ich davon aus, dass er mal viele Kinder wollte. Aber ich würde mich auch über eine kleine Familie freuen. Hauptsache, Familie. Dazu gehörten später natürlich reizende Enkelkinder, die ich total verwöhnen würde, wenn ich einmal eine rüstige Seniorin mit viel Zeit war. Ich würde mit ihnen in Freizeitparks fahren und in der Adventszeit leckere Plätzchen backen. An Weihnachten würden sich ihre strahlenden Augen in den bunten Christbaumkugeln spiegeln, und ich würde gerührt Tränen aus meinen Augen wischen. Mein Lebenstraum. Alles das lag jetzt vor mir. Ich musste nur zugreifen. Meine Knie wurden weich. Langsam öffnete ich meinen Mund.
»I … ich … l …« Verdammt! Es ging nicht. Ich brachte die Worte nicht über meine Lippen. Was war denn nur los mit mir? Die Vorstellung, »Ich liebe dich« zu sagen oder »Mei, i hab mi a so vui in di valiabt«, bereitete mir größtes Unbehagen. Das erwartungsvolle Lächeln verschwand aus seinem Gesicht. Auch er ahnte, was nun kommen würde. Und zum zweiten Mal an diesem Tag ließ ich ihn einfach stehen.
Kapitel 2
In einem traumhaft schönen weißen Kleid und mit einem Blumenstrauß aus dunkelroten Rosen stand ich in einer idyllischen kleinen Kirche irgendwo in England. Der Priester – er sah Mister Bean erstaunlich ähnlich – fragte mich, ob ich Hugh zu meinem mir anvertrauten Mann nehmen und zu ihm stehen wolle, in guten wie in schlechten Tagen, bis dass der Tod uns scheidet. »Yes«, sagte ich mit fester Stimme und machte damit Hugh Grant zum glücklichsten Mann der Welt. Mit dem Gefühl, die glücklichste Frau der Welt zu sein, wachte ich in meinem Zimmer auf. Meine Augen ließen sich allerdings nur sehr schwer öffnen. Sie waren immer noch geschwollen von den vergossenen Tränen der letzten Nacht, mit denen ich die Sahara hätte bewässern können. Mit einem Schlag war es da: das Gefühl, die unglücklichste Frau der Welt zu sein. Und ein Blick auf den Wecker verschaffte mir ein weiteres Gefühl: das erschreckende Gefühl, ordentlich verschlafen zu haben.
Mit einem Satz sprang ich aus dem Bett und mit dem linken Fuß genau auf einen kleinen harten Gegenstand. »Autsch!« Es war der kleine Eskimo, auf den ich getreten war. Scheinbar war er in der Nacht irgendwie aus der Tasche gefallen. Mann, tat das weh! Wütend kickte ich ihn mit dem heilen Fuß unter das Bett und verspürte dabei eine gewisse Genugtuung.
»Jetzt aber schnell, Lene!«, feuerte ich mich selbst an. Ich hasste es, zu spät zu kommen. Ich hinkte zum Kleiderschrank und griff nach dem hellblauen Kleid, das Michi besonders gerne … Stopp! Kein Michi mehr. Kein Kleid heute. Und auch keinen Rock! Ich zerrte meine gute alte Lieblingsjeans aus dem wochenlang unberührten Hosenstapel. Anschließend schlüpfte ich in ein T-Shirt mit der Aufschrift: »Das Leben ist nicht das einfachste!« Und ich zog bequeme Sneakers an. Jetzt fühlte ich mich schon ein wenig besser. Ich war genau richtig angezogen, um den kommenden Tag einigermaßen zu überstehen.
Nachdem ich mir eilig die Zähne geputzt, ein wenig Wasser ins Gesicht geklatscht und die Haarmähne zusammengebunden hatte, fiel mir plötzlich ein, dass ich letzte Nacht nicht mit meinem Auto nach Hause gefahren war, sondern mit dem Taxi. Auch das noch! Gott sei Dank war mein Vater noch nicht draußen auf den Feldern.
»Was machst du denn noch hier?«, fragte er mich verwundert, als ich ihn im Gewächshaus fand. Mein Vater war Biobauer und bewirtschaftete den Hof nach den strengen Vorgaben eines Ökoverbands. Nahrungsmittel waren für ihn das kostbarste Gut der Menschen, und dementsprechend sorgsam und respektvoll ging er damit um.
Nachdem meine Mutter kurz nach meiner Einschulung bei einem Autounfall ums Leben gekommen war, hatte mein Vater mich ganz alleine großgezogen. Und vor ein paar Jahren hatte er den alten Pferdestall in eine schnuckelige Zweizimmerwohnung für mich umgebaut.
Unser Hof war sehr modern und hatte nicht im Geringsten etwas mit den heruntergekommenen düsteren Gebäuden zu tun, die Filmemacher so gerne zeigten, wenn ihre Geschichten in Niederbayern spielen. Allen Leuten, die aufgrund dieser Bilder denken, dass die Menschen in Niederbayern noch in Holzschlapfen über den matschigen Hof laufen oder in Häusern mit zusammengewürfelten Möbelstücken aus den Zeiten beider Weltkriege um einen Tisch sitzen und sich aus einer Schüssel die Suppe teilen, sei gesagt: Auch bei uns haben Einbauküchen, das vierundzwanzigteilige Essgeschirr und Kaffeeautomaten bereits Einzug gehalten. Und die eine oder andere Frau stolziert sogar in Manoloschuhen über den hübsch gepflasterten Hof ihres schicken Einfamilienhauses.
»Ich hab verschlafen. Fährst du mich bitte ins Büro?«
Vater nickte. Er war kein Mann der großen Worte. Und auch kein Mann der hohen Geschwindigkeiten. Die Fahrt nach Passau, normalerweise in zehn Minuten zu schaffen, dauerte mit ihm am Steuer seines nagelneuen Hybridautos mehr als doppelt so lange.
Mit eineinhalbstündiger Verspätung hetzte ich an meinen Schreibtisch, entschuldigte mich in Richtung meiner Kollegen und legte sofort los. Gott sei Dank war viel los heute, sodass ich kaum dazu kam, über Michi und mich nachzudenken. Zumindest so lange nicht, bis ein Karton auf meinen Tisch knallte und ich erschrocken hochfuhr.
»Das soll ich dir von Michi bringen!« Sabine stand vor mir und lächelte mich mit einem Blick an, der an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig ließ: »Ätsch, jetzt gehört er mir!«, sagte dieser Blick. Mein Mund wurde schlagartig trocken. Ich bemühte mich, Haltung zu bewahren, nahm den Karton mit meinen Habseligkeiten und stellte ihn unter den Schreibtisch. Eindeutiger hätte Michi mir nicht sagen können, dass es zwischen uns endgültig aus war. Und das Schlimme daran: Ich hatte es ganz alleine verbockt! Trotzdem hatte es ihm wohl nicht schnell genug gehen können, sich mit seiner tüchtigen Mitarbeiterin zu trösten. So sakrisch kann die Liebe dann doch nicht gewesen sein, dachte ich bitter.
Sabine stand immer noch da. Was wollte sie denn noch? Trinkgeld vielleicht? Miterleben, wie ich einen Weinkrampf bekam? Aber darauf konnte sie lange warten, denn Tränen waren momentan aus. Die Kollegen ringsherum schauten neugierig. Auch ihnen würde ich keine Gelegenheit geben, mir beim Heulen zuzusehen. Gut, dass unser Abteilungsleiter momentan in Urlaub war. Der hätte bestimmt nachgefragt, was mit mir los war.
Ungeduldig trommelte Sabine mit ihren langen Fingernägeln auf meinem Schreibtisch. Dieser Anblick tröstete mich etwas. Michi hasste künstliche Nägel. Er legte viel Wert auf eine natürliche Maniküre. Aber das musste sie selbst rausfinden.
»Was ist jetzt mit dem Schlüssel?« Ihr frecher Ton gefiel mir gar nicht.
»Wenn du Michis Wohnungsschlüssel meinst, den hab ich zu Hause.« Das war zwar eine glatte Lüge, aber ich würde einen Teufel tun und ihn dieser Frau jetzt geben.
»Schick ihn per Einschreiben an die Kanzlei.« Mit diesen Worten verließ sie ohne Gruß das Büro. Ich konnte mich gerade noch zurückhalten, die Hacken zusammenzuschlagen und zu rufen: »Yesss, Mäm!«
»Die hätte wirklich ins Arabian Nights gepasst. Am besten als Domina«, kam Claudias bissiger Kommentar von hinten. Ich hatte gar nicht gemerkt, dass sie gekommen war. Ihr Verständnis für die Lage tat mir gut. Sie sah mich mitleidig an, und bevor ich doch noch anfing zu weinen, rettete sie mich mit den Worten: »Komm, wir machen Mittagspause!«
Die Sonne schien von einem azurblauen Frühlingshimmel, über den gemächlich eine Herde kleiner weißer Schäfchenwolken zog. Claudia und ich saßen auf einer Bank am Ufer des Inns. Um uns herum spielten Kinder, gingen verliebte Pärchen Hand in Hand die Promenade entlang. Studenten saßen im Gras, lernten oder alberten herum, und Rentner fütterten Enten und Schwäne, die gemächlich im Wasser trieben. Eigentlich alles andere als ein Tag für Liebeskummer.
Claudia war für eine Weile sprachlos, nachdem ich ihr alles erzählt hatte. Und das wollte was heißen. Jetzt schaute sie mich ratlos an.
»Was machen wir denn nur mit dir, Lene?«
Wenn ich das nur wüsste. Am besten die Rewind-Taste drücken und vierzehn Stunden zurückspulen. Dann hätte Fräulein Bürowunder Sabine nicht die Nacht mit meinem Freund verbracht. Dann würde ich einen neuen Anlauf nehmen und Michi sagen, dass ich ihn liebe. Öhm … Würde ich das? Verwirrt ob meiner rätselhaften Gefühle blickte ich hoch zum weiß-blauen Himmel. Da schoss mir ein verrückter Gedanke durch den Kopf. Ich sprang hoch.
»Es liegt gar nicht an mir, dass ich es nicht sagen konnte!«, rief ich aufgeregt.
»Was bitte meinst du damit?«, fragte Claudia ein wenig erschrocken über meinen plötzlichen Ausbruch.
Ich versuchte, mich zu beruhigen, um die richtigen Worte zu finden. Das war gar nicht so einfach, denn ich war schrecklich aufgeregt über das, was ich eben herausgefunden hatte. Ich atmete tief durch. Jetzt würde sie gleich Augen machen!
»Ich weiß jetzt, warum ich ihm nicht sagen konnte, dass ich ihn liebe. Das liegt daran, dass es in Bayern dafür keine passenden Worte gibt.«
Claudia schaute mich ungläubig an. »Das versteh ich nicht.«
»Es ist doch ganz einfach, Claudia. Ein verliebter Mensch, der Hochdeutsch spricht, kann ›Ich liebe dich‹ sagen, weil es diesen Ausdruck in seiner Sprache gibt. Ein Engländer sagt: ›I love you‹, und ihr Italiener haucht ein romantisches ›Ti amo‹. Aber für uns Bayern gibt es da nichts. Deswegen konnte ich es nicht sagen.«
Dass ich da nicht früher draufgekommen war? Dabei war es doch so offensichtlich. Ein junges Paar, das neben uns auf einer karierten Decke in der Wiese saß, hörte inzwischen interessiert meinen Ausführungen zum Thema bayerische Liebe zu.
»Lene, geht’s dir noch gut?« Claudia starrte mich an, als ob ich plötzlich zu einer Blondine mutiert wäre.
Doch ich bekräftigte noch mal meine Theorie und brachte sie auf den Punkt.
»Auf Bairisch gibt es Liebe nicht, Claudia.«
»Unsinn. Natürlich gibt es Liebe auch in Bayern.«
»Dann sag mir doch mal den Satz ›Ich liebe dich‹ auf Bairisch«, forderte ich sie auf. Doch es war nicht Claudia, die darauf antwortete.
»I hab di liab.« Das kam von der jungen Frau neben uns.
»Aber das ist nicht das Gleiche wie: ›Ich liebe dich‹«, stellte ihr Freund fest, dessen Wurzeln unüberhörbar am nördlichen Ende der Republik zu finden waren.
»Eben!«, sagte ich triumphierend. »I hab di liab«, sagte man auch zu seiner Omi oder zu seinen Kindern. Es hatte nichts mit der magischen Liebe zwischen Mann und Frau zu tun.
»Wie wär’s mit: I lieb di?« Claudia bemühte sich, bairisch zu sprechen, was sich sehr lustig anhörte.
Aber – da waren die junge Frau und ich uns sofort einig – »I lieb di« hörte und fühlte sich furchtbar abgehackt an und war absolut nicht zu vergleichen mit der spanischen Liebeserklärung »Te amo«. Oder mit einem sinnlich gehauchten französischen »Je t’aime«.
Ich war jetzt absolut gefesselt von dem Thema. Schließlich war das endlich eine Erklärung für mich, warum ich gestern einem der attraktivsten und gefragtesten Männer Passaus einen Korb gegeben hatte.
Claudia war jedoch alles andere als überzeugt von meiner Theorie.
»Das ist dir doch nur eingefallen, damit du eine Entschuldigung hast für deine Unfähigkeit, eine Beziehung einzugehen«, beschuldigte sie mich.
Wie sie nur auf diesen Unsinn kam? Ich wollte doch eine Beziehung. Ganz bestimmt sogar! Und ich wollte eine eigene Familie. Groß oder klein, wie auch immer. Hauptsache, eine richtige Familie! Allein schon aus diesem Grund war ihr Vorwurf völlig aus der Luft gegriffen.
Um ihr zu beweisen, dass meine neu gewonnenen Erkenntnisse keine Ausreden waren, sprach ich auf dem Rückweg zum Verlagshaus weitere Leute an. Wir hörten zwar die unterschiedlichsten Ausdrücke, aber den bairischen Satz für »Ich liebe dich« konnte uns niemand sagen. Ich grinste triumphierend.
Claudia wollte das nicht gelten lassen. »Ich werde dir beweisen, dass es die Liebe auch auf Bairisch gibt«, sagte sie.
»Und wie?«, fragte ich. Ihre Augen leuchteten plötzlich gefährlich. Wie sonst nur, wenn sie einer brisanten Story auf der Spur war. Eigentlich hätte ich alarmiert sein müssen. Und zwar sehr alarmiert. Sie lächelte mich an.
»Das wirst du schon sehen!«
Ich sah es gleich am nächsten Morgen. Viertelseitig und mit einem Farbfoto. Meinem Farbfoto. Ich verschluckte mich an meinem Frühstückskaffee, als ich mir selbst aus dem Lokalteil unserer Zeitung zulächelte.
Die Überschrift lautete:
Wie sagt man es auf Bairisch?
Lene auf der Suche nach der weiß-blauen Liebe.
Und am Ende des Berichts die Aufforderung an die Leser,mir dabei zu helfen.
Kapitel 3
Ich war auf dem Weg zu Claudias Büro, um ihr ordentlich die Meinung zu sagen, als ein Scherzkeks aus der Redaktion es besonders lustig fand, mir den bayerischen Defiliermarsch hinterherzupfeifen. Nicht allen Kollegen gelang es, sich das Lachen zu verkneifen, und ich hörte verhaltenes Kichern und gekünsteltes Hüsteln. Meine Gesichtsfarbe wechselte innerhalb einer Dreiviertelsekunde von hellrosa zu himbeerrot. Was farblich eigentlich sehr gut mit meinem zitronengelben Pulli harmonierte, sich jedoch mit dem Rotbraun meiner Haarfarbe biss. Aber für Modefragen hatte ich jetzt keinen Nerv. Ich würde Claudia den Kopf abreißen!
Bevor ich in ihr Büro stürmte, öffnete sich die Tür, und die Frau, die ich vor Kurzem noch meine beste Freundin nannte, strahlte mich an wie ein Honigkuchenpferd.
»Was hast du dir dabei …«, fing ich an. Doch sie packte mich am Arm, zog mich in ihr Kämmerchen und schloss die Tür.
»Der Bericht über dich schlägt ein wie eine Bombe!« Sie hielt mir einen Packen Kopien unter die Nase. »Schau.«
»Was?« Ich starrte auf das oberste Blatt. Der Ausdruck einer E-Mail mit dem Betreff: »Bayerische Liebesgrüße für die bezaubernde Lene«.
»Heute sind schon über dreihundert E-Mails und Faxe aus ganz Bayern gekommen. Sogar aus Sachsen und Österreich haben die Leute geschrieben. Lauter Leserbriefe über dich und die Liebe auf Bairisch. Matthias ist begeistert. Er möchte morgen eine ganze Seite mit den Vorschlägen der Leser. Außerdem findet er dich sehr fotogen.«
Matthias Berger war der Verleger unserer Zeitung. Ein dynamischer Mann Anfang vierzig mit der unverwechselbaren Ausstrahlung von altem Geld. Erst vor Kurzem hatte er den Posten seines Vaters übernommen, und seither wehte ein neuer, frischer Wind durchs Haus. Berger war seit einem Jahr geschieden, und ich wusste nicht, ob es seither eine Neue in seinem Leben gab. Ich sah ihn nicht allzu oft und bezweifelte, dass er mich jemals wahrgenommen hatte.
»Er findet mich fotogen?«, fragte ich deshalb überrascht. Das war ja mal was ganz Neues.
Claudia nickte. »Ja. Und scheinbar nicht nur er. Ein paar Heiratsanträge sind auch gekommen.« Sie kicherte. »Cool, oder?«
Cool? Vom Heiraten war ich im Moment weiter entfernt als die Katzenberger von einem Oscar für ihr Lebenswerk. Obwohl man der kecken Blondine auch das noch zutrauen könnte. Ich riss Claudia die Blätter aus der Hand und warf sie auf den Schreibtisch.
»Wie konntest du einfach über mich schreiben, ohne zu fragen?« Ich setzte den vorwurfsvollsten Blick auf, der mir zur Verfügung stand. Doch das zeigte keine Wirkung. Absolut nicht. Claudia war resistent dagegen und hatte ein Dauergrinsen im Gesicht, als ob man sie gerade für den Pulitzerpreis nominiert hätte.
»Ich habe gesagt, ich würde dir beweisen, dass es die Liebe auf Bairisch gibt. Oder stehst du jetzt nicht mehr dazu?«, fragte sie provokant.
»Natürlich steh ich dazu!« Ich änderte meine Meinung schließlich nicht alle fünf Minuten! Vor allem nicht so eine bedeutsame Erkenntnis.
»Dann beschwer dich nicht! Du kennst mich jetzt schon lange genug. So was mache ich auf meine Weise.«
Ja, ich hätte es eigentlich wissen müssen. Trotzdem … Während ich noch überlegte, in welche Richtung ich ihr den Hals umdrehen sollte, wählte Claudia sich in die Facebook-Seite unserer Zeitung ein und klatschte dann vor Freude in die Hände.
»Fast tausend Kommentare innerhalb weniger Stunden!«
Das machte mich jetzt doch ein wenig neugierig. Ich überflog einige der Kommentare. Und fühlte mich gleich etwas besser. Claudia schien in ihrer Euphorie noch gar nicht bemerkt zu haben, dass der Schuss für sie nach hinten losgegangen war.
»Das ist ja alles schön und gut, aber was möchtest du mir damit beweisen?«, fragte ich sie ausgesprochen freundlich.
»Nun. Dass du dich getäuscht hast und es die Liebe auf Bairisch doch gibt.« Sie fühlte sich sehr sicher.
»Und woraus schließt du das?«, bohrte ich nach.
»Schau doch, was sich die Leute alles überlegt haben.«
»Was speziell meinst du?«
Claudia setzte sich neben mich und scrollte die Beiträge auf und ab.
»Na hier.« Sie las vor: »Du bist mei große Liab … oder: I steh total auf di … oder Du bist mei liabs Goidkäferl.«
»Und das soll eine Entsprechung für ›Ich liebe dich‹ sein?«, fragte ich und fühlte mich zum ersten Mal seit dem Frühstück wieder richtig gut.
»Da ist ja noch viel mehr«, ereiferte sich Claudia.
»Was denn? Vielleicht Du bist da Wahnsinn für mi oder I dad vor Liab für di sterbn?«, las ich für sie weiter.
»Na ja. Das trifft es vielleicht nicht ganz, aber die Richtung stimmt doch. Und ich muss ja auch erst alles in Ruhe durchgehen.« Ihr Lächeln war nicht mehr ganz so strahlend.
»Merkst du nicht, dass diese ganzen Beiträge nur das bestätigen, was ich gestern herausgefunden habe? Auf Bairisch gibt es ›Ich liebe dich‹ nicht, Claudia!«
Meine Erkenntnis war zwar eigentlich sehr traurig, aber es fühlte sich gut an, recht zu haben. Claudia musste es nur noch zugeben.
»Gar nichts geb ich zu. Du bist auf dem völlig falschen Dampfer, Lene.« Wenn Claudia sich mal was in den Kopf gesetzt hatte, dann war sie sturer als ein sizilianischer Esel. Und sie hatte auch schon wieder eine Idee.
»Komm, wir machen ein ausführliches Interview über die Reaktionen der Leser für die morgige Ausgabe.«
Bevor ich antworten konnte, klingelte mein Handy mit der speziellen Michi-Erkennungsmelodie »Waka-Waka« von Shakira. Ich schluckte und sandte insgeheim ein Stoßgebet zum Himmel. »Lieber Gott, bitte mach, dass er heute noch keine Zeitung in die Finger bekommen hat.«
Vielleicht war die Zeitungsfrau in seiner Straße ja krank? Natürlich nichts Ernstes, nur so ein kleiner Schnupfen. Schließlich durfte sie nicht ausbaden, dass Michi und ich Probleme hatten.
Womöglich hatte sie heute Morgen auch jemand samt ihrer Tasche entführt – natürlich ein höflicher Kidnapper mit dem Aussehen eines Patrick Nuo, oder …
Ich mochte mir gar nicht ausmalen, wie ärgerlich Michi über den Artikel sein würde. Da geh ich einfach nicht ran, beschloss ich spontan. Doch mein anderes Ich ignorierte diese Anweisung, und schon hatte ich das Handy am Ohr.
»Hallo Michi, das ist aber schön …« Weiter kam ich nicht. Schon bombardierte er mich mit Vorwürfen. Wie ich dazu käme, ihn in aller Öffentlichkeit lächerlich zu machen, wo doch viele Leute dachten, wir wären noch ein Paar. Ob ich völlig durchgeknallt sei? Oder unter Drogen stünde? Und dass er froh war, mich rechtzeitig verlassen zu haben. Als im Hintergrund Sabine auch noch ihren Senf dazugab, legte ich auf. Das musste ich mir nicht antun.
Erst jetzt bemerkte ich, dass ich die ganze Zeit die Luft angehalten hatte. Ich nahm rasch einen tiefen Atemzug, bevor ich aus Sauerstoffmangel ohnmächtig wurde. Was hatte er noch mal gesagt? Er hätte sich von mir getrennt, der Herr Rechtsanwalt? Das Wort Rechtsverdreher bekam in diesem Moment eine ganz eigene Bedeutung für mich.
Claudia sah mich mitleidig an. Auch ohne Lautsprecher hatte sie jedes Wort hören können.
»Das wollte ich nicht, Lene.« Sie war tatsächlich zerknirscht. Dass sie meinetwegen ein schlechtes Gewissen hatte, machte mir wiederum ein schlechtes Gewissen, und sie tat mir leid. Ich zuckte mit den Schultern und versuchte, einen auf cool zu machen.
»Ach, schon gut. Um den Michi schwirrt halt jetzt das fleißige Sabinchen herum«, witzelte ich wenig überzeugend und unterdrückte die aufsteigenden Tränen. Wie schnell Gefühle doch umschlagen konnten. Noch vor zwei Tagen hatten Michi und ich uns täglich mindestens fünfzig Kurznachrichten geschickt, und die Welt war in Ordnung gewesen. Inzwischen hatte ich ihn so verletzt, dass wir keinen normalen Satz mehr miteinander wechseln konnten. Dabei wollte ich ihm niemals wehtun. Wenigstens wusste ich jetzt, warum mir das passiert war. Und genau das würde ich Michi begreiflich machen. Vielleicht gab es dann doch noch eine Chance für uns …
Die halbe Nacht lag ich wach und dachte über einen Plan nach, wie ich Michi versöhnlich stimmen konnte. Gleichzeitig mit dem Sonnenaufgang ging mir endlich ein Licht auf. Auch wenn ich selbst nicht besonders stolz auf meinen Einfall war, sah ich nur eine Möglichkeit, wieder an ihn heranzukommen: Ich musste seinen Verstand ausschalten. Und das ging am besten durch den beherzten Einsatz meiner hervorragendsten Körperteile. Inzwischen war es früher Morgen, und ich stand vor der Gartentür seines Grundstücks. Wahrscheinlich hätte ich mich selbst nicht erkannt, wenn ich mir auf der Straße begegnet wäre. Meine Haare waren zu einem strengen Pferdeschwanz zusammengebunden, meine Lippen dunkelrot geschminkt. Ich trug ein extrem kurzes rotes Kleidchen, das Michi mir erst vor einigen Tagen gekauft, ich jedoch noch nicht getragen hatte. Erst kurz vor dem Haus war ich in die schwarzen High Heels geschlüpft, die mich fast einen halben Kopf größer machten. Meine Brüste drohten bei jeder Bewegung aus dem verboten tiefen Ausschnitt zu hüpfen. Um meinen Hals trug ich eine zarte Kette, und daran hing Michis Haustürschlüssel, den ich als Vorwand für mein Kommen benutzen wollte. Ein Blick auf meine Armbanduhr. Gleich war es halb acht, und Michi würde sich zu seiner täglichen Joggingrunde aufmachen. Und tatsächlich: Langsam öffnete sich die Haustür. Ich zupfte nervös am Saum meines Kleids, der sich gefühlt knapp unterhalb meines Bauchnabels befand.
Doch anstatt Michi verließ Sabine das Haus. Wohnte die schon hier, oder was? Sie sah auch nicht so aus, als ob sie vorhatte, sich sportlich zu betätigen.
Schnell, Lene, hau ab!, meldete sich mein Selbsterhaltungstrieb. Ich wollte mich unbemerkt davonschleichen, da blieb ich mit meinem Absatz im Pflaster hängen. Ausgerechnet jetzt! Bevor es mich bäuchlings auf den Bürgersteig streckte, konnte ich mich gerade noch am Gartenzaun festhalten. Mühevoll richtete ich mich wieder auf und fühlte mich miserabel. Vor allem deswegen, weil Sabine inzwischen neben mir stand und mich mit einem Blick anstarrte, mit dem man sonst nur auf Kakerlaken und sonstiges ekliges Kleingetier herabschaute.
»Was soll das? Was willst du hier?« Ihr Ton war nicht sonderlich freundlich.
Konnte sie denn nicht wenigstens mit ihrer Fragerei warten, bis ich meinen Schuh aus der Pflasterspalte befreit und wieder angezogen hatte?
Endlich stand ich wieder, wenn auch noch ein wenig wackelig, in beiden Schuhen auf beiden Beinen. Sie schaute mich abschätzig – oder war es gar ein wenig neidisch? – von oben bis unten an, und ich wäre vor Scham am liebsten im Boden versunken. Was für ein Teufel hatte mich nur geritten, dieses Outfit zu tragen, welches besser in die Domina-Abteilung des Arabian Nights gepasst hätte?





























