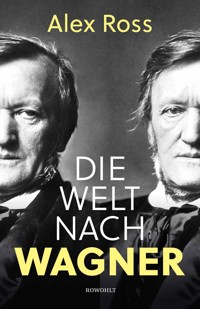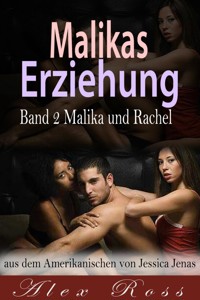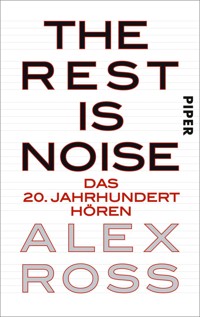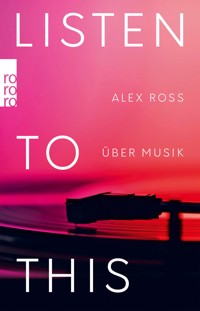
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Alex Ross, der renommierteste Musikkritiker der USA, beschäftigt sich in «Listen to this» mit der Rezeption von klassischer und populärer Musik und deren Bedeutung für menschliches Empfinden – und mit seiner ganz persönliche «Hörgeschichte». In seinem Buch versammelt er Texte, die im New Yorker erschienen sind. Ein persönliches Werk, in dem Ross von seinen Hörerfahrungen berichtet, von Mozart, Schubert, Bach bis hin zu Bob Dylan, Björk und Radiohead. «Warum nur kann ein deutscher Autor nicht so erzählen wie Alex Ross?» Deutschlandfunk
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 579
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Alex Ross
Listen To This
Über Musik
Über dieses Buch
Alex Ross, einer der renommiertesten Musikkritiker der USA, beschäftigt sich in «Listen To This» mit der Rezeption von klassischer und populärer Musik und deren Bedeutung für menschliches Empfinden – und mit seinem ganz persönlichen Zugang zu dieser ganz besonderen Kunstform. In seinem Buch versammelt er Texte, die im New Yorker erschienen sind, und malt ein einzigartiges Bild der musikalischen Landschaft. Ein fachkundiges und gleichzeitig sehr intimes Werk, in dem Ross von seinen Hörerfahrungen berichtet.
«Warum nur kann ein deutscher Autor nicht so erzählen wie Alex Ross?» Deutschlandfunk
Vita
Alex Ross, geboren 1968, ist seit 1996 der Musikkritiker des New Yorker. Davor schrieb er vier Jahre für die New York Times. Sein erstes Buch «The Rest is Noise» erschien 2013 auch in Deutschland, nun folgen sein epochales Werk «Die Welt nach Wagner» und sein Essayband «Listen To This». Ross wurde ein Arts and Letters Award der American Academy of Arts and Letters verliehen, der Belmont Prize, ein Guggenheim Fellowship und ein MacArthur Fellowship. Er war 2002 Fellow der American Academy in Berlin.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Dezember 2020
Copyright © 2020 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«Listen To This» Copyright © 2010 by Alex Ross
All rights reserved including the rights of reproduction in whole or in part in any form.
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Daniel Grill/Getty Images
ISBN 978-3-644-00730-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Daniel Zalewski
und David Remnick
… I follow with my eyes the proud and futile wake. Which, as it bears me from no fatherland away, bears me onward to no shipwreck.
SAMUEL BECKETT, MOLLOY
Vorwort
Ein altehrwürdiger Mythos verklärt Musik in ein vom alltäglichen Leben losgelöstes, freischwebendes Reich der Wahrheit und Schönheit. Oft gilt sie als die reine, universelle Sprache, die direkt zum Herzen spricht. Zur gleichen Zeit aber stattet man diese Kunstform mit enormer sozialer Macht aus. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts hat das jeweilige Publikum die Musik zu einer Art weltlichen Religion oder spirituellen Kraft gemacht und ihr Botschaften angedichtet, die so eindringlich wie unbestimmt waren und sind. Beethovens Sinfonien versprechen politische und individuelle Freiheit; Wagners Opern befeuern die Einbildungskraft von Schriftstellern und Demagogen; Strawinskys Ballettkompositionen setzen Primär-Energien frei; die Beatles verkörpern das Aufbegehren gegen eine überkommene Gesellschaftsordnung. An jedem Punkt der Geschichte gibt es ein paar Komponisten und kreative Musiker, die das Geheimnis ihrer Zeit in sich zu tragen scheinen. Die Musik bricht unter einer solchen Last fast zusammen, und wenn wir von ihrer Ausdruckslosigkeit sprechen, wollen wir sie vermutlich vor einem übertriebenen Anspruch schützen. Denn sosehr wir unsere Musikidole verehren, so sehr zwingen wir sie, quasi auf Knopfdruck bestimmte Emotionen zu liefern: Ein Teenager lässt Hip-Hop dröhnen, um seine Wut zu kanalisieren; eine Frau im gehobenen Management hört zur Entspannung Bach. Die Musiker befinden sich in der merkwürdigen Situation, gleichzeitig vergöttert zu werden und versklavt zu sein.
Dieses Buch ist der vorläufige Bericht einer gefährdeten Spezies, des amerikanischen Musikkritikers. Seit 1996 habe ich das große Glück, Musikkritiken für den New Yorker zu schreiben, eine der wenigen amerikanischen Publikationen, die der klassischen Musik noch Platz widmen. Von Anfang an ermutigten mich meine Herausgeber, den Blick weit über die musikalische Landschaft streifen zu lassen – also nicht nur über die Stars in Carnegie Hall oder Metropolitan Opera zu schreiben, sondern auch an entlegeneren Orten nach jungen Stimmen zu suchen. Genau wie meine Vorgänger Andrew Porter und Paul Griffiths war ich immer der Ansicht, dass modernen Komponisten die gleiche Behandlung wie den kanonischen Meistern gebührt – ein Grundsatz, der zu meinem ersten Buch The Rest Is Noise: Das 20. Jahrhundert hören geführt hat. Gelegentlich kam es auch zu Ausflügen in Pop und Rock, aber als jemand, der komplett mit klassischer Musik aufgewachsen ist, fühle ich mich außerhalb dieses Bereichs eher unsicher. Die Zeitschrift hat mir durchaus erlaubt, anderes Terrain zu betreten – ich durfte über Thomas Mann, die Frankfurter Schule, Stéphane Mallarmé, Oscar Wilde, Orson Welles und das Death Valley schreiben –, aber meine Heimat ist und bleibt einfach die Musik.
Im Gegensatz zu den meisten Amerikanern meiner Generation – ich kam 1968 zur Welt – bin ich mit einer fast schon fanatischen Hingabe an die großen Komponisten der klassischen Tradition aufgewachsen. Wie ich im ersten, memoirenhaften Essay dieses Buchs darlege, war mir zeitgenössische Musik anfangs vollkommen gleichgültig, egal ob klassisch oder populär. Listen to This stellt zum Teil eine Dokumentation dar, wie ein Zuhörer seine jugendliche Liebe zur Klassik mit einem reiferen Verständnis des musikalischen Kosmos versöhnt. Die ersten Essays versuchen, die komplizierten Verbindungen zwischen den Genres zu entwirren, und zeigen auf, wie sehr die Musikkultur von den gesellschaftlichen und politischen Umständen abhängt, innerhalb deren sie sich bewegt. Danach kommen ein paar Aufsätze zu kanonischen Figuren von Bach bis Cage, an die sich Ausflüge in den zeitgenössisch-populären Bereich anschließen. Ganz am Schluss hinterfrage ich dann den Kanon als solchen, und zwar anhand der verdienstvollen, schattenhaften Figur Antonio Salieri.
Die Große Sowjetische Enzyklopädie definiert Musik in einem ihrer weiseren Momente als «eine spezielle Variante menschlich erzeugter Klänge». Die Musik-Essayistik besteht also letzten Endes darin, dass man nicht über Klänge schreibt, sondern über Menschen. Das ist tatsächlich knifflig, weil im Fall von lebenden Künstlerinnen und Künstlern anmaßend, im Fall von toten hingegen rein spekulativ. Dennoch hoffe ich natürlich, hier den einen oder anderen Blick auf die geisterhafte Realität zu ermöglichen, die uns die Musik offenbart.
Alex Ross, im Oktober 2020
Teil IPanorama
1.Listen to this: Überquerung der Grenze zwischen Klassik und Pop
Ich hasse «klassische Musik»: nicht die Sache als solche, nur den Begriff. Er verortet eine hartnäckig lebendige Kunst in einem Themenpark der Vergangenheit. Er schließt die Möglichkeit aus, dass Musik im Geiste Beethovens auch heute noch erschaffen werden kann. Der Ausdruck erzeugt eine Hängepartie für das Werk Tausender Gegenwartskomponisten, die im Grunde gebildeten Menschen Rede und Antwort stehen müssen, womit sie da eigentlich ihren Lebensunterhalt bestreiten. Der Begriff ist eine Glanzleistung an Negativ-Publicity, ein extrem gelungener Anti-Hype. Ich wünschte, es gäbe eine andere Bezeichnung. Wie sehr beneide ich die Jazzer, die einfach nur «die Musik» sagen.
Den Großteil des vergangenen Jahrhunderts war die Musik von einem Kult des mediokren Elitarismus getragen, der seinen Selbstwert dadurch zu steigern sucht, dass er sich an hohle Phrasen einer intellektuellen Überlegenheit klammert. Man höre sich einmal die anderen Bezeichnungen an, die so im Umlauf sind: «Kunst»-Musik, «ernste» Musik, «bedeutende» Musik, «gute» Musik. Natürlich kann die Musik bedeutend und ernst sein, aber Bedeutsamkeit und Ernsthaftigkeit sind nicht ihre entscheidenden Charakteristika. Sie kann genauso gut auch dumm, vulgär und krank sein. Komponisten sind Künstler und keine Kolumnisten für Etikettefragen; sie haben das Recht, jede Emotion, jede geistige Verfassung auszudrücken. Sie wurden von wohlmeinenden Liebhabern hintergangen, die finden, man müsse die Musik als Luxusartikel vermarkten – als eine Sache, die das schlechtere Produkt «Pop» ersetzen kann. Diese Schwellenhüter sagen letzten Endes: «Die Musik, die euch gefällt, ist Müll. Hört euch lieber unsere bedeutende, kunstvolle Musik an.» Dadurch erreichen sie wenig bei den vermeintlichen Ignoranten, denn sie haben vergessen, die Musik als etwas zu beschreiben, das zu lieben sich lohnt. Musik ist ein viel zu persönliches Medium, als dass sie für eine absolute Wertehierarchie taugen würde. Die beste Musik ist immer die, die uns glauben lässt, sie sei die einzige auf der Welt.
Wenn die Leute «klassisch» hören, denken sie automatisch an «tot». Die Beschreibung dieser Musik schließt immer ihre Distanz zur Gegenwart mit ein, ihren Unterschied zur Masse. Kaum verwunderlich also, dass jeder schon Geschichten von ihrem bevorstehenden Ende gehört hat. In den Zeitungen wird über die wohlbekannten Probleme berichtet: Orchester und Opernhäuser fahren Defizite ein; die Musik wird kaum noch an staatlichen Schulen unterrichtet, ist in den amerikanischen Medien so gut wie unsichtbar und wird von Hollywood ignoriert oder verhöhnt. Nur gab es diese Geschichte auch schon vor vierzig, sechzig oder achtzig Jahren. Im Jahr 1969 schrieb Stereo Review: «Es werden weniger Klassikplatten verkauft, weil die Menschen sterben (…) Der heutige Klassikmarkt ist, was er ist, weil vor fünfzehn Jahren niemand versucht hat, die Liebe zur klassischen Musik bei den Kindern zu wecken, die damals noch zu beeindrucken waren und heute den Markt darstellen.» Der Dirigent Alfred Wallenstein schrieb im Jahr 1950: «Die wirtschaftlichen Probleme, vor denen ein amerikanisches Sinfonieorchester steht, spitzen sich immer mehr zu.» Der Kritiker Karl Heinz Stuckenschmidt schrieb 1926 im Beitrag «Mechanische Musik»: «Konzerte sind schlecht besucht, und die Haushaltsdefizite werden von Jahr zu Jahr größer.» Die Klagen über den Niedergang oder gar Tod der Kunstform sind bis ins 14. Jahrhundert zurückzuverfolgen, als die gefühlvollen Melodien der Ars Nova das Ende der Zivilisation anzukündigen schienen. Der Pianist Charles Rosen hat den klugen Satz geäußert: «Der Tod der klassischen Musik ist vermutlich der älteste und beständigste Teil ihrer Tradition.»
Das Klassik-Publikum gilt allgemein als todgeweihte Versammlung der Alten, der Weißen, der Reichen und der Gelangweilten. Wie Statistiken des National Endowment for the Arts zeigen, ist die Situation nicht ganz so schlimm. Das Publikum ist hier tatsächlich älter als in anderen Sparten, aber das wohlhabendste ist es keineswegs. Musicals, Theater, Ballett und Museen bekommen im Einkommenssegment 55000 Dollar und darüber größere Stücke des Kuchens ab (wie auch der Sportsender ESPN übrigens). Das Parterre der Metropolitan Opera spielt den Gastgeber für Firmenchefs und die oberen Zehntausend, aber in den weniger teuren Bereichen – bei Abfassung dieses Textes kosteten die meisten Plätze in den oberen Rängen fünfundzwanzig Dollar – tummeln sich Lehrer, Textkorrektoren, Studenten, Rentner und viele andere, die keinen Eintrag im Who’s who haben. Wer echten, durch Schweizer Konten gestützten und auch zur Schau gestellten Reichtum sehen will, geht besser zu den Millionären, die bei einem Billy-Joel-Konzert in den Stadionlogen sitzen – so die Security das zulässt. Was das Ergrauen des Publikums betrifft, kann diese Tendenz nicht verleugnet werden, aber mit etwas Glück pendelt sich das ein. Paradoxerweise ist es nämlich so, dass trotz des zunehmenden Durchschnittsalters der Zuschauer das der Musiker immer mehr abnimmt. Die Mitglieder der Berliner Philharmoniker sind durchschnittlich eine Generation jünger als die Rolling Stones.
Die Musik liegt ständig im Sterben, und das seit jeher. Sie ist wie eine alterslose Diva auf permanenter Abschiedstournee, die noch ein allerletztes Konzert gibt. Sie ist schwer zu benennen, weil sie im Grund nie wirklich existiert hat – also nicht in dem Sinn, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt oder an einem bestimmten Ort entstanden ist. Sie hat keine Genealogie, keine ethnische Herkunft: Die führenden Komponisten der Gegenwart kommen aus China, Estland, Argentinien oder Queens. Die Musik ist einfach das, was Komponisten erschaffen – eine lange Reihe niedergeschriebener Werke, an die sich verschiedene Aufführungstraditionen geheftet haben. Sie umfasst das Hohe, das Niedrige, Oberschicht, Untergrund, Tanz, Gebet, Stille, Lärm.
Bis ich zwanzig wurde, habe ich ausschließlich klassische Musik gehört. Im Rückblick betrachtet, wirkt das etwas seltsam, aber damals kam es mir völlig normal vor. In gewisser Hinsicht bin ich nicht in den Siebzigern und Achtzigern aufgewachsen, sondern in den Dreißiger und Vierzigern, den Jugendjahren meiner Eltern. Weder meine Mutter noch mein Vater haben eine Musikausbildung genossen – beide wurden Mineralogen –, aber sie waren begeisterte Konzertgänger und Plattensammler. Sie wuchsen im «Goldenen Zeitalter» des amerikanischen Mittelstands auf, als die Musik in der Gesellschaft noch einen anderen Platz einnahm als heute. In diesen Jahren, die einem heute wie eine Traumwelt vorkommen, saß man zu Millionen vor den Radios und hörte zu, wie Toscanini das NBC Symphony Orchestra dirigierte. Walter Damrosch erklärte Schulkindern die Klassiker und erfand Liedchen, mit denen sie sich das Behandelte besser merken konnten. (Meine Mutter erinnert sich noch an eines: «This is / The sym-pho-nee / That Schubert wrote but never / Fi-nished (…)» – Das ist / Die Sin-fo-nie / Die Schubert schrieb, aber nie / vollen-dete.) Die NBC übertrug an einem Nachmittag ein College-Football-Spiel, am nächsten dann ein Konzert von Lotte Lehmann. Bei mir daheim kamen erst das Boston Symphony Orchestra und dann Football. Für mich klaffte dazwischen keine Lücke.
Schon früh stürzte ich mich auf die Plattensammlung meiner Eltern, gut bestückt mit Werken des Goldenen Zeitalters: Serge Koussevitzkys Sibelius, Charles Munchs Berlioz, das Thibaud-Casals-Cortot-Trio, das Budapest String Quartet. Wie die Platten aussahen und sich anfühlten, war untrennbar mit ihrem Klang verbunden. Es gab Otto Klemperers majestätische, in Zeitlupe vorgetragene Matthäus-Passion mit der schockierenden Illustration des Meisters von Delft. Toscaninis energische Interpretationen von Beethoven und Brahms waren von Robert Hupkas Fotos geziert, die den Maestro in Aktion zeigten, im Gesicht das gesamte Gefühlsspektrum von der Ekstase bis hin zum Ekel. Mozarts Divertimento in Es-Dur schmückte das berühmte Porträt, auf dem der Komponist nachdenklich den Blick senkt, wie ein General, der eine aussichtslose Schlacht vor sich hat. Während ich zuhörte, las ich die Begleittexte, die meist im leicht überkandidelten und deshalb fast schon platten Stil gehalten waren, wie er um die Mitte des 20. Jahrhunderts in den Medien vorherrschte. Über Tschaikowsky hieß es etwa, er zeige eine «Melancholie, die manchmal abyssale Tiefen erreicht». Nichts davon ergab Sinn für mich: So etwas wie Melancholie war mir unbekannt, von abyssalen Tiefen ganz zu schweigen. Wichtig war nur das abrupte Aufwallen des Gedankens, das meiner Reaktion auf die Musik entsprach.
Das erste Werk, das ich fast bis zum Wahnsinn verehrte, war Beethovens Eroica-Sinfonie. Bei einem Garagenflohmarkt fand meine Mutter eine Platte von Leonard Bernstein und dem New York Philharmonic Orchestra – aus der Reihe der Music-Appreciation Records des Book-of-the-Month-Clubs. Eine Begleitplatte enthielt Bernsteins Analyse der Sinfonie, eine Art Reiseführer zu ihrer fünfundvierzigminütigen Ausdehnung. Jetzt kannte ich die Bezeichnungen für die Konturen, die ich da wahrnahm. Bernstein bespricht etwas, das nach etwa zehn Sekunden passiert: Dem fanfarenähnlichen Hauptthema in Es-Dur wird von der Note Cis aufgelauert. «Hier gab es einen Stoß zudringlicher Andersartigkeit», sagte Bernstein so rätselhaft wie verführerisch mit seinem nikotinlastigen Bariton. Immer wieder hörte ich mir diesen Ton der Andersartigkeit an. Ich kaufte mir die Partitur und entzifferte die Notation. Mit Hilfe von Max Rudolphs Dirigierhandbuch brachte ich mir ein paar Bewegungen bei, mit denen man den Takt richtig schlägt. Im Wohnzimmer nahm ich meine Eltern in Geiselhaft, während ich für eine verzehrende Fassung der Eroica den Plattenspieler dirigierte.
Übertreibt Bernstein, wenn er dieses zurückgenommene Cis in den Celli als «Schock», «Hieb» und «Stoß» bezeichnet? Hätte man Gelegenheit, die Eroica einem vierzehnjährigen Hip-Hop-Fan vorzuspielen, würde er sie wohl im besten Fall schockierend langweilig finden. Aber das Werk fährt fort, wie aufs Stichwort für immer neue Überraschungen zu sorgen. Sieben Takte Es-Dur, dann das Cis, das für einen Moment auftaucht und gleich wieder verschwindet: wie ein Redner, der ans Mikrophon tritt, die ersten Worte einer feierlichen Ansprache äußert und dann verstummt, als müsse er an ein Kindheitserlebnis denken oder hätte im Publikum eine kritische Miene erblickt. Ich kann mich nicht mit dem Zuhörer identifizieren, der beim Anhören der Eroica sagt: «Uff! – Zivilisation!» Bei mir hat Musikhören nicht den Zweck, zivilisiert zu sein; immer wieder mache ich es, um der Welt um mich herum zu entfliehen. Was ich an der Eroica liebe, ist die Art und Weise, in der sie Romantik und Aufklärung, Zivilisation und Revolution, Körper und Geist, Ordnung und Chaos vereinigt. Sie weiß genau, dass man denkt, die Musik würde jetzt da oder dahin gehen, und schlägt dann triumphierend eine andere Richtung ein. Der dänische Komponist Carl Nielsen hat einmal einen Monolog für den Geist der Musik geschrieben, in dem sie oder er sagt: «Ich liebe die riesige Oberfläche der Stille – und mit allergrößtem Vergnügen durchbreche ich sie.»
Etwa zu der Zeit, als ich von Beethovens Cis gestoßen wurde, fing ich selbst mit dem Komponieren an. Meine dahingehende Karriere dauerte vom achten bis zum zwanzigsten Lebensjahr. Ich habe noch den Spiralblock mit einer ehrgeizigen Auflistung zukünftiger Kompositionen: dreißig Klaviersonaten, zwölf Violinsonaten, diverse Sinfonien, Konzerte, Phantasien und Trauermärsche, die meisten davon in der Tonart d-Moll. Ideen für diese Werke finden sich auf den folgenden Seiten verstreut, nur wurde da letztendlich nichts draus, was insgesamt auch für mein Komponistendasein gilt. Für den Schulgottesdienst gelang mir immerhin eine Vertonung von «O Magnum Mysterium»: Sie endete mit einem dissonanten Orgelakkord, der einen rätselhaften Gott symbolisieren sollte. Aufgeführt wurde sie nie. Gern denke ich an den Kommentar meines College-Dozenten, des Komponisten Peter Lieberson, der auf die letzte Seite meiner Semesterabschlussarbeit kritzelte, ich hätte da eine «hochinteressante und ziemlich eigenwillige Sonatine» geschrieben. Ich legte den Stift weg und versank in Schweigen, genau wie Sibelius in Järvenpää.
Meine Unfähigkeit, irgendetwas fertigzustellen – und schon gar etwas Gutes –, erzeugte bei mir den allergrößten Respekt vor dieser absurden Art und Weise, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Komponisten rebellieren im Grunde gegen die Realität. Sie erschaffen ein Produkt, das komplett überflüssig ist – zumindest bis ihre Musik ins öffentliche Bewusstsein dringt und die Leute ab da denken, sie könnten ohne dieses Produkt gar nicht mehr leben. Die meisten derer, die regelmäßig auf der Liste mit den meistgespielten Komponisten auftauchen – Mahler, Strauss, Sibelius, Debussy, Ravel, Rachmaninow, Strawinsky, Schostakowitsch, Prokofjew und Copland –, waren noch nicht einmal geboren, als der erste Entwurf des «Standardrepertoires» verfasst wurde.
Über die gesamte Teenagerzeit hatte ich Klavierunterricht bei einem Mann namens Denning Barnes. Ich lernte bei ihm auch Komposition, Musikgeschichte und die Kunst des Zuhörens. Er war ein drahtiger Mann mit wirrem Haar, dessen Tweedjacketts komisch rochen: nicht gut oder schlecht, einfach komisch. Er kannte sich gut mit Beethoven, Schubert und Chopin aus, liebte aber auch die Musik des 20. Jahrhunderts. Besonders angetan war er von Béla Bartók und Alban Berg. Er öffnete mir eine weitere Tür – in einer Wand, von der ich bislang nicht einmal wusste. Seine eigene Musik war wild, jazzig und leicht durchgeknallt. Einmal hämmerte er eine der Variationen aus Beethovens letzter Klaviersonate herunter und erklärte mir, das sei eine Vorwegnahme von Boogie-Woogie. Ich wusste nicht, was Boogie-Woogie sein sollte, war aber total begeistert, dass Beethoven das vorweggenommen hatte. Die Beethoven-Marmorbüste meiner Kindheit war ab da ein adleräugiger Wächter auf den Bollwerken des Klangs.
«Boogie-Woogie» war ein Wesen aus der ernsthaft-lustigen Welt Bernsteins, und Mr. Barnes war mein persönlicher Bernstein. Nichts an ihm war snobistisch: Er bestand zu hundert Prozent aus Enthusiasmus und war ein Fünfzehn-Dollar-die-Stunde-Guerillakämpfer für die Musik, die er liebte. Er starb 1989 an einem Gehirntumor. Bei unserem letzten Treffen spielten wir eine haarsträubende Version von Schuberts Fantasie in f-Moll für Klavier zu vier Händen. Sie enthielt viele falsche Töne, vornehmlich auf meiner Seite der Tastatur, fühlte sich aber großartig an und war wunderbar laut – bis heute hat für mich keine andere Interpretation des Werks die unsrige übertroffen.
In meiner Highschool-Zeit machte ich eine fürchterliche Entdeckung: Ich war in meiner Altersgruppe der Einzige, der dieses Zeug mochte. In anderen Klassen gab es zwar durchaus Klassik-Nerds, aber wir waren viel zu unterschiedlich, um irgendwie zusammenzufinden. Ein paar «normale» Freunde schleppten mich in eine Filmvorführung von Pink Floyd – The Wall, nach der ich immerhin einräumte, eine Passage daraus würde nach Mahler klingen.
Erst im College begann meine musikalische Festung dann zu bröckeln. Ich verbrachte viel Zeit beim Campus-Radio, wo ich eine Sendung moderierte und das Klassikprogramm mitgestaltete. Fast schon fanatisch kontrollierte ich die Grenzen des täglichen Sendeablaufs und war nicht bereit, auch nur fünfzehn Minuten von Meisterwerke der Kammermusik oder Ähnlichem abzugeben. Um Punkt 22 Uhr wechselte das Programm von Klassik zu Punk, und zwar Punk der abstrusesten Sorte. Sobald von einer Platte mehr als nur ein paar hundert Stück verkauft wurden, flog sie von der Playlist. Die DJs ließen zu Beginn ihrer Sendung gern die schlimmsten, abgedrehtesten Songs laufen, um die Klassik-Hörer abzuschrecken. Ich versuchte, sie mit klanglichen Wallungen von Xenakis zu übertreffen. Sie bedankten sich mit Sinatras «Only the Lonely». Einmal beantworteten sie meinen Beitrag über Herbert von Karajan, indem sie sarkastisch einen Song der Neonazi-Band Skrewdriver spielten, in dem es hieß: «Free Rudolf Hess / How long can they keep him there? We can only guess».
Verrückterweise waren diese studentischen Punkrocker die interessantesten Typen, die ich je getroffen hatte. Zwischen penibel recherchierten Sendungen zu Mission of Burma oder den Butthole Surfers erstellten sie Hausarbeiten über römische Befestigungsanlagen oder das liberale Denken des Autors und Literaturkritikers Lionel Trillings. Ich fing an, nach meiner eigenen Sendung noch im Studio abzuhängen, und unterdrückte meine instinktive Angst vor ihren stickerbesetzten Lederjacken und buntgefärbten Haartrachten. Ich erklärte ihnen – genau wie Mr. Barnes das getan hätte –, dass die atonale Musik Arnold Schönbergs all das bereits vorweggenommen hätte. Und ich begann, auch neuere Sachen zu hören. Die ersten beiden Rock-Platten, die ich mir zulegte, waren die Pere-Ubu-Kompilation Terminal Tower sowie Daydream Nation von Sonic Youth. Ich arbeitete mich vom Underground zum Alternative Rock vor und landete schließlich beim durchweg kommerziellen Rock. Ich verabschiedete mich von der Vorstellung einer Überlegenheit der Klassik, was aber zu einer Glaubenskrise führte: Wenn die Musik nicht bedeutend und ernst, nicht groß und mächtig war – was war sie dann?
Als ich nach der Uni im nördlichen Kalifornien lebte, dachte ich eine Zeitlang daran, die klassische Musik ganz aufzugeben. Ich verkaufte viele meiner CDs, darunter auch die gesammelten Sinfonien von Arnold Bax, um mir mehr Pere Ubu und Sonic Youth kaufen zu können. Ich schnitt mir die Haare kurz, trug wütende T-Shirts und trieb mich in Berkeleys Punkklub 924 Gilman Street herum. Ich wurde Fan einer Band namens Blatz – weiter hätte ich mich von Bax nicht entfernen können. (Ihr großer Hit war «Fuk Shit Up».) Zum Glück musste mir niemand erst sagen, dass ich am falschen Ort war. Es gibt in Amerika den merkwürdigen Traum, dass eine neue Musik dir eine neue Persönlichkeit, eine neue Gesellschaftsschicht, sogar eine neue Rasse schenken kann. Das außerkörperliche Gefühl ist aufregend, solange es anhält, aber die meisten Leute werden dorthin zurückgeworfen, wo sie gestartet sind.
Als ich mich wieder ins Ghetto der Klassik begab, beschloss ich, seine Begrenzungen zu akzeptieren. Ich merkte, dass diese Kultur nach außen hin zwar ungemein baufällig wirkte, in sich aber nach wie vor eine leuchtende Flamme barg. Und ich dachte: Wenn ich von Brahms zu Blatz gehen kann, können andere diesen Weg auch in der Gegenrichtung bewältigen. Ich wollte schon immer über Klassik reden, als sei sie populäre Musik – und über populäre, als sei sie Klassik.
Für viele Leute ist Popmusik der Soundtrack zur chaotischen Adoleszenz, während die andere dann im langen Zwielicht des Erwachsenseins erklingt. Bei mir ist das genau umgekehrt. Wenn ich die Eroica höre, verspüre ich eine fast schon kindliche Energie, eine glückliche Bereitschaft für die Welt. Da ich erst spät zur Popmusik kam, gehe ich sie auch erwachsener an. Für mich ist sie tiefgründig, wissend, voll winziger Schattierungen der Wahrheit darüber, wie die Dinge wirklich sind. Bob Dylans Blood on the Tracks zerlegt eine scheiternde Beziehung mit nüchterner Klarheit. Pervers gedacht, wäre die Eroica das ungehobelte, grobschlächtige Ding – ein einziger Ausbruch von Ich und Es –, ein Song wie Radioheads «Everything in Its Right Place» hingegen die reine, abgeklärte Erwachsenen-Ironie. Die Vorstellung, dass das Leben harmlos und ebenmäßig dahinfließt – die dunkle Cis-Haftigkeit der Welt zwar spürbar, aber nicht bestätigt –, entspricht einer Schicksalsergebenheit, die Beethoven wahrscheinlich nie fühlte und schon gar nicht kommunizierte. Niemals will ich akzeptieren, dass eine bestimmte Art von Musik dem Verstand guttut und eine andere der Seele. Weil das vom jeweiligen Verstand und der jeweiligen Seele abhängt.
Die fatale Bezeichnung kam erst ganz spät in Umlauf. Von Machaut bis zu Beethoven war die Musik, die es gab, moderne Musik, und der Markt, in dem mit ihr gehandelt wurde, ganz ähnlich wie die heutige Popkultur. Ältere Musik wurde entweder schnell vergessen oder nur in akademischen Zusammenhängen behandelt. Sogar in den Kirchen war ständig Bedarf an neuem Material. Im Jahr 1687 wurde in Flensburg die Entlassung eines Kantors angestrebt, der auf ältere Musikstücke zurückgriff und keine zeitgenössischen spielen wollte. Als Johann Sebastian Bach im Jahr 1730 dem Leipziger Stadtrat vorwarf, nicht genug Sänger und Musiker engagiert zu haben, begründete er das damit, dass «die ehemahlige Arth von Musik unseren Ohren nicht mehr klingen will» und man nur mit ausgebildeten Künstlern «die neueren Arthen der Musik bestreiten» könne.
Bis weit ins 19. Jahrhundert waren Musikveranstaltungen eklektische Spektakel, bei denen Opernarien mit Teilen aus Sonaten und Konzertkompositionen kombiniert wurden. Drehorgelspieler trugen die beliebtesten Melodien hinaus auf die Straßen, wo sie sich mit Volkliedern abwechselten. Das Publikum drückte Gefallen oder Missfallen durch Beifall oder Rufe aus, während die Musik noch gespielt wurde. Mozart schrieb bezüglich seiner «Pariser» Sinfonie im Jahr 1778 über den Umgang mit seinem Publikum: «Gleich mitten im ersten Allegro war eine Passage, die ich wohl wusste, dass sie gefallen müsste: alle Zuhörer wurden davon hingerissen, und war ein grosses Applaudissement. – Weil ich aber wusste, wie ich sie schrieb, was das für einen Effect machen würde, so brachte ich sie zuletzt noch einmal an, – da ging es nun da capo.»
James Johnson beschreibt in seinem Buch Listening in Paris einen Abend in der Pariser Opéra, etwa zur gleichen Zeit:
Auch wenn die meisten Zuschauer mit dem Ende des Ersten Akts ihre Plätze eingenommen hatten, hörten die Bewegungen und Gespräche nie ganz auf. Lakaien und Junggesellen drängelten sich im überfüllten und oft auch lauten Parterre, dem ebenerdigen Bereich, zu dem nur Männer Zutritt hatten. Gebürtige Prinzen und Herzöge besuchten sich gegenseitig in den gut sichtbaren Logen des ersten Rangs. Weltliche Abbés plauderten im zweiten Rang fröhlich mit diamantengeschmückten Damen und ernteten empörte Rufe aus dem Parterre, wenn die Gespräche allzu vertraulich wurden. Liebespaare zogen sich gern in die lichtschwachen Höhen des dritten Rangs zurück – ins Paradies –, um der Kontrolle der Operngläser zu entgehen.
In Amerika waren Musikveranstaltungen ein stilistisches Durcheinander, ein Spiegel der bunten Gesellschaftsstruktur. Walt Whitman deutete die Oper als Metapher der Demokratie; die Stimmen seiner Lieblingssänger waren integraler Bestandteil seines lauter werdenden «barbarischen Raubvogelschreis».
Um das Jahr 1800 war es in Europa so weit, dass die Vergangenheit zunehmend Druck auf die Gegenwart ausübte. Johann Nikolaus Forkels Bach-Biographie (1802), eines der ersten größeren Werke über einen toten Komponisten, ist vermutlich die Gründungsurkunde des «klassischen» Denkens. Alle wichtigen Punkte finden sich hier: die Sehnsucht nach untergegangenen Epochen, die Verehrung eines einzelnen, gottgleichen Wesens, die Ablehnung der Gegenwart. Bach war «der erste Klassiker, der je gewesen ist, und vielleicht je seyn wird», verkündete Forkel. Er sagte außerdem: «Wenn die Kunst Kunst bleiben, und nicht immer mehr zu bloß zeitvertreibender Tändeley zurück sinken soll, so müssen überhaupt klassische Kunstwerke mehr benutzt werden, als sie seit einiger Zeit benutzt worden sind.» Mit «zeitvertreibender Tändeley» meinte Forkel wahrscheinlich das Parlando oder auch Geschwätz der italienischen Oper; seine Biographie richtet sich an «patriotische Verehrer echter musikalischer Kunst», vor allem der deutschen. Forkels Klage, die Musik seiner Zeit sei am Aussterben, wirkt heute natürlich amüsant, denn im Sommer 1802 nahm Beethoven die Arbeit an seiner 3. Sinfonie, der Eroica, auf.
Das gigantische, turbulente Werk stieß anfänglich eher auf Unverständnis, doch dann erkannte man zunehmend seinen Zauber. Eine Aufführung in Leipzig stellte 1807 den Wendepunk dar: Die Sinfonie wurde eine Woche später «wegen großer Nachfrage» wiederholt und erhielt sogar den Ehrenplatz am Ende des Programms. Beethoven müsse mehrmals gehört und erlebt werden, hatte ein Kritiker bereits über die 2. Sinfonie geschrieben: «Sie will, selbst von dem geschicktesten Orchester, wieder und immer wieder gespielt sein.» Es war vor allem die bestechende Komplexität seiner Konstruktionen – die Erschaffung größerer Strukturen aus einer obsessiven Entwicklung kleinerer Motive –, die der Repertoire-Kultur der Klassik den Weg ebnete. Damit soll nicht gesagt sein, dass sich wiederholtes Hören bei Beethovens Vorgängern mit ihren variationsreichen Spielereien nicht lohnen würde. Bei Beethoven selbst entsteht aber geradezu eine Abhängigkeit, eine Unausweichlichkeit. Kein Komponist kämpft so sehr darum, Langeweile zu vermeiden und die Aufmerksamkeit der Person zu fesseln, die eine seiner Kompositionen zum zehnten oder auch hundertsten Mal hört oder selbst spielt.
So kam es, dass Beethoven den problematischen Status einer säkularen Gottheit erlangte und seinen Schatten nicht nur auf die warf, die nach ihm kamen, sondern auch auf diejenigen, die ihm vorausgegangen waren. Bereits zu Lebzeiten intensivierte sich diese Verherrlichung. Im Jahr 1810 veröffentlichte E.T.A. Hoffmann, Schriftsteller und selbst großer Musiker, der aber vornehmlich für seine Phantasie- und Schauergeschichten bekannt ist, eine erstaunliche Rezension der 5. Sinfonie:
So öffnet uns auch Beethovens Instrumentalmusik das Reich des Ungeheuern und Unermeßlichen. Glühende Strahlen schießen durch dieses Reiches tiefe Nacht, und wir werden Riesenschatten gewahr, die auf- und abwogen, enger und enger uns einschließen und uns vernichten, aber nicht den Schmerz der unendlichen Sehnsucht, in welcher jede Lust, die schnell in jauchzenden Tönen emporgestiegen, hinsinkt und untergeht. (…) Beethovens Musik bewegt die Hebel der Furcht, des Schauers, des Entsetzens, des Schmerzes (…)
Das war Musikkritik in einer neuen Tonart. Der Musik werden sowohl transzendente als auch transformative Kräfte zugeschrieben: Sie schwebt weit über der normalen Welt, reicht jedoch herunter und verändert den Lauf der menschlichen Dinge.
Klassische Konzerte erhielten zunehmend den Charakter von Kulthandlungen. Die Partitur wurde ein geheiligtes Objekt; Improvisation fand immer weniger statt. In den Konzertsälen kehrten Stille und Zurückhaltung ein, Verhalten und Kleidung wurden förmlich. Bei den Wagnerfestspielen in Bayreuth, die erstmals 1876 stattfanden, zeigte man sich bei der Unterbindung von Beifall besonders rigoros. Für die Parsifal-Premiere 1882 verbot Wagner, dass die Sänger nach dem Vorhang noch einmal herauskamen, damit die ergriffene Stimmung seines «Bühnenweihfestspiels» nicht zerstört würde. Das Publikum nahm das als generelles Verbot von Applaus. Cosima Wagner, die Frau des Komponisten, notierte in ihr Tagebuch, was bei der zweiten Aufführung geschah: «Nach dem ersten Akt entsteht ein wohltuendes Schweigen der Andacht. Aber nach dem zweiten wirkt es peinlich, daß die Beifall-Spendenden wieder ausgezischt werden.» Zwei Wochen später brachten Zuschauer einen Mann zum Schweigen, der bei der Blumenmädchenszene «Bravo!» rief. Ihnen war nicht klar, dass sie den Komponisten auszischten. Die Wagnerianer nahmen Wagner ernster als er sich selbst – eine bedenkliche Entwicklung.
Die Sakralisierung der Musik, um hier eine Formulierung von Lawrence Levine zu verwenden, hatte aber auch Vorteile. Viele Komponisten waren froh, dass bei den Zuschauern Ruhe einkehrte; das sanfte Schock eines Cis bliebe ansonsten ja unbemerkt. Sie fingen an, für ein schweigendes, hörerfahrenes Publikum zu komponieren. Leute wie Beethoven oder Verdi kümmerten sich wenig um diese Herausbildung einer selbsternannten Elite. So egoman die Großmeister des 19. Jahrhunderts vielleicht waren – als Snobs kann man sie nicht bezeichnen. Wagner war von Luxus, hochrangigen Persönlichkeiten und sehr viel Dünkel umgeben und wetterte trotzdem gegen den Gedanken eines «klassischen» Repertoires, für den er die Juden verantwortlich machte. Sein erschreckender Antisemitismus ging Hand in Hand mit einem immer wieder charmanten Populismus. In einem Brief an Franz Liszt beklagte er den «monumentalen Charakter» der zeitgenössischen Musik, ihr «Kleben und Hangen an der Vergangenheit».
Nachdem die europäische Bourgeoisie Beethoven zum Halbgott erhoben hatte, verlor sie sogar an den aufregendsten unter den lebenden Komponisten das Interesse. 1859 schrieb ein Rezensent in Leipzig, dass «neue Kompositionen wenig oder gar kein Glück gemacht haben (…) Das gegenwärtige vierzehnte Gewandhausconcert war nun wieder ein solches, in dem eine neue Composition zu Grabe getragen wurde». Die Musik, um die es hier ging, war das Klavierkonzert Nr. 1von Brahms. (Brahms wusste, dass es schlecht für ihn lief, als nach dem ersten Satz niemand klatschte.) Um die gleiche Zeit bemerkten die Veranstalter einer Pariser Konzertreihe, dass ihre Abonnenten «ärgerlich werden, wenn auf dem Programm auch nur ein einziger zeitgenössischer Komponist steht». Der Musikwissenschaftler William Weber hat gezeigt, wie das historische Repertoire in ganz Europa Dominanz über das Konzertwesen erlangte. 1782 betrug in Leipzig der Anteil der Musik noch lebender Komponisten satte 89 Prozent. 1845 war er auf rund 50 Prozent abgesunken, und noch später im 19. Jahrhundert ging er sogar bis auf 25 Prozent zurück.
Die Fetischisierung der Vergangenheit hatte eine verheerende Wirkung auf die Moral der Komponisten. Immer mehr bezweifelten sie, dieses unversöhnliche Publikum befriedigen zu können, das alles ablehnte, was ihm angeboten wurde, egal in welchem Stil. Wenn es eh keinen interessiert, dachten sich die Komponisten, dann können wir uns ja gleich nur untereinander austauschen. Das war in etwa die Haltung, die im frühen 20. Jahrhundert zur kompromisslosen, manchmal fast schon asozialen Mentalität der Avantgarde führte. Ein Rezensent der Uraufführung der Eroica sah genau, welche Sackgasse sich da auftat:
Die Musik könne so bald dahin kommen, daß jeder, der nicht genau mit den Regeln und Schwierigkeiten der Kunst vertraut ist, schlechterdings gar keinen Genuß bey ihr finde, sondern durch eine Menge unzusammenhängender und überhäufter Ideen und einen fortwährenden Tumult einiger Instrumente, die den Eingang charakterisiren sollten, zu Boden gedrückt, nur mit einem unangenehmen Gefühl der Ermattung das Koncert verlasse.
In Amerika trieb die bürgerliche Mittelschicht die Klassik-Verehrung zu einem fast schon nekrophilen Extrem. Lawrence Levine gibt in seinem Buch Highbrow/Lowbrow ein erschreckendes Bild der Musikkultur, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts im Land herrschte. Es war demnach eine Welt, die Virtuosität, Extravaganz und alles, was nur entfernt nach «Unterhaltung» roch, rigoros ablehnte. Die Orchester widmeten sich «der hervorragenden Aufführung der bedeutenden Schöpfungen bedeutender Komponisten, der besten und tiefgründigsten Kunstwerke – und ausschließlich dieser», um die leicht redundante Formulierung des Dirigenten Theodore Thomas zu zitieren, der mehr oder weniger der Begründer des modernen amerikanischen Orchesters gelten kann.
Teilweise geht Levine mit der Kultur des späten 19. Jahrhunderts etwas zu streng um. Zwar stimmt es, dass die europäische Musik für viele Amerikaner zum Statussymbol wurde, nur verfolgten die meisten der führenden Köpfe – darunter auch Henry Lee Higginson, der Gründer des Boston Symphony Orchestra – ganz altruistische Ziele und wandten sich an Zuhörer aller Schichten, Nationalitäten und ethnischer Herkünfte. Die billigen Plätze in den großen Konzerthallen kosteten nicht viel mehr als der Eintritt in die Vaudeville-Theater, meist von fünfundzwanzig Cent an aufwärts. Trotzdem machten sich Überheblichkeit und Bevormundung breit: Die klassische Musik fing an, sich selbst für einen Modus der spirituellen Erhebung und kollektiven Selbstvervollkommnung zu halten – und nicht für einen Bereich des ungebremsten künstlerischen Ausdrucks.
Bereits ein oder zwei Jahrzehnte später hatten amerikanische Sinfonieorchester etwas so Verknöchertes, dass progressivere Geister einen dahingehenden Wandel forderten. «Amerika ist mit Kultur belastet, von Kultur gepeinigt», schrieb der Kritiker-Komponist Arthur Farwell im Jahr 1912. «Sinfoniekonzerte, Recitals und Opern sind voller Konventionalismus, Zynismus und Befangenheit.» Daniel Gregory Mason, ein einzelkämpferischer Columbia-Professor, attackierte die «prestigebesessenen» Plutokraten, die das New York Philharmonic Orchestra betrieben. Erheblich mehr Freude hatte er an Open-Air-Konzerten im Harlemer Lewisohn Stadium, wo sich das Publikum frei zu äußern pflegte. Von dort führte Mason süffisant den Verhaltenshinweis an: «Das Publikum wird höflich gebeten, nicht mit den Sitzkissen zu werfen.»
In den Konzertsälen hielt eine strengere Etikette Einzug. Beifall wurde erneut rationiert, und die Zuhörer waren angehalten, sich nicht nur während der Musik, sondern auch zwischen den Sätzen längerer Kompositionen ruhig zu verhalten – und das sogar nach den oft ohrenbetäubenden Codas erster Sätze, die zu Klatschen und Beifallsrufen quasi auffordern. Deutsche Musiker hatten sich das zu Beginn des 20. Jahrhunderts ausgedacht. Leopold Stokowski war als Dirigent des Philadelphia Orchestras maßgeblich daran beteiligt, diese Praxis auch in Amerika heimisch zu machen. Mason schrieb in seinem Buch Tune in, America: «Nach dem Trauermarsch der Eroica hätte Mr. Stokowski, wie jemand meinte, wenigstens einen Knopf drücken und über ein Schild dem Publikum (lautlos) mitteilen können: ‹Jetzt dürfen Sie das andere Bein übereinanderschlagen.›»
In den 1930er Jahren nahm eine neue Generation von Komponisten, Dirigenten und Radiomachern Farwells Idee einer «Musik für alle» auf. Das legendäre Zeitalter des Mittelstands begann. David Sarnoff, Chef der NBC, hatte die Vision, Toscanini für ein Massenpublikum dirigieren zu lassen, und dieses Publikum materialisierte sich in Millionenhöhe. Die Hollywood-Studios engagierten Komponisten wie Erich Wolfgang Korngold, Aaron Copland oder Bernard Herrmann und bemühten sich sogar um die modernistischen Giganten Schönberg und Strawinsky (beide verlangten aber zu viel Geld). Die Roosevelt-Administration förderte das Federal Music Projekt, das in zweieinhalb Jahren 95 Millionen Menschen erreichte; Konzerte fanden auch in Jugendstrafanstalten und noch im hintersten Dorf von Oklahoma statt. Nie zuvor hatte klassische Musik ein so großes und buntgemischtes Publikum erreicht. Wer diese Kunstform für inhärent elitär hält, sollte über folgende Ironie nachdenken: In einer Zeit anhaltender Wirtschaftskrisen, als Amerika politisch weiter nach links rückte als je zuvor in seiner Geschichte, als sozialistische Ideen die Staatsreligion des freien Unternehmertums bedrohten – genau da erreichte die klassische Musik ihre größte Popularität. Toscaninis Beethoven-Ausstrahlungen symbolisierten ein Nationalgefühl, das von Selbstlosigkeit und Gemeinsamkeit geprägt war und nicht nur die Depression, sondern auch noch die folgenden Kriegsjahre beherrschte.
Unter den jüngeren Intellektuellen sahen das aber nicht alle so. Für sie waren Oper und Symphonik spinnwebenverhangene Bollwerke der High Society, weshalb sie die Populärkultur als Ausweichmöglichkeit nutzten. Im Jahr 1925 erregte Ellin Mackay, Tochter des Verwaltungsratsvorsitzenden des New York Philharmonic Orchestra, dadurch Aufsehen, dass sie die in der gehobenen Gesellschaft üblichen Debütantinnenbälle vermied und lieber Kabaretts und Nachtclubs besuchte. Die Gründe dafür legte sie in einem geistreichen Artikel dar, der mit der Überschrift «Why we go to Cabarets: A post-debutante explains» im neu gegründeten New Yorker erschien. Der Aufschrei, den der Text auslöste, war mit der Grund dafür, dass diese Zeitschrift Fuß fassen konnte. Der Premierenbesuch an der Metropolitan Opera war eines der verhassten Rituale, die der Debütantin im Jazzzeitalter überflüssig vorkamen. Für noch größeres Aufsehen sorgte Mackay, als sie sich mit Irving Berlin verlobte, dem Komponisten von «Alexander’s Ragtime Band». Ihr Vater verkündete öffentlich, er würde seine Tochter bei Umsetzung ihres Plans enterben. Ellin und Irving heirateten trotzdem, und Clarence Mackay wurde in der Presse zu einer lächerlichen Figur, zum Inbegriff des «Hochkultur»-Snobs.
Die Anzahl an Deserteuren war Legion. Carl Van Vechten, berühmter Autor des Romans Nigger Heaven, schrieb ursprünglich Klassik-Kritiken für die New York Times; er hörte Strawinskys Le Sacre du Printemps und bezeichnete den Komponisten als Erlöser. Dann verlagerte sich seine Aufmerksamkeit und er entdeckte mehr Leben im Ragtime, in der Songschmiede Tin Pan Alley, im Blues und im Jazz. Gilbert Seldes schrieb in seinem 1924 verfassten Buch The Seven Lively Arts, dass «Alexander’s Ragtime Band» oder «I Love a Piano» musikalisch und emotional gehaltvoller seien als Four Indian Love Lyrics oder The Rosary – Hausmusiklieder der Jahrhundertwende – und dass «der Zirkus kunstvoller als die Metropolitan Opera sein kann und das auch ist». Für junge, afroamerikanische Musikexperten war die Enttäuschung sowohl bitterer als auch persönlicher. 1893 hatte Antonín Dvořák als Leiter des New Yorker National-Konservatoriums ein großes Zeitalter der «Negermusik» vorhergesagt und damit die Hoffnung geweckt, die klassische Musik würde das sogenannte Vorankommen der Rasse befördern. Leute wie James Weldon Johnson erwarteten den schwarzen Beethoven, der die Musik für Gottes Posaunen komponieren würde. Aber es dauerte nicht lange und ehrgeizige junge Sänger, Geiger, Pianisten oder Komponisten stießen auf eine Wand des Rassismus. Nur im Bereich der populären Musik konnten sie Karriere machen.
Die soziale Funktion der Musik hatte sich vollkommen verändert. Im späten 19. Jahrhundert sorgte die klassische Musik dafür, dass die weiße Mittelschicht sich aristokratisch fühlte; im Jazzzeitalter half die populäre Musik der gleichen Schicht, mit Elend und Schmutz zu kokettieren. Ein alberner Film aus dem Jahr 1934, Murder at the Vanities, bringt den damaligen Krieg der Genres gut auf den Punkt. Er spielt hinter der Bühne einer Varieté-Revue á la Ziegfeld, bei der eine Nummer daraus besteht, dass ein als Liszt verkleideter Pianist die Ungarische Rhapsodie Nr. 2 spielt. Duke Ellington und seine Band tauchen immer wieder von hinten auf und machen freche Einwürfe. Schließlich vertreiben sie die blasierten klassischen Musiker und spielen eine Variation namens Ebony Rhapsody: «It’s got those licks, it’s got those tricks / That Mr. Liszt would never recognize.» Liszt kommt mit einer Maschinenpistole zurück und mäht die Band nieder. Das Bild entspricht so ziemlich der damaligen Wirklichkeit. Auch wenn sich viele lobend über den Jazz äußerten – Ernest Ansermet bezeichnete Sidney Bechet sogar als «Genie» –, versuchten andere, die aufkommende Strömung mit verbalem Gewehrfeuer niederzustrecken. Daniel Gregory Mason, der Mann, der das Werfen von Sitzkissen für eine gute Sache hielt, war einer der größten Gegner und bezeichnete den Jazz als «kranken Moment in der Entwicklung der menschlichen Seele».
Die Verachtung beruhte auf Gegenseitigkeit. In der Kultur des Jazz herrschte, zumindest was die weißen Sektionen betrifft, jener umgekehrte Snobismus, der sich endlos dazu gratuliert, der Elite entkommen zu sein. (Jemand in Murder at the Vanities rühmt sich damit, einen Rhythmus entdeckt zu haben, den der arme Liszt – ausgerechnet! – niemals verstehen würde: Was für ein Snob.) Klassische Musik wurde zu einer Art Folie, vor der Popularmusiker ihre Coolness demonstrieren konnten. Die Komponisten waren hingegen äußerst irritiert darüber, dass sie jetzt als Zuarbeiter eines stinkreichen Monstrums galten. Sie waren es doch, die von der Macht des Geldes terrorisiert wurden. In diese Richtung ging Lawrence Gilmans Kritik im New York Tribune, nachdem Paul Whiteman und sein Palais Royal Orchestra Gershwins Rhapsody in Blue in der Aeolian Hall aufgeführt hatten. Gilman mochte die Rhapsody nicht, aber was ihn wirklich ärgerte, war Whitemans Äußerung, der Jazz sei ein Underdog, der gegen die Übermacht der Symphonik ankämpfen müsse. «Es sind genau die Palais-Royalisten, die das konservative, reaktionäre, konventionelle Element in der heutigen Musik repräsentieren», schrieb Gilman. «Sie sind die Aristokraten, die Platzhirsche des zeitgenössischen Musikschaffens. Sie sind die Strahlemänner, die Bezieher großer Gehälter, die Freunde der Royalität.» Gilmans Vorwurf wird durch Fakten gestützt. Ende der Zwanziger verdiente Gershwin mindestens 100000 Dollar jährlich. 1938 hatte Copland, einer der bedeutendsten Komponisten amerikanischer Konzertmusik, gerade mal 6 Dollar und 93 Cent auf dem Konto.
Trotz des unerbittlichen Ansturms von Jazz und Pop behielt die klassische Musik ihr gutes Ansehen auch dann, als die Ära von Depression und Weltkrieg in die des Kalten Krieges und seines begleitenden Wirtschafts-Booms überging. Es wurde unglaublich viel Geld in die Kultur gepumpt – auch, um sich gegenüber den Russen zu profilieren. Fördergelder der Ford Foundation sorgten für einen starken Zuwachs an Musikensembles, speziell Orchestern; hatten vorher ein paar Dutzend Profi-Orchester existiert, gab es jetzt ein paar hundert. In New York, Los Angeles und Washington, D.C., wurden gewaltige, multifunktionale Musik-«Zentren» errichtet, deren schnittige Fassaden sie wie weltliche Kathedralen wirken ließen. Zu Beginn der LP-Ära machten die großen Plattenfirmen mit Klassik ordentlich Kohle; Decca verkaufte von der pionierhaften Studioeinspielung des Wagner’schen Ring des Nibelungen satte achtzehn Millionen Stück.
Zahltag war dann in den 1960ern, als die klassische Musik ihren entscheidenden und offenbar dauerhaften Schritt in die Randbereiche der Kultur machte. Das Auftauchen von Dylan und den Beatles stellte erneut den klassischen Anspruch, «hohe Kunst» zu sein, in Frage, nur dass jetzt eine komplette Generation heranwuchs, ohne eine Identifikation mit dem klassischen Repertoire zu entwickeln. Das Publikum ergraute, die Besucherzahlen sanken. Einer Statistik zufolge ging im Lauf dieses Jahrzehnts der Klassik-Anteil bei den Plattenverkäufen von 20 Prozent auf ganze 5 Prozent zurück. Heute hält die Musik noch etwa ein Prozent des Marktes. Wie durch eine ironische Laune des Schicksals hat der Jazz einen ähnlich geringen Käuferanteil, was Duke Ellington und Franz Liszt endlich zu Kollegen macht.
Jede Musik wird irgendwann zu klassischer Musik. Wenn ich mir die Geschichte anderer Genres ansehe, kommt es immer wieder zu komischen Déjà-vu-Erlebnissen. Die Geschichte des Jazz scheint beispielsweise die der Klassik im Eiltempo zu durchlaufen. Am Anfang die jugendliche Rebellion: Satchmo, der Duke, Bix und Jelly Roll zeigen einer Generation, wie man sich in der Musik verlieren kann. Dann die Ära bourgeoisen Pomps: Die erstklassigen Swing-Bands übernehmen die Rolle des romantischen Orchesters. Phase 3: Die Musiker rebellieren – ähnlich wie bei der modernistischen Revolution – gegen das bourgeoise Image, teilweise sogar durch direkte Zitate. (Charlie Parker baut die Anfangstöne von Le Sacre du Printemps in «Salt Peanuts» ein.) Phase 4: der Free Jazz verkörpert den Moment, an dem die Vorhut den Kontakt zum Massenpublikum verliert und zur selbstzufriedenen Avantgarde wird. Phase 5: eine Periode der Konsolidierung und Rückbesinnung. Wynton Marsalis’ Versuch, ein traditionalistisches Jazz-Revival zu lancieren, entspricht der neoromantischen Musik vieler Komponisten des späten 20. Jahrhunderts. Aber dieses Engagement kommt zu spät, um die Kunst wieder dem populären Mainstream zuzuführen.
Die gleiche Entwicklung ist im Rock ’n’ Roll feststellbar. Was waren denn meine supergebildeten Punkrock-Freunde anderes als Modernisten der Phase 3, die gegen Phase 2 – den aufgeblasenen Romantizismus des Stadionrocks – rebellierten? In den ersten Jahren des neuen Jahrhunderts gab es in dem, was vom Rock noch übrig war, jede Menge Neoklassizismus der Phase 5. The Strokes, The Hives, die Stills, Thrills, White Stripes und zahlreiche andere Bands griffen auf einen verlorenen, reinen Moment in den Sechzigern oder Siebzigern zurück. Viele setzten auf alte Instrumente, alte Verstärker, alte Mischpulte. Ein Rockmusiker sagte sogar: «Ich verwende ausschließlich das, was ich zuvor schon gehört habe.» Ein Tonträger der White Stripes brachte den Hinweis: «No computers were used during the recording, mixing, or mastering of this record.» («Beim Aufnehmen, Mischen oder Mastern dieser Platte wurden keinerlei Computer eingesetzt.»)
Die ursprüngliche klassische Musik befindet sich in einem interessanten Schwebezustand. Sie hat die Chance, sich von den sozialen Klischees, die sie gegenwärtig definieren, zu befreien. Sie ist nicht mehr das einzige Genre, das die Last der Vergangenheit zu tragen hat. Gleichzeitig hat sie den Vorteil, sich ständig neu interpretieren, mit jeder Wiederholung runderneuern zu können. Die beste Art, klassische Musik zu spielen, besteht nicht in einem Rückzug in die Vergangenheit, sondern in einer Intensivierung der Gegenwart. Apostel der Klassik haben immer den Fehler gemacht, ihre Liebe zur Vergangenheit mit einer Ablehnung der Gegenwart zu verbinden. Die Musik hat aber anderes im Sinn: Sie hasst die Vergangenheit und will ihr entfliehen.
Das Merkwürdige an der klassischen Musik in Amerika ist heute, dass sehr viele von ihr wissen, sich dafür interessieren, vielleicht sogar tiefere Kenntnis besitzen, aber nicht ins Konzert gehen. Die Leute, die sich mit der Vermarktung von Orchestern beschäftigen, haben eine Bezeichnung für diese bedauerlichen Phantome: sie sind, um eine Formulierung aus der Zeitschrift Symphony zu zitieren, die «kulturbewussten Fernbleiber». Ich kenne diesen Typ Mensch; die meisten meiner Freunde sind Fallbeispiele. Sie kennen die wichtigen Namen und Perioden der Musikgeschichte: haben gelesen, was Nietzsche über Wagner geschrieben hat, können unter mehreren Musikstücken Strawinsky herauspicken, besitzen Glenn Goulds Goldberg Variations sowie etwas Mahler und vielleicht noch eine CD von Arvo Pärt. Sie verfolgen alle anderen Künste – gehen zu Vernissagen, lesen die neuesten Romane, sehen sich Arthouse-Filme an. Aber für ein klassisches Konzert haben sie noch nie Geld ausgegeben. Sie sind beinahe auch noch stolz auf ihre Ignoranz: «Ich habe keine Ahnung von Beethoven», verkünden sie, was sie garantiert nicht sagen würden, wenn Henry James oder Stanley Kubrick Thema wären. Es ist dies ein Bereich, in dem sich sogar gebildete Leute die antiintellektuelle Amerika-Flagge umhängen. Das ist aber nicht allein ihre Schuld: Jahrhunderte der klassischen Intoleranz haben zur Erschaffung des «kulturbewussten Fernbleibers» beigetragen. Wenn ich den Leuten sage, was ich beruflich mache, erzeugt das immer den gleichen Gesichtsausdruck – ein blinzelnder Blick zur Seite, als sei es meinem Gegenüber peinlich, über so etwas wie ein Cis nicht Bescheid zu wissen. Unmittelbar danach kommt das fröhliche Bekenntnis der Ignoranz. Der alte Kulturkampf ist ausgetragen und verloren, noch bevor ich überhaupt ein Wort gesagt habe.
Manchmal unternehme ich das Experiment, mich auf die andere Seite zu versetzen und mir vorzustellen, ich sei ein alternder Pop-Fan, der mal was Neues ausprobieren möchte. Ich kaufe also eine Platte, auf der Klemperer die Eroica dirigiert. Ich höre zwei mächtige, laute Akkorde und dann etwas, das der Begleittext als «wahrhaft heroisches» Thema bezeichnet. Es klingt etwas seicht, schlingernd, walzerartig. Meine Gedanken schweifen ab. Ein paar Tage später probiere ich es erneut. Jetzt höre ich eine attraktiv-adoleszente Grandezza mit ein paar barbarischen Akzenten. Der Rest ist mechanisch, verhalten. Aber bei jeder Wiederholung erkenne ich mehr von dieser imaginierten Welt. Ich erfinde Geschichten für das, was da passiert. Gewaltige Akkorde, der Held steht hinter der Bühne, ein quälender Gedanke, der Held redet über Lautsprecher, ein paar Songideen, aus denen nichts wird, ein Mann oder eine Frau am Flehen, der Held schreit zurück, Spannung, Wut, Verschwörungen – ein Mordversuch? Die nervöse Pracht des Ganzen geht mir unter die Haut. Ich marschiere ins Buchgeschäft und betrachte das Klassik-Regal, das mehr Ratgeber für Idioten und Dummies enthält als jede andere Abteilung hier. Ich lese das entsprechende Kapitel in Bernsteins Von der unendlichen Vielfalt der Musik, erfreue mich an Geschichten, wie der Komponist sich brüllend über Napoleon äußert, und höre die Sinfonie erneut an. Nach dem zehnten Anhören wird die Musik meine eigene; ich weiß, was hinter jeder Ecke kommt, und bin glücklich darüber. Es ist, als könnte ich die Nachrichten vorhersagen.
Jetzt bin ich Fan genug, also kaufe ich mir für 25 Dollar ein Ticket, um ein berühmtes Orchester die Eroica spielen zu hören. Das Erlebnis ist nicht sehr heroisch. Kaum betrete ich den Saal, ist Schluss mit der Begeisterung. Meine schwarzen Jeans sorgen für verächtliche Blicke bei Männern, die alle den gleichen Anzug wie Johnny Carson tragen. Argwöhnisch betrachte ich die zwanzig Beige-Töne, in denen der Saal gehalten ist. Die Musik beginnt mit den gebieterischen Akkorden, die sagen: «Listen to this – aufgepasst!» Nur kann ich mich nicht wirklich auf Beethovens Abscheu vor der Tyrannei über den menschlichen Geist einlassen, wenn der Herr neben mir wie mein Zahnarzt aussieht. Die Mordszene im ersten Satz ist weniger aufregend, wenn die Gesichter der Musiker ausdruckslos sind. Ich muss husten; ein dünner Mann, der in einer mit Eselsohren versehenen Partitur mitliest, schaut zu mir her. Etwa eine Minute vor dem Satz-Ende tappert eine alte Frau den Gang entlang Richtung Tür – in ihrem Gesicht höchste Unzufriedenheit, ein paar Schritte hinter ihr ein Ehemann mit unbewegter Miene. Dann die drei gewaltigen, abschließenden Akkorde, ganz offensichtlich dazu da, tosenden Beifall auszulösen. Ich fange an zu klatschen, aber der Mann mit der Partitur sieht schon wieder her. Man klatscht nicht mitten in der großartig bedeutend-bedeutungsvollen Musik, auch wenn der Komponist das quasi fordert! Hüstelnd, herumrutschend, flüsternd unterdrückt das Publikum den Wunsch, sein Gefallen zu bekunden. Es ist, frei nach Freud, wie ein «kollektives anales Verhalten». Der langsame Trott des Begräbnismarsches, oder wie alle unbedingt sagen wollen: der Marcia funebre, beginnt. Mir kommt es vor, als würde sich mein neuentdeckter Respekt vor der Musik hinter dem Leichenwagen herschleppen.
Aber ich bleibe dabei. Für die Dauer der Marcia versuche ich, nicht auf das Publikum zu achten und mich nur auf die Musik zu konzentrieren. Fast schon schockierend ist, dass alles, was ich höre, vollkommen natürlich entsteht und die gesammelten Schwingungen diverser alter Instrumente in einem schachtelartigen Saal herumschwirren. Jedes Kratzen eines Bogens verwandelt sich in einen gestrichenen Ton; was ich sehe, ist gleichzeitig das, was ich höre. Als die Celli und Bässe in der Mitte des Marschs mit ihrem fetten, tiefen Klang den Boden erzittern lassen (was Bernstein als «Wums!» bezeichnet), ist die Wirkung der Stelle rein körperlich. Verstärker sind etwas für Feiglinge, denke ich. Das Orchester spielt nicht mit der gleichen, einschüchternden Gewalt wie Klemperers Helden, aber der Klang ist wärmer, satter und ausgewogener als auf der CD. Ich mache meinen Frieden mit der Steifheit der Szenerie, indem ich sie als kühlen Rahmen für eine heiße Aktion nehme. Vielleicht muss das so sein: Beethoven braucht als Folie ein passives Publikum. Zu meiner Linken ein schlafender Zahnarzt; rechter Hand ein indignierter Ästhet; und vor mir der Begräbnismarsch, der zu einer fugalen Raserei anschwillt, dann in leise schluchzende Erinnerungen an Themen zerfällt und Platz für eine vollkommen neue Stimmung macht – vehement, lachend, torkelnd, leicht betrunken.
Vor zweihundert Jahren beugte sich Beethoven über sein Manuskript der Eroica und eliminierte Napoleons Namen. Immer wieder hieß es, er hätte sich selbst zum Protagonisten seines Werks gemacht. Tatsächlich verkörperte er einen Archetypus – den rebellischen Künstlerhelden –, auf den moderne Kunstschaffende bis heute gern zurückgreifen. Nur frage ich mich, ob Beethovens Geste wirklich das meinte, was alle denken. Vielleicht befreite er seine Musik auch nur von einer allzu spezifischen Interpretation, von seiner persönlichen Voreingenommenheit. Er gab seine Sinfonie frei, ließ sie treiben wie eine Flaschenpost. Er hätte sich schwerlich vorstellen können, dass sie zweihundert Jahre unterwegs sein würde, durch das dunkle Herz des 20. Jahrhunderts hindurch und mitten hinein ins pulverisierende Elektronikzeitalter. Aber er wusste, dass sie weit kommen würde, und beschwerte sie nicht. Es gab jetzt eine zerrissene, leere Stelle auf dem Deckblatt. Die Sinfonie wurde ein fragmentarisches, unvollendetes Ding, und das ist sie auch heute noch. Ganz wird sie nur im Kopf und in der Seele von jemand, der sie zum ersten Mal hört – und ab da immer wieder.
2.Chaconne, Lamento, Walking Blues: Basslinien der Musikgeschichte
Zu Beginn des 17. Jahrhunderts – das spanische Weltreich erreichte gerade den Gipfel seiner Macht – herrschte größte Begeisterung für einen fast schon erotisch quirligen Tanz, der jeden, der ihn hörte, in den Bann schlug: die Chacona. Niemand weiß genau, woher er kam, aber verstreute Hinweise lassen vermuten, dass er aus den spanischen Kolonien in der Neuen Welt stammt. Im Jahr 1598 führte Mateo Rosas de Oquendo, ein Soldat und Höfling, der sich zehn Jahre in Peru aufgehalten hat, die Chacona in einer Liste mit an, die regionale Tänze und Airs (Lieder) mit «nombres que el demonio a puesto» («Bezeichnungen, die der Teufel erfunden hat») verzeichnet. Niemand aus Fleisch und Blut, schrieb Oquendo, könne diesen Klängen widerstehen, weshalb das Gesetz jeden daraus entstehenden Ärger ignorieren sollte. Der Teufel leistete ganze Arbeit: Die Chaconne ist geradezu ideal dafür, die Sinne zu betören. Sie hat einen Dreierrhythmus, wobei der zweite Schlag betont ist und einen Hüftschwung provoziert. Die Musiker einer Chacona-Gruppe legen ein Ostinato zugrunde – ein Motiv, eine Basslinie oder eine Akkordfolge, mit ständiger Wiederholung. («Ostinato» ist das italienische Wort für «hartnäckig, eigensinnig.») Andere Instrumente fügen Variationen hinzu, je wilder, desto besser. Außerdem tritt eine Sängerin oder ein Sänger vor und erzählt anrüchige Geschichten von la vida bona, dem «guten Leben». Das Resultat ist ein kleiner Klang-Tornado, der sich wirbelnd seinen Weg bahnt. Wenn ein Ensemble für Alte Musik diese Form rekonstruiert – der katalanische Gambist Jordi Savall macht mit seiner Gruppe Hespèrion XXI immer wieder Chaconne-Improvisationen –, dann verschmelzen die Jahrhunderte, und moderne Füße bewegen sich zu einer uralten Melodie.
Die Spätrenaissance brachte etliche solcher Ostinato-Tänze hervor – den Passamezzo, die Bergamasca, die Sarabande, die Folia –, aber die Chaconne erlangte besondere Berühmtheit. Die Autoren des goldenen spanischen Zeitalters rühmten ihren so exotischen wie zweifelhaften Ruf: Für Lope de Vega war der Tanz eine «Vieja», die «eine Alte, die aus Westindien per Post nach Sevilla gekommen ist». In Cervantes’ Novelle La ilustre fregona (Die vornehme Küchenmagd), veröffentlicht im Jahr 1613, gibt es eine Szene, in der sich ein junger Adliger als Wasserträger ausgibt und in einer Taverne die Dienstmädchen und jungen Eseltreiber mit einer Chaconne unterhält. Er singt:
Entren, pues, todas las ninfas
Es mögen also alle Nymphen und Faune hereinkommen,
y ninfos que han de entrar,
die hereinkommen müssen,
que el bayle de la chacona
weil der Tanz der Chacona
es más ancho que la mar.
ist viel weiter als der Ozean.
Chacona-Texte haben oft das chaotische Wesen des Tanzes zum Inhalt – seine Fähigkeit, festgefügte Verhältnisse zu stören und Schranken niederzureißen. Diebe benutzen sie, um ihre Opfer zu täuschen. Könige begeben sich auf die Stufe ihrer Untertanen. Als ein Totengräber bei einer Beerdigung statt «Requiem» versehentlich «Vida bona» sagt, fangen alle an, im bekannten Rhythmus zu tanzen – wie es heißt, sogar die Leiche. «Un sarao de la chacona», ein Lied des spanischen Musikers Juan Arañes, zeichnet dieses quirlige Tableau:
Porque se casó Almadán se hizo un bravo sarao,
Denn Almadán hat einen wilden Tanzabend organisiert,
dançaron hijas de Anao con los nietos de Milán.
es tanzen Anaos Töchter mit den Enkeln Miláns.
Un suegro de Don Beltrán
Ein Schwiegervater von Don Beltrán
y una cuñada de Orfeo
und eine Schwägerin des Orpheus
començaron un guineo
begannen mit einer Guineo
y acabólo un amaçona
und beendeten mit einer Amaçona,
y la fama lo pregona.
und der Ruhm verkündet es.
A la vida, vidita bona,
Zum Leben, zum guten Leben,
vida vámanos a Chacona.
zum Leben – gehen wir zur Chacona.
Es folgt eine surreale Parade der Hochzeitsgäste: Ein Blinder pikst mit seinem Stock die Mädchen, ein afrikanischer Heide singt mit einer Zigeunerin, ein Arzt trägt Kochgeschirr um den Hals. Säufer, Diebe, Ehebrecher, Raufbolde sowie Männer und Frauen zweifelhaften Rufs vervollständigen die Szenerie.
König Philipp II., der gestrenge Herrscher des spanischen Weltreichs, starb 1598, also etwa zu der Zeit, in der es in Peru erste Zeugnisse der Chacona gab. In den letzten Monaten seiner Herrschaft wurde Philip auf unmoralische Tänze in Madrid aufmerksam; von kirchlicher Seite kam die Klage, die Frivolität, die in der Stadt um sich griff, würde an die Dekadenz des römischen Imperiums erinnern. Diese Diskussion setzte sich auch nach Philips Tod fort. 1615 verbannten die königlichen Ratsherren die Chacona, die Sarabande und andere Tänze, die man als «lasciva», «deshonesta» oder «malsonante» bezeichnete, aus den öffentlichen Theatern. In Wahrheit hatte die Obrigkeit von diesen unanständigen Liedchen nichts zu befürchten. So umstürzlerisch sie sich gerieren, stellen sie die etablierte Ordnung keineswegs in Frage. Die umherstreifenden Adligen in Cervantes’ Geschichte nehmen schlussendlich ihre angemessene Rolle ein; die Figuren in «Un sarao de la chacona» sind tags darauf wieder an ihrem gewohnten Platz. Es ist kein Zufall, dass Arañes seine Liedersammlung dem spanischen Botschafter beim Heiligen Stuhl widmete. Höfische Kreise hatten keinerlei Probleme damit, sich die Chacona anzueignen – die rasch zu einer eigenständigen, seriösen Musikform in dem wurde, was wir heute «Klassik» nennen.
Ab da durchzieht die Geschichte der Chacona vier Jahrhunderte der westlichen Kultur. Nachdem die anfängliche Mode abgeflaut war, beschäftigten sich die Komponisten mit den verborgenen Möglichkeiten dieses Tanzes, der eine simple Idee mit den raffiniertesten Variationen kombiniert. Er gelangte in italienische, französische, deutsche und englische Hände und erhielt dabei die Maske geheimnisvoller Virtuosität, aristokratischer Eleganz, in Moll gehaltener Nachdenklichkeit oder zuversichtlichen Begehrens. Ludwig XIV., dessen Weltreich das von Philip in den Schatten stellte, tanzte am Hof von Versailles «la chaconne»; in der Moderne verwendete man dann weitgehend diese französische Bezeichnung. Johann Sebastian Bach komponierte eine Chaconne (in seiner zweiten Partita für Solovioline), die fast schon schockierend komplex ist und die Form als solche kaum mehr erkennen lässt. In Klassik und Romantik kam die Chaconne aus der Mode, aber angesichts der Schrecken des 20. Jahrhunderts griffen die Komponisten wieder auf sie zurück, wobei man sie eher mit der Ernsthaftigkeit Bachs in Verbindung brachte – und nicht mit der Überschwänglichkeit ihrer Urform. Auch in den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Chaconne weiterentwickelt. 1978 komponierte György Ligeti, ein Avantgardist mit weit zurückreichendem Musikgedächtnis, das Cembalowerk Hungarian Rock (Chaconne), das den spanischen Tanzrhythmus wiederaufleben ließ und ihn um Boogie-Woogie-Elemente bereicherte.
Die weitläufige Karriere der Chaconne kreuzt sich immer wieder mit der einer anderen Ostinatofigur, nämlich der das basso lamento. Dabei handelt es sich um eine wiederkehrende Basslinie, die über das Intervall einer Quarte hinweg absteigt, sei es über die Stufen einer Molltonart (man denke an das Pianomotiv in «Hit the Road Jack» von Ray Charles) oder über eine chromatische Abfolge (man denke an das «Crucifixus» der Bach’schen h-Moll-Messe oder, so einem das lieber ist, an Bob Dylans «Simple Twist of Fate»):
Wenn die Chaconne etwas Merkurhaftes hat, indem bei ihrer Reise durch Raum und Zeit radikal die Bedeutung geändert wird, dann bringen diese Motive des Weinens oder Verlangens eine grundlegende Kontinuität in der Musikgeschichte zum Vorschein. Sie scheinen geradezu einen tieferen Sinn zu beinhalten, ganz als seien sie Fragmente eines musikalischen DNA-Strangs.
Die Theoretiker versichern uns, dass die Musik eine nicht-referentielle Kunst ist, dass ihre affektive Wirkung auf außermusikalischen Assoziationen beruht. Tatsächlich kann eine Veränderung der Variablen eine anrüchige Chaconne in ein tödliches Lamento verwandeln. In diesem Medium ist nichts festgelegt. «Musik ist von sich aus nicht in der Lage, etwas auszudrücken», sagte Strawinsky einmal, um sentimentale Interpretationen abzuwehren. Aber als er die Eingangsklage seines Balletts Orpheus komponierte, griff er zu ebenjener über vier Töne absteigenden Figur, die seit mindestens eintausend Jahren Trauer ausgedrückt hat.
Die Volksliedklage
Über die Jahrtausende hinweg haben gelehrte Menschen versucht, eine Grammatik der musikalischen Bedeutung herauszuarbeiten. Die alten Griechen glaubten, ihr Skalensystem stünde im Zusammenhang mit unterschiedlichen Gefühlslagen. Bei den indischen Ragas gibt es die Kategorien Hasya (Freude), Karuna (Trauer), Raudra (Ärger) und Shanta (Friede). In der europäischen Musik gelten Musikstücke in Dur als fröhlich gestimmt, solche in Moll eher als traurig. Obwohl diese Unterscheidung einer näheren Betrachtung nicht durchweg standhält – Beethovens Fünfte entzieht sich etwa mit ihrem muskulösen c-Moll einer dahingehenden Kategorisierung –, können wir doch meist überraschend gut sagen, wie ein unbekanntes Musikstück zu