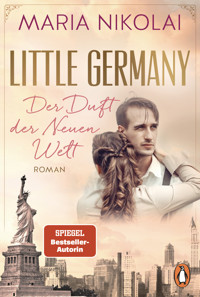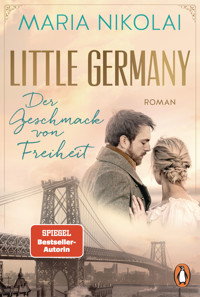
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Bäckerinnen von Manhattan
- Sprache: Deutsch
Das Schicksal zweier Frauen. Zwei Entscheidungen, die alles verändern. Die neue Saga von Bestsellerautorin Maria Nikolai – basierend auf wahren Ereignissen
Little Germany, Manhattan, 1904: Eine verheerende Katastrophe hat das deutsche Viertel in Schockstarre versetzt. Trotz des schweren Schicksalsschlags, der auch sie getroffen hat, kämpfen Lissi und Julia weiter für ihre Bäckerei und ihr persönliches Glück. Doch bald schon zeichnet sich ab, dass Little Germany nie mehr die Heimat sein wird, zu der es für sie geworden war. Noch einmal müssen die beiden jungen Frauen von vorn beginnen – und eröffnen »Lissi's Kleine Konditorei« auf der 86th Street in Yorkville. Wie ein aufstrebender Stern am German Broadway erobert die schwäbische Confiserie schnell die Herzen aller. Währenddessen müssen sich Julia und Lissi ihrer Vergangenheit stellen, denn zwei Männer aus ihrem alten Leben treiben sie nicht nur in ein Gefühlschaos, sondern stellen auch ihre Zukunft infrage. Zur selben Zeit beginnt der Prozess gegen die Verantwortlichen der Tragödie auf dem East River …
Unnachahmlich und mitten in die Herzen der Leser*innen schreibt sich Bestsellerautorin Maria Nikolai mit ihrer neuesten Auswanderersaga »Little Germany«. Gleichermaßen gefühlvoll wie abenteuerlich porträtiert sie das historische »Deutschländle« mit all seinem unwiderstehlichen Charme zu Anfang des 20. Jahrhunderts. Durch ihre brillante Recherche fördert sie bezaubernde Details aus dem alten New York zutage und lässt Sie staunend zurück.
*** Entdecken Sie noch mehr Lesegenuss von Maria Nikolai mit ihren Bestseller-Sagas:
»Die Schokoladenvilla« (1)
»Die Schokoladenvilla. Goldene Jahre« (2)
»Die Schokoladenvilla. Zeit des Schicksals« (3)
»Töchter der Hoffnung. Die Bodensee-Saga« (1)
»Töchter des Glücks. Die Bodensee-Saga« (2)
»Töchter eines neuen Morgens. Die Bodensee-Saga« (3)
*** Zum Wegträumen schön sind auch Maria Nikolais Kinofeeling-Events. Infos unter www.marianikolai.de.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Maria Nikolai liebt historische Stoffe und zarte Liebesgeschichten. Mit Die Schokoladenvilla schrieb sie sich in die Herzen der Leser*innen: Die opulente Historie rund um eine Stuttgarter Schokoladenfabrikantenfamilie stand monatelang auf der Bestsellerliste und verkaufte sich fast eine halbe Million Mal. Mit ihrer zweiten spannenden Bestsellertrilogie entführte Maria Nikolai ihre Fans an den Bodensee zu Ende des Ersten Weltkriegs. Ihr aktueller Zweiteiler Little Germany erzählt von zwei jungen Frauen, die mit Mut und Abenteuerlust den Aufbruch in die Neue Welt wagen. Dies ist der zweite Band der Dilogie.
Begeisterte Stimmen zu Maria Nikolais Büchern:
»Ganz großes Kino!«
Nürtinger Zeitung über Little Germany. Der Duft der Neuen Welt
»Maria Nikolai hat ein feines Händchen für allerfeinsten Herzschmerz, für Geschichten zum Dahinschmelzen.«
Reutlinger General-Anzeiger
»Spannend, vielschichtig, einladend – eine Saga, die viel verspricht und noch mehr hält!«
Denglers-Buchkritik über die Bodensee-Saga
»Ein richtig schöner Sofaschmöker.«
SWR über Die Schokoladenvilla
Außerdem von Maria Nikolai lieferbar:
Die Schokoladenvilla
Die Schokoladenvilla. Goldene Jahre
Die Schokoladenvilla. Zeit des Schicksals
Töchter der Hoffnung. Die Bodensee-Saga
Töchter des Glücks. Die Bodensee-Saga
Töchter eines neuen Morgens. Die Bodensee-Saga
Little Germany. Der Duft der Neuen Welt
www.penguin-verlag.de
Maria Nikolai
Little Germany
Der Geschmack von Freiheit
ROMAN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2025 der Originalausgabe by Penguin Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Redaktion: Ulrike Strerath-Bolz
Karte: © Peter Palm, Berlin
Umschlaggestaltung: Favoritbuero
Umschlagabbildungen: Shutterstock (Everett Collection, icemanphotos, NATALIA-PZ); Trevillion Images (Rachael Fraser)
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-31941-0V001
www.penguin-verlag.de
Amazing grace, how sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost, but now am found
Was blind, but now I see
Text: John Newton
Erster TeilAmazing Grace
1. Kapitel
North Brother Island im East River, New York, 15. Juni 1904, halb zehn Uhr abends
Frederick konnte nichts mehr tun. Abgekämpft stand er im Gras, lehnte sich an den Stamm eines Baumes und ließ seine müden Augen über das zu einem Sandstrand abfallende Ostufer von North Brother Island schweifen. Acht Bogenlampen, die bei Einbruch der Dunkelheit von der Metropolitan Street Railway Company aufgestellt worden waren, warfen ein bläuliches Licht über das Gestade, an dem keine zwölf Stunden zuvor die lichterloh brennende General Slocum gestrandet war. Ein Anblick, den Frederick nie mehr vergessen würde.
Draußen auf dem East River zogen noch immer Schlepper und Barkassen ihre Bahnen, strichen die Suchscheinwerfer der Patrouillenboote über das dunkle Wasser, auf der Suche nach Vermissten. Sie würden niemanden mehr retten. Nur noch bergen.
Es war ein Wettlauf gegen die Zeit gewesen.
Frederick wusste nicht, wie viele er an Land gebracht hatte. Zunächst gemeinsam mit den Besatzungen anderer Boote, später Hand in Hand mit den Ärzten, Schwestern und sogar einzelnen Patienten des Quarantäne-Hospitals auf der Insel. Manche von ihnen hatten lange, schwere Leitern herangeschleppt, um sie den Ertrinkenden entgegenzuschieben, manche sich selbst ins trübe, überhitzte Wasser des East River gestürzt und damit ihr eigenes Leben riskiert. Andere hatten sich um die Überlebenden gekümmert – und um die Toten.
Frederick stieß sich vom Baum ab.
Nun, da die beinahe übermenschliche Kraft nachließ, die ihn während der vergangenen Stunden angetrieben hatte, kam ein unerträgliches Sehnen auf. Er musste weg von hier, zurück ins Hotel und sich um Julia kümmern, hätte es längst tun sollen. Auch wenn sie auf den ersten Blick nur leicht verletzt gewesen war, wurde ihm auf einmal bewusst, sie mit ihrem Leid, ihrem Schmerz und dem Grauen dessen, was sie durchgemacht hatte, allein gelassen zu haben.
Nach wenigen Schritten hielt er erschöpft inne. Zugleich standen ihm die Momente vor Augen, da er mit einem kleinen Holzboot zur Slocum gerudert war, aus der meterhoch die Flammen schlugen. Ein unerklärlicher Instinkt hatte ihn die Stelle finden lassen, an der Julia in diesem Moment über die Reling kletterte. Den Blick unaufhörlich auf sie gerichtet, war er mit seinem Kahn längsseits gegangen, hatte ihr zugeredet. Hatte sie aufgefangen.
Er senkte den Kopf, fuhr sich mit beiden Händen über das Gesicht. Merkte, dass er weinte. Sie war die Erste gewesen, die er gerettet hatte. Die Tatsache, dass weitere Passagiere überlebt hatten, weil er Julia in sein Hotel hatte bringen lassen und selbst zur brennenden Slocum zurückgerudert war, milderte seine Schuldgefühle kaum.
»Ich versichere Ihnen: Das ist das schlimmste Unglück, das diese Stadt je gesehen hat«, sagte jemand in seine Gedanken hinein. »Und es gab schon einige.«
Frederick richtete sich auf und wischte die Tränen ab.
Ein Mann mit tropfnassen Schwimmwesten auf dem Arm stand neben ihm. Frederick erkannte ihn als Coroner William O’Gorman, einen der Rechtsmediziner, die mit den Polizisten und Feuerwehrleuten schon kurz nach dem Unglück nach North Brother Island gebracht worden waren.
»Eine …« Frederick hustete. »Eine Apokalypse.«
»Wohl wahr. Bis jetzt sind wir bei über fünfhundert Toten. Aber es steht zu befürchten, dass es noch viel mehr werden.« O’Gorman legte den Ballen aus Segeltuch und Kork auf dem Boden ab und stieß verächtlich mit einem Fuß dagegen. »Die Dinger waren nicht nur unbrauchbar. Sie waren tödlich.«
»Das habe ich gesehen«, antwortete Frederick, der durch seine engen Geschäftskontakte zu englischen Pferdezüchtern recht gut Englisch sprach. »Die Hüllen waren gerissen. Das Innere ist herausgequollen …«
»Schlimmer«, unterbrach ihn der Coroner. »Der Kork, der die Leute hätte tragen sollen, war buchstäblich pulverisiert. Kommt das kaputte Material dann mit Wasser in Kontakt, saugt es sich blitzschnell voll. Hab so ein Bleigewicht um den Leib – es zieht dich nach unten. Nicht einmal gute Schwimmer haben dann eine Chance.« Er schüttelte den Kopf. »Und der Zustand der Westen ist ja längst nicht alles! Die Versäumnisse im Hinblick auf die Sicherheit an Bord der Slocum sind eine Schande.«
»Mir ist im Laufe des Tages mehrmals zu Ohren gekommen, dass das Schiff wie ein Pappkarton in Flammen aufgegangen sei«, erwiderte Frederick. »Die Mannschaft hat angeblich weder den Brand bekämpft noch sich um die Rettung der Passagiere gekümmert. Das ist mir völlig unverständlich.«
»Ihre eigene Haut – die haben sie gerettet.« Der Coroner machte keinen Versuch, seine Wut zu verbergen. »Und dann hatten sie noch die Stirn, uns Märchen von ihrem heldenhaften Kampf gegen das Feuer zu erzählen. Nichts haben sie gemacht. Feige waren sie.«
»Ich dachte immer, dass es in der Seefahrt so etwas wie einen Ehrenkodex gibt.« Frederick rieb mit dem Handrücken über seine Stirn. »Und dass die Besatzung als letztes von Bord geht.«
»Offenbar hat die Besatzung der Slocum das anders gesehen.« O’Gorman langte in die Innentasche seines Jacketts und holte eine zerdrückte Zigarettenpackung heraus. »Allein das, was die Taucher bisher aus dem Wrack geborgen haben, spricht Bände. Oder wie erklärt man sich, dass das Ventil eines Standrohres fest verschlossen war, wo es doch Wasser zu den Löschstationen hätte leiten sollen?« Er bot Frederick eine Zigarette an.
»Das hört sich so an, als ob nicht einmal der Versuch unternommen wurde, die Flammen einzudämmen.« Frederick ließ sich Feuer geben.
Der Coroner fächelte mit dem Zündholz, sodass es erlosch. »Wäre dem Brand angemessen begegnet worden, hätte er ohne Schwierigkeiten beherrscht werden können. Das steht fest.«
Frederick stutzte. »Sie meinen, es wäre ein Leichtes gewesen, diese Katastrophe zu verhindern?«
»Ein Leichtes vielleicht nicht.« Der Coroner nahm einen knisternden Zug von seiner Zigarette. »Aber eine erfahrene und geübte Besatzung hätte die Herausforderung bewältigen müssen.«
Frederick dachte an die Feuerfontänen und dicken Rauchwolken, die zuletzt aus dem Rumpf des Dampfers geschossen waren, hatte noch einmal den Moment vor Augen, als der Flaggenmast zitternd und ächzend in sich zusammengebrochen war, erinnerte sich an die unheimliche Stille danach, in der nur noch das Prasseln des brennenden Schiffs zu hören gewesen war.
»Die Slocum ist nördlich von hier gesunken, vor dem Ufer von Hunts Point«, sagte der Coroner, als habe er Fredericks Gedanken gelesen. »Ich war vor ein paar Stunden mit anderen Verantwortlichen dort. Das viele Löschwasser hat ihr den Rest gegeben. Jetzt ragt nur noch ein Gerippe mit Schornsteinen und Schaufelrädern aus dem Wasser.«
Frederick nickte und zog an seiner Zigarette. Er hatte gesehen, wie das brennende Wrack auf einmal abgetrieben war. Zwei Schlepper hatten es daraufhin an den Haken genommen und nordostwärts gezogen, damit es nicht führungslos auf dem East River schwamm und womöglich noch andere Schiffe gefährdete.
O’Gorman sah ihn prüfend an. Im Licht der Strahler wirkte sein Gesicht fahl. »Ich bin einiges gewöhnt, Mister …«
»Varell.«
»Mr. Varell.« Der Coroner atmete den Zigarettenrauch durch die Nase aus. »Das bringt mein Beruf mit sich. Aber was ich heute gesehen habe, bringt selbst mich an meine Grenzen. Genau genommen … hat es meine Grenzen gesprengt.«
Ein paar Wimpernschläge lang schwiegen sie, gedanklich vereint im Schrecken des Erlebten und dem Versuch, all die Bilder und Gefühle zu bewältigen, die dieser Tag ihnen aufgezwungen hatte.
Frederick sah zwei Schwimmer aus dem Wasser kommen. Jeder trug eine nasse, leblose Last. »Die Verantwortlichen werden doch sicher zur Rechenschaft gezogen?«
O’Gorman war seinem Blick gefolgt. »Sie können sicher sein, dass alle Behörden der Stadtregierung an einem Strang ziehen, um die Schuldigen vor Gericht zu stellen. Und da der Fisch bekanntlich vom Kopf zu stinken anfängt, machen wir auch vor denen nicht halt, die zu dieser Stunde in ihren weichen Sesseln sitzen und alle Hebel in Bewegung setzen, um ungeschoren davonzukommen. Allen voran die Knickerbocker Steamboat Company, der die Slocum gehört. Ihr Direktor hat in einer ersten Presseerklärung den Passagieren die Schuld an dem Unglück gegeben. Einer von ihnen habe ein Bananenbüschel auf dem Vorschiff abgelegt und mit trockenem Gras bedeckt. Das habe sich entzündet, und die nachfolgende Hysterie der vielen weiblichen Fahrgäste habe den Rest erledigt. Findet man da noch Worte?«
»Das wagt er? Im Angesicht dieser Tragödie?« Frederick konnte kaum glauben, was der Coroner erzählte. »Wie kann man nur so kaltblütig sein?«
»Man muss nicht lange suchen, um sie zu finden, die mächtigen Männer, denen Gewissenlosigkeit und Verderbtheit in den feinen Stoff ihrer Anzüge eingewebt wurden. Für sie zählt nur der Profit. Und Barnaby ist ein besonders schlimmes Exemplar. Deshalb müssen wir jede Meile dieser Fahrt nachvollziehen und jeden Zoll des Wracks untersuchen. Um nichts zu übersehen. Damit wir vor Gericht alle nötigen Beweise haben.«
»Dann wird es einen Prozess geben?«
»Dessen können Sie sicher sein.« Der Coroner warf seine abgerauchte Zigarette ins Gras und trat sie aus. »Sie sind aus Deutschland? Ich höre es an Ihrem Akzent.«
»Das ist richtig.« Frederick nahm einen letzten Zug. »Ich bin auf Besuch in der Stadt. Dass ich in diesem Moment hier stehe, ist reiner Zufall.«
O’Gorman legte ihm einen Arm um die Schultern. »Sie sind am Ende, Varell. Ich sehe es Ihnen an.«
Frederick nickte.
»Gehen Sie nach Hause. In ein paar Minuten legt ein Schlepper ab, der bringt Sie rüber zur Bronx.« Er deutete auf eine kompakte Schiffssilhouette, deren Lichter etwas abseits in die Dunkelheit leuchteten.
»Danke, Coroner.«
»Ich sage Danke.« O’Gorman klopfte ihm auf die Schulter. »Hätten wir doch nur mehr Menschen Ihres Schlages in New York. Vielleicht wäre die Stadt dann eine bessere.«
Die Bemerkung des Coroners gab Frederick ein Stück seiner Kraft zurück. Und während er sich auf den Weg zum Schlepper machte, gelang es ihm, durch den Vorhang der schrecklichen Szenen, die er von North Brother Island mitnahm, Dankbarkeit zu empfinden. Für jedes einzelne Leben, das er dem Inferno abgerungen hatte.
Und für das seiner Frau.
2. Kapitel
Das Fifth Avenue Hotel, etwa zur selben Zeit
Julia war voller Schmerz. Er lag als Glühen auf ihrer Haut, krallte sich in ihre Handflächen, brannte in ihre Seele. Vor ihren geschlossenen Augen züngelten orangerote Flammen, in ihren Ohren hallten noch immer Schreie und das unaufhörliche Tuten des Schiffshorns.
Wasser und Feuer. Feuer und Wasser.
Wie von fern drangen englische Sprachfetzen in den Aufruhr ihrer Gedanken.
»War sie auf der Slocum?«, fragte eine Frau.
»Ja«, erwiderte eine zweite, sehr junge weibliche Stimme.
»Ein entsetzliches Unglück.« Wieder die ältere.
»Offenbar ist sie nur leicht verletzt.« Kleiderstoff raschelte. »Sie ist schon untersucht worden. Der Arzt hat ihr etwas gegen die Schmerzen gegeben.«
»Hat sie den ganzen Nachmittag geschlafen?«
»Die meiste Zeit. Wenn sie zwischendurch aufgewacht ist, habe ich darauf geachtet, dass sie trinkt. Und wo die Haut gerötet war, habe ich vorsichtig mit feuchten Tüchern gekühlt.«
»Ich sehe sie mir gleich an.« Die Stimme der Älteren strahlte Kompetenz aus. »Die Hotelleitung hat mich angewiesen, über Nacht bei ihr zu bleiben.«
»Kennen Sie sich denn mit solchen Verletzungen aus?«
»Deshalb wurde ich benachrichtigt.« Etwas klapperte.
»Dann ist es gut. Ich weiß kaum was über Verbrennungen und hatte Angst, Fehler zu machen. Aber ich hab auch erst neu angefangen in der Schwesternschule.« Wieder das Rascheln von Kleidung. »Darf ich dann gehen?«
»Melde dich am besten gleich bei einem der nächsten Krankenhäuser. Die brauchen jede Hand.«
»Dann mach ich das. Auf Wiedersehen, Ma’am.« Eine Tür klackte.
Für einen Augenblick herrschte Stille im Raum.
Dann kam jemand näher. »Mrs. von Varell?«
Nur mit Mühe hob Julia die Lider.
»Sind Sie wach, Mrs. von Varell?«
Julia blinzelte so lange, bis sie nicht mehr verschwommen sah. »Ich, ich …« Sie hustete.
Sofort wurde vorsichtig ihr Kopf angehoben und ein Glas an ihre Lippen gesetzt. »Trinken Sie. In kleinen Schlucken.«
Julia gehorchte. Das kühle Wasser linderte den Hustenreiz. Nachdem das Glas geleert war, ließ sie sich zurück in die Kissen sinken.
»Mein Name ist Selma Blum.« Ein Paar freundlicher grauer Augen blickte sie an. »Der Direktor hat mich angefordert, damit ich bis auf Weiteres für Sie sorge. Wie fühlen Sie sich, Mrs. von Varell?«
Julia widerstand dem Drang, sofort wieder die Augen zu schließen. »Ich weiß es nicht.« Ihre Stimme klang rau. »Mir tut alles weh.«
Die Frau in blauer Schwesterntracht, Julia schätzte sie auf etwa sechzig Jahre, nickte. »Verständlich.« Sie stellte das Wasserglas auf den Nachttisch neben dem Bett. »Darf ich mich Ihres Zustands einmal selbst versichern? Brandverletzungen können tückisch sein.«
Julia wollte sich aufrichten, doch bereits beim Abstützen auf ihre Handflächen entfuhr ihr ein lautes Stöhnen.
»Bleiben Sie bitte liegen, Mrs. von Varell. Wenn Sie gestatten, decke ich Sie auf.«
Julia nickte.
Selma Blum schlug das seidene Laken zurück. Trotz aller Behutsamkeit, mit der ihr Körper bewegt wurde, presste Julia die Lippen zusammen, versuchte, den Schmerz zu unterdrücken, indem sie sich auf das geschwungene Muster des schweren Baldachins konzentrierte, der sich über das Doppelbett spannte.
»Sie haben einige Schutzengel gehabt«, sagte die Schwester schließlich und deckte Julia wieder zu. »Auch wenn es sich für Sie im Moment anders anfühlt, sollten die leichteren Verbrennungen bald abheilen. Dann lassen auch die Schmerzen nach. Darf ich noch einen Blick auf Ihre Handinnenseiten werfen?«
Julia hielt ihr die bandagierten Hände hin.
Selma Blum wickelte die Verbände ab und betrachtete die mit Brandblasen übersäte Haut. »Diese Verbrennungen sind ernster.«
»Ich habe mich an der Reling festgehalten.«
Selma Blum nickte. »Man sieht es am Verlauf.«
»Dann bin ich gesprungen.«
»Daher die Prellungen und Schürfwunden an der Hüfte. Ein Wunder, dass nichts gebrochen ist.«
Julia legte die Hände mit den Handflächen nach oben auf ein Tuch, das die Schwester ausgebreitet hatte. »Ich fühle mich … als befände ich mich auf einem anderen Planeten.«
»Das war ein schockierendes Erlebnis. Ihre Seele möchte es am liebsten ungeschehen machen.«
Julia sah zu, wie die Schwester ihre Brandwunden mit einer desinfizierenden Lösung behandelte. »Eigentlich wollten wir einen schönen Tag am Long Island Sound verbringen.« Ihre Kehle wurde eng. »Unsere Kirchengemeinde, St. Mark’s in Little Germany, hatte heute eigentlich ihren Jahresausflug – das Schiff wurde eigens dafür gechartert. Niemals hätte ich gedacht, dass … es so ein Ende nimmt.« Sie schluckte. »Wir hatten noch nicht lange abgelegt, es war vielleicht eine Viertelstunde vergangen, als sich auf einmal ein Feuer ausbreitete. Anfangs waren es Stichflammen. Dann raste es über die Decks. Es blieb keine Zeit, nachzudenken, es kam immer näher. Das war eine solche Hitze! Ich habe mich bis auf die Unterkleider ausgezogen, wollte springen, aber das Wasser war voller Menschen …« Sie schluckte wieder. »Ich kann schwimmen, Schwester, aber ich wusste nicht, ob dieser Pulk mich vielleicht unter Wasser zieht.«
»Das hätte durchaus passieren können.«
»Plötzlich war da das Boot. Es hat sich direkt unter die Stelle geschoben, an der ich hing. Und dann … habe ich die Reling losgelassen und bin auf die Planken gefallen.«
Die Schwester hielt inne. »Da hatten Sie doppeltes Glück. Der Sprung hätte tödlich enden können. Oder zumindest mit schlimmen Knochenbrüchen.«
»Darüber habe ich in dem Moment gar nicht nachgedacht. Ich hatte keine Wahl. Und Frederick … also Mister Varell … hat mir zugerufen, dass ich springen soll. Ich war mir sicher, dass es gut geht.«
»Mister … Varell? Von Varell? Ihr Ehemann?« Die Stimme der Schwester klang ungläubig. »Er hat Sie gerettet?«
»Ich habe keine Ahnung, woher er wusste, dass ich genau an dieser Stelle …« Julias Herz zog sich zusammen, als sie an den Moment dachte, da Frederick sie in die Arme geschlossen hatte. »Er hat mich an Land gebracht … und in eine Droschke gesetzt. Dann wollte er noch einmal zu dem brennenden Schiff zurück.« Sie stutzte und warf einen Blick auf die Uhr auf dem Kaminsims. »Es ist bald zehn Uhr. Müsste er nicht längst hier sein?«
Selma Blum tupfte vorsichtig eine hellgelbe Salbe auf die Wunden, wobei sie die intakten Brandblasen aussparte.
»Die Zeitungen schreiben, dass viele der Retter noch auf North Brother Island sind. Es waren ja über tausend Menschen auf dem Dampfer, wenn man den Berichten glauben darf. Bis alle versorgt sind, wird es sicherlich dauern.«
»Hoffentlich finden sie noch … viele.« Julia war, als würde sich ein Eisenring um ihre Brust legen. »Frauen und Kinder aus ganz Little Germany waren dabei, auch Familien. Wir waren so fröhlich.« Sie schluchzte trocken.
»Die ganze Stadt leidet mit den Betroffenen, das ist überall zu spüren.«
Julia hörte, was die Schwester sagte, ihre Gedanken aber wanderten bereits weiter. »Heute Morgen schien die Sonne«, fuhr sie fort. »Schon in der Frühe war ganz Little Germany auf den Beinen und hat sich auf den Weg zur 3rd Street Pier gemacht, wo der Dampfer lag.« Der Druck um ihre Brust verstärkte sich. »Und dann … Eine Kapelle hat gespielt, einige haben getanzt. Und die Kinder – sie waren so aufgeregt und glücklich …«
»Noch weiß man zu wenig.« Die Schwester schloss den Tiegel mit der Salbe. »Wir können nur hoffen, dass die meisten sich irgendwie retten konnten.«
Julia dachte an die vielen hilflosen Menschen, die sie im Feuer und im Wasser gesehen hatte. Wie viele Wunder hätte es gebraucht, um sie sicher an Land zu bringen?
Auf einmal erfasste sie eine starke innere Unruhe. »Ich muss nach Hause fahren«, sagte sie unvermittelt. »Die Tochter meiner Freundin und ihr Ehemann waren mit an Bord. Als ich gemerkt habe, wie gefährlich die Situation ist, habe ich nach ihnen gesucht, sie aber nicht gefunden …«
»Sie sollten sich dringend weiter ausruhen, Mrs. von Varell.« Selma Blum legte sorgsam Wundgaze auf Julias Handflächen. »Ich werde jemanden schicken, der sich erkundigt, einverstanden? Wie heißen die Angehörigen, die mit Ihnen auf der General Slocum waren?«
»Paul Steiner. Und das Kind heißt Aurelia. Sie ist erst zweieinhalb Jahre alt.« Julias Stimme versagte.
Die Schwester begann, Julias Hände zu verbinden. »Sie sollten etwas zu sich nehmen. Ich habe eine Suppe bestellt. Anschließend gebe ich Ihnen noch einmal etwas gegen die Schmerzen. Wie lautet die Adresse Ihrer Freundin?«
Julia dachte kurz nach. Angesichts der beunruhigenden Nachrichten war Lissi sicher bei Annedorle und Harry geblieben. »Die Anschrift ist 102 Avenue A. Dort befindet sich die Swabian Pretzel Bakery. Fragen Sie nach Lissi Steiner.« Sie kämpfte gegen ihre aufkeimende Panik an. Was, wenn Aurelia und Paul es nicht geschafft hatten? Wenn sie …
»Solange wir nicht sicher wissen, was mit ihnen geschehen ist, gehen wir davon aus, dass sie leben.« Selma Blum schien ihre Angst zu spüren. »Ich kümmere mich, Mrs. von Varell.«
3. Kapitel
Das Lebanon Hospital, Bronx, kurz zuvor
Seit um die Mittagszeit die ersten Verletzten des Schiffsunglücks auf dem East River eingeliefert worden waren, hatte Tobias Frey keinen Augenblick zum Durchatmen mehr gehabt. Gemeinsam mit den anderen Ärzten, Schwestern und Pflegern des Krankenhauses an der Ecke Westchester Avenue und 150th Street focht er seitdem einen harten Kampf um jedes einzelne Menschenleben. Die Verletzungen waren brutal, vieles hatte er in dieser Schwere noch nie gesehen. Das Hospital war hoffnungslos überfüllt, in den Zimmern stand Bett an Bett, unzählige Patienten lagen auf den Korridoren oder in Räumen, die sonst anderweitig verwendet wurden. Dazwischen irrten diejenigen umher, die ihre Angehörigen suchten. Auch wenn es die Arbeit des medizinischen Personals erschwerte, ließ man es zu. Es war eine Ausnahmesituation in einer Nacht voller Angst.
Er hetzte über die Flure in einen Nebenraum, wo eigentlich Laken und Verbandsmaterial lagerten. Dorthinein hatte er einen der Schwerstverletzten bringen lassen, um ihm nach einer so gut wie aussichtslosen Behandlung eine einigermaßen ruhige Umgebung für seine letzten Stunden zu ermöglichen. Doch nachdem er eingetreten war, blieb er zwischen den Wäschebergen stehen und rang auf einmal selbst um Fassung. Denn am Bett des Mannes, aus dem alles Leben gewichen war, saß eine Frau, die eine zärtliche Erinnerung auslöste. Sie umfing den Sterbenden mit beiden Armen und zitterte am ganzen Leib.
Im selben Moment merkte sie offenbar, dass sie nicht mehr allein war, und hob den Kopf. Rötlichblonde Strähnen hatten sich aus ihrem Haarknoten gelöst, Tränen rannen über ihre Wangen. Das Leid in ihren blaugrünen Augen erschütterte ihn bis ins Mark.
»Tobias?«, wisperte sie. »Tobias Frey?«
Er fing sie auf, bevor sie zu Boden glitt, und sein Herz fand mühelos den Weg zurück zu ihrer ersten Begegnung auf dem Dampfer von Bremerhaven nach New York. Zweieinhalb Jahre war das nun her. Auch damals war es ihr nicht gut gegangen. Sie hatte gerade ein Kind zur Welt gebracht …
Sein Blick fiel auf den Patient in dem schmalen Bett – Paul Steiner. Toby hatte den Namen selbst auf das Pappschild geschrieben, das am Fußende befestigt war. Zweifellos ihr Ehemann, er hatte den schmalen Goldring an ihrem Finger gesehen. Was für eine eigenartige Situation.
Seine Augen kehrten zu Lissis blassem Gesicht mit den feinen Sonnenflecken zurück, das an seiner Schulter lag. Auf einmal hatte er das Gefühl, sie so nicht halten zu dürfen, es war, als würde er in etwas Intimes eindringen. Vorsichtig setzte er sie am Rand des Bettes ab, wagte aber nicht, sie ganz loszulassen.
Es dauerte nur ein paar Sekunden, bis ihre Lider flatterten und ihr Rücken sich straffte. Er nahm seinen Arm von ihrer Schulter. »Geht es wieder?«
Sie sah ihn an, mit einer Mischung aus Verwirrung und Dankbarkeit, die nach wenigen Wimpernschlägen von Trauer und Distanziertheit verdrängt wurde.
Ohne ihm zu antworten, drehte sie sich zu ihrem Mann um, legte eine Hand auf seine Decke und betrachtete ihn lange. Paul Steiner war tot.
Tobias blieb neben ihr stehen. Auch wenn er dringend weitermusste, brachte er es nicht übers Herz, sie allein zu lassen.
»Warum dieses Schiff?«, flüsterte sie schließlich, nahezu unhörbar. »Warum … er?«
Was sollte er sagen im Angesicht dieses Leids, das in seinem Ausmaß selbst für ihn als Arzt alles sprengte, was er je gesehen hatte?
»Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde«, antwortete er gedämpft, »die wir nicht begreifen. Sie übersteigen alles Wissen, alle Erfahrung. Bleiben Sie so lange hier in diesem Raum, wie Sie möchten, Lissi, wir lassen Sie ungestört. In der Zwischenzeit werde ich alles Nötige veranlassen, damit Ihr Mann so schnell wie möglich nach Hause gebracht werden kann.«
Sie nickte.
»Sind Sie allein? Oder gibt es jemanden, den ich benachrichtigen kann?«
»Harry. Harry ist mitgekommen.« Nun blickte sie doch noch einmal zu ihm auf. »Mein Bäckergeselle. Er wartet vor dem Krankenhaus.«
Lissi hielt Pauls Hand und strich in langsamen Bewegungen über die kühle Haut. Sie sah ihn vor sich, wie er sich heute Morgen auf der East 3rd Street Pier von ihr verabschiedet hatte – einen liebevollen Blick in seinen dunklen Augen und ein fröhliches Lächeln um den Mund. Sie spürte seinen sanften letzten Kuss auf ihrer Wange, bevor er mit Julia und Aurelia an Bord gegangen war. Ihr tat die Ungeduld leid, mit der sie auf die Abfahrt des Ausflugsdampfers gewartet hatte, weil sie in der Bäckerei einen großen Auftrag für Alva Vanderbilt Belmont hatte vorbereiten müssen. Hätte sie geahnt, dass sein Winken vom Sturmdeck der General Slocum ein letzter Gruß sein würde …
Nächsten Monat wäre er zweiundvierzig Jahre alt geworden.
Auf einmal wurde sie unruhig.
Sie tastete nach seinen Armen, die unter der Decke lagen, ließ ihren Blick über seinen bandagierten Kopf gleiten. Schürfwunden zogen sich über Mund, Brauen und Kinn, Ruß und Blut auf seinem Gesicht waren nur notdürftig abgewischt. Was hatte er erlitten in diesen letzten Minuten? Was gedacht? War ihm bewusst gewesen, dass er sterben würde?
Die Enge in ihrem Herzen wurde unerträglich, doch es kamen keine Tränen mehr, die ihr hätten Erleichterung verschaffen können. Stattdessen fluteten unzählige Fragen ihren Kopf und verdrängten die schwarze Leere, die in den ersten Minuten nach Pauls Tod alles verdunkelt hatte. Als man ihn geborgen hatte, war er noch am Leben gewesen. Warum musste er sterben, wo er doch im Krankenhaus aufgenommen und versorgt worden war?
Tobias. Ihn könnte sie fragen.
Sie drehte sich um, aber das Zimmer war leer.
Lissi wurde kalt.
Dass ihr dieser Mann, für den sie noch lange nach ihrem Kennenlernen – damals, auf dem Überseeschiff nach New York – Gefühle gehegt hatte, ausgerechnet jetzt wiederbegegnete, war eine zynische Laune des Schicksals. Sie hatte soeben ihren Gefährten verloren, ihren Ehemann, dem sie so vieles verdankte. Den sie geliebt hatte, ohne es zu wissen und ohne je in ihn verliebt gewesen zu sein. Und dem sie nie wieder würde zeigen können, wie viel er ihr bedeutet hatte. Stattdessen musste sie ihr Entsetzen mit jemandem teilen, der eigentlich nicht hier sein sollte. Warum arbeitete er im Lebanon Hospital in New York, wo er damals doch vorgehabt hatte, nach Kalifornien weiterzureisen?
Ihr Inneres war ein Schlachtfeld. Zerfetzt alles, was ihr wichtig gewesen war, was Sicherheit bedeutet und den Rahmen ihres Lebens gebildet hatte.
Ihre Hände glitten von Pauls Decke. Sein Gesicht wirkte friedlich, es war nur schrecklich bleich.
Mühsam erhob sie sich.
Sie musste Tobias Frey suchen. Er war der Arzt. Er musste ihr Rede und Antwort stehen, ihr erklären, warum er Paul nicht mehr hatte helfen können.
Bereits nach ein paar Schritten wurde ihr wieder schwindelig. Mit beiden Händen stützte sie sich auf einem der überladenen Tische ab und versuchte, ruhiger zu atmen. Als der Raum sich nicht mehr drehte, setzte sie sich zurück an Pauls Seite. Sie hatte nicht die Kraft, durch das Krankenhaus zu laufen, um den Arzt zu suchen.
Im selben Moment klackte die Tür.
»Ich habe Ihnen jemanden mitgebracht.« Tobias Frey war zurück. Seine blonden, lockigen Haare, fiel Lissi nun auf, trug er inzwischen kürzer, der Vollbart war geblieben.
»Mrs. Steiner?« Harry trat neben Lissi, nahm seine Mütze ab und senkte den Kopf. »Ich hatte gehofft … Es … es tut mir … leid.« Der Bäckergeselle versuchte, ein Schluchzen zu unterdrücken.
»Ich habe einen Transport angefragt«, sagte Tobias Frey. »Voraussichtlich wird erst morgen früh ein Wagen zur Verfügung stehen. Aber ich stehe zu meinem Wort. Wenn Sie es wünschen, dann können Sie die Nacht über hierbleiben. Ich besorge Ihnen eine Droschke, sobald wir wissen, wann die Überführung stattfindet.«
Seine Fürsorglichkeit weckte in ihr den Wunsch, all ihren Schmerz loszulassen und sich ihm anzuvertrauen, so wie damals, als er sich nach Aurelias Geburt um sie gekümmert hatte. Sie versuchte, diese Regung wegzuschieben.
»Ich möchte gerne wissen, Doktor Frey …« Es fiel ihr schwer, die Fassung zu wahren. »… woran er gestorben ist.« Es war ihr unmöglich, zu der vertraulichen Anrede mit Vornamen zurückzukehren, die sie vor zweieinhalb Jahren gepflegt hatten. Nicht vor Harry.
Tobias trat ans Bett und warf ihr einen raschen Blick zu, so als wollte er sich davon überzeugen, dass sie in der Lage war, die Wahrheit zu verkraften. Dann sah er auf Paul. »Die Verbrennungen haben großflächig die Haut zerstört. In dem Ausmaß, wie ich es hier gesehen habe, wäre ein Überleben einem Wunder gleichgekommen. Dass es ihm so schnell so schlecht ging, lag zudem an einer massiven Vergiftung durch den Rauch. Es gibt Brandopfer, die allein an dieser Ursache versterben.«
»Musste er …« Sie schluckte. »Hat er sehr gelitten?«
»Nein. Bei Verbrennungen solchen Grades gibt es kein Schmerzempfinden mehr.«
Trotz der Klarheit seiner Worte empfand Lissi eine Spur Erleichterung.
»Dann … hatte er keine Chance? Es ist nichts versäumt worden?«
»Aus ärztlicher Sicht haben wir alles Menschenmögliche getan.« Die echte Anteilnahme in seinem Blick gab ihr Halt. »Der Rest lag in Gottes Hand.«
»In Gottes Hand …«, wiederholte sie leise.
4. Kapitel
Das Fifth Avenue Hotel, gegen Mitternacht
Nach dem Essen war Julia wieder in einen Dämmerschlaf gefallen. Im Traum stand sie neben ihrer Freundin Lissi an der Reling eines Auswandererschiffes, das über ein glutrotes Meer fuhr und schließlich das lichterloh brennende New York erreichte. Das Schiff ähnelte dem Ozeandampfer Kaiser Wilhelm der Große, mit dem sie vor zweieinhalb Jahren gemeinsam nach Amerika gekommen waren. In der Nähe der Freiheitsstatue – schwarz und verkohlt bis auf die golden leuchtende Fackel – gingen sie an einer kleinen grünen Insel vor Anker. Diese lag, von allen Gefahren verschont, vor dem Südzipfel Manhattans.
Auf einmal wechselte das Bild, und Julia träumte von ihrem Vater, den sie seit mehr als zwei Jahren nicht mehr gesehen hatte, von Achill, ihrem Hengst, der ihr Ein und Alles gewesen war, und von einem steinernen Herrenhaus. Sie stand auf dem Balkon und blickte auf einen weitläufigen Park, der eigenartigerweise tief verschneit zu ihren Füßen lag. Ein einsamer Wanderer stapfte durch den Schnee, rief immer wieder ihren Namen. Schließlich drehte er sich um, sah zu ihr hinauf, hob die Hand und machte ein Zeichen.
Frederick.
Was wollte er ihr sagen? Und was tat er bei diesem Wetter draußen? Er würde sich den Tod holen …
»Julia?«
Seine Stimme, tief und warm, weckte die Sehnsucht, sich darin einzuhüllen. Sie wollte zu ihm, doch während sie nach einem Weg nach unten suchte, löste sich die Szenerie in weißem Nebel auf.
Eine Berührung an der Schulter führte sie in die Wirklichkeit. »Du musst etwas trinken, Julia.«
Er war hier. Bei ihr.
Sie schlug die Augen auf, erfasste sein rußverschmiertes Gesicht mit dem dunklen Bartschatten, das zerzauste dunkle Haar, suchte seinen Blick. Erschöpfung stand in seinen Augen, deren ungewöhnliche Melange aus dunklem Grün und tiefem Braun ihr zum ersten Mal bewusst auffiel.
Obwohl er erbärmlich aussah und das weiße Hemd unter seiner grauen Weste vor Dreck starrte, lächelte er. »Die Schwester hat mir aufgetragen, für dich zu sorgen.«
»Frederick …« Sie hob den Arm, wollte ihre verbundene Hand an seine Wange legen.
Er fing ihren Arm ein und betrachtete das Weiß der Bandage. »Du musst auf deine Hände achtgeben.«
»Das heißt aber doch nicht, dass ich dich nicht berühren darf.«
»Nein. Das heißt es nicht.« Behutsam führte er ihre Hand an seine Schläfe.
»Ich bin so froh, dass du endlich da bist!«, brach es aus ihr heraus. »Ich habe mir Sorgen gemacht, dass dir beim Helfen etwas zustößt.«
»Ich habe auf mich achtgegeben. Ich wollte ja zu dir zurückkommen.«
Er legte ihre Hand vorsichtig auf das Laken zurück, dann schob er seinen Arm unter ihren Rücken. »Du musst trinken.«
Julia nickte und ließ sich von ihm aufhelfen. Während er nach dem Glas auf dem Nachttisch langte, hielt sie die Decke gegen ihre Brust gedrückt und schob die Füße über den Rand des Bettes.
»Ich glaube nicht, dass du aufstehen solltest«, protestierte er sofort.
»Aber ich muss aufstehen. Ich habe ein … Bedürfnis, das keinen Aufschub duldet.«
Er verstand sofort und stellte das Glas zurück. »Ich hole die Schwester.«
»Ich möchte aber keine Bettpfanne untergeschoben bekommen.«
»Aber wie … soll es denn sonst gehen?«
Angesichts seiner Ratlosigkeit musste Julia lachen. »Du hilfst mir bis ins Badezimmer und setzt mich auf … nun ja, du weißt schon.«
»Auch wenn dein Wille mir Befehl ist«, gab er halb scherzhaft, halb verzweifelt zurück, »weiß ich nicht, ob du den Weg schaffst.«
»Wenn nicht, darfst du mich auffangen.«
»Aber wenn ich dich irgendwo anfasse, könnte es wehtun.«
»Das Risiko muss ich eingehen.« Auch wenn die Arznei, die man ihr gegeben hatte, nicht alle Schmerzen wegnahm, traute sie sich die kurze Strecke zu. Seit Frederick bei ihr war, ging es ihr ohnehin deutlich besser. Es war, als hätte er ihre Lebensgeister geweckt – auch wenn der eine oder andere unter ihnen noch ein bisschen matt war.
»Könntest du mir mit einem Morgenmantel aushelfen, Frederick? Ich habe … nichts an.«
Zwanzig Minuten später lag sie wieder im Bett. Der kleine Ausflug hatte sie mehr angestrengt, als sie zugeben mochte. Dankbar trank sie von dem Wasser, das Frederick an ihre Lippen hielt, zugleich merkte sie, wie die Müdigkeit zurückkehrte.
»Schlaf, Julia.« Er strich ihr eine Haarsträhne aus dem Gesicht. »Ich kümmere mich um ein zweites Zimmer. Wir sehen uns morgen. Darf ich dir zum Frühstück Gesellschaft leisten?«
»Wieso willst du dich um ein zweites Zimmer kümmern? Wir sind doch verheiratet!« Sie wollte die Nacht nicht ohne ihn verbringen.
»Ich kann mich doch nicht einfach zu dir legen.« Er schluckte. »Es ist noch so vieles offen zwischen uns. Ich hätte das Gefühl, die Umstände auszunutzen.«
»Heute …«, Julia ließ seinen Blick nicht los, »… haben wir den Tod gesehen. Lass mich nicht allein.«
»Bist du dir sicher …?«
Es klopfte.
Er hielt inne, sah Julia an und stand dann auf, um die Tür zu öffnen.
»Mister von Varell.« Selma Blum trat ins Zimmer, in der Hand einen Teller mit einem großen Steak, Pommes Duchesse und grünen Bohnen. »Ich habe Ihnen eine Mahlzeit mitgebracht.«
»Das ist sehr aufmerksam von Ihnen.« Frederick nahm ihr den Teller ab. Julia bemerkte, wie er an sich heruntersah. »Aber vielleicht sollte ich mich erst einmal umziehen.«
»Lassen Sie die Etikette für heute außen vor«, erwiderte die Schwester. »Ich sehe doch, wie hungrig Sie sind.«
Während Frederick sich zum Essen setzte, trat Selma Blum zu Julia. »Ich habe etwas in Erfahrung bringen können.«
Julia merkte auf. »Von zu Hause?«
Die Schwester nickte. »Das Kind Ihrer Freundin ist wohlbehalten daheim.«
»Aurelia? Dem Himmel sei Dank!«
»Aber«, begann Selma Blum und rieb ihre Hände aneinander, »das ist nicht alles.«
»Was meinen Sie damit?« Julia merkte, dass ihr Mund trocken wurde. »Ist es … geht es um Lissis Mann? Oder um Giovanni und Bernardo?« Sie sah, wie Frederick sein Besteck ablegte und aufstand.
»Es ist …« Selma Blum holte tief Luft. »Mister Steiner hat das Unglück nicht überlebt. Es tut mir unendlich leid, Ihnen diese Nachricht überbringen zu müssen.«
Julia erstarrte.
Mit zwei Schritten war Frederick wieder an ihrem Bett, nahm sie in die Arme, stützte sie. Selma Blum nickte ihm zu und zog sich mit raschelnden Röcken in den angrenzenden Salon zurück.
»Meine Lissi.« Julia schluchzte trocken. »Meine arme Lissi.«
Frederick strich ihr sacht über den Rücken.
Julia vergrub ihr Gesicht in seiner Schulter, vor ihren geschlossenen Augen standen wieder tanzende Flammen, über ihren Rücken zogen Schauer der Angst. Sie sah sich über die brennende Slocum hetzen auf der Suche nach Aurelia und Paul …
»Warum?« Ihr Schrei wurde durch den Stoff von Fredericks Hemd gedämpft. »Warum?«
5. Kapitel
Die Swabian Pretzel Bakery an der Avenue A, Little Germany, Manhattan, Donnerstag, 16. Juni 1904, 6.30 Uhr morgens
Schwer wie Blei lag die Trauer über Little Germany. Nachdem bis weit in die Nacht hinein Droschken, Wagen und Ambulanzen durch die Straßen des deutschen Viertels gerumpelt waren, Überlebende, Verletzte und später auch die ersten Toten nach Hause gebracht hatten, war es still geworden. Jetzt, da der Morgen heraufdämmerte, hatte sich die Stille über ganz Kleindeutschland gebreitet. Wo an Donnerstagen sonst reges Treiben herrschte, war Leere, wo sonst gerufen, geschimpft und gelacht wurde, waren Kümmernis und Schweigen.
Annedorle stand am Fenster der Bäckerswohnung im ersten Stock über der Swabian Pretzel Bakery an der Avenue A. Aus einem grauen Himmel tropfte Nieselregen auf das Straßenpflaster und die Schirme der wenigen dahineilenden Passanten auf den Gehsteigen. Gestern noch waren hier die Menschen in freudiger Aufregung vorbeigezogen, bepackt mit Picknickkörben, Decken und Spielsachen, auf dem Weg zur 3rd Street Pier. Die Straßen unter dem blauen Sommerhimmel waren verstopft gewesen, weil Hunderte sich aufgemacht hatten – Julia, Paul und Aurelia mitten unter ihnen. Annedorle hatte ihnen gewinkt, sie vielleicht auch ein bisschen beneidet. Wer hätte ahnen können, dass nur Aurelia und Julia diesen Tag überleben würden?
Annedorle spielte mit dem Spitzenvorhang vor dem Fensterglas, den sie ein wenig zur Seite geschoben hatte. Zwei Männer in dunklen Anzügen querten die Avenue A und bogen in die 6th Street ein, ihr Schritt schwer, die Rücken gebeugt. Es war anzunehmen, dass sie nach St. Mark’s wollten. In der Kirche hatte die Gemeinde eine Anlaufstelle eingerichtet, wo Angehörige und Freunde sich nach denen erkundigen konnten, die bisher nicht zurückgekehrt waren. Die Aushänge mit Verletzten, Unversehrten, Vermissten und Toten wurde ständig angepasst. Viele Menschen aber, die das Warten nicht mehr ertragen konnten, waren auf eigene Faust unterwegs, streiften durch die Krankenhäuser von Harlem und der Bronx und durch die provisorische Leichenhalle an der Wohlfahrtspier. So wie Lissi, die sich am frühen Abend mit Harry auf den Weg in die Bronx gemacht hatte, um Paul zu suchen.
Annedorle war mit Aurelia zurückgeblieben, hatte versucht, das Kind aufzufangen, das Schreckliches gesehen haben musste. Lissis Tochter war eines der wenigen Wunder, die der gestrige Tag zugelassen hatten. Leicht verletzt war sie gegen Mittag nach Hause gebracht worden. Zu diesem Zeitpunkt zogen gerade die ersten Berichte über das Schiffsunglück auf dem East River durch Little Germany, bestätigten erste Überlebende das Unfassbare. Den ganzen Tag über hatten sie um Julia und Paul gebangt, dann war die erlösende Nachricht gekommen, dass Julia lebte. Nur von Paul hatte man nichts gehört, er war auch nirgends verzeichnet gewesen. Erst mit Harrys Heimkehr gegen halb elf Uhr in der Nacht war die Befürchtung zur Gewissheit geworden. Kurz darauf hatte ein Page des Fifth Avenue Hotels vor der Tür gestanden. Sie hatten ihm die traurige Botschaft mit auf den Weg zu Julia geben müssen.
Annedorle ließ den Vorhang fallen und ging zum Esstisch, wo nahezu unberührt das Frühstück stand. Weder Harry noch sie hatten mehr als zwei Bissen heruntergebracht. Aurelia schlief noch in Annedorles Bett, nachdem sie eine unruhige Nacht gehabt hatte. Harry war vor einer halben Stunde in die Backstube gegangen, um eine Notration an Brot vorzubereiten. Der längliche Bau mit dem gemauerten Ofen stand im Innenhof des fünfstöckigen Backsteinhauses, das nicht nur die Bäckerei, sondern auch eine Reihe von Wohnungen beherbergte. Julia und Annedorle nutzten jene über der Bäckerei, die anderen waren vermietet und trugen auf diese Weise zu ihrem Auskommen bei.
Annedorle atmete tief ein und aus, hoffte, auf diese Weise die Bedrückung zu lösen, die ihren Magen zusammenschnürte.
Das Leben war so voller Aufbruchsstimmung gewesen, als Lissi und Julia vor nicht ganz zwei Jahren die Swabian Pretzel Bakery übernommen und zu einem gern frequentierten Mittelpunkt des Viertels gemacht hatten – Lissi mit ihrer Backkunst, Julia mit ihrem Sinn fürs Geschäft. Annedorle hatte ihren ungeliebten Job in einer Zylinderhutfabrik aufgegeben, um Teil des Bakery-Teams zu werden. Seither arbeitete sie dort mit, wo sie gebraucht wurde, verkaufte im Laden, übernahm Botendienste und sorgte dafür, dass zu den Mahlzeiten ein Essen auf dem Tisch stand.
Ihr Blick wanderte über die leeren Stühle.
Hier, an diesem Holztisch, hatten sie nahezu täglich zusammengefunden. Sie selbst, Julia, Lissi, Harry, Aurelia und Paul Steiner, der ihnen in der finanziell schwierigen Anfangszeit unter die Arme gegriffen hatte. Dass Lissi und Paul im vergangenen Dezember geheiratet hatten, war allen ein Symbol für eine rosige Zukunft gewesen, hatte ihnen das Gefühl gegeben, auch ohne Blutsverwandtschaft eine große Familie zu sein.
Annedorle stellte zwei Teller ineinander, hielt dann aber wieder inne und schüttelte den Kopf. Unvorstellbar, dass Paul nicht mehr unter ihnen sein sollte. Er war einer der Guten gewesen. Klug und integer, sich selbst nicht so wichtig nehmend, immer ein Lächeln auf den Lippen und eine Prise Humor in den Augen. Einer, der es ohne Halsabschneidermethoden zu Wohlstand gebracht hatte – sein Lebensmittelgeschäft lag ein paar Straßenecken weiter südlich, sein Mietshaus warf einiges ab, ein weiteres sollte gebaut werden. Lissi hatte ein solches Glück mit ihm gehabt. Aurelia war für ihn wie ein eigenes Kind gewesen, seine kleine Familie hatte er über alles andere gestellt. Gewohnt hatten die drei seit der Heirat in einer großen, modernen Wohnung über der Grocery.
Annedorle wischte sich über ihre tränenfeuchten Wangen.
Eigentlich hätten auch sie und Lissi auf dem Dampfer sein sollen. Nur weil ein großer Auftrag vorzubereiten gewesen war, hatten sie ihre Tickets kurzfristig weitergeschenkt …
»Anne-dole?«
Annedorle drehte sich um.
Eine viel benutzte Stoffpuppe unter dem Arm stand Aurelia mitten im Zimmer und rieb sich die Augen.
Sofort ging Annedorle zu ihr hin und nahm sie auf den Arm. »Du bist aufgewacht!« Es gelang ihr leidlich, gefasst zu klingen. »Jetzt hast du bestimmt Hunger?«
Aurelia deutete zum Tisch. »Essen!«
Annedorle setzte sich auf einen Stuhl, behielt Aurelia auf dem Schoß und bestrich eine Scheibe Brot mit Butter und Marmelade. Während sie die Brotscheibe in Stückchen teilte, überlegte sie, wie man einem so kleinen Kind vom Tod erzählte. Würde die Kleine sich später überhaupt an das erinnern, was passiert war?
Aurelia griff mit der Hand in den Teller und stopfte sich das Marmeladenbrot in den Mund. Ein paar Stücke fielen zu Boden. Annedorle bückte sich nicht danach, ließ sie auf den Holzdielen liegen und das Kind gewähren. Stattdessen versuchte sie, ihr eigenes Entsetzen zurückzudrängen und ihre mentale Kraft zu bündeln. Es würde ihre und Harrys Aufgabe sein, ihre kleine Schicksalsgemeinschaft über die kommenden Tage und Wochen, unter Umständen sogar die nächsten Monate zu bringen.
Der Teller war fast leer. Aurelia leckte ihre marmeladenbeschmierte Hand ab und streckte sie dann aus. »Wa-ssa!«
»Wir machen deine Hände sauber«, versicherte Annedorle. »Sollen wir zusammen einen Waschlappen holen?«
»Ja-a!«
Annedorle stand auf, setzte sich Aurelia auf die Hüfte und wollte gerade in die Küche gehen, als von der Straße Hufgetrappel heraufdrang – begleitet von lauten Rufen und den rumpelnden Geräuschen mehrerer Wagen, die vor dem Haus zum Stehen kamen.
Annedorle wusste sofort, was das zu bedeuten hatte.
»Machen wir deiner Mama die Tür auf?«, fragte sie Aurelia, während sie zur Tür ging.
Lissis Anblick war zum Erbarmen. Ihr ohnehin blasses Gesicht war grau und fahl, die Augen rot geweint. Sie wirkte nicht nur völlig übermüdet, sondern geradezu apathisch.
Auch Aurelia schien zu spüren, dass es ihrer Mutter nicht gut ging. Ihr leises »Mama« war kaum zu hören.
Durch Lissi aber ging in diesem Moment ein Ruck. Sie streckte die Hände nach ihrer Tochter aus, nahm sie Annedorle ab und trug sie ins Wohnzimmer. Dort setzte sie sich in den großen Ohrensessel mit dem grünen Samtbezug, der schon seit jeher in der Nähe des Kamins stand, drückte ihr Kind an sich und richtete den Blick zur Decke. Annedorle sah keine Tränen. Lissi war leergeweint.
Langsam ging Annedorle zu ihr. »Hast du Hunger, Lissi? Möchtest du etwas essen?«
Lissi schüttelte den Kopf.
»Mama muss essen«, sagte Aurelia und machte Anstalten, sich aus der engen Umarmung zu befreien. Lissi strich ihr über das blonde, lockige Haar und ließ sie auf den Boden hinunter, wo sie sofort in ihre Spielecke ging und ihre kleine Holzkutsche auf den Schoß zog. Ein Geschenk von Paul zu Aurelias zweitem Geburtstag. Lissi begann leise zu schluchzen.
Annedorle kniete vor die Freundin und nahm ihre Hände. »Wir sind an deiner Seite, Lissi. Du bist nicht allein.«
Lissi senkte den Kopf. »Mir ist, als wäre ich mit ihm gestorben.«
»Ich verstehe dich.«
»Das kannst du nicht.« Lissi schluchzte wieder. Tränenlos. »Das kann niemand … verstehen.«
Annedorle hörte Stimmen auf der Treppe. Sie drückte noch einmal Lissis Hände und stand auf. »Ich bin gleich wieder bei dir.«
Am oberen Treppenabsatz stieß sie auf zwei Männer mit einer langen Kiste aus hellem Holz. Harry ging hinter ihnen, die Bäckermütze in der Hand. Sie sah in seine Augen und wusste: Paul Steiner war nach Little Germany heimgekehrt.
6. Kapitel
Mulberry Street, Little Italy, drei Stunden später
Giovanni hatte keine Ahnung, was mit ihm los war. Er fühlte sich, als hätte man eine Armee Ameisen auf ihn angesetzt, konnte nicht still sitzen und schon gar nicht im Bett bleiben, so wie Nonna Antonella es befohlen hatte. Ihre Anordnung missachtend, tigerte er durch die Wohnung hinter dem Laden seiner Großmutter, die zwar nicht seine richtige Nonna war, ihn aber vor Jahren angenommen hatte, als wäre er ihr leiblicher Enkel. Das war einer der Glückstage seines Lebens gewesen. So wie der gestrige, der leicht der letzte hätte werden können.
Vor den Regalen mit ihren Reliquien blieb er schließlich stehen, suchte sich zwei aus und nahm sie in die Hände. Täuschend echte Nachbildungen in Gläsern, die seine Nonna als Originale aus Jesu Heimat verkaufte oder verschenkte – eine kleine Lüge, die nötig war, damit die Knochen besser halfen, weil die Leute dann viel mehr an ihre Kraft glaubten. Eigentlich kamen die Knochen vom Schlachthaus, und das Wasser war aus der Pumpe im Hof, aber das spielte für die Nonna keine Rolle. Der Glaube, sagte sie immer, der war das Wichtige. Er konnte Berge versetzen.
Giovanni stellte die beiden Gläser auf den Hausaltar der Nonna und kniete sich davor. Normalerweise machte er das nicht freiwillig, aber heute hatte er das Bedürfnis. Zum einen wollte er dem lieben Gott danken, dass er ihn beschützt hatte, zum anderen wollte er ihn bitten, das komische Gefühl in seinem Bauch wegzunehmen. Es war unangenehm. Eine drückende Mischung aus Unruhe, Angst und Traurigkeit.
Er schloss die Augen.
Sofort stand alles wieder vor ihm. Das Gelborange des Feuersturms, der geplatzte Löschschlauch, die Panik in den Augen des ersten Offiziers und des Matrosen, der die Flammen hatte löschen wollen. Das Patschen der beiden großen Schaufelräder, die in einem irrsinnig schnellen Rhythmus aufs Wasser schlugen. Giovanni schüttelte den Kopf und machte die Augen wieder auf, um die Bilder nicht mehr sehen zu müssen. Stattdessen wollte er sich aufs Gebet konzentrieren.
Er faltete die Hände und hob den Blick zu der Madonnenstatue, die auf einem Eckregal stand. Über ihr schwebte ein Kruzifix, unter ihren unsichtbaren Füßen lag eine weiße Spitzendecke. Früher war die Madonna klein gewesen, ihr Kleid weiß mit einem blauen Band. Inzwischen hatte die Nonna eine neue gekauft. Groß und aus Holz geschnitzt und so bemalt, dass sie wie eine echte Frau aussah. Auch das Jesuskind auf ihrem Arm sah echt aus. Links der Figur lag ein Rosenkranz, auf der anderen Seite ein Gebetbuch. Abgebrannte Kerzen zwängten sich dazwischen.
Il nostro Padre Celeste, ich danke dir, dass du mich behütet hast, und bitte gib denen viel Kraft, die schlimmer verletzt sind als ich …
Er hatte überlebt. Weil er schwimmen konnte, so wie sein spanischer Freund Bernardo, mit dem er auf dem Ausflug gewesen war. Wahrscheinlich aber auch, weil sie beide rechtzeitig gemerkt hatten, dass es für den brennenden Dampfer keine Hoffnung gab. Sie waren losgerannt, hatten sich durchgedrängelt in Richtung Heck, weg vom Feuer, das sich in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit durch die drei übereinanderliegenden Decks fraß. Unterwegs war ihm ein kleines Mädchen aufgefallen, wimmernd und allein. Giovanni hatte die kleine Aurelia erkannt, die Tochter von Mrs. Steiner von der Swabian Pretzel Bakery, bei der er regelmäßig arbeitete. Weil ihr Stiefvater nicht zu sehen gewesen war, hatte er sie einfach gepackt. Zu dritt hatten sie sich zur Reling durchgekämpft. Von dort waren sie in den East River gesprungen.
Giovanni konnte nicht länger knien und beten. Es ging einfach nicht. Er vertraute darauf, dass sein Dank trotz aller Kürze bis zum himmlischen Vater durchgedrungen war.
Einen Augenblick lang stand er unschlüssig herum. Dann ging er nach vorn in den Laden, wo die Nonna Oliven, Käse und andere Spezialitäten aus Italien verkaufte. Sie war nicht da. Er trat vor die Tür, sah die mit Wagen, Handkarren und Menschen vollgestopfte Mulberry Street entlang, entdeckte sie aber auch dort nirgends. Wahrscheinlich war sie im Viertel unterwegs, wo sie Familien half, die so arm waren, dass sie sich kaum etwas zu essen kaufen konnten. Im großen Herzen seiner Nonna hatten sie alle ihren Platz, die Verlorenen von Little Italy.
Ohne dass er es eigentlich vorgehabt hatte, lief er die Mulberry Street nordwärts. Erst nach ein paar Schritten wurde ihm bewusst, dass es ihn nach Little Germany drängte. Dort waren diejenigen, die gestern dasselbe durchlebt hatten wie er, vielleicht half ihm das gegen seine Unruhe. Außerdem wollte er wissen, wie es Aurelia ging – und vielleicht gab es in der Bäckerei etwas zu tun. Das würde ihn ablenken.
An der Ecke Mott und Prince Street, auf Höhe der alten Kathedrale, packte ihn jemand grob an der Schulter. »Hey, Giovanni!«
Giovanni erkannte die Stimme und riss sich los. »Lass mich, Angelo!«
»Du musst zu Kelly kommen«, rief Angelo hinter ihm her.
Giovanni drehte ihm den Rücken zu. »Geht nicht.«
»Seit wann hast du da was mitzureden?«, höhnte Angelo. Der Siebzehnjährige war Teil der Five Points Jungs um den ehemaligen Boxer Paul Kelly – zu denen bedauerlicherweise auch Giovanni zählte. Kelly, eigentlich Italiener, war der größte Unterweltboss New Yorks, kontrollierte Bordelle und Spielhöllen, Wettbüros und anderes mehr, und pflegte korrupte Beziehungen bis in höchste politische Kreise. Immer wieder musste ihm Giovanni für Handlangerdienste zur Verfügung stehen, dabei wollte er eigentlich nichts mehr mit Kelly und seinen kriminellen Machenschaften zu tun haben. Doch es war fast unmöglich, sich einem Paul Kelly zu entziehen. Sein Netz spannte sich inzwischen über ganz New York, da sein größter Rivale, Monk Eastman, im Gefängnis saß. Damit gab es niemanden mehr, der Kelly die Macht streitig machen könnte.
Angelo holte ihn ein, packte ihn von hinten. »Los, Mann! Der Boss wartet nicht gern, das weißt du.« Als Giovanni sich zu ihm umdrehte, weiteten sich seine Augen. »Wie siehst du denn aus?«
»Ich war gestern auf dem Dampfer, verdammt!« Giovanni brachte einige Schritte Abstand zwischen sich und den Älteren. »Ich wär fast verbrannt!«
Angelo starrte ihn an. »Du warst auf der Slocum? Die ganze Stadt spricht davon!«
»Ja! Und jetzt lass mich in Ruhe!« Giovanni drehte sich um und lief weiter in Richtung Houston Street. In diesem Fall war es wenigstens zu etwas nutze, dass er furchtbar aussah, mit seinen Brandblasen und Schnittwunden im Gesicht – auch wenn die Nonna ihn gestern versorgt und die versengten Spitzen seines kräftigen dunkelbraunen Haars abgeschnitten hatte.
Als er einige Minuten später zurücksah, war Angelo verschwunden.
Obwohl es nieselte, ging Giovanni nicht direkt zur Swabian Pretzel Bakery, sondern erst einmal zur Haltestelle der Hochbahn an der 8th Street. Schon aus einiger Entfernung hörte er, wie einer der Züge ratternd in die Station einfuhr und mit schrillem Kreischen zum Stillstand kam. Ob die Second Avenue El noch immer Leute von der Slocum nach Hause brachte? Gestern waren er, Bernardo und Aurelia unter ihnen gewesen.
Er lehnte sich an einen der Stahlträger und sah die eiserne Treppe hinauf, aber es kamen nur wenige Menschen vom Bahnsteig herab. Viel zu wenige für einen Wochentag. Alles wirkte eigenartig. Beklemmend. Gerade als Giovanni überlegte, ob er nicht doch lieber zurück nach Hause oder zu Bernardo nach Little Spain laufen sollte, hüpfte ein Junge über die Stufen, den er kannte – und der auch auf dem Dampfer gewesen war.
»Hey, Willie!« Giovanni stieß sich vom Pfeiler ab, erleichtert, dass tatsächlich immer noch Überlebende zurückkehrten.
Willie nahm die drei letzten Stufen mit einem Satz, blieb stehen und sah sich um.
»Hier!« Giovanni hob die Hand.
Willie steckte die Hände in die Hosentaschen und schlenderte zu ihm hin. »Vater hatte es verboten«, sagte er heiser.
Giovanni verstand nicht ganz. »Was hatte er dir verboten?«
»Den Ausflug.«
»Gestern? Du bist heimlich aufs Schiff?«
Willie nickte. Er wirkte verängstigt und übernächtigt, Gesicht und Kleidung starrten vor Schmutz. Allerdings schien er nicht so schlimm verletzt wie Giovanni. »War die Nacht in Harlem«, krächzte er. »Im Park.«
»Warum denn das?«
»Dachte, ich könnte nicht nach Hause. Aber ich hab eine Zeitung gesehen, da war mein Name auf der Vermisstenliste.«
Giovanni konnte es nicht glauben. »Du hast dich nicht nach Hause getraut und kommst deswegen erst jetzt? Aus Harlem?«
»Ich hab Angst vor Vaters Prügel«, antwortete Willie. »Aber lieber kriege ich Schläge, als dass ich Mutter das Herz breche. Sie muss ja denken, ich wär tot.«
Giovanni legte einen Arm um den zitternden Elfjährigen. »Ich begleite dich, Willie.«
Gemeinsam gingen sie die 8th Street in Richtung Osten. Überall sah man schwarze Wagen, eilten verstörte Menschen in Trauerkleidung vorüber, versammelten sich Angehörige mit erstarrten Gesichtern. Aus den offenen Fenstern der Mietshäuser drangen Weinen und Wehklagen bis hinunter auf die Straße. Giovanni drängte es weg von hier, aber er brachte es nicht übers Herz, Willie allein zu lassen. So folgte er ihm bis zu einem Tenement in der East 7th Street.
Der Junge drehte sich zu Giovanni um. »Kommst du mit rauf?«
Giovanni atmete tief durch, nickte. Hintereinander stiegen sie die enge, dunkle Treppe hinauf, bis sie vor einer Wohnungstür standen. Willie streckte die Hand nach dem Türknauf aus, zögerte, sah Giovanni an.
Giovanni nickte ihm aufmunternd zu.
Willie drehte den Kauf.
Als die Tür aufschlug, richteten sich die Augen der Familie, die bedrückt am Küchentisch gesessen hatte, ungläubig auf den Jungen. Dann sprangen sie auf. Die Mutter zog Willie in die Arme, herzte ihn, bedeckte sein Gesicht mit Küssen, bevor der Vater seinen Sohn fest umarmte, ihn dann auf Armlänge von sich schob und ihn ansah, als könnte er es nicht glauben. »Wie? Wie hast du es geschafft?«
»Ich bin ans Ufer geschwommen, Vater.«
Dem Vater liefen Tränen der Freude über das Gesicht. »Du bekommst einen Dollar, Willie. Einen ganzen Dollar.« Er klopfte seinem Sohn auf die Schultern. »Weil du so gut schwimmen kannst!« Dann zog er ihn wieder an seine Brust.
Giovanni ging zur Treppe.
Dieser Augenblick gehörte Willie und seiner Familie.
Giovanni schlug einen Haken über die Second Avenue und wollte gerade links auf die East 6th Street einbiegen, als er die endlos lange Menschenschlange sah, die sich, ausgehend von der St. Mark’s Kirche, um den Häuserblock wand. Giovanni wechselte auf das Trottoir gegenüber, lief weiter in Richtung Tompkins Square Park, vorbei an Vätern, Müttern, alten Menschen und Kindern. Journalisten umschwirrten die Wartenden, und es gab eine Menge Polizisten, die sich in ihren blauen Uniformen entlang der Menschenschlange postiert hatten.
Giovanni hielt inne. Gab es einen Gottesdienst in St. Mark’s?
Doch als er die Menschen einzeln oder in Grüppchen die Treppen zur Kirche hinaufgehen sah, während andere mit gesenktem Kopf oder versteinerten Gesichtern den roten Backsteinbau mit dem großen Portal verließen, ging er davon aus, dass es dort wohl eine Art Auskunftsstelle geben musste.
Giovanni wandte den Kopf ab und ging zügig weiter. Er fand es unanständig, den Schmerz anderer neugierig zu beobachten. Wenige Minuten später querte er die Avenue A und stand vor der Swabian Pretzel Bakery. Zu seiner Überraschung war der Laden geöffnet. Er ging hinein, fand aber weder Mrs. Steiner noch Miss Annedorle vor.
Unschlüssig nahm er seine Schiebermütze ab und knautschte sie in den Händen. Vielleicht wäre es doch besser, das weinende Little Germany hinter sich zu lassen und Bernardo in der West 14th Street zu besuchen. Er hatte die Tür schon fast wieder in der Hand, als Harry in den Laden kam, einen großen Korb mit Brot in den Händen. Als er Giovanni erkannte, ging ein Leuchten über sein Gesicht, das rote Flecken auf seinen Backen hinterließ. Er stellte den Korb auf die Theke und legte einen Arm um Giovanni. »Was freu ich mich, dich zu sehen, Junge!« Er rückte die Bäckermütze auf seinem roten Haar zurecht. »Ohne dich wär Aurelia nicht …«
»Ich dachte, ich frag mal, ob Sie Arbeit für mich haben«, unterbrach ihn Giovanni. Eigentlich wollte er nicht an die letzten Momente auf der Slocum erinnert werden.
Harry sah ihn überrascht an, schien dann aber zu verstehen. »Die hab ich wohl genügend«, antwortete er. »Ich möchte die Bäckerei zumindest ein paar Stunden am Tag offen halten, damit die Menschen sich versorgen können. Die meisten Geschäfte in Little Germany werden in den nächsten Tagen geschlossen bleiben.«
»Wann soll ich anfangen?«
Harry kratzte sich im Nacken. »Am besten gleich.«
»Nee«, erwiderte Giovanni, der nun doch lieber erst einmal frei herumstreunen wollte. »Meine Nonna weiß nicht, wo ich bin.«
»Dann morgen?«
Giovanni nickte.
Harry hielt ihm die Hand hin. »Schlag ein! Du bekommst einen guten Lohn.«
Sie bekräftigten ihre Abmachung mit einem festen Händedruck. »Junge«, sagte Harry dann. »Bevor du wieder abhaust, musst du mit nach oben kommen. Dort gibt es jemanden, der dir bestimmt Danke sagen möchte.«
Kaum hatten sie die Wohnung betreten, ertönte ein glockenhelles »Vannniiiiiiieeee!«. Eine Minute später hatte Aurelia Giovannis Knie mit den Armen umschlungen und presste sich fest an ihn, fast so wie auf dem Schiff am Vortag. »Vanniiieee.«
Er nahm sie auf den Arm.
Harry nickte ihm zu.
Gemeinsam betraten sie das Wohnzimmer – und Giovanni wusste, dass die Katastrophe auch in diese Familie eine schreckliche Lücke geschlagen hatte.
7. Kapitel
Lebanon Hospital, Bronx, Freitag, 17. Juni 1904
Heftige Schmerzen attackierten Kapitän William van Schaick auf seinem harten Krankenbett im Lebanon Hospital, wanderten über seine verbrannte Haut und malträtierten seine gebrochene Ferse. Vor allem aber quälten sie seinen Geist. Unaufhörlich drehten sich nicht nur die Bilder der letzten Minuten der Slocum