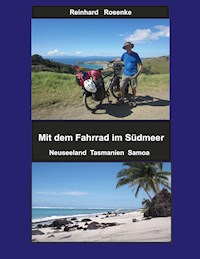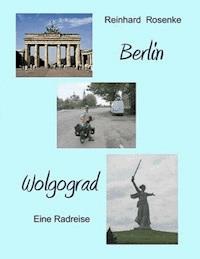Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Reinhard Rosenke (geb. 1940) reist Anfang Februar 2015 mit einem Containerschiff von Hamburg nach Buenos Aires, besteigt dort sein Fahrrad und kämpft sich bis zur Südspitze des amerikanischen Kontinents durch. Dort verkauft er das Rad, besucht per Bus und Flug einige eindrucksvolle Landschaften und zum Schluss Buenos Aires. Das Buch hat 164 Seiten, davon 60 Farbseiten, und zusätzlich zahlreiche Schwarzweiß-Bilder.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 182
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Bilanz
Überfahrt
Die „Cap San Nicola“
Bordleben
Südamerikanische Küste
Mit dem Fahrrad nach Feuerland
Ankunft und Abmarsch
Auf der Ruta 3
Provincia de Pampa
Mar del Plata - Sein oder Nichtsein
Auf der Straße
Am Rio Colorado beginnt Patagonien
Wind, Wind, höllisches Kind
Im Guanako-Land
Peninsula Valdez
Fahren und Gefahrenwerden
Tierische Abwechslungen
Pechtag - Glückstag?
Magellan läßt grüßen
Nach Rio Gallegos
Auf zur Magellan-Straße
Ein Stück Chile
Endlich am Ende der Welt
Ushuaia - das Ziel meiner Träume
Punta Arenas
Zum Cabo Froward
Weiter per Bus und Flugzeug
Punta Arenas
Nationalpark Torres del Paine
Glaciar Perito Moreno
Von Mendoza in die Hoch-Anden
Im indianischen Norden
Zum Rio Parana in Corrientes
Die Wasserfälle im Parque National Iguazo
Buenos Aires
Eindrücke
Jüdisches Leben
Tango
Verwendete Literatur
Bilanz
Geschafft!!! Die in nasse Wolkennebel gehüllten Berge liegen hinter mir. Das steile Auf und Ab über zehn Stunden dieses kalten, düsteren Tages (es ist der 8. April 2015) steckt mir in den Knochen.Von Südwesten bläst mir der Wind ins feuchte Gesicht. Er schiebt das Gewölk in die Richtung, aus der ich gerade aufgetaucht bin, hin zu den schneebedeckten Tausendern. Das fahle Dämmerlicht ist hier ein wenig heller geworden. Hinter der letzten Kurve meines langen Weges auf der „Ruta 3“ winken die Lichter einer menschlichen Siedlung zu mir herauf. Das kann nur Ushuaia sein, mein Magnet in den zurückliegenden harten Wochen. Mein Herz jubelt, aber mein Körper schüttelt sich vor Nässe, Kälte und dem Verlust der letzten Kalorien. Meine Freude jagt mich nicht über die letzten Kilometer. Nein, ich steige ab, irgendwie steif – und versenke mich in das unter mir sich ausbreitende Panorama: die Bay of Ushuaia, die der Beagle Canal hier bildet, bis an dessen Ufer die Stadt hinunter reicht. Wie von einem Gürtel ist sie umschlossen von den wolkenverhangenen Bergen.
Schnell bin ich Teil des Autoverkehrs und des pulsierenden Lebens. In der Hosteria „Pinguin“ finde ich ein schönes Zimmer für 600 Pesos (50 Euro), teuer, aber egal! Eine heiße Dusche, frische, trockene Sachen und das kleine Fläschchen Whisky verwandeln mich in einen entspannten und glücklichen Menschen.
Später, schon im Bett, reizt es mich, im Tagebuch zurückzublättern und aus der jetzt sicheren Position heraus meinen körperlichen und seelischen Zustand beim täglichen Kampf auf dem Fahrradsattel herbeizurufen. So, wie man ein aufregendes Buch liest, von dem man das Happyend kennt. Doch ich irre mich. Nur sehr knapp ist dieser Punkt angesprochen. Warum? Ich hatte keine Lust auf eine nicht endende Jammerlitanei. Sah nicht auch meine Befindlichkeit vor vierundzwanzig Stunden noch ganz anders aus? Konnte nicht trotz der Gewissheit, dem Ziel nahe zu sein, noch einiges dazwischen kommen – abgesehen von meiner ausgelaugten körperlichen Verfassung? Gut so, mein Innenleben von gestern braucht mich nicht mehr zu interessieren. Das mir gegebene Versprechen „Nie wieder!“ nach jedem Marathonlauf mit all seinen Schmerzen und inneren Kämpfen hielt ja auch immer nur ein paar Stunden. Ich kann mir überstandene körperliche Anstrengungen nicht realistisch vorstellen. Wohlig, wenn auch noch überdreht, strecke ich mich und lösche die Bettlampe...
Nach den Andeutungen der letzten Sätze lässt sich mutmaßen, dass die gestrampelten 3150 Kilometer kein Pappenstiel gewesen sein können. Musste ich mich wirklich so quälen? Ja, ich musste! Eines ist gewiss: Wenn auch der so leicht dahingesagte Satz „Der Weg ist das Ziel“ gut und häufig zutreffend ist, so formulierte ich für diese Tour: „Das Ziel gibt mir die Kraft für den Weg.“ Wer von meinen Freunden und guten Bekannten konnte wohl etwas anfangen mit meiner Begeisterung für das ZielCapode Horno bzw. Kap Hoorn? Zwei bemerkenswerte Kaps gehören schon längst zu meinen Radler- Erfahrungen: das europäische Nordkap und die Nadelspitze Australiens, das Cape York. Nicht zu vergessen, mein persönliches „Kap der Stürme“, Schwanenwerder am Wannsee, das mir auf meinem Jollenkreuzer Aran so manchen Nervenkitzel beschert hat.
In meiner Bibliothek befinden sich Dutzende von Büchern mit Berichten über die Umrundung von Kap Hoorn während der Zeit, als gegen Ende des 19. Jahrhunderts große stählerne Frachtensegler trotz Konkurrenz der Dampfschifffahrt Gewinn einfuhren im Handel zwischen Europa, Südamerika, USA und Australien. Die stürmischste Ecke unserer Erde musste umrundet werden. Vor den Seeleuten, die dieses vollbrachten, hatte ich schon als Junge tiefsten Respekt.
Wie hat der polnisch-englische Schriftsteller Joseph Conrad (1857-1924), der selbst jahrelang als Kapitän eines Segelschiffes fuhr, formuliert? „Ein (Segel)-Schiff ist ein Geschöpf, das wir gewissermaßen zu dem Zweck in die Welt gesetzt haben, an ihm unsere Fähigkeiten zu beweisen.“
Das Besondere an Kap Hoorn wurde über viele Jahrzehnte herausgestellt durch den Club der Cap Horniers, den „Amicale Internationale des Capitaines au long Cours“ oder, wie es in einem Buchtitel heißt: „Die letzten Seeleute von Kap Hoorn“. Inzwischen ist dieser Klub ausgestorben.
Und inzwischen habe ich den größten Teil meines Lebens gelebt, habe mit meinem Fahrrad einige große Reisen erlebt und habe jüngst bei der Lektüre von Conrads Der Spiegel der See Feuer gefangen. Wenn schon nicht als Seemann, so möchte ich mich mit dem Rad zum Kap Hoorn aufmachen und auf meine Art und Weise mich vor den Kräften der Natur bewähren.
Überfahrt
Die „Cap San Nicola“
Wie es der Zufall will, beginnt meine Reise schon im Hamburger Hafen mit einem „Kap“. Denn die Reederei Hamburg Süd hat mir auf ihrem Containerfrachter Cap San Nicola, der im Jahre 2013 in Südkorea vom Stapel lief, einen Platz reserviert. Der Schiffsname bezeichnet ein Kap an der südamerikanischen Ostküste, und das 300 Meter lange Schiffchen wird mich nach Buenos Aires bringen, der Hauptstadt Argentiniens.
Jetzt stehe ich mit Fahrrad und Gepäck am Burchard Kai vor einer unendlich langen und stockwerkhohen, roten Wand, der Bordwand meines Schiffes. So reicht auch die Gangway in für mich schwindelnde Höhe. Dort hinauf mit Rad und Gepäck?? Das wird 'ne Schufterei! Plötzlich zeigt sich ein roter Overall mit blauem Helm. Ein asiatisches Gesicht grinst mich an. Wie bei einem indischen Seilkunststück senkt sich aus dem grauen Himmel vor meiner Nase ein dünnes Drahtseil herab. Schon liegt eine Plane bereit, nimmt die fünf Gepäckstücke - 25 Kilo - auf, wird mit dem Seil und dem Fahrrad umschlungen, und meine ganze Habe entfernt sich auf ein Zeichen des Overalls hin nach oben. Für mich habe ich selber zu sorgen, klimme voller Erwartung die Gangway hoch.
Dresdener Sächsisch empfängt mich freundlich in Gestalt eines hageren, jungen Mannes, er ist hier der Erste Offizier. Mit dem Lift fahren wir in die 7. Etage (G) des 40 Meter hohen Wohnturmes, wo mir der „Erste“ die Owners Cabine zuweist. Das klingt nach Luxus und ist es auch. Es ist die Suite des Schiffseigners. Ja, hier hat schon Dr. Oettger genächtigt, einer der Anteilseigner der Hamburg Süd. Mit einem Aufpreis von 400 Euro konnte ich diesen Platz ergattern, denn zur Zeit meiner Anmeldung waren die beiden Passagierkabinen schon vergeben.
Die Etage über mir ist dem Sport vorbehalten, wo die Besatzungsmitglieder an Geräten trainieren und Tischtennis spielen können. Darüber befindet sich „die Brücke“, die Befehlszentrale des Schiffes.
Meine Kabinenfenster eröffnen mir eine tolle Aussicht auf das Schiff und das Ladegeschehen. Der Kühlschrank ist mit Bier- und Wasserflaschen gefüllt. Kaffee, Tee und der zugehörige Wasserkocher stehen zum Gebrauch bereit. Nach Backbord und Steuerbord sind es vor der Tür nur wenige Schritte auf eine Plattform. Alle Plattformen sind durch Außentreppen miteinander verbunden. Natürlich kann man im Turm-Innern eine Treppe oder den Lift benutzen.
Meine Habe schwebt gen Himmel
Der Weg an Bord
Liegt ein Frachter im Hafen, dann ist das Leben an Bord dem schnellen Be-und Entladen vorbehalten. Die ganze Besatzung und besonders die Schiffsführung sind gefordert. Als ich mich abends in der Offiziersmesse zu meinem ersten Dinner einfinde, hat links von mir an dem großen, runden Tisch Martin W., ein Passagier aus Hamburg, schon Platz genommen. Der Kapitän - „Master“ - taucht nur kurz auf. Er wird von mir nicht als solcher wahrgenommen, ihm geht es um Schiff und Mannschaft, nicht um eitle Selbstdarstellung. Der mir schon bekannte Dresdener „Erste“ schlingt schnell ein paar Happen hinunter, bevor er wieder verschwindet. Der „Erste Ingenieur“ , ein sympathisches Kraftpaket aus Bulgarien, trinkt eilig ein Glas Milch.
Am Nachbartisch lässt sich der polnische „Zweite Offizier“ blicken, dessen junge Frau und das kleine Töchterchen die zweite Passagierkabine für die Hin- und Rückreise bewohnen. Am selben Tisch erscheint dann noch eine junge Frau, die als Azubi für eine Offizierslaufbahn das Schiffsleben von der Pike auf hier kennenlernen soll. Über das Reich der Küche herrscht der philippinische Koch - ein sehr fähiger Mann, wie ich rückblickend sagen muss. Einer seiner Landsmänner fungiert als Steward, wie überhaupt der Großteil der Besatzung sich aus den allseits bewährten und begehrten Männern von den Philippinen zusammensetzt.
Bordleben
Begleitet vom Glitzerschein der Stadt Hamburg segeln wir um 22 Uhr los, zuerst mit Schlepperhilfe, dann, inmitten des Elbstroms langsam aus eigener Kraft. Martin und ich stehen oben auf der Außenbrücke über die Reling gelehnt, warm eingepackt. Es herrschen Gefriergrade. Vor uns liegen drei Wochen auf See, ich bin voller Anspannung und Freude. Zuerst passieren wir die Lichter von Blankenese, von weitem sehen wir den erhellten Himmel über Brunsbüttel. Um Mitternacht gibt es nur noch dieses Schiff, das kaum hörbar das vom Silbermond beschienene Wasser zerteilt.
Noch nicht richtig wach, schon nicht mehr schlafend durchfließt mich Wohligkeit an diesem nachtdunklen Wintermorgen. Kein Laut dringt in mein Schlafgemach, durch das Kabinenfenster sehe ich die Positionslichter unseres Schiffes. Die Gedanken kreisen um die aufregenden Stunden gestern und enden mit einem Seufzer: Alles ist gut... Nichts stört mich, das Hier und Jetzt ist vergleichbar mit einem „Inselgefühl“, was besagt: Hier ist meine heile Welt.
Plötzlich nistet sich ein Gedanke in meinen Kopf, der mein Behagen verdrängt: „Reinhard, raus aus den Federn, unten wartet der Swimmingpool auf dich!“ - „Iiii, jetzt in die kalte Brühe steigen? Keene Lust!“ - „Du Flasche, mach schon, du hattest es dir vorgenommen.“ - „Ja, verdammt, wo ist meine Badehose?“ So laufe ich lustlos fünf Stockwerke hinunter. Keine Seele begegnet mir. In dem kleinen Stahlbecken von drei mal vier Metern schwappen die Wellen nach allen Seiten. Das Wasser ist kalt, da hilft nur Bewegung, kein richtiges Schwimmen. Die Zeit will nicht vergehen. Was muss ich nicht alles tun, bis meine mir auferlegte halbe Stunde vorüber ist! Herrlich, die heiße Dusche!
Im Glauben, jetzt frisch und dynamisch zu sein, geht’s nach oben. Es folgt Nummer zwei der täglichen Körperertüchtigung. Nennen wir es „Treppensteigen“, wie ich es schon auf einer Reise nach Neuseeland praktiziert hatte. Es beginnt auf der Brücke mit einem Verweilen, Schauen und Begrüßen der aufgehenden Morgensonne. Natürlich gilt auch dem Wachhabenden mein „Guten Morgen“. Es folgt Deck für Deck der Abstieg auf den Außentreppen: 40 Meter hinunter bis zum „Upperdeck“.
Vom Morgentau oder Regen sind Stufen und Treppengeländer nass und glitschig. Ich darf nicht träumen, genieße den weiten Blick aufs Meer. Wie
Nautische Arbeit des Ersten Offiziers
sich die Morgenwolken mit roten Farbtönen aufblähen! Wie der Horizont an Schärfe zunimmt! Wie der Wind sein Wellenspiel betreibt! Beim Hochsteigen ist Armarbeit angesagt. So geht das hoch und runter, vor dem Frühstück und am Vormittag, bis ich 25 „Treppen“ absolviert habe. Das sind täglich 1000 Meter „Bergsteigen“, ein gutes Mittel gegen „Dickbauch“ und für die Kondition.
Martin, der ehemalige Esso-Ingenieur, der beruflich die ganze Welt kennengelernt hat und fließend Englisch spricht, zeigt sich als ein netter und humorvoller Schiffskamerad. Uns beide drängt es nach dem üppigen Frühstück oft zu einem Marsch hin zum „Forecastle“, dem Vorschiff. So steigen wir denn hinunter zum Upperdeck und beginnen unsere Wanderung entweder entlang der Backbord- oder der Steuerbordreling. Die Umlaufbahn um das 300 Meter lange Schiff besteht aus einem schmalen Hohlweg. Neben und über uns stapeln sich die Container. Aber das Auge hat ja Raum genug, um weit zu schweifen. Im Rhythmus des Auf und Ab, das die Dünung dem Schiff aufzwingt, ächzt und quietscht die schwere Last. Wenn nicht gerade das Deck geschrubbt wird, schaffen wir es mit trockenen Füßen bis zum Vorschiff. Eine hohe, rote Stahlwand trennt diesen Teil vom Ladebereich. Er ist allein der gewaltigen Ankerkette und den Oberarm dicken Festmachertrossen vorbehalten. Was uns hier fasziniert, ist die absolute Abschirmung von den Maschinengeräuschen. Schließt man die Augen, so hört man nur den Wind in der Takelage und das Rauschen der Bugwellen. Ganz wie auf einem Segelklipper… Wir stellen uns auf den Tritt an der Bugspitze und beobachten den stromlinienförmigen, raketenartigen Unterwasserbug, wie er mit 20 Knoten durch's Wasser schießt. Hier rauchen wir auch mal eine Zigarette und sinnieren im Dialog über alles, was uns so in den Sinn kommt.
Heute, am neunten Tag, nähern wir uns mit Kurs SW der Insel Madeira. Wir stehen am Bug und schauen aufs Spiel der Wellen, da ertönt aus der Meerestiefe ein langgezogener, tiefer Grunzlaut. Dann ein stöhnendes, röchelndes Ein- und Ausatmen. Ein Rülpsen, ein anhaltendes Wimmern.
„Reinhard, das kann nur Neptun sein. Er will uns etwas mitteilen.“
„Martin, ich dachte auch sofort an ihn, wollte es bloß nicht aussprechen.“
„Der will was von uns, er leidet.“
„Kann sein, aber was könnte der von uns kleinen Menschenwürmern wollen?“ - „Fragen wir ihn doch mal!“ - „Soll ich grunzen?“
„Neptun, ist dir nicht wohl? Können wir dir helfen?“
Wir lauschen, das Meer rauscht, und dann aus der Tiefe: „Duuuuurst!!!“
„Der hat doch sein Meer!“ - „Nein, eben klang es nach „Whiiiiiisky“!
„Ach, der arme Kerl! Haben wir bei unseren abendlichen Gute-Nacht-Tröpfchen auch nur ein einziges Mal an den Herren der Meere gedacht?“
„Nee, wir waren fahrlässig, fühlten uns sicher auf diesem Riesenpott, haben jede Ehrerbietung vergessen.“
„Bööööö!“ dröhnt es zu uns herauf.
„Schon gut! Noch heute sollst Du, ehrwürdiger Gott, Deinen Schluck bekommen – und nicht nur heute...“
Und an den Abenden, die folgen, spült fortan ein unsichtbarer Dritter seine Kehle so ausgiebig durch, dass wir noch eine neue Pulle kaufen müssen. Auf dem Vorschiff herrscht jetzt Ruhe. Aber eine Ahnung von Neptuns Anwesenheit sitzt ganz tief in uns.
Der Herzschlag der San Nicola trägt uns Tag um Tag, Nacht für Nacht in stetigem Tempo in Richtung Südwest voran. Eine beeindruckende Führung im Bauch des Schiffes durch den Ersten Ingenieur macht mich vor Maschinen, Turbinen, Kurbelwellen und Schaltsystemen zu einem Liliputaner, während dieser bescheidene und liebenswürdige bulgarische Ingenieur mit all seinem Wissen und Können für mich den Riesen verkörpert.
Nur selten einmal kommt ein Schiff in Sicht. Nicht lange, dann werden wir Brasiliens Küste vor uns haben. Heute schälen sich aus den Morgenwolken die Konturen einer der Kapverdischen Inseln heraus. Dieser Tag ist zugleich Auftakt meiner Kurze-Hosen-Saison, denn es ist spürbar wärmer geworden. Am frühen Nachmittag klingelt beim Tee mein Telefon. „Dr. Oetker“ melde ich mich. „Hier die Brücke, schnell, Schildkröten!“ Ich greife das Fernglas, bin in Sekunden oben. Martin ist auch schon da. Der Kapitän winkt mir zu und deutet auf einen großen gelben Fleck, ähnlich einem schmelzenden Butterstück in der Suppe. Die See ist glatt, wir fahren dicht an drei Schildkröten vorbei. Sie müssen sehr groß sein, denn trotz unserer Höhe erkennt man Kopf und Paddelbeine. Man freut sich - und zugleich überkommt mich Traurigkeit. Am liebsten würde ich mich bei diesen Urwelttieren entschuldigen, wie wir rücksichtslos mit Brachialgewalt ihr angestammtes Revier durchpflügen.
Dieses Zusammentreffen eines Superschiffes in all seinem Luxus und seiner Stärke mit einem Wesen, das den Gesetzen der Natur ausgeliefert ist und nichts anderes im Sinn hat, als an einem bestimmten Strand seine Eier einzugraben - das trifft mein Gemüt.
Heute queren wir die rote Linie des Äquators. Neben der Taufe mit Süßwasser, die mich zum Christen machte, hatte ich im hohen Alter schon die „Äquatortaufe“ auf 99° 12' Länge - ein Glas Sekt in der Hand - auf dem Pazifik und die mit Eisstücken in den Nacken vollzogene „Polartaufe“ am Nördlichen Polarkreis über mich ergehen lassen. Eine Beschreibung von „Taufen“ an Bord von Großseglern will ich mir hier ersparen. Im Sinne Neptuns müsste ich ein sauberer Mensch sein und brauche mich der Taufzeremonie nicht mehr zu unterwerfen. Aber Martin ist heute dran!
„Na, Martin, schon aufgeregt? Heute wird’s ernst!“
„Ja, hoffentlich hat Neptun gute Laune!“
„Ach bestimmt, bei unseren Opfergaben...“
Einige Stunden später macht Martin auf dem sonnenüberfluteten Deck seinen Kniefall und darf sich fortan „Baracuda“ nennen. Ein knusprig gebratenes Tierchen, namens „Spanferkel“ wird bei Anwesenheit der Mannschaft vom Kapitän angeschnitten. Damit ist eine Decksparty mit vielerlei Leckerbissen und Getränken eröffnet. Bis Mitternacht schallen die leidenschaftlich vorgetragenen Karaoke-Gesänge der Seeleute übers Meer.
Am Sonntag, dem 15. Februar, zeigt uns der „Erste“ auf der Seekarte die Insel Fernando de Noronha. Dort vorbei führt unser Kurs, und wir sehen, wie jedes Tages-Etmal sorgfältig in der Karte eingetragen ist. Überhaupt haben wir Passagiere unbegrenzten Zugang zur Brücke und lassen uns gern das „Hirn“ dieses stählernen Organismus erklären.
Mein kleines Radio gibt endlich wieder Töne von sich: Samba-Klänge und Lieder, aus deren Texten mir nur das Wort „Carneval“ bekannt vorkommt. Auf der ganzen Reise war und ist TV an Bord nicht möglich - Gott sei Dank!, Internetbenutzung muss mit dem Master abgesprochen werden.
Noch ist die Insel nicht in Sicht. Plötzlich schweben große Vögel geisterhaft über uns. Sie haben markant geschnittene, schmale Flügel und einen tief gegabelten Schwanz. Wie aus einer anderen Welt! Unheimlich wirkt ihr bewegungsloses, stummes Schweben, immer über dem Antennenmast des Schiffes, so, als sei es von ihnen als Beute auserkoren. Es sind Fregattvögel. In Flügelform, Größe und Gleitkunst sind sie dem Albatross ähnlich. Dieser lässt sich jedoch erst ab 40° südlicher Breite blicken, dem Reich der berüchtigten stürmischen „roaring forties“. Die Fregattvögel waren für die Leute auf den Segelschiffen freudig erwartete Botschafter von „Land in Sicht“.
Inzwischen sind in großer Zahl Meeresschwalben eingetrudelt. Sie machen Jagd auf fliegende Fische, die durch das Schiff aufgescheucht wurden. Und die Fregattvögel? Die überlassen die Beutejagd den kleinen flinken Meeresschwalben, heften sich dann aber an die erfolgreiche Jägerin. Da hilft kein Hakenschlagen, keine Finte - der große Schatten schwebt erbarmungslos über der Möwe. Erst wenn diese völlig erschöpft ihren Fang abgibt, ist sie den Verfolger los. Sind das nicht paradiesische Zustände?
Südamerikanische Küste
Das riesige rote Schiff erledigt treu seine Arbeit und verbraucht dabei etwa 100 Tonnen Öl in 24 Stunden. Als wäre die Kompassnadel auf der Außenbrücke festgenagelt, ändert sich für uns Laien nichts an der Richtung Südwest. Von Tag zu Tag steigt die Temperatur an. Mittags wird es so heiß, dass man nicht mit bloßen Füßen umhergehen kann. Im Schatten dagegen ist es durch Fahrtwind und Seebrise sehr angenehm. Bei Tisch und auf der Brücke werden wir natürlich über unsere Position aufgeklärt.
Mir zur Rechten hat der Kapitän, der Master, seinen Stammplatz. Zu den Mahlzeiten gibt es viele Gelegenheiten zum Gespräch. Er ist in den Vierzigern, macht einen sehr aufgeschlossenen Eindruck, sowohl politischgesellschaftlich als auch in allen Fragen der Schifffahrt und des modernen, globalen Seehandels. Unser Master lacht und spottet gern, trägt jetzt auch nur kurze Hosen und trinkt mit uns und den Offizieren am Feierabend in der Bar Bier vom Fass. Seine Wurzeln liegen in Oranienburg bei Berlin. Seine seemännische Ausbildung hat er nach dem Abitur bei der DDR-Marine erfahren, und gleich nach dem Mauerfall schipperte er schon über alle Meere dieser Erde.
Heute, am 18. Februar, sind seit unserer Abreise zum erstenmal andere Schiffe zu sehen. Um 19 Uhr zieht sich vor uns die brasilianische Küste in Südwest-Richtung entlang. Martin und ich liegen auf der Plattform G auf unseren Liegestühlen, als gegen 22 Uhr ein rötlich erleuchteter Himmel den Widerschein der Metropole Rio de Janeiro erkennen lässt, die wir allerdings hinter uns lassen. Bis dort sind es 35 Seemeilen.
Das Frühstück ist anderntags kaum heruntergeschluckt, da nähern wir uns dem Hafen von Santos, welcher der Millionenstadt Sao Paulo vorgelagert ist. Viele Schiffe liegen draußen „auf Reede“, d.h. sie müssen warten, bis sie einen Anlegeplatz zugesprochen bekommen. Wir dagegen haben freie Fahrt. Den an horizontweiter Wasserwüste gewohnten Augen wird eine belebende Sightseeing-Tour entlang der langgezogenen Meeresbucht geboten. Hügelketten mit tropischem Urwald, ausgedehnte Hüttensiedlungen, ein Fort aus portugiesischer Kolonialzeit und schließlich, sehr nahe, moderne Hochhäuser in Augenhöhe mit uns. Ein Lotse bringt uns bis zum größten Container-Terminal Südamerikas. Viele Kommandos gehen in den Maschinenraum, bis wir endlich ohne Schrammen sicher an der Pier liegen.
Die feucht-heiße Tropenluft kann uns beide Passagiere nicht davon abhalten, das Schiff zusammen mit unserem Kapitän zu verlassen, um uns die Stadt anzusehen. Da die City auf der Insel Sao Vicente liegt, gibt es für Fahrensleute einen besonderen Schnellboot-Zubringer dort hinüber. Nach einer Kontrolle mit Fingerabdruck sind wir mit Hilfe unseres ortskundigen Masters schnell im Zentrum. Dann geht er seiner Wege, nachdem er uns die Etappen des Rückwegs eingeschärft hat.
Wie soll man sich eine fremde, 500.000 Einwohner zählende Stadt in wenigen Nachmittagsstunden einverleiben? Dem Zwecke einer Stadtbesichtigung dient uns eine alte, ausgediente Straßenbahn mit offenen Holzwaggons. Alt, abgenutzt, heruntergekommen und so lá lá von der Substanz lebend – das ist auch der erste Eindruck von der Stadt. Wir fahren mit einer Standseilbahn auf den Monte Serrat. Im Maschinenhaus der Seilbahn zeigt man uns die über hundert Jahre alten, großen Zahnräder mit dem Prägestempel Siemens Berlin. Hier oben befand sich einst ein mondänes Spielcasino. Jetzt erinnert das Gebäude wie auch die Innenstadt an frühere Städte im „real existierenden Sozialismus“, d.h. an Verfall. Den Status eines Erholungsortes hat Santos seinem unendlich langen und breiten Sandstrand zu verdanken, der allerdings bei Flut regelmäßig überspült wird.
Der Menschentyp auf den Straßen ist die Mischung von Schwarz und Weiß über Jahrhunderte hinweg. In meinem Meyers Konversationslexikon aus dem Jahre 1872 lese ich später:
Die 10 Millionen gezählten Brasilianer bestehen außer der eingeborenen Urbevölkerung aus Portugiesen, Mischlingen zwischen beiden, Schwarzen und Indianern, freien Negern und Negersklaven, zu denen neuerdings noch Briten, Franzosen, Schweizer, Deutsche etc. gekommen sind…
Nach unserer beider Geschmack haben unsere Augen Schwierigkeiten, aus den Menschen auf der Straße hübsche Frauen herauszufiltern. Wir bemühen uns förmlich darum, aber - Pustekuchen. Eine nähere Begründung bleibt unser Geheimnis.