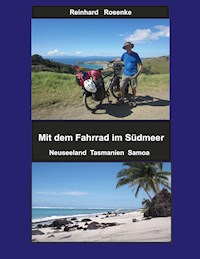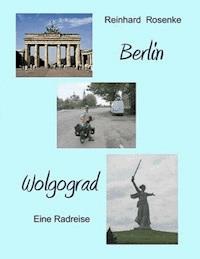7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Kurzbeschreibung: Im Sommer 2010 unternahm Reinhard Rosenke eine ausgedehnte Fußwanderung (etwa 1000 km). Ihn begeistert das seit 1990 grenzenlose, freie Europa, besonders dasjenige, welches hinter dem sogenannten Eisernen Vorhang verborgen war. Er entschied sich für eine Gebirgswanderung: Riesengebirge, Glatzer Bergland, Niedere und Hohe Tatra, Wald- und Ostkarpaten, auf der er vier Länder passierte: Tschechien, Slowakei, Ukraine, Rumänien. Was er dabei erlebte, fühlte und dachte, schildert er in diesem Buch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Die Sudeten
Der erste Tag
Im Isergebirge
Auf die Schneekoppe
Körpersorgen
Der Ton der Bienen
Mit Rübezahl unterwegs
Waldsteppe und Steppenwolf
Hier hat der Hund das Sagen
Im Braunauer Ländchen
Der Romantiker
Mützenkoller
Der lange Weg
Preußisches Schicksal
Nächtliches Leuchtfeuer
Die Beskiden
Zur slowakischen Grenze
Meine peinliche Geschichte
„Gott erhalte Franz, den Kaiser”
Hinter Bumbalka beginnen die Beskiden
Die Niedere Tatra lockt
Auf dem Kamm
Aus dem Leben eines Taugenichts
Vorsicht Schutzhütte
Von Quelle zu Quelle
Schutzhütte Andrejcova
Im Slowenischen Paradies
Schwierig ist das Zigeunerleben
In der Hohen Tatra
Die Karpaten
Transkarpatien
In Ushgorod
In die Waldkarpaten
Yaremcha
Der „heilige Berg”
Im Huzulenland
Zur rumänischen Grenze
Sighetu
In den Ostkarpaten
Zur Statia Meteorologica
Alles Glück der Erde
Ausklang
Gheorgheni und die letzte Tour
Ein bisschen „Dracula“
Brasov - Kronstadt
Bukarest
Die Sudeten
Der erste Tag
Der 16. Juni schickt sich an, die Serie sonniger und heißer Tage fortzusetzen. Ich hocke in den Startlöchern, meine große Fußtour soll heute losgehen. Da mein Zug nach Zittau von Berlin-Südkreuz schon gegen 6 Uhr abdampfen wird, umgibt mich jetzt auf meinem Weg zum Bahnhof noch die Frische des frühen Morgens. Im Zugabteil erfasst mich beim Hochstemmen des Rucksacks in Richtung Gepäcknetz von neuem der Gedanke, der sich einnistete, seit ich meiner Wohnung den Rücken gekehrt und die tausend Meter zur S-Bahn gelaufen war: Diese Last ist eine Strafe! Sie wird mich quälen, mich zum Kuli machen, mir das Laufabenteuer der kommenden sieben Wochen vermiesen.
Gestern Abend bescheinigte die Digitalwaage meinem gepackten Rucksack 15,5 Kilo. Meine liebe Nachbarin Hertha, 80jährig, „…hohes, hartes Friesengewächs…“, kam diesmal nicht mit dem Akkordeon für ein Abschiedslied, nein, sie wollte wissen, was „der Jung“ für die kommenden zwei Monate auf dem Buckel tragen würde. Als sie auf meine Einladung hin den Packen anheben wollte, kam nur ein stöhnendes „oh Gott!“ von ihren Lippen. Allerdings hatte ich ein großes Fresspaket hineingepresst - nichts sollte im Müllbeutel landen - und einen Liter Wasser in der Flasche. Fürchterlich! Bildlich gesehen drücken mir gut 15 große Getränkeflaschen auf die Wirbel.
Im Zug sitzt mir ein älteres Ehepaar gegenüber. Leider war ich so hilfsbereit, ihnen zu Beginn der Reise die Koffer ins Gepäcknetz zu befördern. Das ist dem Mann Anreiz genug, mich auf der weiteren Strecke mit seiner nicht endenwollenden Geschwätzigkeit zu belästigen. Da das Paar aus der Lausitzer Gegend stammt, erzählt mir der ehemalige DDR-Bürger ödes Zeug über Züge, Zugzeiten, Strecken, Bahnhöfe, über miese Polen und betrügerische Tschechen zu guten DDR-Zeiten. Nur Geschwafel, Gebrabbel. Wenn ich auch mal zu Worte komme, in der Hoffnung, etwas tiefer in früheren Zeiten zu bohren, ihm etwas Kritisch-Zeitbezogenes aus der Nase zu kitzeln, sagt er immer nur:„Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja – immer wieder diese vielen „Ja“, wie geistesabwesend. Beide steigen vor mir aus. Ich kann mich endlich ein wenig sammeln, meiner inneren Anspannung nachspüren, versuchen, mich über mein Vorhaben zu freuen.
Bahnhof Zittau. Erst mal - latsch latsch - ins Zentrum! Am Marktplatz der schönen Zittauer Altstadt ist es schon brütend heiß. Vielleicht rede ich mir den Rucksack schwerer als er ist? Mich zieht es in den schattigen Winkel eines Straßencafés. Bloß nicht gleich losstürmen! Zum Kännchen Kaffee mache ich mich an die Gewichtsreduzierung, sprich: Vertilgung von Stullen, Äpfeln und gekochten Eiern. Ohne Durst trinke ich die lauwarme Hälfte meines Wassers und betrachte das gemütliche Treiben ringsumher. Ein gewaltiger, noch junger Fettberg mit roten Haaren und rot angelaufenem Gesicht, den ich nach dem Weg zur Grenze frage, sagt: „Lieber fahren! Rot!“ Verstehe ich nicht. Schweißnass schreite ich ohne Elan mit schwerem Bauch und erleichtertem Rucksack in Richtung deutsch-tschechische Grenze.
Zur Grundausstattung für meine lange Tour gehören ein Biwaksack, ein dünner Daunenschlafsack, eine Iso-Matte. So kann ich im Ernstfall draußen übernachten. Wer bei tropischer Hitze loszieht, muss beim Packen soviel Phantasie entwickeln, sich das Kraxeln oder Biwakieren auch bei Bergeskühle, Nässe, Nebel, Regen und Hagel vorstellen zu können. So suchte ich in den zurück-liegenden Tagen miesgrämig das entsprechende Zeug zusammen. Was für ein Packen!
Bei kalten Abenden und Nächten im Freien braucht der Körper einen Tee oder ein heißes Süppchen. Ein Feuer wäre schnell entfacht, aber ich bin in Mitteleuropa, die Wälder sind knochentrocken und hohe Geldstrafen drohen. Also, hinein in den Rucksackschlund mit dem ersten Kocher meines Lebens und einem Packen Espit-Tabletten, dazu Töpfchen und Teekesselchen, Brühwürfel, ein paar Suppen!
Nach des Tages Arbeit freut man sich auf frische, bequeme Freizeitkleidung. Ich lege Hose, Hemd, leichte Weste, Unterwäsche und Socken zusammen. Schlafanzug ist nicht drin, das übernehmen Unterhose und T-Shirt. Das Hygienetäschchen umfasst kleine Nagelschere, Zahnzeug, Rasierschaber und eine mittelgroße Nivea-Dose. Als Gesichtssonnenschutz wähle ich einen Lippen-Sonnenschutz-Stift. Shampoo, gleichermaßen einsatzfähig für Körper- und Haarreinigung, als Rasierseife und Waschmittel erhoffe ich mir als Zugabe in den kleinen Hotels. Ein kleines Erste-Hilfe-Päckchen enthält verschiedene Pflaster, Verbände, einige Aspirintabletten und die kleinen „Neukönigsförder-Mineraltabletten“.
Wichtig, wenn auch mit beachtlichem Gewicht, sind mir das Mal-Tagebuch nebst kleinem Aquarellkasten. Ein schwerer Posten ergibt sich aus den Wanderkarten (Maßstab 1:40.000 bis 1:60.000), den Übersichtskarten, den aus vier Reiseführern (Tschechien, Slowakei, Ukraine, Rumänien) herausgetrennten speziellen Informationen und den Wortschatzteilen. Fotoapparat, Kompass und Taschenmesser hängen am Gürtel. Das vorab im Werte von je 200 Euro pro Land eingetauschte Geld steckt, nebst Pass, in den Seitentaschen der Hosenbeine. Für lange, einsame Abende begleitet mich mein handtellergroßes Taschenradio.
Die Sonne steht senkrecht über mir, keine gute Zeit zum Loswandern. Die Oberlausitzer Grenzstadt Zittau ist wendischen Ursprungs und trug einmal den Namen Chytawa. Sie galt lange Zeit als Eisenbahnknotenpunkt nach Görlitz, Prag und Wien und war bekannt als Hauptstadt der sächsischen Damast- und Leinwandindustrie. Zittau lag schon vor über hundert Jahren im Einflussgebiet großer Braunkohlegruben.
Vorbei an den verlassenen Kontroll- und Zollbuden der deutsch-tschechischen Grenze aus Vorwendezeiten folge ich einer alten Eichenallee. Laut Karte heißt das hügelige Land hier noch Lausitzer Gebirge. Auf den ersten Kilometern experimentiere ich mit meinem Schritttempo und mit der richtigen Einstellung der Schulter-, Brust- und Hüftgurte. Wie liegt der Rucksack am besten? Wie kann ich das Gewicht gleichmäßig auf Schultern, Hüften und Brust verteilen? Hinter Hradek, Grabsteyn und Chotyne leitet mich am frühen Abend ein schöner Waldweg in das Städtchen Chrastava, direkt an der Neiße. Ich muss nicht lange suchen, denn am zentralen Platz lädt mich ein kleines Appartement-Hotel mit Restaurant zum Bleiben ein. Ich bekomme eine holzverkleidete Unterkunft mit Holzstiege zum Schlafraum.
Die im Freien verzehrte Pizza schmeckt nach den ersten 25 Kilometern meiner großen Wanderung wunderbar. Voller Wohlgefühl studiere ich noch ein bisschen meinen Weg für morgen, schreibe Tagebuch und habe die ganze Zeit das Schwatzen, Lachen und Kichern dreier jüngerer Frauen im Ohr, die ebenfalls an dem langen Tisch sitzen. Ich glaube, sie reden alle gleichzeitig, jede ihren Monolog, aber jede besitzt offenbar die Fähigkeit, zugleich den anderen beiden zuzuhören. Und nicht nur das - sie müssen nebenbei auch noch beißen, kauen und schlucken! Ich bin beeindruckt, aber voller Sympathie, denn sie sehen nett aus und sind so fröhlich.
Warum ich diese Szene überhaupt erwähne? Weil ich einen längeren Moment ihres Schweigens erleben durfte. Ein Schweigen, das mir galt und mir deshalb äußerst peinlich war. Denn als ich mich nach dem Bezahlen erheben und mein Appartement aufsuchen wollte, funktionierte zunächst weder das eine, noch das andere: Schenkel und Waden schmerzten dermaßen, dass ich stöhnen musste. Die Muskulatur war hart wie Stein. Mich wieder hinsetzen? Lieber nicht - die könnten mir noch Hilfe anbieten... Bei jedem Humpelschritt befürchtete ich einen Faserriss. Ich entfernte mich mit schmerzverzerrtem Gesicht, an der Hauswand entlang tastend, von der in mitleidiges Schweigen verharrenden Frauengesellschaft.
Ausgerechnet ich, der Beinmensch, der nimmermüde Läufer und Radfahrer, biete ein Elendsbild, das selbst die muntersten Frauen verstummen lässt! So wird der kurze Weg in mein Appartement unerträglich lang. Niedergeschlagen sitze ich im Sessel und versuche, meinen Zustand zu verstehen. Es schmerzt wie Muskelkater hoch drei. Was tun? Die Muskeln müssen gelockert werden! Stundenlang beschäftige ich mich mit einem Wechsel von heißer Dusche, Massage und Teetrinken, bis weit in die Nacht. Morgens setze ich die Prozedur fort, denn sie hatte geholfen. Die Verursacher des Übels, 25 Wanderkilometer plus Rucksacklast, kann ich nicht ausklammern, denn sie sind immerhin vorerst die ureigenen Bestandteile meiner tagtäglichen Beschäftigung. Mir bleibt nur die Hoffnung, dass der zweite Wandertag ohne weitere Komplikationen verläuft.
Im Isergebirge
Mein erstes großes Ziel liegt in östlicher Richtung. Bergstrecken im Voraus abzuschätzen, das merke ich sehr bald, ist schwierig. Nicht jede Windung eines Weges oder Pfades ist auf der Wanderkarte sichtbar. Entscheidend ist der Schwierigkeitsgrad der Strecke. Ich kann vorher nicht einfach ein durchschnittliches Marschtempo festlegen, wie es im Flachland möglich wäre. So versuche ich, zeitlich großzügig zu überschlagen – na, wie lange werde ich wohl brauchen?
Die schmerzhafte „Muskelstarre“ von gestern abend, der erträgliche Muskelkater heute früh - nach den ersten Wanderkilometern ist und bleibt beides nichts weiter als eine Episode. Der Körper hat kapiert, was läuft. Meine Wanderroute habe ich so festgelegt, dass ich abends möglichst in einem Ort mit Hotel ankomme (Symbol H auf der Karte). Mir zur Seite habe ich einen Wanderstock aus Haselholz, den ich 1988 abgeschnitten und mit Schnitzereien verziert hatte. Seitdem hing er im Keller. Zufällig geriet er in mein Blickfeld. Vielleicht gibt er mir im schwierigen Gelände mehr Trittsicherheit, vielleicht schreckt er auch angriffslustige Hunde ab.
Meine „Gebeine“ waren bislang zu 90 Prozent auf Joggen eingestellt, Wochenpensum 60-70 Kilometer. Beim Wandern dagegen fehlt mir die Regel-mäßigkeit. Ich nehme Wanderangebote von Freunden gerne an. Es macht Spaß, auf märkischen Sandwegen zu laufen, besonders, wenn ein Ziel lockt, welches für mich zugleich eine Entdeckung bedeutet. Das Aufspüren des Grabsteins von Louis Fontane (1796-1867), des Vaters von Theodor Fontane (1819-1898), im einsamen, malerischen Oderland ist da nur ein Beispiel von vielen. Die Kombination von Landschaft und kulturgeschichtlichen Bonbons ergibt für mich die ideale Wandertour.
Ganz anders verhält es sich mit der vor mir liegenden, auf sieben Wochen geplanten Strecke. Plötzlich war sie da, die Idee: Ich will mal ausgiebig wandern, eine Bergwanderung, grenzenlos weit! Das „Weite“ hat nichts mit einer besonderen Leistung, gar einem „Rekord“ zu tun. „Weite“ bedeutet mir die Grenzenlosigkeit, die Freiheit des Ungebundenseins und die Freiheit, die mir mein gesunder Körper für physische Herausforderungen gestattet. Beim Blättern im Atlas blieb mein Auge an einem großen, braunen Haken hängen, einem Gebirgszug, der Deutschland berührt, sich am polnisch-tschechischen Grenzgebiet entlang zieht, den slowakischen Norden prägt, sich durch ein westliches Stück Ukraine bis nach Rumänien hinein schiebt, um sich dort zuerst ostwärts und später gen Westen krümmt. Das sind, grob eingeteilt, die Sudeten, die Beskiden, die Waldkarpaten und die Karpaten. Der Reiz, den ein solch bemerkenswerter Gebirgszug mit seiner geographischen Lage auf mich ausübt, wird durch die politische Landkarte verstärkt. Was hat sich in diesem Schmelztiegel der Völker nicht alles abgespielt!
Die von Reiseführern gepriesenen „Highlights“, die nicht unmittelbar an meinem Weg liegen, werde ich nicht ansteuern, um mich nicht zu verzetteln. Im Mittelpunkt steht das Erleben der Landschaft. Grob überschlagen, liegen vor mir mehr als 1500 Kilometer. Stark besiedelte Täler, die bevölkerungs-reiche Ebene der Mährischen Pforte und Gebiete, für die ich keine Wanderkarten bekommen konnte, werde ich per Bus und Bahn überbrücken.
Befinde ich mich noch im Lausitzer Gebirge? Leider wähle ich an einer Weggabel den falschen Weg und stoße bald auf die Autobahn nach Liberec (Reichenberg). Der Weg hört auf. Parallel zum tosenden Autostrom schlage ich mich durch Gestrüpp, Morast und Brennnesselfelder. Endlich fällt das Gelände ab, ich folge einem Fahrweg. Kurz vor Liberec verwursteln sich Wege, Straßen, Industriegebiete, Eisenbahnbrücken und Flussbrücken zu einem unübersichtlichen Wirrwarr. Eine Tankstelle winkt mit grellem Outfit. Reichlich ausgetrocknet, finde ich dort „Speis und Trank“, außerdem Informationen zu meiner weiteren Strecke.
Bis Bedrichov (Friedrichswald) windet sich die ruhige Straße auf 860 Meter hoch, und mein Atem geht ordentlich in die Tiefe. Hier sind wir schon im Isergebirge. Nach einer Rast merke ich etwas später, dass ich den Brustriemen nicht festgezurrt habe. Nanu, da fehlt etwas: das Befestigungsteil für die rechte Seite! Ein kleines, schwarzes Plastikteilchen. Nichts wie zurück und suchen! Ich finde es dort, wo ich es gar nicht vermutet hatte und kann es wieder in seine Schiene einfädeln. Das dürfte nicht passieren! Denn durch diesen Gurt übernimmt auch die Brustmuskulatur eine tragende Aufgabe, entlastet Rücken und Hüfte.
Zwei Kilometer vor Bedrichov lädt mich ein junger Handwerker zum Mitfahren ein. Er macht mich sogleich mit dem Gruß „Ahoi“ bekannt. Mit „Ahoi“ grüßt man sich in Tschechien und in der Slowakei, allerdings mehr unter Leuten, die sich kennen oder mit denen man einen persönlichen Umgang haben möchte. Die kurze Strecke reicht gerade mal aus, dass er mir auf englisch von seinen tausend Kilometern auf dem „Jakobsweg“ vor zwei Jahren erzählen kann. Ich lobe ihn, aber da sind schon die ersten Pensionen sichtbar! Ich muss aussteigen und wähle in diesem Straßendorf gleich eine „Penzion“ an der Straße. Der Wirt begrüßt mich auf „bemmisch“. Das Flair des gemütlichen Hauses erinnert mich an Bayern.
Eine Wandergruppe aus Frankfurt/Oder, nette Leute, die seit dreißig Jahren regelmäßig ihren Skiurlaub hier verbringen, leitet ihr Essen mit einer Knoblauchsuppe ein. Knoblauchsuppe ist, wie man mir sagt, in dieser Region sehr populär. So schlürfe auch ich davon und sättige mich weiterhin mit Klößen und Gulasch. Die Klöße sehen aus wie Weißbrotscheiben. Der Wirt ist neugierig, möchte wissen, wohin mich meine Tour führen wird. Was ich ihm vorstelle, veranlasst ihn zu einer allgemeinen Warnung vor den Ländern Ukraine und Rumänien. „Dort werden öfter Leute ausgeraubt! Es gab auch Morde! Vor allem bei den Zigeunern muss man aufpassen!“
Meine Reiselektüre Spaziergang nach Syrakus im Jahre 1802 des in Sachsen 1763 geborenen und in Böhmen 1810 gestorbenen Johann Gottfried Seume enthält, wie ich mit Vergnügen und Spannung nach und nach lese, alle Aspekte eines langen Fußmarsches, die einem auch heute begegnen können. Hin und wieder möchte ich aus diesem bedeutenden Reiseklassiker des 19. Jahrhunderts ein paar passende Sätzchen zitieren. So auch zu dem oben angesprochenen Angstthema:
Unsere guten Freunde jagen uns hier Angst ein, dass rund umher in der Gegend Räuber und Mörder streifen… Ich gehe getrost vorwärts und verlasse mich etwas auf einen guten, schwerbezwingten Knotenstock, mit dem ich tüchtig schlagen und noch einige Zoll in die Rippen stoßen kann…
Habe nicht auch ich einen guten Stock dabei?
Dichter Regen verzögert am nächsten Morgen meinen Abmarsch. Für Übernachtung, Abendessen, zwei große Biere und Frühstücksbuffet bezahle ich 710 Kronen, der Wirt lässt sich lieber 30 € geben. Warten liegt mir nicht. Raus in den Regen, auf nach Jizerka (Klein Iser)! Ich freue mich auf die Waldpfade und sehe diesen Tag als ersten richtigen Bergtag an. Fein und mild sprüht es vom Himmel, ich laufe in einer Wolke. In beständigem Auf und Ab gewinne ich an Höhe. Eine gelbe Markierung leitet mich. So kann ich mich in diesem Waschküchen-Dämmerlicht auf Wurzeln und Steine konzentrieren. Wie gelackt schimmern die nassen Fichtenstämme. Ihr Nadeldach hängt dunkel, schwer und tropfend über mir. Das Rauschen kleiner Bäche ist allgegenwärtig.
Nach einiger Zeit beginnt mein rechter Fußballen zu schmerzen. Das steigert sich zu einem brennenden, stechenden Dauerschmerz. Als würde ich über glühende Kohlen gehen. Ein Schmerz, der mir von meinem 100-Kilometer-Nacht-Lauf in Biel 1996 noch in Erinnerung ist. So kann man nicht gehen, geschweige denn rennen. Damals massierte ich den Fuß und schnürte den Schuh lockerer. Danach lief es (ich) reibungslos. Sollten meine neuen Bergschuhe trotz gründlicher Prüfung und fachmännischer Beratung zu eng sein? Meine Füße sind breit, orthopädisch gesehen ist das Fußgebäude aber für gut befunden worden.
Das Brennen veranlasst mich, die Zehen in ihrem Gefängnis zu bewegen. Das hilft kurzfristig. Außerdem bekommt meinen Füßen steiniger, unebener Grund besser als glatte Wegstücke, weil sich damit der Belastungsdruck geringfügig verändert. Das Problem muss angegangen werden. Ich setze mich auf einen nassen Stein und ziehe die Schuhe aus. Wie gut das tut, eine Befreiung! Die dicken Socken tausche ich gegen dünnere. Das Schuhwerk schnüre ich so, dass die untere Fußpartie mehr Raum hat, während der Knöchel fest umspannt ist.
Die Nässe lädt nicht zum Rasten ein. In großen Pfützen tummeln sich Scharen von Kammmolchen. Die habe ich seit meiner Kindheit nicht mehr gesehen. Je höher ich steige, desto geringer ist die Sicht. Nebel wallt - mal stärker, mal schwächer. Jizerka gibt es nicht nur als Ort, sondern auch als 1122 Meter hohen Berg. Ich strebe seinem Gipfel zu. Steiler, steiniger, ausgewaschener wird der Weg. Immer hartnäckiger und unwilliger denke ich an meine 15-Kilo-Last. Was kann ich aussondern? Ohne Pause überschreite ich den geahnten Jizerka-Gipfel, denn zu sehen ist nur Wasser: als Dampf, als Regenschleier und als Pfützengewässer. Kälte durchschauert mich in meinen von Schweiß und Regen durchgenässten Sachen. Ich eile bergab, erhoffe mir Wärme durch Bewegung.
Das Örtchen Jizerka liegt auf einer kahlen Hochebene. Scheinbar ungeordnet verteilen sich die Anwesen, die im Winter alle vom Wintersport leben: Bauden, Pensionen, Hotels. Ein Teil hat geschlossen, einige sind übers Wochenende ausgebucht. Schon mache ich mir Sorgen um eine Bleibe. Ich betrete das Gastzimmer einer ganz aus Holz gebauten Baude. Zwei junge Mädchen, eine am Computer, die andere hinter der Theke, grüßen so verhalten zurück, dass meine Hoffnung schwindet. Aber ich kann bleiben, bin der einzige im 6-Bettenzimmer. Hier kann ich warm duschen, habe eine warme Heizung im Zimmer. Nach dem servierten Sauerkrautgulasch bin ich restlos zufrieden mit dem Tag.
Beim Samstagfrühstück tauchen die Mädels gar nicht erst auf, sie haben alles zum Selbstbedienen vorbereitet. Aha, ich bin nicht der einzige Gast! Ein Pärchen setzt sich ohne Gruß an den Nachbartisch und spielt Karten. Beide sind dick, er mit einem schmalzigen Pferdeschwanz, Nickelbrille und Ziegenbart. Etwas später erscheinen noch zwei junge Paare, wieder ohne Gruß. Die hübsche Blondine ist gegenüber ihrem freundlich-verbindlichen Freund unsagbar eisig, starrt, ohne zu frühstücken, ohne ein Wort zu sprechen, bewegungslos auf einen Punkt. Der schwarzhaarige, ungekämmte Strubbelkopf des anderen Paares und seine zigeunerhaft in bunte Tücher gehüllte Begleiterin wechseln vom Kaffee zur bibbernd vor der Tür gerauchten Zigarette und wieder zurück zum Kaffee. Was führt diese sechs jungen Menschen hier herauf, in Gottes schöne Natur?
Kein Regen! - die Sonne setzt sich durch. Fröhlich, mehr abwärts als aufwärts, laufe ich bis Harachov, wo ich um die Mittagszeit eine Pizza verdrücke. Den Nebentisch teilt sich ein junges Paar mit Baby und ein altes. Oma und Opa beteiligen sich nicht am Gespräch, schauen wie weltentrückt dem süßen Enkelkind zu. Selbst ich vergesse das Kauen beim Anblick dieses winzigen, ungewöhnlich niedlichen, marzipanartigen Menschenwunders, das von der Mama gefüttert wird.
Mein Tagesziel ist Spindleruf Mlyn (Spindlermühle). Nach rund 25 Kilometern verlockt mich noch vor dem vermeintlichen Touristenzentrum ein beschauliches, kleines Hotel zur Einkehr. Ich bin einziger Gast. Der Wirt in rotem Overall und mit einem Beil in der Hand begrüßt mich freundlich, spricht sogar einige Worte deutsch und englisch. Ich bekomme ein hübsches Zimmer und ein makelloses Mittagessen. Ich kann mich mit dem Rucksackgewicht einfach nicht abfinden. Der Ärger darüber nagt in mir. In den Abendstunden schreite ich zur Tat. Aus dem untersten Rucksackfach zerre ich das Paar Joggingschuhe. Es war für die Feierabende gedacht. „Tut mir leid, ihr müsst hierbleiben.“ Der auf kühle Abende im Freien gemünzte Espit-Kocher, der ganze übrige Küchenkram? Weg damit!
Fazit: Schuhe und „Küche“ wiegen gut zwei Kilo. Belasse ich es außerdem angesichts der überall glucksenden Bäche bei der kleineren Wasserflasche (¾ l), dann bin ich einerseits körperlich, andererseits - was viel mehr zählt - gedanklich im Lot. Im Laufe der Zeit wird das Gewicht weiter abgebaut werden, denn der so viel wie ein dickes Buch wiegende Wust an Karten und Informationsmaterial wird, ist er einmal„abgewandert“, schnell im Papierkorb landen. Das „Buch“ wird stetig dünner werden. Die liebe Seele hat endlich Ruh. Ich überreiche am Sonntagmorgen dem Wirt die ausgesonderten, nagelneuen Dinge. Darüber staunt er, freut sich und haut mir gleich fröhlich zwei Eier in die Pfanne.
Auf die Schneekoppe
Spindlermühle ist ein klassischer Wintersport-Ort mit kleinen und großen Hotels, Parkanlagen, riesigen Bauden und schmückender Architektur des 19. Jahrhunderts. Nicht allzu weit wird die Elbe (Labe) geboren, sprudelt hier aber schon als respektables Gebirgsflüsschen unter der Brücke hindurch. Eine Weile verunzieren noch Liftanlagen, breite Schneisen und Massenunterkünfte meinen Weg, aber ab 9 Uhr heißt die Devise: bis Mittag zur Schneekoppe! Der Weg wird zunehmend steiniger und steiler, die Bäume verlieren an Größe, Lichtungen und Ausblicke tun sich auf. Von der polnischen (schlesischen) Seite her soll das Riesengebirge wie eine steile Mauer wirken. Da kann man meinen Aufstieg wohl als Schongang bezeichnen? Mir reicht’s auch so. Der erleichterte Rucksack ist nun nicht mehr mein Spielverderber, nein, er ist ab heute mein Kumpel. So zieht es sich durch unser ganzes Leben: Wir berühren Grenzwerte, deren Über- oder Unterschreitung auf uns eine neue Qualität und ein neues Handeln bewirken.
Die Landschaft ähnelt inzwischen einer endlos weiten, bergigen Tundra, von kleinen Schneefeldern weiß getüpfelt. Nach einem Dreistundenmarsch freue ich mich auf die Rast in der Lucni bouda (Wiesenbaude), einem großen, alten Holzbau mit Tradition. Der Speisesaal ist am heutigen Sonntag gut mit einem durchweg angenehmen Wanderpublikum gefüllt. Ich mixe mir ein „Radler“ aus Bier und Fanta. Soll ich die Schneekoppe besteigen und hier übernachten, oder soll ich nach der Besteigung bis Pomezni Boudy durchlaufen? Ich entscheide mich für’s Weiterlaufen. Die Schneekoppe (Snezka, 1603 m) erscheint wie aufgesetzt, zum Greifen nahe und wird von Wolken umlagert. 230 Meter erhebt sich der granitene Felskegel über den „Koppenplan“. Die Chance für einen freien Blick von oben ist für die nächsten Stunden gegeben, und meine Vorfreude schiebt mich voran.
Ameisenhaft bewegt sich eine Menschenkette bergan. Die meisten davon tragen nur kleine Rucksäcke. Viele klettern den steilen Pfad direkt nach oben, andere benutzen den Fahrweg, der sich als Serpentine hoch windet. Ich bevorzuge es gemütlich, kann dabei, ohne auf den Weg zu achten, weit in die blauviolette Ferne schauen. Oben habe ich Glück zu dieser Nachmittagsstunde! Von 100 Kilometern Fernsicht berichtete man früher. Heutzutage muss man sich mit kürzeren Distanzen zufrieden geben, aber ich finde ohnehin keine markanten Punkte, die mich fesseln könnten. Nicht weit, etwa zwei Kilometer nördlich, liegt das Städtchen Karpacz (Krummhübel), mir namentlich bekannt durch das „Haus Nesthäkchen“. Die Villa gehörte der erfolgreichen Autorin Else Ury (1877-1943). Mit ihren Backfischromanen von „Nesthäkchen“ begei-sterte sie über Jahrzehnte hinweg Millionen von Mädchen. Natürlich stoppten die Nazis den weiteren Druck und Verkauf. Ihr geliebtes Haus, das noch immer in Karpacz steht, musste sie 1938 laut „Verordnung über den Einsatz jüdischen Vermögens“ vom 3.12.1938 zwangsverkaufen. Im selben Jahr war sie sogar noch zu Besuch bei ihrem Neffen in London. Wäre sie bloß dort geblieben! Die Jüdin Else Ury wurde in Auschwitz ermordet.
10 Kilometer weiter, in gleicher Richtung , breiten sich die Häuser von Jelenia Gora (Hirschberg) aus, und im Osten erhebt sich die Kleine Koppe (1400 m). Der Riesengebirgskamm bildete bis zum Zusammenbruch der Habsburger Monarchie am Ende des Ersten Weltkrieges die Grenze zwischen Böhmen und dem einst vom jungen Friedrich dem Großen der Kaiserin Maria Theresia geraubten Schlesien. Auf böhmischer Seite des Gipfels stand eine katholische Kapelle, auf schlesischer (preußischer) Seite eine protestantische. Wichtiger als das Beten war aber sicherlich, dass man hier oben, egal ob Katholik oder Protestant, seinen Durst löschen konnte. Die Geschichte des Riesengebirges ist voller Geschichten über Schmuggler (Pascher), die schwer bepackt ihr Schmuggelgut auf geheimen Paschersteigen über die Grenze brachten.
Zu dieser Stunde, nach ausgiebigem Schauen und einigen Fotos bin ich weit entfernt von den romantischen Empfindungen der Menschen, von denen einige vor 200 Jahren von der Einsamkeit und Erhabenheit der Natur so sehr beeindruckt waren. Goethe schrieb, als er 1790 auf der Schneekoppe stand:
In der Dämmrung des Morgens den höchsten Gipfel erklimmen
Frühe den Boten des Tages grüßen/Dich, freundlicher Stern!
Kleist vermerkte nach der Bergbesteigung:
Leuchtend schreibet der Gott seinen Namen dahin.
Und am 10. Juli 1810 hat sich der Maler der Romantik, Caspar David Friedrich, als Landschaftsmaler aus Greifswald in Schwedisch Pommern… ins Gipfelbuch eingetragen. Von ihm existieren mehrere Riesengebirgs-Bilder. Sein Das Kreuz im Riesengebirge ist, wie fast alle seiner Kunstwerke, romantisch konstruiert und sehr eindrucksvoll. Fast ist es ein religiöses Bild. Einen frühen, rosa überhauchten kalten Morgen gibt der Künstler in dem Bild Riesengebirgslandschaft wieder. Schaut man es länger an, so könnte man angesichts der Kälte des aus den Tälern aufsteigenden Nebels, aber auch der Erhabenheit der kahlen, bis zur Schneekoppe sich hoch windenden Bergrücken erstarren. Ganz vorne in des Betrachters Nähe kontrastieren dunkles Felsgestein und knorrige, kahle Baumsilhouetten als Rest der Nacht mit dem neugeborenen Tag... Nun aber schnell zurück zur Gegenwart! Es gelingt mir hier in 1602 Metern Höhe kein Spagat vom Hier und Jetzt zurück in die Romantik. Der moderne Hotelbau, als Doppelrondell angelegt, glänzt und glitzert im Sonnenschein, die Gipfelfläche ist von fotografierenden Menschen belebt.
Auf der Schneekoppe
Mich hält es nicht länger als zehn Minuten, und schon steige ich bergab. Ein ausgeprägter, schmaler Pfad durch Latschenkiefergestrüpp und dem Binsengras des Hochmoores bringt mich genau in östliche Richtung. Manchmal dienen Holzbohlen zum Durchqueren morastiger Stellen. Das Laufen, nun wieder allein auf weiter Flur, mit der großartigen Sicht und leichtem Gefälle, ist wunderbar. Zwei Stunden später bin ich in Mala Upa und der beleibte Gastwirt des schmucken, kleinen Hotels Bouda Mala Upa meint zu meinem Entschluss, hier zu übernachten: „Nu, das ist schejn.“
Körpersorgen
Die Wetterunbeständigkeit hat sich davon gemacht. Morgens kitzelt schon früh die Sonne meine Nase. Fenster auf, herein mit der frischen Sommerluft! Über Dächern, Wipfeln und Höhenlinien breitet sich gleichmäßiges, allerhellstes Blau. Da hüpft mein Herz vor Lust und Freude. Ich kann sorglos gehen, ohne Wettersorgen, ohne Körpersorgen und in der Gewissheit, eine schöne Wegstrecke vor mir zu haben. Ohne Körpersorgen? Zwei Wochen vor meinem Start gab es, wie ich meinte, körperlich unvermeidbare schwere Tätigkeiten zu verrichten, etwa im Garten oder der Austausch eines alten 30-Kilo-Außenbordmotors auf meinem schwankenden Segelboot gegen einen neuen. Beide Motoren musste ich auf schwankenden Planken über die volle Bootslänge zum Bug und auf den Steg, bzw. in umgekehrte Richtung bugsieren. Nicht gerade rückenfreundlich. Wellenartig spürte ich in der Folgezeit leichte Rückenschmerzen.
Mein Rücken, genauer, meine Wirbelsäule, war vor zwölf Jahren schon mal einem Chirurgenmesser ausgeliefert gewesen. Zwölf Monate später konnte ich unter gewissen Vorsichtsregeln wieder alles tun, wobei mir besonders der Langlauf am Herzen lag. Fünf Wochen vor dem längst schon bezahlten „New York-Marathon 2007“ hatte mich plötzlich wieder der Rückenschmerz in seiner Gewalt. Auf dem Vorbereitungsseminar fragte ich, noch immer schmerzgeplagt, einen vortragenden namhaften Orthopäden um Rat. Der musterte mich, ließ mich auf sich zu gehen und sagte: „Laufen Sie! Laufen Sie durch den Schmerz hindurch!“ Das klang wie „Freispruch“, war Verheißung in meinen Ohren. Noch am gleichen Nachmittag lief ich in den schwäbischen Weinbergen zwei Stunden hintereinander, zuerst innerlich stöhnend und schneckenlangsam, dann immer befreiter, lockerer und mutiger. Am Schluss waren die Schmerzen verflogen. Es blieben mir noch drei Wochen behutsamen Trainings.
Unter den vielen Marathonläufen zähle ich meinen New York-Marathon, vor dem ich wegen meines Handicaps am meisten Schiss hatte, kurioserweise zu den leichtesten. Warum? Ich war auf das Schlimmste vorbereitet gewesen, bin deshalb langsam gelaufen, war locker und unverkrampft, verwandelte den Lauf mental in eine Sight-Seeing-Tour, die ich fotografisch begleitete, und als sich der Rücken brav verhielt, kam in mir eine regelrecht euphorische Stimmung auf.
Nach einer Rückenkrise sitzt mir immer etwas Angst im Nacken. Ich kam zu der Erkenntnis, dass das Hoffen auf eine unbeschwerte Zeit sinnlos ist, wenn ich diese Hoffnung nicht mit der Tat verbinde. Aus einer Mischung von Yoga, Gymnastik und isometrischen Übungen bastelte ich mir eine 30-Minuten-Morgen-Kür zusammen. Der innere Schweinehund - „…keine Lust…“ - stellt sich zwar regelmäßig ein, doch mir fallen keine Ausreden ein. Zeit ist vorhanden, und der Körper ist danach gut auf den anschließenden Morgenlauf vorbereitet. Jetzt, auf wochenlanger Tour, hätte ich die schöne Ausrede: Du bewegst dich den ganzen Tag, da ist Gymnastik überflüssig. Doch ich will mein Vorhaben nicht an (vielleicht) körperlichen Schwierigkeiten (Schwachpunkt: Rücken) scheitern lassen. Also hopp! Stärke deine Bauch- und Rückenmuskulatur! Spanne und entspanne dich! Dehne dich!
Der Ton der Bienen
Immer in tschechisch-polnischer Grenznähe muss ich heute aufmerksam auf mein weiß-rot-weißes Wanderzeichen achten. Ach, die Waldesstille! Gibt es die überhaupt? Ja. Kein von Menschen verursachtes Geräusch dringt an meine Ohren, kein Bächlein murmelt, kein Windhauch raschelt in den Blättern. Sogar die Vögel schweigen. Und doch schwingt ein Ton in der Luft. Ein ätherischer, die ganze Natur umfassender Ton. Tausende, gar Hunderttausende von Bienen verursachen hoch über den Baumwipfeln mit dem rasend schnellen Wirbeln ihrer Flügelchen den beherrschenden, in seiner Lautstärke gleich bleibenden Dauerton. Es erinnert mich unpassender Weise an den Ton der „Tröten“, die zurzeit in den südafrikanischen Fußballstadien den Europäern die Nerven rauben. Was mag das für eine Tonart sein? Ich nehme meine winzige Mundharmonika, die mir beim Wandern manchmal Abwechslung verschafft und finde schnell den identischen Ton. Es ist ein F, allerdings eine Oktave niedriger als auf meiner Mundharmonika. Auch die Waldwiesen werden ihre eigene Musik haben, atonal, denn hier summen nicht nur Bienen. Welch eine Blütenpracht! Mir geht die Gedichtzeile von Theodor Storms Mein Wunderland durch den Kopf:
Ein Land, wo Blumen Küsse tauschen in tausendfarb‘ger Pracht...
Ja, Morgenstund‘ hat Gold im Mund! Ich bin frisch und aufnahmefähig, nehme Düfte, Geräusche und Farben im vollen Bewusstsein auf. Stunden entfernt von der Schneekoppe, wenn mich mein Weg wieder aus dem Wald heraus und über Wiesen führt, beherrscht ihr Kegel deutlich mein Blickfeld. Warum nicht eine kleine Malpause einlegen?
Auch der Schriftsteller Hermann Hesse ist gerne gewandert, vorwiegend im Tessin. Im Rucksack dabei waren immer Aquarellkasten und Malblock. Über die Freude am Malen und die „Magie der Farben“ hat er sich oft geäußert:
Herrlich war das Malen, köstlich war das Malen! Schließlich versuchte ich, auch den Hintergrund etwas bestimmter zu geben, stieß auf Widerstände, geriet mit dem Pinsel voll Graugrün auf eine zu wässrige Stelle, es begann zu verlaufen... verzweifelt wischte ich ab, plötzlich war an allen Ecken zugleich der Teufel los... [1928]
Ja, so und ähnlich ergeht es mir oft. Das Malen ist und bleibt immer spannend. Ich lasse mich am Wiesenhang nieder. Schnell eine kurze Vorskizze. Kaum habe ich das schönste Himmelsblau in den Borsten, wird, als wäre es nicht gestattet, den Snezka zu malen, die Gardine zugezogen. Er ist und bleibt von Wolken verhüllt, und so wird es mein Bild wiedergeben. Ansonsten überall blauer Himmel. Ich sollte darüber nicht meckern, denn statistisch gesehen ist mein Aquarell ein Spiegelbild der üblichen Sichtverhältnisse.
Über sanfte Anhöhen windet sich mein Weg durch einen gesunden, alten Fichtenwald, ab und an aufgehellt von leuchtenden Waldwiesen. Verstreut weisen Holzhäuser (Chata) auf menschliche Anwesenheit hin, und in deren Umkreis wachsen auch Eichen, Eschen, Buchen und Birken. So schön könnte es von mir aus den ganzen Tag hindurch weitergehen. Aber für ein anschließendes Wanderstück brauche ich unbedingt die entsprechenden Karten. Deshalb peile ich als Ziel das Städtchen Zacler (Schatzlar) an. Um 14.30 Uhr bin ich dort. Kilometerlang ziehen sich die Häuser rechts und links der großen Straße dahin. Die Stadt ist mehr grau als bunt, mehr arm als wohlhabend. Es ist heiß, nur wenige Leute begegnen mir, auf der Straße rollt nur spärlicher Verkehr. Kaum Läden, hin und wieder eine „Penzion“ mit abgeblätterten Hinweistafeln, die mir zuflüstern: unsere Zeit ist längst vorbei.
Am Ende zeigt sich das kleine historische Zentrum mit Kirche, Rathaus und einigen stattlichen, alten Bürgerhäusern. Ein Buchladen für meine Kartenwünsche kam mir nicht zu Gesicht. Gerade passiere ich das Museum. „Frag doch mal hier nach!“ Ich drücke die Klinke - geschlossen! Ab 15 Uhr geschlossen! Wenige Minuten zu spät. Da tritt eine junge Frau heraus, mustert mich und fragt nach meinem Begehr. „Ich brauche dringend eine Landkarte.“ - „Ja, wir haben einige Karten. Kommen Sie mit mir!“ Sie spricht in einem gut verständlichen Deutsch. Innen schaltet sie eine Alarmanlage aus, ehe sie zwei weitere Türen aufschließt. Nun noch eine Treppe hoch. Die Frau ist Leiterin dieses Museums und weiß gut Bescheid. Sie fragt nach meinem weiteren Weg und legt mir eine brauchbare Karte vor, Maßstab 1:100.000. Dankbar greife ich zu. Mit Mühe und viel Fragerei finde ich in Zacler als einzige Übernachtungsmöglichkeit das Hotel Sport. Schnell schickt man eine Reinigungskraft hoch. Später erscheint noch einmal die Chefin, um sich der Sauberkeit des Zimmers zu vergewissern.