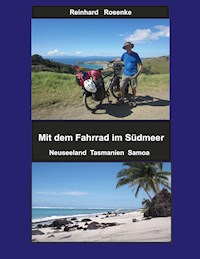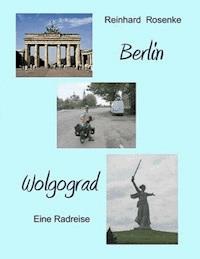Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Reinhard Rosenke, Jahrgang 1940, realisiert einen Jugendtraum, der erst nach dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums wahr werden konnte: er umradelt ganz allein in einem großen Bogen die Ostsee. Dabei durchquert er in drei Monaten alle Anrainerstaaten. Er schläft teils draußen im Zelt, teils in Pensionen, hat mit großer Hitze, Dauerregen, Starkwind und Kälte zu kämpfen, dennoch genießt er in vollen Zügen die großartige Landschaft Nordeuropas. Sie inspiriert ihn zu körperlichen Extremleistungen, deren Krönung die Sturmfahrt zum Nordkap und die Bewältigung des "Trollstigen" (850 Höhenmeter) in Norwegen sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meiner Gisela
gewidmet
Mein großer Dank gilt
meinem alten Fahrtenkumpel und Bruder Eberhard
fürs Lektorieren und für Unterstützung am Computer
Inhalt
DEUTSCHLAND
Aufbruch
An der Oder
POLEN
Erste Nacht draußen
Kriegserinnerungen
Einkehr
In der Kaschubei
Von der Weichsel zur Ostsee
Ostpreußisches
LITAUEN
Leid und Lied der Balten
Wie man sich bettet
Heydekrug
Kurische Nehrung
LETTLAND
Poesie und Gänsehaut
Kontakte
ESTLAND
Geldsorgen
Urlaub auf Saaremaa
Erlebnisse beim Übernachten
Im estnischen Kernland
Am Peipussee
Annäherung an Russland
Narva
RUSSLAND
Mütterchen Russland - authentisch
St.Petersburg
Von Russland nach Finnland
FINNLAND
Nachtrag zu Russland
Auf der Via Karelia
In Finnisch-Lappland
Du bist nicht aus Eisen
In der Finnmark
NORWEGEN
Im Land der Samen
Honnigsvåg
71 Grad 10 Minuten 21 Sekunden - mein Nordpol
Auf Regen folgt Sonne
Inselhüpfen
Lofoten - damals
Der Mahlstrom
Flüchtige Begegnungen
Trondheim
Der lange Weg zur Rosenstadt
Trollstigen
Mein letzter Fjord
Wo Knut Hamsun aufwuchs
SCHWEDEN
Kurs Schweden
Mein Gotteswort
Einsamkeit ade
DÄNEMARK
Entlang der Westküste
DEUTSCHLAND
Die Heimat hat mich wieder
Von Husum nach Rendsburg
Erste Reifenpanne
Ins Mecklenburgische
Heimkehr
Mein Fahrtenlied
Motto
DEUTSCHLAND
Aufbruch
Im Dämmerlicht des 1. Juni 2006 spielt sich auf einem Grundstück am südlichen Rand von Berlin eine geheimnisvolle Szene ab. Da nähert sich eine Gestalt dem Stamm einer hohen, abgestorbenen, astlosen Fichte, blickt prüfend nach oben und macht sich dann entschlossen an seine Besteigung. Die noch harzenden Aststümpfe ermöglichen es, bis an die schwankende Spitze zu gelangen. Jetzt zaubert die Gestalt unter dem Hemd eine an einem langen Stock befestigte kleine Fahne hervor, dazu Schnur, Schere und eine Rolle Klebeband. Eine Hand dient zum Festhalten, mit der anderen Hand und dem Mund gelingt es unter ziemlicher Mühe, das Fähnchen windfest aufzupflanzen. Auch jetzt weht es nicht schlecht, alles ist in Bewegung: der Fichtenstamm, die vor Anstrengung zitternden Knie, und auch der bunte Stoff flattert sogleich munter drauflos. Zufrieden begibt sich der Kletterer zurück auf festen Boden. Das Tuch zeigt ein weiß umrandetes blaues Kreuz auf weinrotem Grund: die Fahne Norwegens.
Ich, die Gestalt, der Kletterer, habe den Gedanken wahr gemacht, der mir gestern kam und für den ich umgehend mit dem Rad zum Segelladen am Wannsee radelte, wo man Wimpel und Fähnchen aller Art bekommt. Ohne dass ich es mir erklären kann, vielleicht weil die Vorstellung von der Riesenstrecke, die vor mir liegt, in mir einen Bammel erzeugt, ist diese kleine, nur für mich selbst inszenierte Zeremonie eine Art Beschwörung: Solange sich der Norwegenstander auf der Baumspitze im Winde bewegt, wird alles gut! Nebenbei soll es aber auch ein wenig zur Erheiterung der Hausbewohner und Nachbarn beitragen, die sich die Augen reiben und fragen werden: „Was soll denn das?“
Nun, der zum Himmel aufragende Fichtenstamm symbolisiert für mich die nach oben, nach Norden gerichtete Kompassnadel. Und nach Norden will ich noch am heutigen Donnerstagmorgen aufbrechen.
To the north to the north and you go with me old boy!
To the north to the north that´s my only joy…
Dieses Lied aus den Goldgräberzeiten am Klondike habe ich mit meinem Bruder Eberhard schon auf einer Fuß- und Kanutour in Kanada und Alaska gesungen und ein anderes Mal auf unserer gemeinsamen Fahrradtour zu Australiens
Nordspitze Cape York. Diesmal ist das Nordkap mein Ziel. Ich denke: „Nun flattere mal schön, liebes Fähnchen, halte durch, bis ich dort oben bin!“
Die Aufregung über mein bevorstehendes Abenteuer raubt mir den Frühstücksappetit. Das Fahrrad lehnt an der Hauswand, beladen mit vier Gepäcktaschen, außerdem Zelt, Schlafsack und Luftmatratze. Am Fahrradrahmen klemmt eine 1½-Liter-Trinkflasche aus Stahl. Ich gehe noch kurz zum nahegelegenen Grab meiner Gisela, die mich Anfang dieses Jahres für immer verlassen hat. Hertha, Uschi und Henry, meine lieben Hausbewohner, sagen mir ade und knipsen einige Fotos von dem mit grauem Regenzeug und einem alten Filzhut aus Alaska bekleideten Nordlandfahrer. Ungeprobt und daher für mich spannend werden die ersten gefahrenen Meter: Spur fahren, den Gartenweg entlang! Etwas wackelig schlingere ich mit der 28-kg-Last durch das Gartentor. Links, wieder links und dann rechts, und schon bin ich auf einem Feldweg in Richtung Osten. Erleichtert registriere ich: Das Fahren mit dem ungewohnten Gewicht macht keine Schwierigkeiten, sofern ich eine bestimmte Geschwindigkeit nicht unterschreite. Über vertraute Feld- und Waldwege, durch Dörfer und Kleinstädte, über Dahme und Spree lenke ich mein Gefährt gen Nordosten. Kurios, durch das Dörfchen Kiekebusch zu fahren, dessen märkischen Namen mein Hauswirt trägt. Interessant, in Erkner zufällig an der offenbar frisch restaurierten Laßen-Villa vorbeizukommen, in welcher der berühmte Dichter des Naturalismus, Gerhart Hauptmann, viele Jahre wohnte und wo er das Drama Vor Sonnenaufgang und die Novelle Bahnwärter Thiel geschrieben hat. Symptomatisch für die riesige vor mir liegende Wegstrecke ist mein erster Schweißverlust beim Auf und Ab durch die Märkische Schweiz. Und wohltuend die Worte einer Briefträgerin, mit der ich auf dem holperigen Pflaster von Buckow ein paar Worte wechsle: „Find ick jut, det Se sich det zutraun. Meen Mann würd ick det nich erlauben. Trotzdem: Komm Se jesund wieda!“
Der graue Himmel schickt einige Schauer herab, aber als ich eine kleine Imbisspause mache, beleuchten für einen Moment helle Sonnenstrahlen die Waldwiese vor mir wie eine Bühne. Einziger Darsteller ist ein schmucker Kranich, ungewöhnlich nahe für ein so scheues Tier. Fühlt er sich einsam? Seine lautstarken Trompetenrufe werden nicht erwidert.
Nachmittags - meine ersten 100 km liegen hinter mir - leuchtet plötzlich „Potsdamer Gelb“ durch hohe Baumwipfel. Das ehemalige Gutsschloss und jetzige
Start in Lichtenrade
Küstriner Festungsreste an der Oder
Sorenbohm
Ostseebad Stolpmünde
Schlosshotel Wulkow heißt mich willkommen. Denn diesen kleinen Gag will ich mir vor den vielen kommenden Zeltnächten noch leisten: die erste Reisenacht in einem Schloss! Zuerst und zuletzt sah ich das Schloss an einem wirbelnden, schneereichen Wintertag zusammen mit Freunden. Jetzt posiert gerade eine Hochzeitsgesellschaft für ein Foto vor dem stolzen Bau.
Wir sind hier schon am Rande des Oderbruchs. Nur wenige Kilometer entfernt liegt das von Friedrich Karl Schinkel 1823 umgebaute Barockschloss Neu Hardenberg. Friedrich der Große hatte es einst dem Rittmeister bei den Ziethen-Husaren, Joachim Bernhard von Prittwitz, nach Ende des Siebenjährigen Krieges geschenkt. Prittwitz hatte in der Schlacht von Kunersdorf, östlich der Oder, mit einer mutigen Attacke seinen König vor der Gefangennahme durch die Kosaken gerettet. Beim Abendbrot bin ich in einem kleinen Saal fast allein.
Ein großes Bücherregal weckt meine Neugier: Vielleicht finde ich noch eine interessante Abendlektüre? Ich schaue, schaue genauer und kann mir ein Grinsen nicht verkneifen. Das hier muss der komplett übernommene Bücherbestand aus einer DDR-Provinzbibliothek sein. Parteilich und parteiisch zusammengestellte Zeigefingerlektüre für politisch unmündig gehaltene Bürger. Zwar macht das den Einrichtern des Hotels keine Ehre, aber jetzt, 16 Jahre nach dem Mauerfall, hat dieses Bücherregal ja schon einen musealen Charakter.
An der Oder
Mit einigen belegten Brötchen vom Frühstück im Gepäck, einem blauen Himmel über mir und voller innerer Spannung schwinge ich mich am Morgen des 2. Juni in den Sattel. Auf ruhigen Landstraßen rolle ich auf den deutsch-polnischen Grenzübergang Küstrin zu. Ich denke an den bevorstehenden Tag in Polen. Ich denke aber auch unvermeidlich an die Oderschlacht von Mitte April 1945, bekannt als die Schlacht um die Seelower Höhen, deren Ausläufer ich gerade durchfahre. Dieses natürliche Hindernis musste die russische 8. Gardearmee unter General Tschuikow noch nehmen, dann konnte sie fast ungehindert bis nach Berlin vorstoßen. Einer gewaltigen Streitmacht von 900.000 gut ausgerüsteten sowjetischen Soldaten standen westlich der Oder fünfmal weniger deutsche Soldaten gegenüber, längst schon ausgeblutet, zusammengewürfelt und unzureichend bewaffnet. Weit über 100.000 Soldaten mussten auf beiden Seiten hier in wenigen Tagen ihr Leben lassen. Es war die größte Schlacht, die jemals auf deutschem Boden stattfand.
Auf dem weiteren Weg nach Küstrin fallen mir die zahlreichen neuen oder neu renovierten Häuser sowie nagelneue Asphaltstraßen und befestigte Wege auf. Nach dem letzten Oderhochwasser von 1997 hat der Staat hier wohl sein Versprechen gehalten. Es geht gegen Mittag, ist warm geworden. Ich verwandle meine lange Goretexhose mittels Reißverschlüssen in eine kurze. Nacktbeinig werde ich denn auch den größten Teil meiner Reise zurücklegen.
Da, die Oderbrücke! Die Reste der einstigen Festung Küstrin ziehen sich als Grundmauern aus roten Ziegeln am Ufersaum des Flusses hin. Berühmtheit erlangte diese Festung einst durch die Haft des jungen Kronprinzen Friedrich, der - im Range eines Oberleutnants - geplant hatte, vor seinem tyrannischen Vater, dem „Soldatenkönig“, zu desertieren. Er musste hier mit ansehen, wie man seinen Freund und Mitwisser, den Leutnant Hans Herrmann von Katte, in der Nacht vom 5. zum 6. November 1730 auf dem Festungshof exekutierte.
Nicht weit von der Oderbrücke, die ich gerade überquere, zeigt ein hoher, sandsteinfarbener Pylon auf seiner Spitze den fünfzackigen Sowjetstern. Dicht dabei, auf stabilen Sockeln, T-34 Panzer. Kleine Dinger im Vergleich zu den heutigen Monstern. Das Fahrrad schiebend nehme ich die Bilder in mir auf. Schon weisen weiße Spurpfeile und Hinweisschilder auf die nahe Grenzkontrolle hin. Als Radler nehme ich mir das Recht, die Reihen der langsam vorrückenden Autos zu überholen, bis ich direkt am Kontrollschalter stehe. Polnische und deutsche Zollbeamte versehen hier gemeinsam ihren Dienst. Ein kurzer Blick in meinen Pass, ein knappes Durchwinken - und ich befinde mich mitten im polnischen Freitagnachmittagverkehr von Kostrzyn (Küstrin) an der Warta (Warthe).
Ich folge der Hauptstraße, bis ich am nördlichen Ausgang der Stadt den Richtungspfeil nach Szczecin (Stettin) sehe. Für heute habe ich Debno (Neudamm), vielleicht auch noch Mysliborz (Soldin) angepeilt. Ein dichter Verkehrsstrom fließt in meine Richtung. Der weiße Streifen, der mich von der zweispurigen Fahrbahn abgrenzt, gibt meinem unbehelmten Kopf ein sicheres Gefühl. Meinen Fahrradhelm habe ich in der Garage hängen gelassen. Vor zwei Jahren kaufte ich ihn zusammen mit dem Rad. Bin ja schließlich über hundertmal die 17 km zur Charité gehetzt, wenn Gisela nach einer Operation dort liegen musste. Und sie bestand irgendwann einmal darauf, dass ich mit dem Schutzhelm fuhr. Auf dieser Reise aber will ich den Kopf frei haben und bin ja nur noch für mich selbst verantwortlich.
In Debno ist allerhand los. Viele Geschäfte, viele Menschen, besonders junge, die Eis essen und munter in ihrer polnischen Sprache schwatzen. Hier darf der Radfahrer auf den breiten Bürgersteigen fahren. Die Wochenendatmosphäre beschwingt mich. Doch schnell bin ich wieder bei den vorbeidonnernden Lastern auf der Straße. Wenn der Begrenzungsstreifen fehlt, und das geschieht immer häufiger, verkrampft sich mein Körper instinktiv, will sich klein machen - aber das gibt sich mit der Zeit.
POLEN
Erste Nacht draußen
Später Nachmittag, 115 km gefahren, mir reicht‘s für heute. Von einer sanften Steigung geht ein Feldweg seitab, von Büschen eingefasst. Ohne zu zaudern verlasse ich die hektische Straße. Nach hundert Metern knickt der Weg ab, und vom Lärm der Autos ist nichts mehr zu hören. Tief atme ich durch, schmecke den Duft von Gras und Erde. Kein Problem, ein Plätzchen für das kleine Zelt für die erste Nacht „fern der Heimat“, zu finden.
Das Zelt ist nagelneu. Sein „Rückrat“ besteht aus mehreren, durch Gummiband verbundenen Aluminiumröhrchen, die ich ineinander stecke und dann in die lange Stoffröhre des Zeltes schiebe, so dass es eine tonnenartige Wölbung annimmt. Wichtig sind die vier Alu-Heringe für den Zeltboden und sechs für die langen Schnüre mit den Spannern. Die grüne Außenfarbe soll mich neugierigen Blicken entziehen. Das Zeltinnere ist unterteilt in Vorraum und Schlafzimmer. Nun sitze ich im Abendsonnenschein, esse meine Klappstullen vom Hotel Wulkow, trinke klares Wasser und habe auch noch eine Süßigkeit als Nachtisch. Das Tagebuch muss noch geschrieben werden, und die Packordnung in den vier Taschen wird bestimmt nicht zum letzten Mal umgemodelt.
Zwar habe ich keine Waffe bei mir, aber doch einen Verteidigungsgegenstand: Hundespray. Noch nie vorher in Erwägung gezogen, geschweige denn angewendet, muss ich zumindest einmal ausprobieren, wie man mit der kleinen Spraydose hantiert. Aus einem Blatt Papier reiße ich eine Zielscheibe zurecht, groß wie ein Hundegesicht. Es ist fast windstill, also kein Problem, aus ein bis zwei Meter Entfernung das Papier zu treffen. Ich stelle mir vor, wie der Hund sich bewegen würde und gebe noch einige schnelle „Schüsse“ in unterschiedliche Richtungen ab. Nun muss ich aber selbst flüchten, um das Zeug nicht in die Augen oder Atemwege zu bekommen. Meine Skepsis über die Wirkung auf einen schnell attackierenden, kräftigen Hund bleibt bestehen. Im Schlafsack veranstalte ich meine erste „Tagesschau“ mit den heute geknipsten Bildern. Die Canon, eine Digitalkamera, ist neu für mich, aber ich habe schon gemerkt, um wieviel einfacher das Fotografieren ist als mit meiner alten Rollei 35.
Der „Indianerschlaf“, den ich mir während Giselas jahrelanger schwerer Krankheit angewöhnt hatte, stellt sich hier in „freier Wildbahn“ schon in der ersten Nacht wieder ein. Zwar schlafe ich, registriere aber gleichzeitig die Geräusche meiner Umgebung. Wenn man außerhalb eines Zeltplatzes irgendwo alleine kampiert, liegt immer eine unbestimmte Gefahr in der Luft. Nicht durch Tiere, sondern durch Menschen, denen man letzten Endes alles zutrauen kann. In dieser Nacht vernehme ich aus allen Himmelsrichtungen das unterschiedlichste Bellen, Jaulen, Kläffen von Hunden, ferne Schüsse, das Rascheln irgendwelcher Kleinsäuger, das scharfe „Öck-Öck“ rivalisierender Rehböcke und das sich nähernde und dann wieder entfernende Knattern eines Motorrades. Schon gegen drei Uhr sickert Helligkeit durch die dünnen Zeltwände, und es wird empfindlich kalt. Kein Problem mit meinem Daunenschlafsack.
Kriegserinnerungen
Als ich um sechs hinauskrieche, tappe ich durch totale Nässe. Schwerer Tau hat sich abgesetzt. Somit hebt mit diesem Morgen die Ära der „Tau-Wäsche“ an: einmal mit der Hand durchs hohe Gras, das bringt nicht weniger als ein Wasserhahn. Auch Ganzkörper-Taubäder und Zähneputzen mit Tau werden schnell zur Routine. Die Wasserflasche bleibt allein dem Trinken vorbehalten. Noch brauche ich fast 90 Minuten, bis ich wieder auf dem Rad sitze. Mit „Training“ dauert es in wenigen Tagen nur noch halb so lange. Ich starte leicht beunruhigt, denn irgendwas tut sich auf meiner rechten Pobacke. Eine bestimmte Stelle juckt, schmerzt und schwillt. Das kann nur von einem Insektenstich herrühren! Mal abwarten, was daraus wird.
Mein heutiges Ziel ist das Ostseedorf Sorenbohm (Sarbinowo). Unsere Mutter hatte die letzten beiden Kriegsjahre mit meinem älteren Bruder und mir in Sohrenbom verbracht, um den Bombenangriffen auf Berlin zu entgehen. Meine Mutter erzählte, der große Schauspieler Heinrich George hätte einmal im Dorfgasthaus „Hoppe-hoppe-Reiter“ mit mir gespielt. Das könnte in der Zeit gewesen sein, als er im nahe gelegenen Kolberg als Hauptdarsteller in dem Durchhalte-Propaganda-Film Kolberg mitwirkte.
Als der Donner der näherrückenden Front und der nicht endende Strom der Flüchtlingstrecks eine Entscheidung verlangte, brachte uns ein Bauer - mit dem meine Mutter öfter mal Skat gespielt hatte - mit dem Pferdewagen nach Köslin (Koszalin). Von hier folgte eine nächtliche Fahrt im offenen Güterzug unter Flugzeugbeschuss nach der von den Nazis zur Festung bestimmten Hafenstadt Kolberg (Kolobrzeg). Im chaotischen Durcheinander der Bahnhofshalle hatte mich die Mutter an eine Schnur geknotet, zu Recht, wie spätere jahrzehntelange Suchdienstsendungen im Rundfunk bewiesen. Viele Kinder waren auf der Flucht verloren gegangen und nur zu oft wussten sie noch nicht einmal ihren vollen Namen.
Trotz des ungeheuren Menschengedränges am Kai gelang unserer Mutter das Kunststück, einen Decksplatz auf einem Schiff zu ergattern. Allerdings war dabei sämtliches Gepäck bis auf einen großen Topf mit Schmalz abhanden gekommen. Ich erinnere mich noch an einzelne Szenen vor und während dieser winterlichen Schiffsfahrt, z.B. an eine große Gruppe Verwundeter mit weißen Verbänden, an einen Schwarm „Goldfasane“: hohe Funktionäre der NSDAP in goldgelben Uniformen, denen natürlich ein Platz auf dem Schiff sicher war, an treibende Eisschollen in bewegter See, an nächtliche Eiseskälte, an mehrfaches Stoppen der Maschinen, wenn Treibminen gesichtet wurden und an einen weiteren nebligen Tag, bis wir endlich Swinemünde erreichten. Später habe ich viel über die unvorstellbare Leistung der Handels- und Kriegsmarine gelesen, die über zwei Millionen Flüchtlinge noch im allerletzten Moment, zwischen Ende Januar und Anfang Mai 1945, in den Westen brachte. Eine rechtzeitige Flucht hatte die Naziführung unter schwere Strafe gestellt.
Nun kehre ich auf ruhigen Straßen und bei schönem Wetter nach Sorenbohm zurück. Der Leuchtturm über den Kiefernwipfeln, der spitze Turm der Kirche, das Ensemble alter Häuser rings um den Kirchplatz - in mir blitzt keine Erinnerung auf. Selbst der Strand ist in meiner Erinnerung breiter und weißer. Das Dorf hat sich zu einem unorganisch wild wuchernden Badeort entwickelt, der mich ernüchtert und mir nichts mehr bedeutet.
Einkehr
Mit jedem weiteren Tag wächst der Insektenstich am Gesäß zu einem geschwürartigen Gebilde heran. Ich kann es nicht sehen, aber abtasten. Und natürlich schmerzt der Sattel. Ich sitze oft krumm und schief, um die entzündete Stelle zu entlasten. Denn bei jedem Tritt in die Pedale reibt die Haut am feuchtgeschwitzten Stoff der Hose. Eines Morgens platzt endlich der Abzess und eine nicht für möglich gehaltene Menge von Eiter, Wundwasser und Blut versaut meine schöne, neue Liegematte. Der Druck ist nun raus und der Schmerz wesentlich geringer. Aber auch in der Folgezeit sondert sich in Abständen ab, was der Kampf der Körperabwehr gegen die bösen Entzündungserreger hinterlässt.
Meine Art von Behandlung: Abtupfen mit Kognak und Abdecken mit einem Zellstoffpflaster. Dass es zu keiner Infektion kommt, habe ich nach meiner festen Überzeugung dieser Art der Behandlung zu verdanken. Allerdings werde ich das letzte Pflaster erst im fernen Lappland abziehen - und das „Medizinfläschchen“ längst vorher in Russland nachfüllen. Eigentlich wollte ich ja mit dem knappen Kognak jeden zurückgelegten Tausender und jedes neu betretene Land begießen…
Darlowo (Rügenwalde), Ustka (Stolpmünde), Slupsk (Stolp). Wellige Moränenlandschaft mit Kartoffeläckern, fruchtbare Felder, blühender Raps, Feuchtwiesen, ausgedehnte Waldstücke, schattige, den Wind abschirmende Alleen. Jede Stadt, jedes Dorf in diesem Teil Polens kommt mir so vertraut vor, als wäre ich schon hier gewesen. Kein Wunder, gehörte doch das, was der Krieg an Kirchen, Bahnhöfen, Postämtern und Wohnhäusern übrig gelassen hat, zum alten preußischen Kernland. Mich überkommt ein ähnliches Gefühl wie früher bei Tagesausflügen in die DDR. Typisch deutsch und vertraut, aber sehr heruntergekommen.
Tristesse kommt aber bei mir hier in Polen nicht auf. Der post-sozialistische polnische Kapitalismus sorgt überall für Farbigkeit und für markante Inseln des Wohlstands. Ob Jugendmode, Kaufhäuser, Lebensmittelmärkte oder der sehr rege Autoverkehr, alles kann man zum europäischen Standard zählen. Das gute Aussehen polnischer Frauen - bilde ich mir das nur ein? Oder legen sie wirklich mehr Wert auf ihre äußere Erscheinung als die deutschen Frauen? Aber vielleicht fände ich ähnliche Unterschiede auch zwischen Bayern und Niedersachsen? Also Vorsicht mit Verallgemeinerungen, Reinhard!
Mit den vielen Storchennestern in den Dörfern kann selbst unsere Mark Brandenburg nicht mithalten. Bei Adebars scheint das Familienleben besser zu funktionieren als bei uns Menschen. Und den Dörflern gilt der Storch nicht nur als Kinderbringer, sondern ganz allgemein als guter Geist für Haus und Hof.
Zweimal hintereinander gewähren mir verwilderte Apfelbäume Obdach:
Bei einem Wirte wundermild,
da war ich jüngst zu Gaste;
ein goldner Apfel war sein Schild
an einem langen Aste.
Diese Zeile aus Ludwig Uhlands Gedicht Einkehr kommt mir in den Sinn, obwohl ja an goldne Äpfel noch längst nicht zu denken ist. Die starken, tief herabhängenden Äste dieser knorrigen, noch blühenden Bäume bieten einen idealen Sichtschutz für das Zelt.
Im Schutze des einzigen Apfelbaumes, der auf dem kargen Sand einer Vordüne viele Jahrzehnte bis zu seiner jetzigen, vollendeten Form heranwuchs, umfängt mich das gleichmäßige Rauschen der Ostseewellen. Als ich am Morgen sein gastliches Dach verlasse und mit Tempo abwärts, Richtung Chaussee, sause, gerate ich in eine tiefe Sandmulde und werde mit Schwung auf den rauhen Asphalt geschleudert. Wie ein Reibeisen zerfetzt er die Haut am rechten Knie.
Bei weiteren Stürzen im Verlauf der Reise lande ich wieder und wieder auf diesem verdammten Knie, so dass es nie richtig verschorfen kann. Alle Fliegen Ost- und Nordeuropas erwählen es zu ihrem Sammelplatz, auf dem man sich an frischem Blut gütlich tun kann, manchmal aber auch sein Leben verliert. Erst zu Hause kann die Wunde endgültig vernarben.…
Meine nächste Apfelbaumherberge lockt mich mit ihren zartrosa Blüten auf ein verwildertes Feld. Während ich fürsorglich meinen geschädigten Hintern blank in die Abendsonne halte - neben Kognak und frischer Luft meine wichtigste Heilkraft -, umkreist eine Füchsin mit drei rotflauschigen Welpen meinen Ruheplatz. Ich habe allerhand zu tun, aber immer dann, wenn ich nach den Tieren schaue, sehe ich die gespitzten Ohren der Füchsin an einer anderen Stelle, und jedesmal näher dran, zur Beobachtung. In meinem Kopf verwandelt sich der Titel meines Lieblingsfilms Der mit dem Wolf tanzt in Der mit dem Fuchs tanzt. Ich wäre enttäuscht, wenn Mutter Fuchs mich an diesem milden Abend verlassen würde.
In halb liegender Position, durch das dichte Blattwerk des Baumes zur Chaussee hin gedeckt, verspeise ich meine Abendmahlzeit. Kraniche lassen sich einige hundert Meter entfernt für die Nacht nieder, und drüben, vor einer Himbeerhecke, balgen sich die Fuchswelpen, so als wäre ihr Todfeind Nummer eins nicht ganz in der Nähe. Welch ein Vertrauen in meine Harmlosigkeit! Eine schlaue Fuchsmutter! Am nächsten Morgen
…dann fragt ich nach der Schuldigkeit
da schüttelt er den Wipfel
Gesegnet sei er alle Zeit
von der Wurzel bis zum Gipfel.
Marienburg
Freund Adebar
Allee in Polnisch-Ostpreußen
Ostpreußische Landschaft
In der Kaschubei
Danzig umfahre ich in großem Bogen, so wie ich auch weiterhin jede größere Stadt wegen des Autoverkehrs meiden werde. Hinter Lebork (Lauenburg) gerate ich geradewegs auf eine zünftige Bergtrainingsstrecke. Dieser Teil des Baltischen Höhenrückens heißt Kaschubische Schweiz. Eine schöne, liebliche Landschaft, diese „Kaschubei“: Berge, Rinnenseen, sumpfige Urstromtäler, Mischwälder und gepflegte Ortschaften. Heute bekennen sich 350.000 polnische Staatsbürger zur kaschubischen Minderheit. In Günter Grass‘ immer noch bekanntestem Werk Die Blechtrommel lamentiert die kaschubische Großmutter des Oskar Mazerath:
So isses nu mal mit de Kaschuben, Oskarchen, …die missen immer dableiben und Koppchen hinhalten, damit de anderen drauftäppern können, weil unerains nich richtich polnisch is und nich richtich deitsch jenug, und wenn man Kaschub is, das raicht weder de Deitschen noch de Pollacken.
Im Gegensatz zu den protestantischen Kaschuben, den Slowinzen, wurden die katholischen Kaschuben nach dem Krieg nicht aus ihren angestammten Gebieten vertrieben und haben sich ihren Dialekt erhalten. Für mich ein kleiner Trost bei dem Gedanken, dass das Ostpreußische in wenigen Jahren ausgestorben sein könnte. Neuerdings hat der polnische Geldadel die schönsten Plätze in der Kaschubei entdeckt und mit prachtvollen Immobilien bestückt. Hoffentlich ist das nicht der Beginn einer Zersiedelung, wie wir sie in Deutschland längst vorexerziert haben.
Ein Landrover stoppt neben mir und ein sympathisch aussehender, smarter Mitvierziger steigt aus. Woher weiß er, dass ich Deutscher bin? In gutem Deutsch fragt er nach Woher und Wohin und nennt mir landschaftliche Perlen, die ich mir noch anschauen sollte. Er hat sein großes Geld mit einer Gebäudereinigungsfirma im Ruhrgebiet gemacht Hat nach dem Architekturstudium als kleiner Hilfsarbeiter angefangen und sich irgendwann mit einem Freund selbständig gemacht. Nun wohnt er hier in seinem eigenen, großen Haus und verdient sein Geld als Bauunternehmer.
Bei starkem Gegenwind arbeite ich mich voran, es geht stundenlang bergauf und bergab. Das macht Hunger und Durst. Deshalb kommt mir nachmittags das gepflegte Restaurant in einer Jugendstilvilla gerade recht. Anstatt Brot, Käse, Tomaten und Joghurt will ich mal „echt polnisch“ speisen. Gottlob habe ich noch vor zwei Stunden mein Hemd in einem Bach gewaschen, weil ich meinen eigenen Schweißgeruch nicht mehr ertragen konnte. Inzwischen ist das Hemd am Körper getrocknet und duftet nach Rei in der Tube. Der junge, freundliche Kellner spricht gut deutsch. Er ist Student und jobbt hier immer in den Sommerferien. Ich bestelle eine sauersüße, mit Sahne abgemilderte Krautsuppe im Brotteig, Schweinebraten, Kartoffeln und eine mit Rosinen und Backpflaumen delikat abgeschmeckte Soße. Dazu Salat aus geriebenen Möhren, Weißkraut und Rotkraut. Dann passt nur noch ein kühles Bier in den vollen Wanst.
Weiter! Ab 15 Uhr schweift das Auge prüfend übers angrenzende Gelände. Bis ein passendes Plätzchen für die Übernachtung gefunden ist, kann durchaus noch eine Stunde vergehen. Denn wenn‘s nicht ganz hart kommt, stelle ich an den Lagerplatz einige Anforderungen: er sollte vor menschlichen Blicken geschützt sein, an einem Hang mit Waldrand liegen, vom Wind befächelt (wegen der Mücken, Bremsen und Fliegen) und von der Abendsonne beschienen werden. Diesmal habe ich Glück.
Doch mitten in der Nacht signalisiert mir mein „Indianerschlaf“ zwischen den ersten Baumreihen eines Mischwaldes plötzlich Gefahr. Da war ein merkwürdiges Geräusch im Wald hinter mir. Es klang auf dem trockenen Laub nach einem gleichmäßigen, sehr zögernden Schreiten. Immer wieder einige langsame Schritte, dann Pause. Diese Pausen verstärken den Eindruck von Vorsicht, von Anpirschen und Lauschen. Genau auf mich zu! Bis zur letzten Haarspitze angespannt liege ich da und lausche. Dann pelle ich mich schnell aus dem Schlafsack. Mein Messer liegt, wie jede Nacht, griffbereit neben mir. Aber für eine bessere Waffe bei dunkler Nacht halte ich meinen Fotoblitz, der jeden Angreifer für einen Moment blenden wird. Wer, zum Teufel, könnte das nur sein, hier im Wald? Jetzt höre ich noch einen zweiten sich nähernden Schritt. Ebenso vorsichtig. Sind es Jäger? Wilderer? Nach meiner Uhr kann die Dämmerung nicht mehr weit sein. Der erste Schritt hat den Wald seitlich von mir verlassen, verharrt auf der Wiese, so dass ich mich quasi zwischen den beiden befinde. Eine verdammt unheimliche Angelegenheit! Im Zeltinnern fühlst du dich in Gefahrenmomenten ohnehin wie in einem Sack gefangen.
Plötzlich ertönt von der Mitte der kleinen Wiese her ein tiefes, lang gezogenes, löwenähnliche Grollen. Ich atme auf, meine Anspannung löst sich. Ja, diesen Laut kenne ich! Noch einmal ein tiefes Grunzen. Wie als Antwort auf den unappetitlichen Vokallaut antwortete der Waldkumpel mit einem öligen Rülpser. Dann anhaltende Stille, kein Laut mehr. Für ein Greenhorn wäre diese nächtliche Szene sicherlich bis zum Schluss ein Alptraum gewesen. Dabei waren es nur zwei Hirsche, denen mein Zelt wohl ebenso unheimlich war wie mir ihr zögerlicher Schritt. Und wie wilde Tiere so sind, haben sie sich geräuschlos davon gemacht.
Von der Weichsel zur Ostsee
Der Vormittag ist mit Steigungen bis zu 12% gespickt. Ich schaffe es noch immer ohne Schieben bis oben, denn die Berge sind nicht allzu lang. Und ich konstatiere, dass ich bergauf mein Gesäß entlaste. Der Druck auf das Geschwür verringert sich, weil ich mich mit dem Lenker den Berg hochziehe. Der gleiche Effekt ergibt sich bei Gegenwind. Na bitte, so hat die Schinderei doch etwas Gutes! Etwas anderes aber ist überhaupt nicht gut: Die Löcher, in die ich am Straßenrand hin und wieder mit dem Hinterrad gerate, fordern ihren Tribut. Zwei Speichen brechen, das Rad schleift an einer Bremsbacke. Jede Speiche weniger erhöht natürlich die Belastung für die anderen Speichen.
Aber ich habe ja Ersatzspeichen und Spezialwerkzeug zum Abschrauben des Kranzes dabei. Es gelingt mir auch, eine Speiche durch ein Speichenloch zu fädeln, muss sie nur noch mit dem Gewinde festdrehen. Nanu! Das geht nicht! Die Speiche ist viel zu kurz! Und die anderen? Alle gleich kurz! Verdammter Mist! Da haben sich die hilfsbereiten Jungs vom Fahrradladen fahrlässig verschätzt. Was nun? Abends, auf meinem Lagerplatz, entscheide ich: Das Gewicht muss runter! Es folgt eine langwierige, gründliche Inventur und danach eine radikale Gewichtsreduzierung: Lebensmittel, Topf und Pfanne, Beil, ein robustes Fahrradschloss, Werkzeug, entbehrliche Teile der diversen Sprach- und Reiseführer, Skandinavienkarten und noch etliches Kleinzeug werden aussortiert. Da ich weiß, dass Zelt und Schlafsack zusammen knapp 7 kg wiegen, hänge ich beides an das eine Ende einer kleinen Wippe. An das andere Ende kommt ein Plastikbeutel mit den aussortierten Sachen. Erst, als sich beide Gewichte die Waage halten, bin ich zufrieden. Somit wiegt meine Bagage ab morgen früh nur noch 21 kg!
Den Plastikbeutel stelle ich, mit einem aus Wörterbuch-Polnisch zusammengestoppelten Brief versehen, auf die Bank einer Bushaltestelle. Der Finder kann sich freuen. Ich schätze, auch mein Körpergewicht hat sich in diesen ersten ungewohnten Fahrtagen schon verringert. Den Gürtel schnalle ich jedenfalls bereits um ein Loch enger. Also nur noch 73 kg statt 74?
Erleichtert im dreifachen Sinne überquere ich schon früh um sechs bei Tczew (Dirschau) die mächtige Weichsel. Urplötzlich nimmt die Landschaft ein neues Gesicht an, wird platt und grün wie friesisches Marschland. Aber meine Aufmerksamkeit wird vom Verkehr absorbiert. Das Fahren auf der Europastraße mit Autobahncharakter jagt mir Angst ein. Saumäßige Seitenstreifen! Pausenlos donnern die Laster vorbei, was oft mit dem Gefühl körperlicher Berührung verbunden ist. Aber auch das ist mal vorbei.
Endlich kann ich mich auf das Geländer der Nogatbrücke lehnen. Ich bin in Malbork (Marienburg). Am Ufer erhebt sich in rotem Klinker die mächtige Burg des Deutschen Ritterordens, Ausgangspunkt von Eroberungen und Missionierungen im Mittelalter. Es ist der größte Backsteinbau und der drittgrößte Burgkomplex Europas. Ich setze mich - zu noch früher Morgenstunde - auf eine Bank am Westufer des Nogat und empfinde beim Anblick der Türme, Tore, Ringmauern, Schlösser und des Hochmeisterpalastes wieder einmal einen gewaltigen Respekt vor der Leistung unserer Vorfahren.
Mit der „Goldenen Bulle von Rimini“ 1226 bestätigte Friedrich II., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, dem Hochmeister des Deutschen Ordens Hermann von Salza:
… Daher haben wir dem Meister die Vollmacht erteilt, in das Preußenland… einzudringen… und überlassen und bestätigen dem Meister, seinen Nachfolgern und seinem Hause sowohl besagtes [Kulmer] Land… wie auch alles Land, das er mit Gottes Zutun in Preußen erobern kann.
Endlich hatte der Orden einen Platz zum Bau einer Burg gefunden, um dann getreu dem Satze des Bernhard von Clairvaux zu handeln: „Christliche Mission - das heißt entweder Taufe oder Tod!“
Etwa 3000 Ritter gehörten dem Orden an, dem eine 200-jährige Blütezeit beschieden war. Erst mit der Schlacht bei Tannenberg am 15. Juli 1410, von den Polen „Schlacht bei Grunwald“ genannt, in der 12.000 bis 15.000 Ritter und Ordens-Söldner den Kampf gegen ein 20.000 Mann starkes polnisch-litauisches Heer verloren, ging es mit dem Orden bergab.
Weil es für eine Besichtigung viel zu früh ist und ich mit Gisela schon vor 34 Jahren einmal hier war, frühstücke ich Kuchen, Brot und Käse im Angesicht dieses nach dem Zweiten Weltkrieg vorbildlich restaurierten Bauwerks. Hier wurde von polnischer Seite nicht Rache durch Zerstörung eines historischen Baus geübt, wie wir es aus der DDR hundertfach kennen.
Soeben hat ein armer Mensch, der sich vom Erlös einiger in Mülltonnen gefundener Leerflaschen eine Flasche Bier geholt hat, diese fallengelassen. Traurig starrt er auf den in das Erdreich sickernden Gerstensaft. Ich spendiere ihm eine neue, denn es wird ja schon wieder heiß. Dann fahre ich auf Feldwegen und schmalen Straßen bis nach Elblag (Elbing), der bis zum Zweiten Weltkrieg zweitgrößten Stadt Ostpreußens, die große Bedeutung als Hafen- und Seehandelsstadt hatte. Die große Kirche St. Nikolai, in Backsteingotik, überragt alle Neubauten um sie her, und auch hier wieder, wie in so vielen anderen polnischen Städten, finde ich ein Ensemble fachmännisch restaurierter Häuser.
Auf einem Platz seitab eines riesigen Kirchenneubaus schallen mir wilde, zündende Melodien entgegen: Akkordeon, Klarinette, Geige, Posaune, Tambourin, Gesang - das ist die Mixtur, die für Stimmung sorgt. Die Musiktruppe wirbt über Lautsprecher für den Kauf feilgebotener CD‘s. Zwei alte Frauen, eine mit Kopftuch und einem freundlichen, zahnlosen Lachen, die andere mit der Einkaufstasche in der Hand, tanzen temperamentvoll mit gekonnten Schritten zur Musik. Auch mich stimmt schon der Zusammenklang dieser Instrumente fröhlich. Das Lied nistet sich in mein Gehirn ein, bleibt haften, ich pfeife es noch Wochen später.
Der weitere Weg bringt mich über Tolkmicko (Tolkmit) am Frischen Haff durch die hohen Buchenwälder der Elbinger Höhen und unter hundert Flüchen wegen der nicht nachlassenden Anstrengung nach Frombork (Frauenburg). Mir reichen die heutigen 130 Kilometer. Jetzt einen Platz zum Zelten suchen? Nein, lieber schaue ich nach einem Zimmer. Und da weist mir auch schon ein bescheidenes Schild „Zimmervermietung“ die Richtung zu einem adretten Gartenhaus, wenige Minuten vom kleinen Hafen entfernt.
„Dzien dobry“ (Guten Tag). Die freundliche Vermieterin zeigt mir ein einladendes Zimmer mit Bad - für 50 Sloty (25 €). Minuten später stehe ich unter der Dusche, wasche alle Klamotten, die es zu waschen gibt und stelle fest, dass ich auf einen Vollbart verzichten werde. Habe schon genug graue Haare auf dem Kopf, da muss ich nicht auch noch um die Schnauze grau sein…
Geduscht, mit sauberem T-Shirt und Jeans, genieße ich eine Stunde später jeden Schritt durchs Städtchen. Brauche mich nur noch darum zu kümmern, wie ich am angenehmsten meinen Hunger stille. Auf der Terrasse eines Restaurants verspeise ich einen Riesenzander zu Kartoffeln und delikaten Salaten, stopfe dann noch quarkgefüllte russische Bliny hinterher und schließe mit einem großen Glas Bier. Nun noch eine langsame Genussrunde um die mit vielen kleinen Türmchen und Dachreitern geschmückte gotische Kathedrale.
Frombork (Castrum dominae nostrae, Unserer Frauen Burg) ist der Ort, an dem Nikolaus Kopernikus (1473-1543) an seinem die Welt verändernden Werk De revolutionibus orbium coelestium arbeitete, mit dem er beweisen wollte, dass die Erde nicht im Mittelpunkt des Weltalls steht, sondern sich als Planet um die Sonne dreht.
Ein Gang noch zum kleinen Fischerhafen. Am Platz finde ich ein Geschäft, in dem man alles bekommt, was in der DDR einmal unter dem Begriff „revanchistisch“ firmierte. Zum Beispiel polnische Landkarten mit den deutschen Städtenamen der Vorkriegszeit, oder Faksimile-Drucke deutscher Ansichtskarten und Bücher. Auch ich ärgerte mich ja über die unversöhnliche Tonlage seitens der Funktionäre der Vertriebenenverbände. Das bedeutet aber doch nicht, dass man die Geschichte der ehemaligen deutschen Provinzen aus dem Gedächtnis streichen muss. Und mit der Möglichkeit des Reisens haben sich mittlerweile viele private Kontakte zwischen den ehemaligen und den heutigen Besitzern von Häusern und Bauernhöfen ergeben.
Frauenburg ist über die polnische Grenze hinweg berühmt wegen seiner Orgelmusiktradition. Jedes Jahr findet hier im Juli/August das „Internationale Festival der Orgelmusik“ statt. Ich kaufe mir eine CD mit Originalaufnahmen von Orgelkonzerten aus der hiesigen Kathedrale. Später im Zimmer mache ich erste Bekanntschaft mit dem polnischen Fernsehen. Alles dreht sich um die bevorstehende Fußballweltmeisterschaft. Aber bald fallen mir die Augen zu. Wohliges Einschlafen in einem richtigen Bett! Ein scheußlicher Alptraum weckt mich zwischendurch: Gisela muss zur Dialyse, aber ich finde unser Auto nicht im Labyrinth von Gassen, Höfen, Kellern voller ignoranter Menschen…