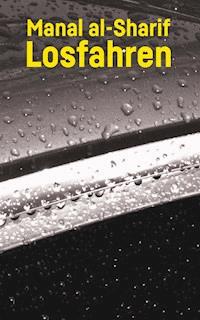
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Secession Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Saudi-Arabien ist das letzte Land, das Frauen noch das Autofahren verbietet. Ein Gesetz gibt es nicht, nicht einmal eine religiöse Begründung. Es ist eine Frage der Macht in einer Gesellschaft, in der Frauen weitgehend rechtlos sind. Es ist nicht mehr als ein Gewohnheitsrecht, das Männer für sich reklamieren. Manal al-Sharif hat sie herausgefordert: Die Computerexpertin ist es leid, ihren Bruder fragen zu müssen, wenn sie in ihrem eigenen Wagen zu einem Geschäfstermin gefahren werden will. Sie setzt sich selbst ans Steuer, lässt sich dabei filmen und stellt dieses Dokument des zivilen Ungehorsams ins Internet. Neun Tage sitzt sie dafür im Gefängnis. Und es wären wahrscheinlich viele mehr gewesen, wenn nicht ein weltweiter Proteststurm sie befreit hätte. Losfahren erzählt aus erster Hand von diesem Aufstand im Auto, mit dem Manal al-Sharif eine Frauenbewegung in Gang setzte, die den Gralshütern des Patriarchats im Königreich immer mehr zu schaffen macht. Aber Losfahren ist viel mehr als das. Selten gab ein Buch so tiefe Einblicke in den streng geregelten Alltag einer saudischen Familie. Offen und eindringlich schildert Manal al-Sharif ihre Kindheit und Jugend, in der sie auf dem Weg war, eine vom Salafismus beeinflusste radikale Muslima zu werden, die das Elternhaus von "unreiner" Musik säuberte und sogar Aufnahmen ihres Bruders im Ofen einschmolz. Die Helden dieser Generation waren die islamistischen Extremisten, die Vorläufer des heutigen Terrors, die den nach ihrem Verständnis zu liberalen Staat auf ihre Weise herausforderten. Am eigenen Leib erlebt Manal al-Sharif die Widersprüchlichkeit des in zwei Generationen zu immensem Reichtum gelangten Landes. Trotz bester Schulnoten wird sie zu Hause immer wieder verprügelt, um ihren Platz an der Uni, wo sie getrennt von männlichen Kommilitonen unterrichtet wird, muss sie kämpfen, und als sie bei der Ölfirma Aramco gemeinsam mit Männern in einem Büro arbeitet, wird sie als Flittchen beschimpft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 500
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Manal al-Sharif
Losfahren
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel»Daring to Drive – A Saudi Women’s Awakening«© 2017 Simon & Schuster, New YorkCopyright © 2017 by Manal al-Sharif
Erste Auflage© 2017 by Secession Verlag für Literatur, ZürichAlle Rechte vorbehaltenÜbersetzung: Gesine Strempel unter Mitarbeitvon Joachim von ZepelinLektorat: Malte RauchKorrektorat: Dr. Peter Natterwww.secession-verlag.com
Gestaltung und Satz:Erik Spiekermann und Marco Stölk, BerlinHerstellung: Renate Stefan, BerlinDruck und buchbinderische Verarbeitung:Friedrich Pustet, RegensburgPapier Innenteil: 100g Fly 05Papier Vor- und Nachsatz: 130g Fly05Papier Überzug: BilderdruckGesetzt aus Lyon & FabrikatPrinted in GermanyISBN 978-3-906910-10-9eISBN 978-3-906910-11-6
Wir danken Dr. Thomas Würtz für seinen Rat bei den arabischen Ausdrücken und den islamischen Fachbegriffen.
Anmerkung der Autorin: Dieses Buch beruht auf meinen persönlichen Erinnerungen. Ich habe mich dabei bemüht, so genau wie möglich zu sein, aber ich kann für mich nicht beanspruchen, eine Historikerin oder eine Religionswissenschaftlerin zu sein. In den allermeisten Fällen habe ich die Namen weggelassen oder ausschließlich die Vornamen benutzt.Alle Irrtümer oder fehlenden Details sind unbeabsichtigt.Ich entschuldige mich für alle Fehler, die auf den folgenden Seiten stehen.
Was mir widerfährt, kann mich verändern.Aber ich lasse mich nicht verbiegen.
MAYA ANGELOU
Die Weißen werden dich beschuldigen,Unruhe zu stiften.Dabei hast du nur wie ein Mensch gehandelt,statt dich zu unterwerfen.
ROSA PARKS
Es erscheint immer unmöglich,bis man es gemacht hat.
NELSON MANDELA
Kapitelverzeichnis
Kapitel EinsEin Land mit einem König und Millionen Königinnen
Kapitel ZweiKakerlaken und Gitterstäbe
Kapitel DreiUnreine Mädchen
Kapitel VierMekka im Belagerungszustand
Kapitel FünfHinter dem Schleier
Kapitel SechsMeine Barbie wird ermordet
Kapitel SiebenDie verbotene Satellitenschüssel
Kapitel AchtAngestellt und wohnungslos
Kapitel NeunLiebe und der Falafel-Mann
Kapitel ZehnLebe frei
Kapitel ElfFrauen am Steuer
Kapitel ZwölfIm Königreich saudischer Männer
Kapitel DreizehnAboya geht zum König
Kapitel VierzehnDer Regen beginnt mit einem einzigen Tropfen
Kapitel Eins
Ein Land mit einem König und Millionen Königinnen
Die Geheimpolizei kam um zwei Uhr morgens, um mich zu holen. Schlug gegen die Tür. Ein zweiter Schlag schnell hinter dem ersten. Ein lautes, hartes Geräusch, dröhnend, das den Türrahmen erzittern ließ. Mein fünf Jahre alter Sohn schlief. Ich war noch wach und saß mit meinem Bruder zusammen.
Er sprang erschrocken auf und eilte zum Eingang. Ich hielt mich etwas hinter ihm, spürte den Strom der kühlen Nachtluft, als er die Tür aufriss. Es war Mai, schon warm, aber noch angenehm, nicht drückend heiß. Alles war dunkel. Das Verandalicht war seit Wochen defekt, und ich hatte mir nicht die Mühe gemacht, die Glühbirne zu ersetzen. Ich dachte an die Beleuchtung, fragte mich, ob der Lärm meinen Sohn geweckt habe – beiläufige Gedanken, die mir in jenen Sekunden, bevor sich alles änderte, durch den Kopf schossen.
In der Dunkelheit konnten wir lediglich die Schatten der Männer erkennen, die sich um meine Eingangstreppe scharten und zur Tür drängten. Sie trugen keine Uniform, nichts, woran man sie hätte erkennen können. Als mein Bruder fragte, wer sie seien, schwiegen sie. Schließlich sagte einer: »Ist das hier das Haus von Manal al-Sharif?«
»Ja«, sagte mein Bruder mit fester Stimme ohne zu zögern.
»Sie muss mitkommen, sofort. Die Polizei in Dhahran will sie sprechen.« Mein Bruder musste nicht nach dem Grund fragen. Gestern Nachmittag hatte mich die Polizei angehalten, ich hatte das Verbrechen begangen, das Auto meines Bruders zu fahren. Genauer gesagt bestand das Vergehen darin, als Frau am Steuer gesessen zu haben.
Mein Bruder hatte neben mir gesessen, auf dem Beifahrersitz, und dann saß er fünf Stunden neben mir bei der Verkehrspolizei in Thuqbah in einem zweigeschossigen unscheinbaren Regierungsgebäude aus Beton, das von einem massiven Zaun umschlossen war. Dort gab es einen Trakt, in dem Autofahrer bis zu zwei Tagen festgehalten werden konnten. Es gab nur eine einzige Zelle, und die war ausschließlich für Männer bestimmt. Ich bin ziemlich sicher die erste Frau gewesen, die jemals dieses Polizeigebäude betreten hat. Die Beamten brauchten mehrere Stunden, einschließlich eines Anrufs beim Polizeichef und eines Besuchs im Regierungsgebäude des Gouverneurs der Stadt, um ein Dokument zu verfassen, das ich unterschreiben sollte. Es war eine Erklärung, in der ich mich verpflichtete, nie wieder in Saudi-Arabien Auto zu fahren. Ich weigerte mich zu unterschreiben, aber sie bestanden darauf. Als mein Bruder das Papier las, wurde ihm bewusst, dass ich hier lediglich zugab, gegen saudische Sitten verstoßen zu haben, denn festgeschriebene Gesetze, die Frauen verbieten, Auto zu fahren, gibt es in Saudi-Arabien gar nicht. Man konnte mir lediglich vorwerfen, den Urf, also den nicht schriftlich fixierten herrschenden Verhaltenskodex, missachtet zu haben. Ich unterschrieb, und wir durften gehen. Mein Bruder und ich fuhren mit dem Taxi nach Hause und glaubten, die Sache wäre damit erledigt, wir glaubten, das System ausgetrickst, einen kleinen Sieg davongetragen zu haben.
Wir fuhren zurück zu mir nach Hause, wo der Fernseher lief. Auf dem Couchtisch lagen Pizzaschachteln, drei meiner Freundinnen hockten samt Laptops und Smartphones im kleinen Wohnzimmer eng beieinander. Als ich eintrat, brach meine Schwägerin in Tränen aus, meine Freundinnen stürzten sich auf mich, umarmten mich und riefen, sie könnten einfach nicht glauben, dass die Polizei mich laufen gelassen habe. Ein Freund hatte sogar einen Hashtag auf Twitter eingerichtet, #FreeManal, nachdem ich ihm noch aus dem Auto eine Text-Nachricht geschickt hatte, dass ich von der Polizei angehalten worden war. Alle redeten durcheinander, sagten, ich solle mir diesen Tweet ansehen oder jene Meldung auf Facebook oder noch irgendeine andere Nachricht. In den sechs Stunden seit meiner Festnahme hatte sich die Neuigkeit wie ein Virus verbreitet. Aber ich wollte mir nichts davon ansehen. Ich war erschöpft, körperlich und seelisch. Ich wollte nur noch unter die Dusche und dann schlafen. Aber es verstößt gegen alle saudischen Sitten, Gäste zu bitten, das Haus zu verlassen. Also setzte ich mich, und wir sprachen darüber, wie wir unsere erste Schlacht gewonnen hatten, wie wir bewiesen hatten, dass es kein Gesetz gibt, das Frauen das Autofahren ausdrücklich verbietet. Als sie endlich gingen, waren sie immer noch sehr aufgekratzt und glücklich – so wie ich auch. Ich dachte, na schön, jetzt kann uns nichts mehr aufhalten.
Aber dann war es zwei Uhr nachts, und da standen diese Männer vor der Tür. Meine Hochstimmung von zuvor war verflogen. Als ich die Worte »Polizeirevier Dhahran« hörte, bekam ich Panik. Mein Bruder schlug die Tür zu und verriegelte sie. Erst blieb es ruhig. Dann hämmerten sie wieder auf sie ein.
Mein Haus stand keineswegs in der für Nichtmuslime verbotenen heiligen Stadt Mekka, in deren Straßengeflecht ich meine Kindheit zwischen Pilgerströmen verbracht hatte. Es befand sich auch nicht zwischen den schimmernden Türmen und hohen Brücken der saudi-arabischen Hauptstadt Riad, hoch oben auf einem Wüstenplateau. Mein Haus war Teil der wohl westlichsten Enklave des gesamten Königreichs, des hochmodernen Aramco-Firmengeländes in der östlichen Provinz, das ursprünglich von amerikanischen Arbeitern der John D. Rockefeller Company, Standard Oil, entworfen worden war und mit dessen Hilfe Aramco, die Arabian American Oil Company, gegründet wurde. Heute ist Aramco die staatliche saudische Ölfirma, die täglich mehr Öl als jede andere Firma der Welt fördert und auf Vorkommen von 260 Milliarden Barrel Öl sitzt. Aramco ist zudem die wertvollste Firma der Welt, mit einem Nettovermögen von geschätzten zweieinhalb Billionen Dollar. Und Aramco war mein Arbeitgeber. Als die Amerikaner Aramco an die Saudis verkauften, wurde vertraglich festgelegt, dass die Saudis weiterhin auch Frauen beschäftigen mussten.
Das Firmengelände von Aramco war schon immer eine Welt für sich gewesen. Mit saftig grünen Golfplätzen, Rasenflächen, Palmen, Parkanlagen und Swimmingpools ähnelt es beinahe einer perfekten südkalifornischen Stadt. Hinter den Toren von Aramco gelten keine saudischen Regeln mehr. Frauen und Männer bewegen sich hier nebeneinander. Frauen müssen sich nicht verschleiern oder gar vollständig verhüllen. Wir feiern Feste wie Halloween und verkleiden uns dazu. Und anders als überall sonst in Saudi-Arabien dürfen Frauen auf dem Aramco-Gelände Auto fahren. Es gibt weder Verbote noch Einschränkungen. Frauen setzen sich einfach ans Steuer und lassen den Motor an. Und sie sind geschützt. Weder die lokale Polizei noch die saudische Religionspolizei darf das Aramco-Gelände betreten. Aramco besitzt seine eigene Sicherheitstruppe und eine eigene Feuerwehr. Der Konzern regelt seine Angelegenheiten unabhängig, wie ein abgeschotteter und eigenständiger Staat. Die saudische Geheimpolizei aber hat, wie ich in jener Nacht erfahren musste, trotzdem Zugang.
Ich sah zur gläsernen Schiebetür an der Außenwand meines Wohnzimmers. Im Gegensatz zur saudischen Tradition, das eigene Haus ebenso zu verschleiern wie die Frauen, habe ich Vorhänge nie gemocht. Ich wollte immer Licht hereinströmen lassen. Jetzt presste einer der Männer sein Gesicht gegen das blanke Glas, sein feuchter Atem legte sich wie Nebel über die Scheibe, ehe er von der trockenen Wüstenluft aufgesogen wurde. Er sagte nichts, er bewegte sich nicht. Nur seine Augen tasteten langsam das Innere des Zimmers ab. In jener Nacht entfernte er sich keinen Schritt weit, seine Nase blieb die ganze Zeit über an der Scheibe heften. Er trug Zivilkleidung, wie die anderen auch. Das, so weiß man, ist das Markenzeichen der Geheimpolizei. Sie trägt keine Uniform. Sie gibt sich nicht einmal als Polizei zu erkennen. Ihre Mitglieder haben andere Berufe, andere Identitäten. Doch sie sind in allen Teilen der Gesellschaft gegenwärtig. Ihre einzige Aufgabe besteht darin, Informationen zu sammeln und weiterzureichen. Sie sind Angestellte des Staates, um Bürger zu überwachen und die Einhaltung von Regeln zu garantieren.
An der Tür begann mein Bruder sich zu wehren. »Ist Euch klar, dass es zwei Uhr morgens ist? Die Menschen hier schlafen. Außerdem sind wir gerade erst von der Verkehrspolizei in Thugbah zurückgekommen.« Damit wollte er deutlich machen, dass die Angelegenheit bereits geregelt war. Aber er erhielt keine Antwort.
Er machte eine Pause, dann wurde er lauter. »Wer seid ihr überhaupt? Solange ihr uns keinen Haftbefehl zeigen könnt, verlassen wir dieses Haus nicht. Wenn ihr etwas wollt, kommt morgen früh wieder. Es gehört sich nicht, nachts um zwei aufzutauchen und uns damit zu drohen, uns zur Polizei zu schleppen.«
Das war eine Untertreibung. In Saudi-Arabien werden unsere Rechtsvorschriften nicht als Gesetze verstanden, denn nach der Überzeugung gläubiger Muslime können diese nur von Gott erlassen werden. Es gibt stattdessen ein anderes Wort dafür, welches grob mit »System« übersetzt werden könnte. In diesem System ist geregelt, dass niemand wegen eines kleinen Vergehens in den Stunden zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang festgenommen werden darf. Dasselbe System besagt auch, dass ohne richterlichen Beschluss niemand festgenommen werden darf, es sei denn, die Behörden gehen davon aus, dass der Gesuchte die nationale Sicherheit gefährdet. Aber die Männer vor der Tür sagten kein Wort. Nach wenigen Minuten begannen sie wieder, gegen die Tür zu hämmern.
Ich stand jetzt in meinem Wohnzimmer, trug eine Trainingshose und ein Micky Maus-T-Shirt. Ich konnte nirgends sonst hingehen. Es war ein kleines Haus, Wohnzimmer, Küchenzeile, Schlafzimmer, Balkon, alles in allem 70 Quadratmeter, genug Platz für meinen fünfjährigen Sohn und mich. Ich war geschieden, und ohne Ehemann war nach saudischen Regeln mein Vater mein männlicher Vormund. Ohne seine Erlaubnis durfte ich weder arbeiten noch zur Schule gehen oder verreisen. Aber er lebte in Dschidda, am anderen Ende des Landes.
Ich wusste nicht, ob die Männer die Tür gewaltsam aufbrechen, ins Haus kommen und mich mitnehmen würden. Ich wusste noch nicht einmal, wer genau »sie« waren, aber mir wurde klar, dass ich über das, was hier geschah, irgendjemanden informieren musste. Ich rief eine saudi-arabische Journalistin an, mit der ich Kontakt aufgenommen hatte, als ich zum ersten Mal daran gedacht hatte, beweisen zu wollen, dass Frauen rechtmäßig Auto fahren dürfen. Obwohl es mitten in der Nacht war, nahm sie ab und sagte, dass sie mir einen Anwalt besorgen werde, dessen Nummer sie mir gab. Eine Minute später klingelte das Telefon. Eine Frau namens Suad al-Shammari stellte sich mir als Anwältin vor. Sie riet mir, unser Gespräch aufzunehmen, also schnitt ich es auf meinem iPhone mit.
»Was sind das für Männer?«, fragte sie. »Sind sie von der Religionspolizei? Vertreter der Verkehrspolizei? Haben sie so etwas wie einen Haftbefehl?«
Ich antwortete, dass ich keine Ahnung hätte. »Sie klopfen immer noch«, sagte ich.
Suaad sprach fast zwanzig Minuten mit mir. Sie versicherte, dass die Männer nur dann das Recht hätten, mitten in der Nacht zu kommen und mich mitzunehmen, wenn sie von der nationalen Behörde für Innere Sicherheit kämen und ich eine gesuchte Terroristin sei. Sie schlug mir vor, mich bei der örtlichen Polizei zu erkundigen, ob ein Haftbefehl gegen mich erlassen worden sei. Gäbe es keinen, sollte ich nicht nachgeben. »Schicken Sie die Männer weg«, sagte sie. »Gehen Sie auf keinen Fall mit.« Während die Männer weiterhin mit Fäusten gegen meine Haustür schlugen, wählte ich die 999, die Nummer der Polizei. Ein Mann am anderen Ende der Leitung versicherte mir, es liege kein Haftbefehl gegen mich vor.
Kaum hatte ich das Gespräch beendet, klingelte mein Telefon wieder. Diesmal meldete sich Kholud, eine Frauenrechtlerin, die schon am Nachmittag über meine Festnahme getwittert hatte. Ich wusste nicht, dass sich genau in diesem Moment Omar al-Johani, einer meiner Arbeitskollegen bei Aramco, nahe meinem Haus hinter Buschwerk versteckt hielt. Er hatte Kholuds Tweets über meine Verhaftung verfolgt und kannte die Straße, in der ich wohnte. Er umfuhr das Haus, bis er die Autos und Polizisten sah. Jetzt twitterte er über die Männer, die meine Tür belagerten. Kholud folgte ihm online. »Manal«, sagte sie ganz ruhig, »ich möchte, dass du etwas unternimmst. Ich möchte, dass du mit diesen Typen mitgehst. Es wird Schande über sie bringen, wenn wir öffentlich erklären, dass sie dich mitten in der Nacht aus dem Haus geholt haben. Das ist eine Verletzung deiner Rechte. Wir sollten sie bloßstellen.«
Die Vorstellung, mit diesen Leuten irgendwohin zu gehen, gefiel mir nicht. Ich wollte meinen Sohn nicht alleinlassen, und ich wusste immer noch nicht, wer tatsächlich da draußen stand. Aber ich dachte darüber nach, wozu Kholud mir geraten hatte. Ich beschloss zu beten und ging nach oben. Im Flur vor meinem kleinen Zimmer sprach ich zwei Raka’as, den vollen Zyklus des islamischen Gebets, der im Stehen, im Sitzen und auf den Knien verrichtet wird, und bat Gott, mir den richtigen Weg zu weisen. Inzwischen war es vier Uhr morgens. In etwas über einer Stunde würden am Himmel die ersten Streifen der Wüstensonne zu sehen sein. Ich spürte eine innere Stimme, die mir sagte: »Geh mit, Manal. Alles wird gut.«
Ich beruhigte mich, ging nach unten und öffnete die Tür. Nicht alle da draußen waren mir fremd. Einen Mann erkannte ich. Fahad, ein Angestellter von Aramco, der zum Beweis seinen Firmenausweis hochhielt. Er redete mit mir, wandte aber sein Gesicht von mir ab und sah immer nur meinen Bruder an. »Wir wollen nur, dass Sie mit uns auf das Polizeirevier in Dhahran kommen«, sagte er. »Sie unterzeichnen ein paar Papiere, dann werden Sie wieder entlassen. Ich bin Ihr Kollege. Sie können mir vertrauen. Ich werde bei Ihnen bleiben, ich werde sie nicht alleinlassen, und ich werde Sie auch zurückbringen.«
Ich traute ihm nicht. Ich rief bei der Security von Aramco an. Ein Mann versicherte: »Er arbeitet für uns. Er wird Sie zum Polizeirevier begleiten.« Mein Bruder bestand darauf, ebenfalls mitzukommen, was den Männern vor der Tür nicht passte, sie wollten, dass ich allein mitginge, ohne meinen Bruder, was mich eigentlich hätte hellhörig werden lassen müssen. In der saudischen Gesellschaft braucht eine Frau für jeden Behördengang entweder ihren Ehemann oder einen Mahram, einen nahestehenden männlichen Verwandten, der die Frau nicht heiraten kann, also den Vater, einen Bruder, einen Onkel oder sogar einen Sohn.
Selbst ein Krankenhaus nimmt eine kreißende Frau ohne ihren Ehemann oder Mahram nicht auf. Ist der Vormund einer Frau nicht anwesend, darf weder bei einem Überfall die Polizei das Haus betreten, noch bei einem Brand oder einem medizinischen Notfall die Feuerwehr. Im Jahr 2014 starb Amna Bawazir auf dem Campus der König-Saud-Universität. Die Universitätsbehörden hatten den Rettungssanitätern nicht gestattet, den nur Frauen vorbehaltenen Teil der Universität zu betreten, nachdem Amna dort in Folge eines Herzleidens zusammengebrochen war. Dieselbe Geschichte wiederholte sich 2016, als es männlichen Rettungssanitätern untersagt wurde, den Campus der al-Qasim-Universität zu betreten, um die Studentin Dhuba Almane zu behandeln, die kurz darauf starb. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass der Tod hinnehmbarer ist als eine Verletzung der strikten Vormundschaftregeln.
Ich ging zurück ins Haus und zog meine Abaya an, den wallenden schwarzen Umhang, der meinen Körper bis auf Hände und Füße vollkommen verhüllte, und legte auch den Hidschab um, das Kopftuch, das mein Haar, meine Ohren, meinen Hals und Nacken, alles, bis auf mein Gesicht, bedeckte. Zuletzt rief ich noch Atika Shubert an, eine CNN-Journalistin, die damals im Londoner Büro arbeitete und mich eine Woche zuvor interviewt hatte. Atika versprach, die Nachricht von meiner Festnahme auf die Webseite von CNN International zu stellen. Sollte sie ihr Versprechen halten, konnte ich darauf vertrauen, nicht einfach sang- und klanglos zu verschwinden.
Am Arm meines Bruders trat ich aus dem Haus, ich hatte nicht nach meinem kleinen schlafenden Jungen gesehen, ihm keinen Abschiedskuss gegeben. Ich wollte glauben, dass es sich nur eine Formalität handelte und dass ich rechtzeitig wieder zurück wäre, um ihn aufzuwecken, ihm sein Frühstück zu machen, ihn zur Schule zu bringen und dann zur Arbeit zu fahren. Ich würde höchstens ein paar Stunden weg sein, beruhigte ich mich. Zu dieser Nachtzeit fuhr man in weniger als zehn Minuten vom Aramco-Gelände bis zum Polizeirevier in Dhahran.
Vor der Tür zählte ich sofort die Menschen, die dort standen. Es waren neun, sieben Männer, zwei Frauen und fünf Autos. Kaum war ich vor die Tür getreten, drängten sich die beiden Frauen an mich – Aramco Security, tiefverschleiert, bis auf den schmalen Spalt für die Augen. Dass sie für Aramco arbeiteten, erkannte ich daran, dass sie über dem Tschador die üblichen khakifarbenen Mäntel mit dem großen Logo des Unternehmens auf der Brust trugen. Sie gehörten höchstwahrscheinlich zum Frauenkontingent, mit dem der Checkpoint am Eingang für Frauen zum Firmengelände besetzt war. Wollten verschleierte Frauen das Gelände betreten, nahmen diese Wächterinnen ihnen den Schleier ab und kontrollierten ihre Ausweise. Sie konnten so jeder Frau ins Gesicht sehen, ihre Identität prüfen, ohne jemals die eigene preiszugeben.
Sie gingen unangenehm dicht neben mir her, als wären sie sofort bereit, mich zu packen und festzuhalten, sollte ich fliehen wollen. Ich stieg hinten in eines der Autos ein, es war kein Polizeiwagen, sondern ein Firmenauto. Die Frauen stiegen nicht mit ein. Ich war allein mit zwei Männern. Mein Bruder saß vorn, Fahad, der Aramco-Angestellte, saß am Steuer. Niemand sprach ein Wort. Ich sah aus dem Fenster in die schwarze Nacht hinaus, spürte, wie das Auto die Straße entlangschnurrte. Fünf Minuten vergingen. Dann zehn. Ich konnte keines der mir vertrauten Gebäude von Dhahran erkennen. Wir fuhren nicht in die Stadt. Wir fuhren Richtung Osten. Ich hatte nur noch eine einzige Frage im Kopf: »Wohin bringen sie uns?«
Ich wollte nie in meinem Leben eine Frauenrechtlerin sein. Ich war ein religiöses Mädchen, geboren und aufgewachsen in Mekka. Ich trug Abaya und Niqab, noch bevor ich das offizielle Alter dafür erreicht hatte, weil ich meinen Religionslehrerinnen nacheifern und ihnen gefallen wollte. Und ich glaubte an eine sehr fundamentalistische Auslegung des Islam. Jahrelang schmolz ich die Popmusikkassetten meines Bruders im Ofen ein, weil Musik im fundamentalistischen Islam haram, also verboten ist. Ich war zwanzig, als ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Popsong hörte. Die Backstreet Boys. »Show Me the Meaning of Being Lonely«. Noch heute kann ich fast jedes Wort auswendig.
Das einzige irgendwie Aufmüpfige in meiner Jugend war mein Entschluss, arbeiten zu gehen. Ich hatte einen Bachelor Abschluss in Informatik und wurde von Aramco als Expertin für Datensicherheit eingestellt. Ich heiratete früh, mit vierundzwanzig, bekam einen Sohn. Dann wurde ich geschieden, was relativ normal ist, die Scheidungsrate in Saudi-Arabien ist hoch; manche der veröffentlichten Statistiken schätzen sie auf rund sechzig Prozent. Meine Eltern waren vor ihrer Ehe ebenfalls bereits einmal geschieden. Als ich dreißig wurde, begann ich damit, an meinen Geburtstagen immer etwas Aufregendes zu tun. Ich arbeitete damals in den Vereinigten Staaten in New Hamphshire und machte meinen ersten Fallschirmsprung. Im folgenden Jahr buchte ich einen Flug nach Puerto Rico und hielt mich dort sechsunddreißig Stunden allein auf. Und als ich 2011 wieder in Saudi-Arabien war und zweiunddreißig wurde, beschloss ich, auch dort Auto zu fahren.
Autofahren lernte ich, als ich in Amerika arbeitete, ich besaß erst einen Führerschein aus New Hampshire, später einen aus Massachusetts. Aber in Saudi-Arabien hatte ich noch nie am Steuer gesessen, bis auf die Fahrten innerhalb des Firmengeländes von Aramco. Wenn saudi-arabische Frauen von A nach B wollen, sind sie auf Fahrer angewiesen, zumeist ausländische Männer, von denen manche weder eine Fahrerlaubnis noch überhaupt jemals Fahrstunden gehabt haben. Wir sind ihnen ausgeliefert. Manche Familien sind wohlhabend genug, um einen privaten Chauffeur einzustellen, aber viele Frauen sind auf in losen Netzwerken organisierte Fahrer angewiesen, die illegal Frauen transportieren. Oder wir nehmen ein Taxi. Deren Fahrer sind zumindest registriert und von der Verkehrspolizei zugelassen, aber ihre Wagen sind alt, und viele Fahrer waschen sich nicht, ihr Gestank ist häufig unerträglich. Meine Freundinnen und ich schrieben uns immer eine SMS, wenn wir einen sauberen Fahrer gefunden hatten.
Fast jede Frau, die ich kenne, ist schon von einem Fahrer belästigt worden. Sie äußern sich über unser Aussehen oder unsere Gespräche, die sie belauschen, sie verlangen mehr Geld als vereinbart, sie berühren einen unangemessen. Manche Frauen wurden tätlich angegriffen. Ich selbst hatte Fahrer erlebt, die sich alle möglichen ungehörigen Bemerkungen erlaubten und meine Telefongespräche aufzeichneten, sogar solche Fahrer, die kein Arabisch sprachen, und wohl glaubten, mich so unter Druck setzen oder erpressen zu können. Und es gibt Fahrer, die Kinder, die sie zur Schule bringen oder von dort abholen, sexuell belästigen.
Es ist ein erstaunlicher Widerspruch: Eine Gesellschaft, die auf Frauen herabsieht, sobald diese sich ohne einen Mann auf der Straße zeigen, eine Gesellschaft, die einem nicht gestattet, grundlegende Dinge selbstständig zu erledigen, die einem verbietet, einzukaufen, ohne dabei von einer zwei Meter hohen Trennwand abgeschirmt zu sein, die jedweden Blick des anderen Geschlechts verhindern soll, die einen zwingt, getrennte Eingänge von Universitäten, Banken und Moscheen zu benutzen, die Restaurants durch Wände abtrennt, so dass Männer und Frauen, die nicht miteinander verwandt sind, auch nicht gemeinsam in einem Raum sitzen, genau diese Gesellschaft erwartet von einem, ganz allein in ein Auto mit einem Fahrer zu steigen, der kein Verwandter, sondern ein völlig Unbekannter ist, der einen dann in einem verriegelten Wagen irgendwohin bringen soll. Selbst Frauen, die einen privaten Chauffeur haben, bekommen diese Abhängigkeit zu spüren. Manche dieser angestellten Fahrer kommen einfach nicht, andere verschwinden ganz. Saudische Männer bezeichnen Frauen als »Königinnen« und behaupten, Königinnen würden nicht selbst fahren. Frauen machen sich häufig über diesen Titel lustig und höhnen: »Das Königreich mit einem König und Millionen Königinnen.« Oder sie posten ein Foto von Königin Elisabeth II., wie sie ihren Jaguar fährt, und sagen: »Wahre Königinnen fahren ihre eigenen Autos.«
2011 hatte ich an einem Abend nach der Arbeit einen Arzttermin außerhalb des Firmengeländes in Khobar. Als ich die Praxis kurz vor neun Uhr abends verließ, rief ich sämtliche Fahrer an, die ich kannte, um nach Hause zu kommen. Keiner hatte Zeit. Sie hatten entweder frei, oder sie fuhren bereits andere saudische Königinnen. Als die Praxis ihre Türen schloss, ging ich allein los. Viele Männer fuhren an jenem Abend mit ihrem Auto an mir vorbei, sie alle sahen, dass ich allein und unverschleiert unterwegs war, was für die meisten saudischen Frauen äußerst ungewöhnlich ist. Für die Männer war es wie eine Einladung, mich zu belästigen, was sie auch taten. Einige rasten schnell vorbei, andere bremsten auf Schritttempo ab. Die Fahrer hupten und brüllten Verunglimpfungen, Beschimpfungen oder andere Gemeinheiten. Ich blickte stur geradeaus, aber ich war verängstigt. Ich rief meinen Bruder an, der aber sein Telefon ausgeschaltet hatte.
Eines der Autos folgte mir. Die Straße war von Geschäften gesäumt, die aber zu dieser nächtlichen Zeit geschlossen waren. Die Gebäude waren alle ein wenig zurückgesetzt, davor lagen große Parkplätze. Der Autofahrer hielt auf einem davon an, ließ die Fensterscheibe herunter und sah mich an, als wollte er mich einladen, einzusteigen. Ich ging weiter, er fuhr auf den nächsten Parkplatz und blickte mich wieder an. Ich war ausgesprochen wütend. Ich wurde belästigt, weil ich keinen Chauffeur finden konnte und weil mir nicht erlaubt war, was für diesen Mann selbstverständlich war: selbst nach Hause zu fahren. Als ich an einer Baustelle vorbeikam, hob ich einen Stein vom Boden auf und hielt ihn in der Hand. Wie er mich so sah, warf er mir einen wütenden Blick zu und raste mit quietschenden Reifen davon. Ich schleuderte ihm den Stein trotzdem hinterher, so kräftig, wie ich konnte. Dann blieb ich auf der Straße stehen, mir kamen die Tränen, ich weinte wie ein kleines Mädchen. Ich bin kein Mädchen, ich bin eine Frau, ich bin Mutter, ich bin gebildet, ich besitze ein Auto, das ich selbst gekauft und vier Jahre lang abgezahlt habe, das mit seinem kalten Motor direkt neben meinem Haus stand, und trotzdem kann ich nichts dagegen tun, dass mir so etwas widerfährt.
In Saudi-Arabien gelten Belästigungen nicht als Straftat. Der Staat, vor allem die Religionspolizei, gibt immer den Frauen die Schuld. Man behauptet, wir würden belästigt wegen unseres Aussehens, unserer Art uns zu bewegen, unseres Parfüms. Sie machen uns zu Kriminellen.
Als ich in jener Nacht nach Hause kam, schüttete ich meinen ganzen Ärger auf Facebook aus: Ich schrieb von der Erniedrigung, auf einen Fahrer angewiesen zu sein, von der dauernden Angst, erst spät nach Hause zu kommen oder irgendwo steckenzubleiben, von all den Versuchen, Fahrgemeinschaften zu bilden, entweder mit Verwandten oder mit Fahrern, deren Nummern ich im Telefon hortete. Ganz am Schluss des Eintrags gelobte ich, an meinem Geburtstag außerhalb des Aramco-Geländes Auto zu fahren, Videos davon zu machen und sie auf YouTube ins Internet zu stellen. David Headley, einer meiner amerikanischen Freunde aus New Hampshire, antwortete auf meiner Facebook-Seite: »Unruhestifterin!« Und ich gab ihm zurück: »Nein. Ich schreibe Geschichte.« Aber zu diesem Zeitpunkt war ich mir meiner selbst noch nicht so sicher. Ich dachte, ich würde mir etwas vormachen.
Fahad, der für den Kontakt zu den Behörden zuständige Angestellte bei Aramco, derjenige, der mir versprochen hatte, mich wieder nach Hause zu bringen und der mir immer wieder versichert hatte, wir würden zum Polizeirevier von Dhahran fahren, er hatte gelogen. Das konnte ich ihm aber nicht einfach ins Gesicht sagen. Stattdessen fragte ich ihn mit bemüht gelassener Stimme, wohin wir denn führen. Er habe doch gesagt nach Dhahran, zur Polizei, erinnerte ich ihn.
»Ja, ja«, tat er meine Frage ab, »in Dhahran haben sie lange vergeblich auf Sie gewartet, deshalb sollen Sie jetzt zur Polizei nach Khobar.« Er wirkte sanfter und umgänglicher als die Religionspolizei, die mit Knüppeln ausgestattet ist und Frauen auch einfach anschreit und niederbrüllt. Die Botschaft aber war dieselbe: Es war mein Fehler, weil ich nicht sofort nach meiner Tasche und dem Tschador gegriffen hatte und auf der Stelle um zwei Uhr morgens mit einer Gruppe fremder, mir völlig unbekannter Männer mitgegangen war.
Khobar ist eine weitläufige Stadt mit fast einer Million Einwohner. Wie die meisten jüngeren saudischen Städte ist sie eine Ansammlung von Wolkenkratzern und Einkaufszentren an einem historischen Hafen am Persischen Golf, den wir den Arabischen Golf nennen. Im Westen ist Khobar vielleicht vor allem wegen des Anschlags auf die Khobar-Towers, einer Wohnanlage der US-Luftwaffe, im Jahr 1996 bekannt, als eine Bombe, die Extremisten in einem Tankwagen versteckt hatten, explodierte und neunzehn amerikanische Soldaten tötete.
Am Morgenhimmel zeigten sich die ersten rosafarbenen Streifen, als wir an der Polizeistation ankamen, einem großen Gebäude aus Betonziegeln an der König-Abdullah-Straße, unweit vom Ufer des Golfs. Ich war genau an diesem Haus zwei Tage zuvor vorbeigefahren. Das war der einzige andere Tag, an dem ich auf öffentlichen Straßen des Königreichs selbst gefahren war.
Auf dem Revier war zunächst jeder freundlich zu mir, fast fürsorglich. Sie fragten meinen Bruder und mich, ob wir Saft oder Wasser oder vielleicht einen Kaffee haben wollten. Sie entschuldigten sich dafür, uns so früh abgeholt zu haben. »Wir müssen einfach diesen Papierkram erledigen«, sagten sie, »sobald wir damit fertig sind, lassen wir Sie gehen.« Mein Bruder und ich wurden in ein kleines Zimmer mit einem Fenster geführt. Es gab einen Tisch, einige Stühle, und von der Wand blickte ein riesiges gerahmtes Porträt König Abdullahs auf mich herab.
Der Mann von der Polizei beruhigte mich zunächst, dass sie mich nicht verunsichern wollten, und stellte zunächst die einfachste Frage überhaupt: »Sie sind Manal al-Sharif?« Ich nickte. Dann wandte er sich an meinen Bruder, um ihm ebenfalls ein paar Fragen zu stellen.
Es war schwer zu sagen, wie viel Zeit inzwischen vergangen war. Irgendwann trat ein junger Mann ein und bot mir ein Sandwich und Orangensaft an, aber ich wollte nichts. Ich versuchte, bei der Befragung so gut wie möglich zu kooperieren, in der Hoffnung, sie zufriedenzustellen, damit sie mich zu meinem Sohn nach Hause lassen würden.
In dem Zimmer befand sich noch ein zweiter Mann, der hinter einem Schreibtisch saß. Er wollte wissen, wer hinter der Gruppe Women2Drive stehe, zu deren Anführerinnen ich gehörte und deren öffentliches Gesicht ich war, und mit wem von der ausländischen Presse ich gesprochen hätte. Sie fragten mich über meine Beziehung zu Wajiha al-Huwaider aus, jener Frau, die mich am Steuer gefilmt hatte. Wajiha war eine bekannte Frauenrechtlerin in Saudi-Arabien, aber ich hatte keine Ahnung, wie angespannt ihre Beziehung zu den Behörden war. Der zweite Mann stellte mir seine Fragen, und dann wieder der erste, und so ging das immer weiter. Ich lächelte die ganze Zeit über freundlich.
Plötzlich schloss der Mann hinter dem Schreibtisch seine Akte. Er sah mich an und sagte dann etwas, das klang wie: »Nun kommen Sie schon, Manal. Sie wissen, dass der König wegen des Arabischen Frühlings und all der Ereignisse in der Region gerade eine schwere Zeit hat. Warum wollen Sie dem König noch mehr aufbürden? Lieben Sie den König nicht?« Und hier, genau vor mir, blickte das Porträt des Königs an der Wand mit diesem halben Lächeln auf mich herab.
In Saudi-Arabien wird der Grad von Patriotismus daran gemessen, wie sehr man den König liebt. Der König wird verehrt wie ein Vater, und wir alle werden als seine Töchter und Söhne angesehen. Wobei König Abdullah der saudische König war, den ich tatsächlich geliebt und nicht gefürchtet habe. Er war der einzige, der begonnen hat, Frauen Türen zu öffnen, sich für Frauen einzusetzen und ihnen größere Rede- und Pressefreiheit zu gestatten. Deshalb fiel es mir nicht schwer, dem Mann, der mich verhörte, zu versichern: »Nein, natürlich nicht. Ich liebe König Abdullah sehr. Ich will nichts tun, was den König zusätzlich belastet.«
Der Polizist nickte und sagte, das Problem sei weniger, dass ich Auto gefahren sei, sondern dass ich mein Video auf YouTube gestellt, mit ausländischen Medien gesprochen und so viel Unruhe gestiftet habe.
Ich bemühte mich, auf ihn einzugehen, und begann, mich zu entschuldigen. Ich sagte, falls meine Beteiligung an der Women2Drive-Kampagne die Ursache all dieser Probleme sein sollte, würde ich damit aufhören. Ich sagte, ich hätte nie geahnt, in derartige Schwierigkeiten mit den Behörden zu geraten, es tue mir sehr leid. Es sei nie meine Absicht gewesen, fügte ich hinzu, »irgendjemandem Unannehmlichkeiten zu bereiten«.
Er nickte und ging aus dem Zimmer. Mein Bruder und ich blieben allein zurück. Fahad, der Mann von Aramco, war bereits verschwunden. Gerade als der erste Ermittler sein Verhör beendet hatte, steckte Fahad seinen Kopf durch die Tür und sagte: »Ich denke, es ist alles okay. Tut mir leid, aber ich muss zur Arbeit. Es ist sieben Uhr, ich muss mich im Büro melden.« Er sagte, ich könne ja ein Taxi nach Hause nehmen oder ihn anrufen, er würde mich dann abholen kommen.
Schweigend saß ich neben meinem Bruder und schickte den Frauen, die über mich twitterten, eine Textnachricht. Ich bat sie, alle Tweets über mich und meine Festnahme zu stoppen, schrieb ihnen, ich wolle keine weitere Aufmerksamkeit erregen. Es sei nur eine kleine Sache, fügte ich hinzu, das Problem sei nur das Video. Ich würde bald entlassen werden.
Nach etwa dreißig weiteren Minuten, betrat ein anderer Mann den Raum. Als Erstes befahl er meinem Bruder zu gehen, der umgehend hinausgeführt wurde, und an seiner Stelle kam eine Frau herein. Sie wurde mir als Gefängniswärterin vorgestellt. Namenlos, einfach nur »Gefängniswärterin«. Sie war vollverschleiert, trug einen schwarzen Tschador, einen schwarzen Schleier und schwarze Schuhe, schwarze Socken, schwarze Handschuhe. Sogar ihre Handtasche war schwarz. Ich konnte keine Gesichtszüge erkennen. Lediglich ein blasser Schimmer drang durch den Stoff, da, wo das Weiß ihrer Augen leuchtete. Schweigend saß sie neben mir. Ihre Handschuhe waren so alt und abgetragen, dass der Stoff Löcher aufwies, die Nähte lösten sich auf, ich konnte ihre dunkle Haut darunter erkennen. Ihre Tasche war alt und abgeschabt, der Schulterriemen war brüchig. Doch dann musterte ich sie nicht länger, weil der Polizist, der das Verhör fortsetzte, noch nicht fertig war.
Er nahm mir meine Tasche weg, in der sich mein Geld befand und mein Telefon. Alles, was ich dabei hatte: Meine Papiere waren weg. Meine Identität war weg. Selbst mein Zeitgefühl war weg. In dem Zimmer gab es keine Uhr. Sonst wusste ich morgens immer, wie spät es war, wann die Nachbarn anfingen, sich in ihren Häusern zu regen, wann die Aramco-Busse zu ihren Rundkursen auf den makellosen Asphaltstraßen des Firmengeländes aufbrachen. Ich wusste, wann mein fünfjähriger Sohn aufwachte. Aber am heutigen Morgen würde er, sobald er die Augen aufschlug, entdecken, dass seine Mutter verschwunden war.
Jetzt bekam ich wirklich Angst.
Der neue Ermittler stellte mir sämtliche Fragen ein weiteres Mal. Wie heißen Sie? Wie alt sind Sie? Wo arbeiten Sie? Er wollte Namen wissen, wollte wissen, mit wem bei den ausländischen Medien ich gesprochen hätte. Alles lief genauso ab wie bei den vorherigen Befragungen, nur dass sein Tonfall schärfer war. Dann ging er. Ich saß neben meiner schweigenden Wärterin und wartete.
Ein weiterer Mann kam herein. Er setzte sich mir direkt gegenüber hin, und das Erste, was er in einer bewusst mitfühlenden Weise sagte, war: »Erzählen Sie mir Ihre Geschichte.« Also wiederholte ich meine Geschichte, er hörte zu und verließ dann das Zimmer. Ich erfuhr erst sehr viel später, dass mein Verhör einem festgelegten Muster folgte: Mehrere Ermittler, Verständnis und Vertraulichkeit im Wechsel mit Schärfe und Unnachgiebigkeit, das ständige Wiederholen derselben Fragen, das Wartenlassen der Verhafteten. Jedes Mal versuchten sie von Neuem herauszufinden, ob ich meine Geschichte veränderte. Gab es Unstimmigkeiten? Würde ich versehentlich etwas Falsches sagen oder etwas verraten?
Ich weiß nicht, ob ich mich als von Natur aus geduldigen Menschen beschreiben würde. Aber weil ich seit mehr als vierundzwanzig Stunden wach war, sehr wenig gegessen hatte und erst am Steuer meines Autos und dann nachmittags bei der Verkehrspolizei viel Adrenalin ausgeschüttet hatte, war ich jetzt ruhig und sehr berechnend. Meine Geschichte blieb meine Geschichte. Unverändert.
Irgendwann zeigte mir einer der Ermittler eine Ausgabe der Tageszeitung Al-Yaum. Er hielt sie in der linken Hand, seine Finger packten das Papier wie ein Schraubstock, bis es zerknüllte und sich die Ecken einbogen. Mit der freien Hand deutete er auf mein Foto auf der ersten Seite und auf die Schlagzeile von meiner Verhaftung. Dann warf er die Zeitung auf den Schreibtisch und wollte die Namen derjenigen wissen, die an der Women2Drive-Kampagne beteiligt waren. Ich nannte zwei Namen, die Namen, die er bereits kannte: Bahia al-Mansur, die Frau, die die Facebook-Seite von Women2Drive gestartet hatte, und Wajiha al-Huwaider, die Frauenrechtlerin – beide wurden später ebenfalls festgenommen und befragt. Aber meine Antworten blieben einsilbig, während das bebrillte Gesicht des Königs weiterhin von der Wand auf mich herabblickte. Dann wurden die Gefängniswärterin und ich wieder allein gelassen.
Es war anstrengend, mich auf dem Stuhl zu halten. Ich hätte nie für möglich gehalten, dass Sitzen so ermüdend sein kann, aber ich musste jeden einzelnen Muskel anspannen, um mich aufrecht halten und verhindern zu können, dass mir der Kopf in den Schoß fiel. Ich war bislang noch nicht auf Toilette gewesen, und bald sollte es Zeit sein für die Mittagsgebete. Unablässig fragte ich die Frau, ob ich irgendwo allein sein könne.
Plötzlich endete die Stille. Hektik brach aus. Die Tür wurde aufgerissen, es kamen Männer herein, befahlen aufgebracht in einem schnellen, barschen Ton und ohne die üblichen Freundlichkeiten oder Begrüßungen: »Mitkommen!« Ich gehorchte und fand mich in einer anderen Umgebung wieder, eingekreist von vielen Männern. Mein Gesicht war unverschleiert, ich war bis auf die Gefängniswärterin, die mir stumm gefolgt war, die einzige Frau.
Ich fragte: »Wo ist mein Bruder? Wo ist meine Handtasche? Was geht hier vor?«
Wir wurden zu einer Stahltür geführt, durch die wir gehen mussten. Ich hörte den metallischen Ton, als die Tür hinter uns zugeschlagen wurde. Ich fragte die Wärterin ein weiteres Mal: »Warum sind wir hier? Was ist los?«
Sie war ebenso verängstigt wie ich selbst. Ihre Stimme zitterte, als sie sagte: »Ich weiß es nicht.«
Der Raum war das dreckigste Loch, das ich je gesehen habe. Überall krabbelten Kakerlaken, die in ihren harten Panzern den Fußboden entlang und die Wände hoch huschten, während das Tippeln ihrer Beine ein leises, klickendes Geräusch erzeugte. Der Raum stank nach Urin und Schweiß und allen nur vorstellbaren anderen widerlichen Ausdünstungen. Ich atmete nur flach hinter vorgehaltener Hand, mein Magen zog sich vor Ekel zusammen. Es gab noch einen weiteren, angrenzenden kleineren Raum, der keine Tür hatte, aber dennoch die Toilette sein sollte. Statt einer Sitzschüssel nur ein Loch im Boden, und alles völlig verdreckt mit Kot.
Auf der Erde lag zwischen den vielen Kakerlaken, eine Schaumstoffmatte. Nomadische Araber besitzen kein gewöhnliches Bett, sondern nur diese aufrollbaren Schlafmatten. Wenn viele Leute gemeinsam in einem Haus wohnen, schlafen wir nachts häufig auf solchen Matten, die wir dann tagsüber einrollen. Diese Matte hier war schmal, dreckig, glänzte vor Schweiß und Schmutz, der sich im Bezug festgesetzt hatte. Es gab keine andere Sitzgelegenheit. Wir befanden uns in einer Zelle der Polizei von Khobar, und ich wusste nicht, für wie lange. Ich spürte, wie mir die Tränen in die Augen stiegen, aber ich blinzelte sie weg. Ich würde an diesem Ort nicht weinen. Ich würde vor dieser Frau nicht weinen.
Schließlich sagte mir die Frau ihren Namen. Halima. Ich fragte sie immer wieder: »Halima, was habe ich verbrochen? Wo ist mein Bruder? Was ist hier los? Warum haben sie mir meine Handtasche weggenommen?« Ich machte das wie meine Ermittler, nur eben umgekehrt.
Halima sagte immer nur: »Ich weiß es nicht.«
Dann hämmerte ich gegen die Stahltür, mit schwerer und schließlich schmerzender Faust. »Bitte! Bitte! Wo ist mein Bruder?«, schrie ich. »Kann ich wenigstens mit meinem Anwalt sprechen? Kann ich mit meinem Sohn sprechen?«
Lange Zeit blieb ich noch stehen, aber ich war so unendlich müde. Ich hatte seit beinahe zwei Tagen nicht geschlafen. Mein Kopf dröhnte, und schließlich konnte ich nicht mehr anders, als mich auf diese ekelerregende Matratze zu setzen. Ich musste meine Augen schließen, aber ich begann, mich mit Halima zu unterhalten. Ich erkundigte mich nach ihrem Ehemann und ob sie Kinder habe. Sie erzählte, ihr Mann sei Wachmann. Diese Arbeit ist eine der miesesten Beschäftigungen für einen saudischen Mann. Meist haben sie lange Arbeitszeiten und verdienen sehr wenig, etwa 1500 Saudi Riyal im Monat, nicht mehr als 400 US-Dollar, was oft nicht einmal für die Miete reicht. Halima erzählte, sie habe zwei Kinder, nannte deren Namen, aber in meiner Erschöpfung konnte ich sie mir nicht merken. Ich fragte und fragte immer weiter, so wie man versucht, die eigene Situation zu vergessen, indem man sich in die Lage eines anderen versetzt.
Während Halima sprach, blickte ich auf meine teuren Schuhe, meine eleganten Abaya, die mehr wert waren als ein Monatsgehalt ihres Mannes. Für die Handtasche, die sie mir weggenommen hatten, wären drei Monatsgehälter ihres Mannes draufgegangen. Ihr Telefon war alt, schwarzweiß, ein Modell, das nur zehn Nachrichten speichern konnte. Ich sah sie an und ahnte, dass sie keine andere Wahl hatte, als hier an diesem Ort zu arbeiten. Ich überlegte, was sie dazu gebracht haben mochte, diesen Job anzunehmen. Ich saß in diesem Loch und empfand eher Mitleid mit ihr als mit mir selbst.
Mehr als eine Stunde war vergangen, als die Tür aufgestoßen wurde. »Rauskommen!«, befahlen zwei Wachmänner, und als ich über die Schwelle getreten war, musste ich meine Handflächen ausstrecken. Einer der beiden Männer hielt eine Farbrolle mit blauer Tinte, die er dann so lange auf meinen Händen hin und her rollte, bis sie dick mit Tinte beschmiert waren. Ich musste meine Finger und die Handflächen auf eine ganze Reihe von Papieren drücken, erst die Daumen, dann die Finger, dann die Handflächen. Da ich eine Frau war, durfte er meine Haut nicht berühren. Wie abwesend folgte ich den Anweisungen. Als ich meine Hände auf die Papiere legte, sah ich auf und erkannte einen der anderen Männer im Raum. Es war der Polizeikommandant von Khobar. Als ich bei der Verkehrspolizei in Thuqbah festgehalten worden war, war er auch dabei gewesen.
Ich sah ihm ins Gesicht und fragte: »Was ist hier los? Warum tun Sie mir das an?«
»Das, Manal al-Sharif, müssen Sie sich schon selbst fragen«, antwortete er. »Sie selbst haben sich in diese Lage gebracht!«
Kapitel Zwei
Kakerlaken und Gitterstäbe
Ich kann nicht sagen, wie lange oder wie kurz ich mit meinen klebrigen, mit Tinte beschmierten Händen in dem Raum herumstand, ob Stunden vergangen waren oder nur Minuten. Ich hatte keinerlei Zeitgefühl mehr. Schließlich kam ein Mann herein und erklärte, wir müssten jetzt nach oben gehen. In der Hand hielt er die vielen Blätter mit meinen Handabdrücken, und er ratterte im Befehlston ohne Punkt und Komma, ohne irgendjemanden direkt anzusprechen, einen Katalog bürokratischer Anweisungen und Feststellungen herunter. Mir war, als hörte ich eine Rede in einer anderen Sprache, die ich nur bruchstückhaft kannte. Krampfhaft versuchte ich, ein paar vertraute Sätze zu verstehen. »Wir müssen Ihre Papiere zum Gouverneur schicken. Der Fall liegt nicht mehr in unserer Hand, wir können nichts mehr tun. Man wird sich dort mit Ihren Papieren befassen. Wir müssen Sie dahin überstellen.«
Ich wurde also nicht entlassen.
Stattdessen erwarteten mich zwei Männern in Zivil mit einem zivilen Auto. Es war ein weißer Toyota Camry mit stoffüberzogenen Sitzen. Ein Mann in Uniform übergab ihnen meine Papiere und wies die beiden an, diese zu lesen, sobald wir im Auto wären. Sie schienen es eilig zu haben, rutschten schnell auf ihre Sitze, den Blick geradeaus. Um den Kopf trugen sie die von einer schwarzen Kordel gehaltene traditionelle saudische Kufiya, das rotkarierte Tuch saudischer Männer. Allerdings war sie so um ihre Köpfe geschlungen, dass ich ihre Gesichter nicht sehen konnte. Sollte ich ihnen später irgendwann wieder begegnen, würde ich sie nicht erkennen.
Halima, mit ihren zerschlissenen Handschuhen und der Tasche mit dem fast abgerissenen Schulterriemen, folgte dicht hinter mir, um mich zu begleiten. Schweigend setzte sie sich neben mich, umklammerte die Tasche auf ihrem Schoß. Man hatte ihr mein Smartphone und meinen Ausweis ausgehändigt, ich bekam meine Tasche mit den übrigen Dingen. Im hellen Sonnenlicht sah ich ihren schmutzigen Tschador. Sie sah noch ärmlicher aus als auf der Wache.
Ich bat die Männer darum, meine Nachmittagsgebete verrichten zu dürfen. Sie ignorierten mich. Ich wiederholte meine Bitte, und sie antworteten nur kurz: »Wenn wir dort sind.« Während der Zeit auf dem Polizeirevier hatte ich mich immer wieder beruhigt und mir selbst gesagt, ich sei in Wirklichkeit gar nicht die Frau, die neben einer anderen Frau sitzen würde, welche man als »ihre Gefängniswärterin« bezeichnete, denn schließlich sei ich ja keine Kriminelle, sondern nur jemand, den man zu einer Befragung gebracht hatte. Aber jetzt, während dieser wortlosen Fahrt, hatte ich große Mühe, mir weiterhin etwas vorzumachen.
Es war ein Nachmittag im Mai, weder sehr heiß noch sehr kalt. Der Frühling ist im östlichen Teil Saudi-Arabiens eine besonders schöne Jahreszeit, während derauf den bewässerten Grünflächen Blumen blühen. Ich wusste, dass es etwa zwei Uhr nachmittags sein musste, denn ich sah die Regierungsangestellten, die am Ende ihres Arbeitstages aus den Büros eilten. Die Straßen waren voller Autos, und wir saßen in einem davon, das im Berufsverkehrs verschwand als wir in den Strom der Fahrzeuge einfädelten.
Wenn ich im Auto mitfahre, lese ich normalerweise ein Buch. Ich lese eigentlich immer, wenn ich kann. Bei mir liegt ein Buch auf dem Nachttisch, eines im Büro, sogar eines im Badezimmer. Aber während dieser Fahrt hatte ich kein Buch bei mir. Darum las ich alles, was ich aus dem Fenster sehen konnte. Die Namen der Geschäfte und Kaufhäuser an den Straßen, die Werbeschilder, die Verkehrszeichen. Ich las, als wir nach Dammam kamen, die Stadt, in der ich als verheiratete Frau vier Jahre lang gewohnt hatte. Ich las immer noch jedes Schild, als wir an eine Tafel kamen, auf der stand: Gefängnis Dammam. Die massive Betonmauer und der Checkpoint waren unübersehbar. Man steckte mich ins Gefängnis.
Sie hatten mich um vier Uhr morgens ohne Ankündigung und ohne Haftbefehl aus dem Haus geholt und mir nicht erlaubt, einen Anwalt anzurufen. Ich hatte die Polizisten beim Verhör angefleht, mich mit meinem Sohn telefonieren zu lassen, aber mir wurde kein einziger Anruf erlaubt. Es war, als wäre ich einfach verschwunden. Sie könnten mich ewig einsperren. Es war soweit. In saudi-arabischen Gefängnissen gibt es Menschen, auch Frauen, die dort seit Jahren vor sich hinsiechen, ohne Gerichtsverfahren, ohne Urteil.
Ich schrie die beiden Männer vorn an: »Wohin bringen Sie mich? Hallo, Sie, antworten Sie mir bitte, wohin bringen Sie mich? Es ist mein Recht, zu erfahren, wohin Sie mich bringen!«
Sie schwiegen.
»Das dürfen Sie nicht. Ich bin doch keine Kriminelle!«, brüllte ich. »Wie können Sie mich ohne Papiere, ohne Gerichtsentscheid, ohne eine Verurteilung ins Gefängnis bringen?«
Schweigen. Ich blickte zu Halima. »Halima, sagen Sie etwas, unternehmen Sie etwas«, flehte ich. Aber sie umklammerte nur stumm die Handtasche auf ihren Knien.
Es wäre barmherziger gewesen, wenn wenigstens einer von ihnen zurückgeschrien hätte. Ich war noch nie in einem Gefängnis. Wenn ich einmal dort eingesperrt wäre, war ich mir unwillkürlich sicher, käme ich nie mehr heraus. Ich dachte an meinen Sohn. Würde ich ihn je wiedersehen? Ich dachte an meine Arbeit, die ich sicher verlieren würde, einen Job, für den ich immer wieder hart gekämpft hatte, erst um ihn zu bekommen, dann um ihn zu behalten. Ich war die einzige Frau unter so vielen Männern, und ich war nicht nur einfach eine Kollegin, sondern ich bewies ihnen immer wieder, dass ich besser war als sie. Ich dachte an den Skandal, den es für meine Familie bedeuten würde, wenn ich im Gefängnis säße.
Das Auto hielt. Der Fahrer ließ die Scheibe herunter und fragte den Wachmann, wo das Frauengefängnis sei.
Ich versuchte, einen klaren Kopf zu behalten. Ich musste über Halima eine Botschaft absenden. Am Morgen war ich in großer Eile aus meinem Haus gestürzt, ohne in meine Handtasche zu schauen. Jetzt hatte ich nicht einmal einen Stift und ein Stück Papier zum Schreiben. Doch dann erinnerte ich mich, dass ich einen Zettel in der Tasche hatte. Eine Frau aus der Frauenbewegung wollte mir dabei helfen, einen Führerschein zu beantragen, aber wir hatten kein Taxi bekommen für die Fahrt zur Verkehrsbehörde. Stattdessen bin ich nach der Arbeit mit meinem Bruder Auto gefahren. Als einer der Polizisten auf der Wache in Thuqbah mich später beschuldigte, ohne eine saudische Fahrerlaubnis gefahren zu sein, hatte ich diesen Antrag aus der Tasche gezogen mit den Worten: »Das ist mein Antrag. Geben Sie mir meine Fahrerlaubnis.« Es war schon Ironie, dass ausgerechnet dieser Antrag nun noch in meiner Handtasche steckte. Jetzt brauchte ich nur noch einen Stift. Ich kramte weiter und fand nur einen Augenbrauenstift. Das reichte. Ich schrieb auf meinen Führerscheinantrag: »Hilf mir. Gib mir Muniras Nummer aus meinem Telefon.« Munira war meine Schwägerin. Als wir weiterfuhren, drückte ich Halimas Hand und zeigte ihr, was ich geschrieben hatte. Ich musste vorsichtig sein. Die Männer konnten uns im Rückspiegel beobachten. Sie konnten alles hören, was wir sagten. Aber ich musste Halima dazu bringen, die Nachricht zu lesen.
Sie sagte nichts. Sie sah mich nicht einmal an.
Wir kamen zu einem weiteren Tor, das zu einem Parkplatz und einem Gebäude führte. Aber der Fahrer hielt nicht auf dem Parkplatz, sondern direkt vor der Tür. Die beiden Männer stiegen aus und gingen mit meinen Papieren ins Gebäude. Das war meine Chance. Ich musste jemanden erreichen. Ich wusste nicht, wo mein Bruder war, und die einzige Telefonnummer, die ich auswendig kannte, war die meines Vaters. Aber den wollte ich nicht anrufen. Er wusste nichts von der Women2Drive-Kampagne. Wohl aber meine Schwägerin, sie müsste ich erreichen.
Ich wandte mich Halima zu, diesmal ergriff ich ihre beiden Hände und flehte wieder: »Halima. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich muss meine Familie anrufen.« Ich sagte: »Bitte, Halima. Die Männer sind jetzt im Haus. Niemand wird es erfahren. Ich muss einen Anruf von meinem Telefon machen oder eine SMS an meine Schwägerin schicken. Damit sie wissen, wo ich bin. Bitte.«
Ihre Augen sahen mich durch den schmalen Schlitz an, und sie sagte: »Es tut mir wirklich sehr, sehr leid.« Ihre Stimme klang wie von Schmerzen gequält. Sie sagte, sie habe nicht gewusst, dass sie mich hierher bringen würden. Sie habe mich nur begleiten sollen, damit ich nicht mit zwei Männern allein wäre. Aber sie wiederholte: »Ich darf Ihnen ihr Telefon nicht geben.«
Ich flehte sie weiter an. »Ich habe ein Kind«, sagte ich. »Sie haben zwei Kinder, ich habe ein Kind. Sie wissen, was das bedeutet, Sie verstehen mich.«
Aber sie erklärte, wenn sie mir mein Telefon gäbe, würde man sie entlassen. Sie habe ihre Befehle, denen sie gehorchen müsse. »Wenn ich sie missachte, bekomme ich große Schwierigkeiten. Ich kann es mir nicht leisten, meinen Job zu verlieren.«
Ich bettelte weiter, die ganze Zeit über, die wir warteten, aber sie gab nicht nach. Als die Männer wiederkamen, rissen sie die Autotür auf und befahlen mir, mitzukommen. Ich wollte mich wehren. »Nein. Ich gehe nicht mit Ihnen. Ich möchte einen Anwalt anrufen. Sie können mich nicht einfach ohne Anklage ins Gefängnis werfen.«
Sie entgegneten nur, ich solle mitkommen. Wenn ich mich wehren würde, »müssen wir Sie mit Gewalt hineinbringen«.
Widerwillig schleppte ich mich langsam in das Gebäude, bis wir in eine Halle kamen, an die sich weit hinten ein Büro anschloss. Ich bemerkte sofort die Fliesen. Es waren die gleichen wie in meiner alten Schule in Mekka. Weiß, schwarz und braun, mit etwas im Innern, das aussah wie Steine. Als vor Jahrzehnten im Königreich Regierungsgebäude und Schulen gebaut wurden, hatte man wohl auf allen Böden diese Fliesen verlegt. Damals sahen sie vielleicht wie neu aus, jetzt wirkten sie nur alt und abgetreten.
Am Eingang saßen zwei Männer auf Stühlen, die so wie auf einem Flughafen-Terminal in einer Reihe fest miteinander verbunden waren. Sie hielten Dokumente in der Hand. Man befahl mir, bis zum Büro weiterzugehen und dort in einiger Entfernung zum Schreibtisch auf einem Sofa Platz zu nehmen. Schließlich wurde ich hineingeführt.
Meine Papiere gab man dem uniformierten Mann, der hinter dem Schreibtisch saß. Sein Name war auf einem kleinen Holzschild eingraviert: »Musaad«. Er war der stellvertretende Gefängnisdirektor, wie ich später erfuhr. Der Direktor selbst hatte Urlaub, deshalb stand ich in Musaads Büro. Er trug keine Kopfbedeckung. Bis auf einen Schnauzer war sein Bart kurz geschnitten, und als er meine Papiere durchblätterte, verzog er vor Abscheu das Gesicht. Er blickte auf die Papiere, dann auf mich. Was wohl in den Papieren stand, fragte ich mich.
»Sie sind also die berüchtigte Manal al-Sharif«, sagte er und musterte mich von seinem Schreibtisch aus. »Schämen Sie sich nicht dafür, was Sie getan haben?«
»Ist Autofahren eine Schande?«, gab ich zurück.
Die saudische Tageszeitung, die mir der Ermittler am Morgen gezeigt hatte, lag aufgeschlagen vor ihm. Musaad hielt sie hoch, zeigte mit dem Finger auf das Foto mit meinem unverschleierten Gesicht und dem bunten Kopftuch. Dann schrie er mich an: »Wie konnten Sie so das Haus verlassen? Ihr Gesicht ist unverschleiert und Sie tragen nicht einmal den schwarzen Hidschab.« Er schrie noch lauter, als stünde er ohne Mikrofon vor einem Publikum, seine Worte drangen aus dem kleinen Büro und hallten durch den weiträumigen, gefliesten Eingangsbereich. »Sie haben Ihre Religion beleidigt, sie haben Ihre Tradition beleidigt, sie haben unser Land beleidigt. Sie haben verdient, was jetzt mit Ihnen geschehen wird.«
»Sir«, sagte ich, »das muss ein Irrtum sein. Sie können mich nicht ins Gefängnis stecken.«
Sein Gesichtsausdruck verriet mir, dass er das sehr wohl konnte.
»Darf ich wenigstens mit meinem Sohn sprechen?«, fragte ich. »Er weiß nicht, dass ich hier bin.«
»Jetzt fragen Sie nach Ihrem Sohn? Sie haben nicht nach ihm gefragt, als Sie sich ans Steuer setzten! Sie haben nicht nach ihm gefragt, als Sie die Women2Drive-Kampagne gründeten!« Er saß immer noch, während ich mit meinem unverschleierten Gesicht vor ihm stand. Er musste mir so direkt in die Augen sehen, wie ich ihm in seine schaute. Dass eine Frau es wagte, aufrecht und unverschleiert vor ihm zu stehen, das verstörte ihn vermutlich mehr als alles andere.
Er schimpfte mich noch mindestens eine halbe Stunde lang aus wie ein ungezogenes Kind. Ich blieb höflich, respektvoll, wurde weder wütend noch aggressiv. In allen Verhören habe ich kooperiert, und auf alle Fragen geantwortet. Ich durfte mich nicht provozieren lassen, mich nicht zur Wehr setzen, das war mir klar, denn gegen diese männliche Übermacht war ich chancenlos. Ich wiederholte immer wieder: »Sir, bitte, Sie dürfen mich nicht einsperren, ohne mir zu erlauben, meinen Anwalt und meine Familie zu informieren. Ich weiß nicht, wohin sie meinem Bruder gebracht haben, ich weiß nicht, warum ich hier bin, und meine Familie weiß nicht, wo ich bin.« Er schrie mich immer wieder an: »Nein, Nein, Nein! Später können Sie mit Ihrer Familie sprechen. Jetzt nicht«. Neben ihm auf dem Schreibtisch stand ein Telefon.
Ich versuchte, trotz meiner Erschöpfung möglichst gerade vor ihm zu stehen, als mir einfiel, was mir einmal eine befreundete Frauenrechtlerin erzählt hatte. Auch sie wurde festgenommen, aber sie kam nie ins Gefängnis. Ich fragte sie, wie sie das geschafft habe. Sie erklärte: »Das ist einfach, wir sind schließlich Frauen.« Und dann zeigte sie mir, wie sie es machte. Ihre Schultern fingen an zu beben, Tränen traten in ihre Augen. »Weine ein bisschen, sag, dass du alles bedauerst, und sie werden Mitleid mit dir haben und dich gehen lassen«, versicherte sie. Aber da waren keine Tränen in meinen Augen.
Ich kann nicht vor Männern weinen. Seit 2002 arbeitete ich bei Aramco, und in den ersten sechs Jahren dort hatte ich ausschließlich männliche Kollegen. 2008 kam eine weitere junge Frau in unsere Abteilung. Sie weinte viel, die leiseste Kritik, jede Bemerkung, die sie als verletzend empfand, ließ sie in Tränen ausbrechen. Ich weiß noch, dass mein Chef zu mir sagte: »Manal, ich wünschte, sie hätte zehn Prozent von dir. Ich habe Dich hier noch nie weinen gesehen.« Und es stimmt, schon die Vorstellung, dass ein Mann mich weinen sieht, ist mein Albtraum. Selbst mein Ex-Mann sagte: »Wenn ich dich weinen sähe, würde ich dir ja verzeihen.« Aber ich kann nur weinen, wenn ich allein bin – oder vor Frauen. Sie verstehen das, sie dürfen meine Tränen sehen.
Doch in diesem Augenblick versuchte ich, mir Tränen abzuringen. Würden meine Augen zumindest ein wenig feucht werden, dann könnte ich sagen: »Bitte, Sir, darf ich mit meinem Sohn sprechen?« Vielleicht hätte er Mitleid und ließe mich diese eine Nummer wählen.
Es gab so vieles, was ich Musaad sagen wollte. Zum Beispiel: »Ich bin nicht kriminell. Ich bin ein guter Mensch. Dieses Land sollte stolz auf jemanden wie mich sein. Ich bin die erste Frau, die bei unserem staatlichen Ölkonzern als Expertin für Datensicherheit arbeitet. Man hat mir Aufgaben in einer sehr wichtigen und hoch sensiblen Abteilung übertragen. Die Firma ist sehr stolz auf mich. Die Zeitung hat über mich und meine Arbeit geschrieben, und ich habe Zeitschriften Interviews gegeben. Ich habe es nicht verdient, hier vor Ihnen stehen zu müssen und mich von Ihnen anschreien zu lassen.«
Schließlich gelangen mir ein paar Tränen, genügend, dass Halima, die schweigend neben mir stand, meine Hand ergriff. Sie streichelte sie, so wie eine Mutter über den Kopf ihres weinenden Kindes streicht. Aber die Tränen in meinen Augen machten den stellvertretenden Gefängnisdirektor noch wütender. Er brüllte mir hässliche, verletzende Worte so laut ins Gesicht, dass jeder in der Nähe es hören konnte: die beiden Soldaten in seinem Büro, der Wachmann, die Eskorte, die mich hierher gebracht hatte, alle.
Mitten in seiner Tirade klingelte sein Telefon. Ich konnte den Namen des Mannes am anderen Ende der Leitung verstehen, es war der Polizeichef von Khobar, derjenige, der gesagt hatte, ich selbst sei an allem schuld. Die beiden Männer sprachen eine Weile miteinander, dann schloss Musaad seine Bürotür, sah mich an und verkündete: »Keine Angst, Sie werden nur ein paar Tage hier bleiben.« Dann benutzte er eine arabische Redewendung, die so viel bedeutet wie »die Ohren langziehen«. Wenn jemand in der Schule die Hausaufgaben vergessen hatte oder unartig gewesen war, dann zog der Lehrer ihm die Ohren lang. In der arabischen Sprache bedeutet das, jemandem eine Lektion zu erteilen.
Ich flehte ihn wieder an: »Bitte, darf ich wenigstens in meinem Telefon nach der Nummer meiner Schwägerin schauen?«
Und diesmal sagte er: »In Ordnung. Sie dürfen in Ihr Telefon schauen.«
Halima gab es mir, und während die anderen sich unterhielten, schrieb ich zwei Textnachrichten. Ich tippe sehr schnell. Eine ging an meinen Freund und Kollegen Ahmed, der vom Women2Drive-Account aus twitterte. Ich schrieb ihm: »Ich bin im Frauengefängnis von Dammam. Twittere darüber!« Die andere ging an meine Schwägerin, die bei meinem Sohn war. Auch ihr schrieb ich, dass ich im Frauengefängnis sei. Und ich bat sie, mir einen Anwalt zu besorgen. Zwar hatte ich, kurz bevor ich mein Haus verlassen musste, mit einer Anwältin gesprochen, aber Frauen durften in Saudi-Arabien bis zum Jahr 2014 keine Kanzlei eröffnen und nicht als Anwältinnen arbeiten. Ich brauchte also einen Mann, wenn ich aus dem Frauengefängnis herauskommen wollte.
Genau in diesem Moment wandten sich alle wieder mir zu, und der stellvertretende Direktor fragte: »Was machen Sie da?«
»Ich habe nur nach der Nummer gesucht«, antwortete ich.
»Sind Sie fertig?«
»Ja«, sagte ich, machte das Telefon aus und gab es zurück. Mein Handy war mit einem Passwort geschützt, ich hoffte, dass sie die Sperre nicht überwinden konnten.
Eskortiert von Halima und dem männlichen Sicherheitsbeamten ging ich dann mit meiner Handtasche ohne mein Telefon und ohne meinen Ausweis ins Gefängnis. Das Gebäude war alt, umgeben von hohen Mauern. Um zum Haupthaus zu gelangen, überquerten wir einen großen, dreckigen Hof ohne Pflaster, ohne Weg, nur die nackte Erde. Am anderen Ende sah ich eine gewaltige Stahltür, direkt daneben einen kleinen Verschlag für einen bewaffneten Wachmann. In der Ferne, rund um das Gefängnis, Wachtürme.
Man führte mich durch ein anderes Gebäude hinein. Die Eingangstür war stark beschädigt, im Innern gab es keine Fenster, die Stühle waren verdreckt. Jemand befahl mir, mich zu setzen. Ich pochte immer noch darauf, telefonieren zu dürfen. Später, sagte der Wachmann zu Halima, sobald ich im Frauengefängnis sei, dürfe ich einmal telefonieren, allerdings nicht mit meinem eigenen Telefon. Ich könne eine Telefonkarte im Wert von zehn oder zwanzig Riyal kaufen (es war interessant zu sehen, dass einige gefangene Männer ihre eigenen Telefone hatten).
Ich erwarb eine Karte, dann fragte mich der Wachmann, wie viele Essensmarken ich kaufen wolle.
»Ich werde morgen wieder weg sein«, sagte ich. »Ich will keine.«
Doch er bestand darauf, ich würde sie drinnen brauchen. Also entschied ich mich für einen dünnnen Block im Wert von 100 Riyal, mit Gutscheinen, die aussahen wie die, mit denen wir früher in der Schule unser Frühstück bezahlten. Lauter gelbe Marken, die ich in meine Handtasche steckte.
Vom Vorraum aus gingen wir durch zwei Tore ins Gefängnis. Bei dem kleineren der beiden verabschiedete sich der Wachmann. Hier begann der Bereich, den ausschließlich Frauen betreten durften.
Wir kamen in einen Gang, und ich musste mir sofort Mund und Nase zuhalten, um den scharfen Gestank von Urin und Kot auszuhalten. Der ganze Flur roch wie ein riesiges Klo. Eine Wand bestand aus dickem, doppeltem Plexiglas. Der Bereich dahinter, so erfuhr ich später, war der Besucherraum. Stühle gab es keine: Man presste sich an die Plexiglasscheibe, in die auf beiden Seiten Löcher eingelassen waren, allerdings nicht in gleicher Höhe. Man konnte sich nur schreiend unterhalten, und trotzdem war kaum etwas zu verstehen.
Halima ergriff meine Hand mit ihrem dünnen, abgewetzten Handschuh. Dann übergab sie meine Papiere und mein Telefon einer Gefängniswärterin, sah mich an und sagte: »Gott schütze Sie.« Und sie fügte noch hinzu: »Alles wird gut.«





























