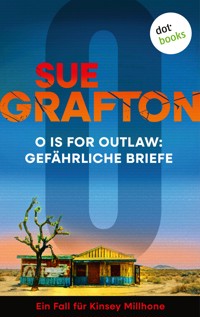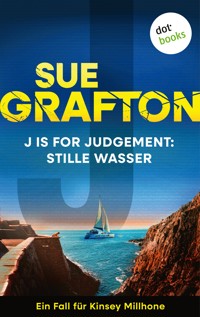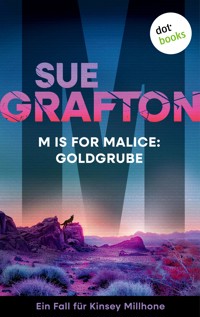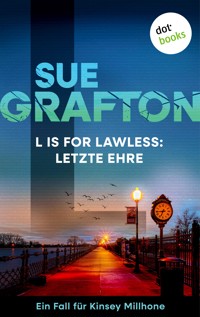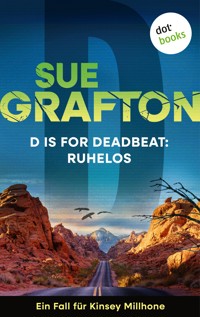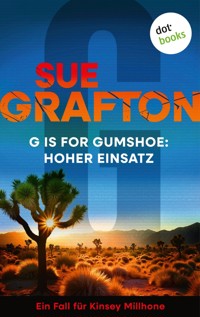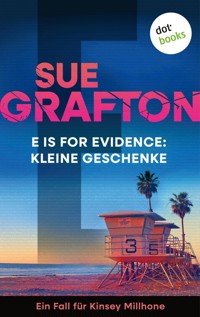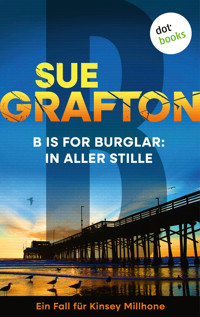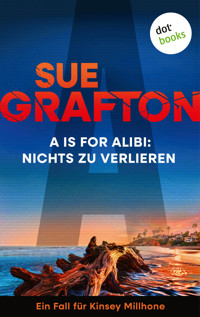Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Kinsey Millhone
- Sprache: Deutsch
In ihrem vierzehnten Fall deckt die scharfsinnigste Privatdetektivin der Westküste ein Verbrechen auf, das nie hätte ans Licht kommen sollen … Eigentlich wollte Privatermittlerin Kinsey Millhone nur einen harmlosen Auftrag übernehmen: Die Witwe eines verstorbenen Polizisten bittet sie, herauszufinden, was ihren Mann in den letzten Wochen seines Lebens belastet hat. Doch kaum ist Kinsey in der abgelegenen Gemeinde Nota Lake angekommen, schlägt ihr offenes Misstrauen entgegen – und Gewalt. Je tiefer sie in das Leben des angesehenen Cops Tom Newquist eintaucht, desto klarer wird: Er war einer grausamen Wahrheit auf der Spur. Eine Wahrheit, die nie entdeckt werden sollte. Als Kinsey dem Täter auf die Spur kommt, ist es fast zu spät – und sie muss um ihr Leben kämpfen … »Jeder Leser, der einen klugen und frechen Ermittler braucht, tut gut daran, Sue Graftons Kinsey Millhone zu lesen.« New York Times Der vierzehnten Band einer der erfolgreichsten Krimiserien überhaupt, der unabhängig gelesen werden kann – ein fesselnder Ermittlerkrimi für Fans von Val McDermid und Patricia Cornwell. In ihrem fünfzehnten Fall muss wird Kinsey Millhone gezwungen, der Wahrheit über ihre eigene Vergangenheit ins Auge zu sehen … »Wie immer lässt mich Sue Grafton die Seiten umblättern und darauf warten, was als nächstes kommt.« – Amazon-Leserin » Absolut eines der besten Bücher in der Serie bisher, wenn nicht sogar das Beste.«– Amazon-Leser
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Eigentlich wollte Privatermittlerin Kinsey Millhone nur einen harmlosen Auftrag übernehmen: Die Witwe eines verstorbenen Polizisten bittet sie, herauszufinden, was ihren Mann in den letzten Wochen seines Lebens belastet hat. Doch kaum ist Kinsey in der abgelegenen Gemeinde Nota Lake angekommen, schlägt ihr offenes Misstrauen entgegen – und Gewalt. Je tiefer sie in das Leben des angesehenen Cops Tom Newquist eintaucht, desto klarer wird: Er war einer grausamen Wahrheit auf der Spur. Eine Wahrheit, die nie entdeckt werden sollte. Als Kinsey dem Täter auf die Spur kommt, ist es fast zu spät – und sie muss um ihr Leben kämpfen …
eBook-Neuausgabe November 2025
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1998 unter dem Originaltitel »›N Is for Noose« bei Henry Holt and Company, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1999 unter dem Titel »Kopf in der Schlinge« im Goldmann Verlag.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1998 by Sue Grafton
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1999 by Wilhelm Goldmann Verlag, München in der Verlagsgruppe Bertelsmann GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Svetolk, Constantin Seltea, Afiq Sam und AdobeStock/Clio
eBook-Herstellung: dotbooks GmbH unter Verwendung von IGP (mm)
ISBN 978-3-69076-385-1
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people . Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected] . Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Sue Grafton
N is for Noose: Kopf in der Schlinge
Kriminalroman – Ein Fall für Kinsey Millhone 14
Aus dem Amerikanischen von Ariane Böckler
dotbooks.
Für Steven, der mein Leben möglich macht
Kapitel 1
Manchmal denke ich darüber nach, wie seltsam es wäre, einen Moment lang in die Zukunft sehen zu können, einen kurzen Blick auf die Ereignisse zu werfen, die uns zu einem unbekannten Zeitpunkt erwarten. Stellen Sie sich vor, wir könnten durch ein winziges Guckloch in der Zeit schauen und einen zufälligen Ausschnitt von dem aufschnappen, was in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Manche Momente, die wir erblickten, würden uns völlig unverständlich sein, und manche, so fürchte ich, würden uns maßlos erschrecken. Wenn wir wüßten, was uns droht, würden wir manche Entscheidungen nicht treffen und am Scheideweg Alternative B statt Alternative A wählen; der Arbeitsplatz, die Ehe, der Umzug in eine andere Stadt, der Nachwuchs, der geplante medizinische Eingriff, der langersehnte Skiurlaub, der soviel Spaß zu machen schien – bis das dunkle Rumpeln der Lawine ertönte. Wären uns die Konsequenzen jeder Handlung klar, könnten wir nach Gutdünken entscheiden und unser Schicksal selbst umgestalten. Aber natürlich verläuft die Zeit nur in eine Richtung, und das offenbar in geordneter Abfolge. Hier, in der nüchternen und kalten Gegenwart, sind wir abgeschirmt vor dem Wissen um die Gefahren, die auf uns warten, durch blinde Unschuld geschützt vor zukünftigen Schrecken.
Nehmen wir nur einmal meinen Fall. Ich kurvte in einem preisreduzierten Mietwagen auf dem Highway 395 durch die Berge, und zwar in südlicher Richtung auf den Ort Nota Lake in Kalifornien zu, wo ich eine potentielle Klientin befragen wollte. Die Straße war trocken und die Sicht einwandfrei, da klares Wetter herrschte. Der Auftrag der Klientin war nichts Besonderes, jedenfalls nicht, soweit ich informiert war. Ich hatte keine Ahnung, daß irgendwelche Risiken lauerten, sonst hätte ich mich nicht darauf eingelassen.
Ich hatte Dietz in Carson City zurückgelassen, wo ich die letzten zwei Wochen damit verbracht hatte, für ihn Krankenschwester und Gesellschafterin zu spielen, während er sich von einem Krankenhausaufenthalt erholte. Er hatte sich einer Knieoperation unterziehen müssen, und ich hatte mich bereit erklärt, ihn in seinem schnieken, kleinen roten Porsche nach Nevada zurückzufahren. Mit meiner Fürsorglichkeit ist es nicht weit her, aber ich bin praktisch veranlagt, und die neunstündige Fahrt erschien mir als die naheliegendste Lösung für das Problem, wie man sein Auto zu ihm nach Hause zurückbefördern sollte. Ich bin eine geübte Fahrerin, und er konnte sich darauf verlassen, daß ich uns ohne unnötige Verzögerungen oder belangloses Geplapper nach Carson City bringen würde. Die vergangenen zwei Monate hatte er bei mir gewohnt, und da unser Abschied nahte, gingen wir persönlichen Gesprächen lieber aus dem Weg.
Der Vollständigkeit halber: Ich heiße Millhone, mit Vornamen Kinsey. Ich bin weiblich, zweimal geschieden, stehe sieben Wochen vor meinem sechsunddreißigsten Geburtstag und bin einigermaßen durchtrainiert. Ich besitze eine Lizenz als Privatdetektivin und wohne in Santa Teresa, Kalifornien, einem Ort, an dem ich hänge wie ein Ball an einer ganz kurzen Schnur. Gelegentlich führt mich mein Beruf zwar in andere Landesteile, aber im Grunde bin ich eine Kleinstadtschnüfflerin und werde es vermutlich mein Leben lang bleiben.
Dietz’ Operation, die für den ersten Montag im März angesetzt war, verlief ohne Komplikationen, also können wir uns diesen Teil sparen. Danach kehrte ich in seine Eigentumswohnung zurück und sah mich interessiert dort um. Ich war verblüfft gewesen, als ich seine Räumlichkeiten zum ersten Mal sah, da sie großzügiger und wesentlich besser eingerichtet waren als meine bescheidene Behausung in Santa Teresa. Dietz ist ein Nomade, und ich hätte nie gedacht, daß er über nennenswerten materiellen Besitz verfügt. Während ich in einer umgewandelten Einzelgarage hause (die kürzlich umgebaut worden ist und nun im Obergeschoß ein Loft zum Schlafen und ein zweites Badezimmer umfaßt), residiert Dietz in einem Penthouse mit drei Schlafzimmern, das inklusive Dachterrasse und einem Dachgarten mit einem richtigen Gewächshaus schätzungsweise 280 Quadratmeter Wohnraum umfaßt. Sicher, das siebenstöckige Gebäude liegt in einem Gewerbegebiet, aber die Aussicht ist umwerfend und die Abgeschiedenheit vollkommen.
Ich war zu höflich gewesen, um herumzuschnüffeln, während er direkt neben mir stand, aber als er in der sicheren Obhut der orthopädischen Abteilung des Carson/Tahoe Hospital lag, durchsuchte ich ohne Skrupel alles in meiner direkten Reichweite, was bedeutet, daß ich einen Stuhl mit mir herumschleppen mußte, auf den ich hin und wieder kletterte. Ich durchsuchte Schränke und Akten, Kisten, Papiere und Schubladen, Jackentaschen und Koffer und fühlte mich ebenso erleichtert wie enttäuscht darüber, daß er nichts Besonderes zu verbergen hatte. Ich meine, was bringt die ganze Schnüffelei, wenn sie nichts Interessantes zutage fördert? Allerdings bekam ich ein Foto seiner Exfrau Naomi in die Finger, die auf jeden Fall wesentlich hübscher war, als er je hatte durchblicken lassen. Darüber hinaus schienen seine Finanzen in Ordnung zu sein, sein Medizinschränkchen barg keine düsteren pharmazeutischen Enthüllungen, und sein privater Briefwechsel bestand fast ausschließlich aus Briefen voller Rechtschreibfehler von seinen beiden Söhnen im College-Alter.
Falls Sie mich für indiskret halten, so kann ich Ihnen versichern, daß Dietz mein Domizil genauso sorgfältig durchsucht hat, als er bei mir wohnte. Das weiß ich, weil ich ein paar Fallen gelegt habe, von denen er eine übersehen hat, als er meine abgesperrten Schreibtischschubladen knackte. Auch wenn seine Lizenz abgelaufen sein mochte, war er beruflich nach wie vor in Form. Keiner von uns hatte je sein Eindringen in meine Privatangelegenheiten zur Sprache gebracht, doch ich hatte mir geschworen, bei ihm das gleiche zu tun, falls sich die Gelegenheit ergab. Unter Detektiven gilt das als berufsspezifische Höflichkeitsgeste: Du durchwühlst meine Wohnung und ich deine.
Am Freitagmorgen der gleichen Woche wurde er aus der Klinik entlassen. Den anschließenden Heilungsprozeß verbrachte er mit viel Herumsitzen, während sein Knie so dick verbunden war, daß es wie eine Nackenrolle aussah. Wir sahen uns Schund im Fernsehen an, spielten Gin-Rommé und setzten ein Puzzle zusammen, das ein derart lebensechtes Bild eines wuselnden Regenwurmnests ergab, daß es mir fast den Appetit raubte. In den ersten drei Tagen übernahm ich das Kochen, was heißt, daß ich Sandwiches zubereitete und zwischen meiner berühmten Erdnußbutter-Essiggurken-Kreation und meiner geliebten Kombination aus heißem, hartgekochtem Ei in Scheiben mit tonnenweise Hellmann’s Mayonnaise und Salz abwechselte. Danach wollte Dietz offenbar unbedingt selbst wieder die Küche übernehmen, und unser Speiseplan wurde reichhaltiger und umfaßte Pizza, Gerichte vom Chinesen und Campbell’s-Suppen – Tomate oder Spargelcreme, je nach Laune.
Nach Ablauf von zwei Wochen kam Dietz ganz gut wieder allein zurecht. Die Fäden waren gezogen, und er hinkte zwischen seinen krankengymnastischen Terminen mit einer Krücke herum. Er hatte noch einen langen Heilungsprozeß vor sich, aber er konnte allein zu seinen Behandlungen fahren und schien auch sonst imstande zu sein, für sich zu sorgen. Mittlerweile hielt ich es nicht mehr für ausgeschlossen, daß ich durchdrehen würde, wenn ich noch länger hinter ihm herlief. Es war Zeit, mich auf den Weg zu machen, bevor unsere Zweisamkeit lästig zu werden begann. Ich war gern mit ihm zusammen, doch ich kannte meine Grenzen. Ich hielt meine Abschiedsworte oberflächlich; jede Menge lässiges »Okay«, »Prima«, »Vielen Dank« und »Bis bald«. Das war meine Art, den schmerzhaften Kloß in meinem Hals zu verdrängen und peinliches Geheule zu verhindern, das meiner Meinung nach lieber unterbleiben sollte. Verlangen Sie bloß nicht von mir, den Jammer, den ich empfand, mit dem fast schwindelerregenden Gefühl von Erleichterung in Einklang zu bringen. Niemand hat je behauptet, daß Gefühle schlüssig sein müßten.
Und hier war ich nun und raste auf der Suche nach Arbeit die Landstraße entlang, alles andere als wählerisch, was meinen nächsten Auftrag anging. Ich wollte Ablenkung. Ich wollte Geld, Zerstreuung, alles, um meine Gedanken vom Thema Robert Dietz fernzuhalten. Ich habe kein Talent fürs Abschiednehmen. Ich habe schon zu viele Trennungen erlebt und kann das Gefühl nicht ausstehen. Andererseits habe ich aber auch kein Talent für Beziehungen. Man kommt jemandem nahe, und im Handumdrehen hat man ihm schon die Macht gegeben, einen zu verletzen, zu betrügen, zu ärgern, zu verlassen oder zu Tode zu langweilen. Meine gewohnte Strategie ist es, auf Distanz zu bleiben und damit einer Menge unkontrollierbarer Gefühle aus dem Weg zu gehen. In psychiatrischen Kreisen gibt es Bezeichnungen für Menschen wie mich.
Ich schaltete das Autoradio ein und erwischte einen knisternden Sender aus Los Angeles, 450 Kilometer weiter südlich. Nach und nach begann ich mich an die Landschaft um mich herum zu gewöhnen. Der Highway 395 verläßt Carson City in südlicher Richtung, durch Minden und Gardnerville. Nördlich von Topaz hatte ich die Staatsgrenze überquert und befand mich nun in Ostkalifornien. Das Rückgrat des Bundesstaates bildet die steil aufragende Sierra Nevada Range, die hochgekippte Kante eines riesigen Verwerfungsblocks, der später von mehreren Gletschern abgeschliffen wurde. Zu meiner Linken lag der Mono Lake, der pro Jahr um einen halben Meter Umfang schrumpft, immer salzhaltiger wird und wenig Leben im und am Wasser zuläßt, außer Salzwasserkrabben und Vögel, die sich von ihnen ernähren. Irgendwo zu meiner Rechten, hinter einem dunkelgrünen Wald aus Jeffreykiefern, lag der Yosemite-Nationalpark mit seinen hohen Gipfeln, zerklüfteten Canons, Seen und tosenden Wasserfällen. Wiesen, die jetzt von einer dünnen Schneeschicht überzuckert waren, bildeten einst den Grund eines pleistozänischen Sees. Später im Frühling würden diese Wiesen von Wildblumen übersät sein. In den höheren Lagen war die winterliche Schneedecke noch nicht geschmolzen, doch die Pässe waren offen. Es war die Art von Landschaft, die von Leuten, die sich leicht beeindrucken lassen, »atemberaubend« genannt wird. Ich bin kein großer Natur-Fan, doch selbst ich war fasziniert genug, um »wow« zu murmeln, während ich mit 110 Stundenkilometern an einem Aussichtspunkt vorbeiraste.
Bei der potentiellen Klientin, zu der ich unterwegs war, handelte es sich um eine Frau namens Selma Newquist, deren Mann irgendwann in den letzten Wochen gestorben war. Dietz hatte früher einmal für sie gearbeitet, indem er ihr half, sich aus einer unerquicklichen ersten Ehe zu lösen. Ich hatte nicht alle Einzelheiten erfahren, aber er hatte durchblicken lassen, daß das, was er über die Finanzgeschäfte ihres Ehemannes ausgegraben hatte, ihr genug Macht gab, um sich aus der Beziehung zu befreien. Dann kam die zweite Ehe, und offensichtlich hatte der Tod ihres zweiten Ehemannes Fragen aufgeworfen, die seine Witwe beantwortet haben wollte. Sie hatte angerufen und Dietz engagieren wollen, doch weil er momentan außer Gefecht gesetzt war, hatte er mich empfohlen. Ich bezweifelte, daß Mrs. Newquist unter normalen Umständen eine Detektivin von der anderen Seite des Bundesstaates in Betracht gezogen hätte, aber meine Heimreise stand ohnehin an, und ich war in ihre Richtung unterwegs. Wie sich herausstellen sollte, war meine Verbindung zu Santa Teresa zweckdienlicher, als es zunächst den Anschein hatte. Dietz hatte sich für meine Zuverlässigkeit verbürgt und mir im Gegenzug versichert, daß Mrs. Newquist geleistete Arbeit gewissenhaft bezahlte. Es sprach nichts dagegen, lange genug haltzumachen, um mir anzuhören, was die Frau zu sagen hatte. Wenn sie mich dann nicht engagieren wollte, hätte ich lediglich eine halbstündige Unterbrechung meiner Fahrt investiert.
Ich erreichte Nota Lake (2356 Einwohner, 1314 m ü. d. M.) nach gut drei Stunden. Der Ort sah nach nicht viel aus, obwohl die Umgebung spektakulär war. Auf drei Seiten ragten Berge empor, und da noch Schnee lag, zeichneten sich die Gipfel in bauschigem Weiß vor den zahlreichen Haufenwolken am Himmel ab. Auf der schattigen Straßenseite sah ich übriggebliebene Schneeflächen und Eisklumpen, die sich vor den blattlosen Bäumen zusammengedrängt hatten. Die Luft duftete nach Kiefern, mit einem leicht süßlichen Nebengeruch. Der eisige Dampf, den ich einatmete, kam mir vor, als steckte ich den Kopf in eine halbleere Vierliterpackung Vanilleeis und saugte den zuckrigen Duft ein. Der See selbst war nicht mehr als drei Kilometer lang und anderthalb breit. Seine Oberfläche war glasig, und in ihr spiegelten sich die Granitzacken der Berge und die Umrisse von Weißtannen und Flußzedern, die auf den Hängen wuchsen. Ich hielt an einer Tankstelle und besorgte mir einen Plan der Stadt, die sich wie ein Fleck am östlichen Ende des Nota Lake ausnahm.
Die wichtigsten Geschäfte schienen sich in fünf Häuserblocks an der Hauptstraße aneinanderzureihen. Ich fuhr einmal alles ab und zählte zehn Tankstellen und zweiundzwanzig Motels. In Nota Lake gab es preiswerte Unterkünfte für die Skifahrer von den Mammoth Lakes. Der Ort hatte außerdem eine große Zahl von Fast-food-Restaurants zu bieten, darunter Burger King, Carl’s Jr., Jack in the Box, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, ein Waffle House, ein International House of Pancakes, ein House of Donuts, ein Sizzler, ein Subway, ein Taco Bell und meinen persönlichen Lieblingsladen McDonalds. Die weiteren Lokale mit Sitzplätzen unterteilten sich gleichmäßig in mexikanisch, Bar-B-Que und »Familienrestaurants«, was auf Massen plärrender Kleinkinder und ein Verbot harter Drinks schließen ließ.
Die Adresse, die ich bekommen hatte, lag am Ortsrand, zwei Blocks von der Hauptdurchgangsstraße entfernt in einer Siedlung, die aussah, als sei jedes Haus vom gleichen Bauunternehmer errichtet worden. Die Straßen des Viertels waren nach verschiedenen Indianerstämmen benannt – Shawnee, Iroquois, Cherokee, Modoc, Crow, Chippewa. Selma Newquist wohnte in einer Sackgasse namens Pawnee Way, und ihr Haus war das exakte Ebenbild des Nachbarhauses: Fachwerkverkleidung, ein Schindeldach, eine Veranda mit Fliegengittern am einen Ende und eine Doppelgarage am anderen. Ich parkte in der Einfahrt neben einem dunklen Ford. Aus Gewohnheit schloß ich meinen Wagen ab, stieg die zwei Stufen zur Veranda hinauf und klingelte – bim bam – wie eine Avon-Beraterin. Ich wartete eine Weile und versuchte es dann noch einmal.
Die Frau, die mir die Tür öffnete, war Ende Vierzig und von kleiner, kompakter Statur. Sie hatte braune Augen und kurzes, dunkles, zerzaustes Haar und trug eine rot-blau-gelb karierte Bluse über einem gelben Faltenrock.
»Hallo, ich bin Kinsey Millhone. Sind Sie Selma?«
»Nein, ich bin ihre Schwägerin Phyllis. Mein Mann Macon ist Toms jüngerer Bruder. Wir wohnen zwei Häuser weiter. Womit kann ich Ihnen helfen?«
»Ich bin mit Selma verabredet. Vermutlich hätte ich vorher anrufen sollen. Ist sie da?«
»Oh, entschuldigen Sie. Jetzt fällt es mir wieder ein. Sie hat sich gerade ein bißchen hingelegt, aber sie hat mir gesagt, daß Sie vorbeikommen würden. Sie sind sicher die Bekannte dieses Detektivs aus Carson City, mit dem sie telefoniert hat.«
»Genau«, bestätigte ich. »Wie geht es ihr denn?«
»Selma hat ihre schlechten Tage, und ich fürchte, heute ist einer davon. Tom ist heute vor sechs Wochen gestorben, und sie hat mich in Tränen aufgelöst angerufen. Ich bin, so schnell ich konnte, rübergekommen. Sie zitterte und war ganz verstört. Die Ärmste sieht aus, als hätte sie seit Tagen nicht geschlafen. Ich habe ihr ein Valium gegeben.«
»Ich kann auch später wiederkommen, wenn Sie das für besser halten.«
»Nein, nein. Sie ist bestimmt wach, und ich weiß, daß sie mit Ihnen sprechen will. Kommen Sie doch herein.«
»Danke.«
Ich folgte Phyllis durch die Diele und einen mit Teppich ausgelegten Flur entlang bis zu Selmas Schlafzimmer. Im Vorübergehen warf ich einen kurzen Blick durch die Türen rechts und links des Flurs. Ich gewann den Eindruck, daß alle Räume hoffnungslos überladen waren. Die Vorhänge und Bezugsstoffe im Wohnzimmer waren auf eine rosa-grüne Tapete abgestimmt, die mit Blumensträußen und pinkfarbenen Schleifen bedruckt war. Auf dem Couchtisch stand ein üppiges Bouquet pinkfarbener Seidenblumen. Der Velours-Teppichboden war blaßgrün und verströmte jenen intensiv chemischen Geruch, der darauf schließen ließ, daß er erst kürzlich verlegt worden war. Das Mobiliar im Eßzimmer war streng und unpersönlich: überall dunkles, glänzendes Holz, wobei der Raum im Verhältnis zu seiner Größe überladen war mit Möbelstücken. An den Fensterscheiben hatte sich ein weißer Kondensationsfilm angesammelt. Die Dämpfe von Zigarettenrauch und Kaffee vermischten sich zu einem penetranten Geruch.
Phyllis klopfte an die Tür. »Selma? Ich bin’s, Phyllis.«
Ich vernahm eine gemurmelte Antwort. Phyllis öffnete einen Spaltweit die Tür und spähte um den Türrahmen herum. »Du hast Besuch. Es ist eine Dame – diese Detektivin aus Carson City.«
Ich wollte sie schon korrigieren, überlegte es mir dann aber anders. Ich war nicht aus Carson City, und ich war mit Sicherheit keine Dame, aber was spielte das schon für eine Rolle? Durch den Türspalt konnte ich einen Blick auf die Frau im Bett werfen: ein Gewirr platinblonden Haares, eingerahmt von den Pfosten eines Himmelbetts.
Offenbar war ich hereingebeten worden, denn Phyllis trat einen Schritt zurück und sagte, als ich vorüberging, halblaut zu mir: »Ich muß jetzt nach Hause, aber Sie können jederzeit vorbeikommen, falls Sie etwas brauchen.«
Ich nickte ihr dankend zu, betrat das Schlafzimmer und schloß die Tür hinter mir. Die Vorhänge waren zugezogen und das Licht gedämpft. Zierkissen lagen rings um das Bett auf dem Teppich. Es gab Unmengen von Rüschen, und knallbunte Stoff- und Tapetenmuster bedeckten Wände, Fenster und die bauschige Bettwäsche. Das Motiv schien auf Berührung explodierende Rosen darzustellen.
»Es tut mir leid, wenn ich Sie störe«, begann ich, »aber Phyllis meinte, es würde Ihnen nichts ausmachen. Ich bin Kinsey Mill- hone.«
Selma Newquist setzte sich in ihrem ausgebleichten Flanellnachthemd auf und strich die Bettdecke glatt, wobei sie mich an eine Kranke erinnerte, die ihr Essenstablett erwartet. Nach einem Blick auf ihre Handrücken, die mit Leberflecken übersät und von Venen durchzogen waren, schätzte ich sie auf Ende Fünfzig. Ihr Teint ließ auf einen dunklen Typ schließen, doch ihr Haar war ein Wust weißblonder Locken und wirkte wie Zuckerwatte. Momentan hing der ganze Turm zur Seite und schien von Haarspray verklebt zu sein. Sie hatte sich die Augenbrauen mit einem rotbraunen Stift nachgezogen, aber Eyeliner oder Lidschatten waren schon lange abgegangen. Durch die Streifen in ihrem dicken Make-up konnte ich die fleckige Gesichtshaut sehen, die auf zuviel Sonneneinwirkung hinwies. Sie griff nach ihren Zigaretten, indem sie auf dem Nachttisch herumtastete, bis sie Päckchen und Feuerzeug gefunden hatte. Ihre Hand zitterte leicht, als sie sich die Zigarette anzündete. »Kommen Sie doch hier rüber«, sagte sie und zeigte auf einen Stuhl. »Nehmen Sie die Sachen runter und setzen Sie sich hierhin, damit ich Sie besser sehen kann.«
Ich nahm ihren gesteppten Morgenmantel vom Stuhl und legte ihn aufs Bett. Dann zog ich den Stuhl näher heran und setzte mich.
Sie starrte mich mit ihren geschwollenen Augen an, während ihr beim Sprechen ein dünner Rauchfaden aus dem Mund quoll. »Tut mir leid, daß Sie mich so sehen müssen. Normalerweise bin ich um diese Zeit schon auf, aber heute war ein harter Tag.«
»Aha«, sagte ich. Der Rauch senkte sich langsam auf mich herab wie die feinen Tröpfchen, wenn einen jemand angeniest hat.
»Hat Phyllis Ihnen Kaffee angeboten?«
»Bitte machen Sie sich keine Umstände. Sie ist wieder zu sich nach Hause gegangen, und ich brauche nichts, danke. Ich möchte nicht mehr Zeit in Anspruch nehmen als nötig.«
Sie sah mich ausdruckslos an. »Ist doch egal«, sagte sie. »Ich weiß nicht, ob Sie je einen Menschen verloren haben, der Ihnen nahestand, aber es gibt Tage, da fühlt man sich, als bekäme man die Grippe. Der ganze Körper tut einem weh, und der Kopf ist so verstopft, daß man nicht mehr richtig denken kann. Ich bin froh, daß ich Gesellschaft habe. Man lernt jede Ablenkung zu schätzen. Seinen Gefühlen kann man nicht aus dem Weg gehen, aber eine kurzfristige Erleichterung nützt auch schon etwas.« Sie neigte dazu, sich beim Sprechen die Hand vor den Mund zu halten. Offenbar war ihr die Verfärbung an ihren beiden Schneidezähnen peinlich, die, wie ich nun sah, auffallend grau waren. Vielleicht war sie als Kind gestürzt oder hatte Medikamente einnehmen müssen, die den Zahnschmelz dunkel färbten. »Woher kennen Sie Robert Dietz?« fragte sie.
»Ich habe ihn selbst vor ein paar Jahren engagiert, damit er mich beschützt. Jemand hat mein Leben bedroht, und Dietz hat dann als mein Leibwächter gearbeitet.«
»Was macht sein Knie? Es hat mir leidgetan, zu hören, daß er das Bett hüten muß.«
»Das wird bald verheilt sein. Er ist ja zäh. Außerdem ist er schon wieder auf den Beinen.«
»Hat er Ihnen von Tom erzählt?«
»Nur, daß Sie erst seit kurzem verwitwet sind. Weiter weiß ich nichts.«
»Dann kläre ich Sie mal auf, obwohl ich eigentlich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Womöglich halten Sie mich ja für verrückt, aber ich kann Ihnen versichern, daß ich das nicht bin.« Sie nahm einen Zug von ihrer Zigarette und seufzte eine Handvoll Rauch aus. Ich erwartete Tränen, während sie erzählte, doch die Geschichte rollte in valiumbedingter Gelassenheit ab. »Tom hatte einen Herzinfarkt. Er war auf der Straße unterwegs ... etwa zehn Kilometer von hier entfernt. Es war zehn Uhr abends. Er muß es früh genug gemerkt haben, um am Straßenrand anzuhalten. Ein Officer der Highway Patrol namens James Tennyson – ein Freund von uns – erkannte Toms Geländewagen, sah, daß er die Warnblinkanlage eingeschaltet hatte, und hielt an, um nachzusehen, ob er Hilfe brauchte. Tom war über dem Lenkrad zusammengesunken. Ich war auf einer kirchlichen Versammlung, und als ich nach Hause kam, standen zwei Streifenwagen in der Einfahrt. Sie wissen doch, daß Tom als Detective im Sheriffbüro gearbeitet hat?«
»Das wußte ich nicht.«
»Ich hatte ständig Angst, daß er eines Tages bei seiner Arbeit ums Leben kommen würde. Nie hätte ich gedacht, daß er auf diese Weise stirbt.« Sie hielt inne, zog an ihrer Zigarette und benutzte den Rauch als eine Art Interpunktion.
»Das muß schwer gewesen sein.«
»Es war entsetzlich«, sagte sie. Erneut führte sie die Hand vor ihren Mund, während ihr die Tränen in die Augen stiegen. »Ich kann immer noch nicht daran denken. Ich meine, soweit ich weiß, hatte er nie irgendwelche Symptome. Oder sagen wir mal so: Falls er welche hatte, hat er mir nichts davon erzählt. Er litt an hohem Blutdruck, und der Arzt hat ihn bedrängt, das Rauchen aufzugeben und Sport zu treiben. Sie wissen ja, wie Männer sind. Er hat alles abgetan und einfach so weitergemacht, wie es ihm paßte.« Sie legte die Zigarette beiseite, damit sie sich die Nase putzen konnte. Warum spähen die Leute eigentlich immer in ihre Taschentücher, um nachzusehen, was ihnen ihr lärmendes Schnäuzen eingebracht hat?
»Wie alt war er?«
»Kurz vor dem Ruhestand. Dreiundsechzig«, antwortete sie. »Aber er hat nie auf sich geachtet. Ich glaube, die einzige Phase, in der er in Form war, war während seiner Armeezeit und direkt danach, als er auf der Polizeischule war und als Hilfssheriff eingestellt wurde. Danach gab’s während der Arbeit nur noch Koffein und Fast food und Bourbon, wenn er nach Hause kam. Er war kein Alkoholiker – verstehen Sie mich nicht falsch –, aber er trank abends gern einen Cocktail. In letzter Zeit hatte er Schlafstörungen. Er ist immer im Haus umhergeschlichen. Ich habe gehört, wie er auf war, um zwei, drei, fünf Uhr morgens, und Gott weiß was gemacht hat. In den letzten Monaten hat er immer mehr abgenommen. Der Mann aß kaum noch, er rauchte nur, trank Kaffee und starrte aus dem Fenster in den Schnee hinaus. Manchmal dachte ich, er würde bald die Nerven verlieren, aber das kann auch nur meine Einbildung gewesen sein. Er hat nie ein Wort gesagt.«
»Klingt, als wäre er irgendwie unter Anspannung gestanden.«
»Genau. Das dachte ich auch. Tom war eindeutig gestreßt, aber ich weiß nicht, warum, und das macht mich wahnsinnig.« Sie griff nach ihrer Zigarette, nahm einen tiefen Zug und streifte die Asche dann in einem Keramikaschenbecher ab, der wie eine Hand geformt war. »Jedenfalls habe ich deswegen Dietz angerufen. Ich finde, ich habe ein Recht darauf, es zu wissen.«
»Ich möchte nicht unhöflich klingen, aber spielt das wirklich eine Rolle? Was auch immer es war, jetzt läßt sich doch nichts mehr daran ändern, oder?«
Sie wandte kurz den Blick von mir ab. »Das habe ich mir auch schon gesagt. Manchmal denke ich, ich kannte ihn im Grunde gar nicht richtig. Wir sind ziemlich gut miteinander ausgekommen, und er hat immer für mich gesorgt, aber er war nicht der Typ Mann, der gern Rechenschaft über sich selbst ablegt. In seinen letzten beiden Wochen war er manchmal stundenlang weg, und wenn er zurückkam, sagte er kein Wort. Ich habe ihn nicht gefragt, wo er war. Ich hätte es wohl tun können, aber er hatte irgendetwas an sich, was mich abhielt. Er wurde wütend, wenn ich ihn bedrängte, also habe ich gelernt, auf Distanz zu bleiben. Aber ich halte nichts davon, bis ans Ende meines Lebens rätseln zu müssen. Ich weiß nicht einmal, wohin er an jenem Abend unterwegs war. Er hat zu mir gesagt, er bleibe daheim, aber irgendetwas muß dazwischengekommen sein.«
»Er hat Ihnen keine Nachricht hinterlassen?«
»Nichts.« Sie legte ihre Zigarette auf den Aschenbecher und griff nach einer Puderdose unter dem Kopfkissen. Dann klappte sie den Deckel auf und musterte ihr Gesicht im Spiegel. Sie berührte ihre Schneidezähne, als wollte sie einen Fleck entfernen. »Ich sehe gräßlich aus«, sagte sie.
»Keine Sorge. Sie sehen gut aus.«
Sie rang sich ein zaghaftes Lächeln ab. »Es ist wohl ohnehin sinnlos, eitel zu sein. Seit Tom weg ist, kümmert es niemanden mehr, mich eingeschlossen, wenn ich ehrlich bin.«
»Darf ich Sie etwas fragen?«
»Bitte.«
»Ich möchte nicht aufdringlich sein, aber waren Sie glücklich verheiratet?«
Mit einem kurzen, verlegenen Lachen klappte sie die Puderdose zu und schob sie wieder in ihr Versteck. »Ich auf jeden Fall. Wie es für ihn war, weiß ich nicht. Es war nicht seine Art zu klagen. Er nahm das Leben mehr oder weniger so, wie es kam. Ich war schon einmal verheiratet ... mit einem gewalttätigen Mann. Und ich habe einen Sohn aus dieser Ehe. Er heißt Brant.«
»Aha. Und wie alt ist er?«
»Fünfundzwanzig. Brant war zehn, als ich Tom kennenlernte, also hat Tom ihn im Grunde aufgezogen.«
»Und wo lebt Brant?«
»Hier in Nota Lake. Er arbeitet als Sanitäter bei der Feuerwehr. Seit der Beerdigung wohnt er bei mir, aber er hat eine eigene Wohnung im Ort«, sagte sie. »Ich habe ihm erzählt, daß ich mit dem Gedanken spiele, jemanden zu engagieren. Seiner Meinung nach ist es sinnlos, aber er wird sicher mithelfen, so gut er kann.« Ihre Nase färbte sich rötlich, doch dann gewann sie wieder die Kontrolle über sich.
»Sie und Tom waren wie lange verheiratet, vierzehn Jahre?«
»Knapp zwölf. Nach meiner Scheidung wollte ich nichts überstürzen. Die meiste Zeit verstanden wir uns gut, aber vor kurzem begann sich alles zum Schlechten zu wenden. Ich meine, er tat seine Pflicht, aber mit dem Herzen war er nicht bei der Sache. In letzter Zeit hatte ich das Gefühl, daß er etwas verbirgt. Ich weiß nicht, er war so ... irgendwie verschlossen. Warum war er an diesem Abend draußen auf der Landstraße? Ich meine, was hat er da gemacht? Was war so heikel, daß er es mir nicht erzählen konnte?«
»Könnte es ein Fall gewesen sein, an dem er gearbeitet hat?«
»Möglich wäre das schon.« Sie dachte darüber nach und drückte ihre Zigarette aus. »Ich meine, es hätte etwas mit seinem Beruf zu tun haben können. Tom hat nur selten ein Wort über die Arbeit verloren. Andere Männer – einige der Hilfssheriffs – haben in Gesellschaft oft Geschichten erzählt, aber Tom nicht. Er nahm seinen Beruf sehr ernst, fast schon zu ernst.«
»Jemand aus dem Präsidium muß doch seine Arbeit übernommen haben. Haben Sie mit dem Betreffenden gesprochen?«
»Sie sagen ›Präsidium‹, als wäre es eine Art Großstadtrevier. Nota Lake ist zwar der Sitz der Kreisverwaltung, aber das hat nicht viel zu sagen. Es gab nur zwei Ermittlungsbeamte, Tom und seinen Partner Rafer. Mit ihm habe ich gesprochen – aber nicht, daß ich irgend etwas erfahren hätte. Er war freundlich. Rafer ist oberflächlich betrachtet immer recht freundlich«, fuhr sie fort. »Aber trotz seines vielen Geplappers ist es ihm gelungen, sehr wenig zu sagen.«
Ich musterte sie einen Augenblick und unterzog das Gespräch meinem Testprogramm für Ungereimtheiten, um festzustellen, was hängenblieb. Mir kam nichts davon abwegig vor, aber ich begriff immer noch nicht, was sie wollte. »Glauben Sie, daß irgend etwas an Toms Tod verdächtig ist?«
Die Frage schien sie zu verblüffen. »Ganz und gar nicht«, erwiderte sie, »aber er hat über irgendetwas nachgegrübelt, und ich will wissen, was das war. Ich weiß, das klingt vage, aber es läßt mir keine Ruhe, wenn ich daran denke, daß er mir etwas verschwiegen hat, das ihn offenbar so stark belastet hat. Ich bin ihm eine gute Ehefrau gewesen, und ich will nicht im ungewissen bleiben, jetzt, wo er gestorben ist.«
»Was ist mit seinen persönlichen Sachen? Haben Sie die durchsucht?«
»Der Leichenbeschauer hat mir die Gegenstände gegeben, die Tom bei sich hatte, als er starb, aber das war nur das Übliche. Uhr, Brieftasche, etwas Kleingeld in der Hosentasche und sein Ehering.«
»Und was ist mit seinem Schreibtisch? Hat er hier im Haus ein Arbeitszimmer gehabt?«
»Ja, schon, aber da wüßte ich gar nicht, wo ich anfangen sollte. Sein Schreibtisch ist ein einziges Chaos. Überall stapeln sich Papiere. Es könnte ganz offen vor mir liegen, was auch immer es ist. Ich kann mich nicht dazu überwinden nachzusehen, ich kann die Sache aber auch nicht ruhen lassen. Damit würde ich Sie gern beauftragen ... daß Sie versuchen herauszufinden, was ihn so beunruhigt hat.«
Ich zögerte. »Versuchen kann ich es. Aber es würde mir weiterhelfen, wenn Sie sich etwas konkreter äußern würden. Sie haben mir nicht viele Anhaltspunkte gegeben.«
Selmas Augen füllten sich mit Tränen. »Ich habe mir das Hirn zermartert und habe trotzdem keine Ahnung. Bitte tun Sie einfach irgendwas. Ich kann sein Arbeitszimmer nicht einmal betreten, ohne mich in Tränen aufzulösen.«
O Mann, das hatte mir gerade noch gefehlt – ein Auftrag, der nicht nur unklar war, sondern mir auch noch aussichtslos erschien. Ich hätte mich auf der Stelle davonmachen sollen, doch ich tat es nicht. Was ich noch sehr bedauern sollte.
Kapitel 2
Gegen Ende meines Besuchs bei ihr schien das Valium zu wirken, und sie nahm sich zusammen. Irgendwie schaffte sie es, in erstaunlich kurzer Zeit auf die Beine zu kommen. Ich wartete im Wohnzimmer, während sie duschte und sich anzog. Als sie eine halbe Stunde später wiederkam, erklärte sie, sich fast wie neugeboren zu fühlen. Ich staunte über ihre Verwandlung. Frisch geschminkt strahlte sie mehr Selbstvertrauen aus, obwohl sie immer noch häufig mit erhobener Hand sprach, um ihren Mund zu verbergen.
Während der nächsten zwanzig Minuten diskutierten wir das Geschäftliche und einigten uns schließlich auf eine Lösung. Mittlerweile stand fest, daß Selma Newquist sich durchzusetzen wußte. Sie griff nach dem Telefon und buchte mir mit einem einzigen Anruf nicht nur eine Unterkunft, sondern setzte auch noch eine Ermäßigung von zehn Prozent auf den bereits gesenkten Preis der Nebensaison durch.
Ich fuhr um zwei Uhr nachmittags bei Selma weg und machte lange genug im Ort halt, um meine gewohnte Junk-Food-Ernährung durch eine Portion Fish and Chips von Capt’n Jack und eine große Cola zu ergänzen. Danach war es an der Zeit, ins Motel zu gehen. Es sah ganz danach aus, als würde ich Nota Lake frühestens übermorgen wieder verlassen. Das Motel, das Selma mir gebucht hatte, hieß Nota Lake Cabins und bestand aus zehn rustikalen Hütten auf einem waldigen Grundstück, direkt neben der Hauptdurchgangsstraße etwa neun Kilometer außerhalb der Stadt. Toms verwitwete Schwester Cecilia Boden war Besitzerin und Geschäftsführerin der Anlage. Als ich in den Parkplatz einbog, merkte ich, daß die Gegend für meinen Geschmack etwas zu abgelegen war. Ich bin im Tiefsten meines Herzens ein Stadtmensch und fühle mich umgeben von Restaurants, Banken, Schnapsläden und Kinos eigentlich am wohlsten. Da Selma für mich bezahlte, wollte ich keinen Protest einlegen, und offen gestanden sahen die Fassaden aus rohen Baumstämmen auch interessanter aus als die Motels im Ortskern. Schön blöd von mir.
Cecilia telefonierte gerade, als ich hereinkam. Ich schätzte sie auf sechzig, doch sie war so klein und kurvenlos wie ein zehnjähriges Mädchen. Sie trug ein rotkariertes Flanellhemd, das sie in dunkle, steife Blue jeans gesteckt hatte. Einen nennenswerten Po besaß sie nicht, hinten war lediglich eine flache Ebene. Ich wünschte jetzt schon, sie würde aufhören, ihr kurzgeschnittenes Haar mit Dauerwellen zu Tode zu quälen. Außerdem fragte ich mich, was wohl geschehen würde, wenn sie unter dem eintönigen Braun des Färbemittels, mit dem sie es behandelt hatte, das natürliche Grau hervorkommen ließe.
Der Empfangsbereich war klein, ein mit Kiefernholz getäfeltes Kabuff, kaum groß genug für einen schmalen gepolsterten Stuhl und das Regal mit den Prospekten, die die unzähligen Freizeitangebote in der Umgebung anpriesen. Eine Seitentür mit der Aufschrift Direktion führte vermutlich in ihre Privatwohnung. Die Rezeption bestand aus einer dreißig Zentimeter breiten Schreibunterlage auf der unteren Hälfte der teilbaren Tür, die die Mini-Lobby vom Büro trennte, wo die üblichen Utensilien zu sehen waren: Aktenschränke, Schreibmaschine, Registrierkasse, Karteikasten, Quittungsblock und das große Buch mit den Reservierungen, das sie zur Beantwortung der Fragen ihres Anrufers zu Rate zog. Sie schien ein klein wenig verärgert über die Fragen zu sein, die ihr gestellt wurden. »Ich habe am vierundzwanzigsten Zimmer frei, aber nicht am Tag danach ... Wenn Sie Fische ausgenommen und eingefroren haben wollen, versuchen Sie es im Elms oder im Mountain View ... Mhm ... Aha ... Tja, etwas anderes kann ich Ihnen nicht anbieten ...« Doch dann lächelte sie vor sich hin, als amüsierte sie sich über einen nur ihr bekannten Witz. »Nö ... Kein Zimmerservice, kein Kraftraum, und die Sauna ist außer Betrieb ...«
Während ich darauf wartete, daß sie zu telefonieren aufhörte, nahm ich aufs Geratewohl ein paar Prospekte aus dem Regal und informierte mich über Werktags-Angebote für Skipässe und Übernachtungen in näher bei Mammoth Lakes und Mammoth Summit gelegenen Orten. Dann studierte ich den lokalen Veranstaltungskalender. Ich hatte das große alljährliche Forellen-Derby verpaßt, das in der Vorwoche stattgefunden hatte. Außerdem war ich für die große Angelshow im Februar zu spät dran. So ein Pech. Ich las, daß die Festlichkeiten im April eine zweite Angelshow umfaßten, dazu den Presseempfang zur Eröffnung der Forellensaison, die offizielle Eröffnung der Forellensaison und eine Leistungsschau des Fischereivereins, eine Feier zum Tag des Maultiers, und später folgte noch ein 30-Kilometer-Lauf im Mai. Es sah ganz danach aus, als hätte ich Gelegenheit, mir die Eastern Sierras wahlweise wandernd, beim Rucksack-Trekking oder auf dem Rücken eines Maultiers zu erschließen. Oben lauerte dann vermutlich eine rasende Horde hungriger wilder Tiere auf uns, die uns ansprangen und nach uns schnappten, während wir uns über gefährlich schmale Pfade den Weg nach unten bahnten und die Felsbrocken die Berghänge hinab in den gähnenden Abgrund polterten.
Ich sah auf und stellte fest, daß Cecilia Boden mich mit verschlossener Miene anstarrte. »Sie wünschen?« fragte sie. Mit den Händen hielt sie die teilbare Tür umklammert, als wollte sie mich davon abhalten, hindurchzugehen.
Ich erklärte ihr, wer ich war, und mit einer Handbewegung lehnte sie die Kreditkarte ab, die ich ihr anbieten wollte. Mit geschürzten Lippen sagte sie: »Selma hat gesagt, ich solle die Rechnung direkt an sie schicken. Ich habe zwei Hütten frei. Sie können sich eine aussuchen.« Sie nahm einen Schlüsselbund vom Haken und öffnete die untere Hälfte der Tür. Indem sie es mir überließ, ihr zu folgen, ging sie zur Vordertür hinaus und einen mit Zedernrinde übersäten Weg entlang. Die Luft draußen war feucht und roch nach Lehm und Kiefernharz. Ich hörte den Wind durch die Bäume wehen und die Eichhörnchen schnattern. Mein Auto ließ ich dort stehen, wo ich es geparkt hatte, und wir gingen zu Fuß weiter. Der schmale Weg, der zu den Hütten führte, war durch eine zwischen zwei Pfosten gespannte Kette abgesperrt. »Ich will keine Autos in diesem Teil der Anlage. Die Erde wird bei schlechtem Wetter zu stark aufgewühlt«, sagte sie, als hätte ich sie danach gefragt.
»Tatsächlich«, murmelte ich, weil mir nichts Besseres einfiel.
»Wir sind fast ausgebucht«, fuhr sie fort. »Ungewöhnlich für März.«
In ihren Augen war das vermutlich Konversation, und so gab ich als Erwiderung entsprechende Laute von mir. Die Hütten vor uns lagen etwa zwanzig Meter auseinander, getrennt durch kahle Ahornbäume, Hartriegelsträucher und genügend Douglastannen, um sich an eine Weihnachtsbaumplantage zum Selberfällen erinnert zu fühlen. »Warum heißt der Ort Nota Lake? Ist das indianisch?«
Cecilia schüttelte den Kopf. »Nö. Früher war die Nota ein Zeichen, das Kriminellen in die Haut eingebrannt wurde, um sie als Gesetzesbrecher zu kennzeichnen. So wußte man immer, wer ein Schurke war. Ein Trupp Desperados ist hier in der Gegend hängengeblieben; Verbrecher, die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts aus England deportiert worden sind. Aus gutem Grund wurden sie allesamt gebrandmarkt: Mörder und Räuber, Taschendiebe, Sittenstrolche – das Übelste vom Üblen. Wenn ihre Strafe verbüßt war, wurden sie freigelassen und verschwanden in den Westen, wobei manche hier endeten. Ihre Nachkommen haben für die Eisenbahngesellschaft gearbeitet und zusammen mit schwarzen und asiatischen Tagelöhnern harte Knochenarbeit geleistet. Die halbe Ortschaft ist mit diesen Sträflingen verwandt. Muß ein lüsterner Haufen gewesen sein. Allerdings weiß kein Mensch, wo sie die Frauen hergeholt haben. Per Post bestellt, nehme ich an.«
Wir waren an der ersten Hütte angekommen, und sie fuhr in wenig verändertem Tonfall fort, ziemlich ausdruckslos und kaum moduliert: »Das ist Willow. Ich gebe ihnen Namen statt Nummern.
Das finde ich hübscher.« Sie steckte ihren Schlüssel ins Schloß. »Jede ist anders. Sie haben die Wahl.«
Willow war geräumig, ein kieferngetäfeltes Zimmer von etwa sechs mal sechs Metern mit einem Kamin aus wulstigen Felsbrocken. Die innere Feuerstelle war rußgeschwärzt, und Holz lag ordentlich gestapelt auf dem Rost. In der Luft hing ein stechender Geruch nach unzähligen Hartholzfeuern. An der einen Wand stand ein Bettgestell aus Messing, dessen Matratze wie ein kleiner Hügel geformt war. Die Steppdecke hatte ein wildes Patchworkmuster und sah aus, als rieche sie nach Moder. Auf dem Nachttisch standen eine Lampe und ein Digitalwecker. Der Teppich war ein Oval aus geflochtenen Flicken, ausgebleicht und völlig flachgetreten.
Cecilia öffnete eine Tür zur Linken. »Hier sind Badezimmer und Wandschrank. Wir haben allen Komfort. Es sei denn, Sie angeln«, fügte sie als kleine Nebenbemerkung zu sich selbst hinzu. »Bügeleisen, Bügelbrett, Kaffeemaschine, Seife.«
»Sehr schön«, sagte ich.
»Die andere Hütte heißt Hemlock. Sie steht drüben bei dem Kiefernwäldchen am Fluß. Sie hat eine Kochnische, aber keinen Kamin. Ich kann Sie hinbringen, wenn Sie möchten.« Meist sprach sie, ohne Blickkontakt aufzunehmen, und richtete ihre Äußerungen an einen Fleck gut anderthalb Meter links von meinen Füßen.
»Ist schon gut. Ich nehme die hier.«
»Wie Sie wünschen«, sagte sie und reichte mir den Schlüssel. »Die Autos bleiben auf dem Parkplatz. Hinterm Haus liegt noch mehr Holz. Achten Sie auf Schwarze Witwen, wenn Sie Holz holen. Ein Münztelefon hängt vor dem Büro. Erspart mir den Zirkus, Telefongespräche abzurechnen. Etwa fünfzig Meter in dieser Richtung die Straße runter ist ein Imbißlokal. Sie können es gar nicht verfehlen. Frühstück, Mittag- und Abendessen. Von sechs Uhr morgens bis halb zehn abends geöffnet.«
»Danke.«
Nachdem sie gegangen war, wartete ich einen angemessenen Zeitraum ab, um ihr genug Zeit zu geben, vor mir am Büro anzukommen. Ich kehrte zum Parkplatz zurück und holte meine Tasche sowie die Reiseschreibmaschine, die ich mitgebracht hatte. Ich hatte die freien Stunden bei Dietz dazu genutzt, längst fällige Schreibarbeiten zu erledigen. Meine Garderobe besteht in erster Linie aus Blue Jeans und Rollkragenpullovern, wodurch das Packen ein Kinderspiel ist, wenn man erst einmal eine Handvoll Unterhosen hineingeworfen hat.
Zurück in der Hütte, stellte ich die Schreibmaschine neben das Bett und legte meine wenigen Kleidungsstücke in eine roh zusammengezimmerte Kommode. Ich packte mein Shampoo aus, legte Zahnbürste und Zahnpasta auf den Waschbeckenrand und sah mich zufrieden um. Welch reizendes Zuhause, wenn man von den Schwarzen Witwen absah. Ich testete die Toilettenspülung, die funktionierte, und inspizierte dann die Dusche, die kunstvoll hinter einem Streifen schweren, weißen Pikeestoffs verborgen war, der von einer Metallstange herabhing. Die Duschwanne sah sauber aus, bestand aber aus der Art Material, die mich unwillkürlich auf Zehenspitzen gehen ließ. Besuche im öffentlichen Schwimmbad in meiner Jugend hatten mich gelehrt, vorsichtig zu sein, und meine nackten Füße schreckten immer noch instinktiv vor Klumpen nasser Papiertaschentücher und verrosteten Haarklemmen zurück. Hier waren zwar keine zu sehen, aber ich spürte die geisterhafte Anwesenheit vom Dreck vergangener Zeiten. Ich nahm den gleichen Chlorgeruch wie damals wahr, vermischt mit dem Shampoo eines Fremden. Ich untersuchte die Kaffeemaschine, doch am Stecker schien ein Stift zu fehlen. Außerdem gab es keine Gratispäckchen mit Kaffeepulver, Zucker oder milchfreiem Kaffeeweißer. Das war also der angepriesene Komfort. Ich war dankbar für die Seife.
Ich kehrte in den Hauptraum zurück und sah mich kurz um. Unter dem Seitenfenster stand eine Sitzgruppe mit einem Holztisch und zwei Stühlen, so angeordnet, daß man auf den Wald hinaussah. Ich nahm die Schreibmaschine und stellte sie auf die Tischplatte. Ich würde mir in der Stadt einen Packen Papier besorgen und einen Copy-Shop ausfindig machen müssen. Heutzutage benutzen die meisten Privatdetektive Computer, aber ich kann mich irgendwie nicht mit ihnen anfreunden. Für meine zuverlässige Smith-Corona brauche ich keinen Stromanschluß, und ich muß mir weder Sorgen über einen Totalabsturz noch über gelöschte Daten machen. Ich zog mir einen Stuhl an den Tisch heran und starrte zum Fenster hinaus in den dürren Baumbestand. Selbst die Nadelbäume sahen schäbig aus. Durch ein Spitzenmuster aus Kiefernnadeln konnte ich ein Stück Zaun sehen, das Cecilias Grundstück von dem dahinterliegenden trennte. Dieser Ortsteil schien aus Ackerland und unerschlossenen Grundstücken zu bestehen, die vielleicht irgendwann einmal bewirtschaftet worden waren. Ich zog einen zerfledderten Schreibblock heraus und machte mir ein paar Notizen.
Genaugenommen hatte Selma Newquist mich engagiert, damit ich die letzten vier bis sechs Wochen im Leben ihres verstorbenen Mannes rekonstruierte, ausgehend von der Theorie, daß das, was ihn belastet hatte, vermutlich innerhalb dieser Zeitspanne aufgetreten war. Ich halte normalerweise nichts davon, wenn Eheleute einander nachspionieren – insbesondere wenn einer der beiden tot ist –, aber sie schien überzeugt davon zu sein, daß die Antworten für sie aufschlußreich wären. Ich hatte da meine Zweifel. Vielleicht hatte Tom Newquist einfach Finanzprobleme, oder er grübelte darüber nach, wie er im Ruhestand seine Zeit ausfüllen konnte.
Ich hatte mich bereit erklärt, ihr alle zwei bis drei Tage mündlich Bericht zu erstatten, ergänzt durch eine schriftliche Zusammenfassung. Selma hatte zuerst abgelehnt und mir versichert, daß mündliche Berichte vollkommen ausreichten, doch ich hatte ihr gesagt, daß ich die Schriftform bevorzugte, unter anderem um die gewonnenen Erkenntnisse genauer auszuführen. Ob ich nun etwas herausfand oder nicht – ich wollte, daß sie sah, wie gründlich ich vorging. Für sie war ebenso wichtig zu erfahren, welche Punkte ich nicht erhärten konnte, wie sie eine Aufstellung der Fakten brauchte, die ich im Lauf meiner Nachforschungen sammelte. Bei mündlichen Berichten geht durch die Übermittlung vieles verloren. Die meisten Menschen sind keine geübten Zuhörer. Aufgrund der Komplexität unseres Denkprozesses schaltet der Empfänger ab, verdrängt, vergißt oder mißversteht achtzig Prozent des Gesagten. Nehmen Sie fünfzehn Minuten eines x-beliebigen Gesprächs und versuchen Sie es später zu rekonstruieren, dann wissen Sie, was ich meine. Wenn die Unterhaltung irgendeinen emotionalen Inhalt hat, nimmt die Qualität der behaltenen Informationen noch weiter ab. Ein schriftlicher Bericht war auch in meinem Interesse. Wenn eine Woche verstrichen ist, kann ich mich kaum noch an den Unterschied zwischen Montag und Dienstag erinnern, geschweige denn daran, welche Stellen ich aufgesucht habe und in welcher Reihenfolge. Ich habe festgestellt, daß die Klienten einen so lange für kompetent halten, bis der Zahltag heranrückt. Dann erscheint ihnen die Gesamtsumme auf einmal unerhört, und sie stehen da und fragen sich, was man eigentlich getan hat, um den Betrag verdient zu haben. Es ist besser, eine Rechnung mit beigefügter Chronologie einzureichen. Ich belege gern alles ganz genau und bis ins Kleinste. Zumindest kann man damit seine Intelligenz und seine schriftstellerischen Fähigkeiten beweisen. Wie könnte man jemandem vertrauen, der mit der Rechtschreibung auf Kriegsfuß steht oder es nicht schafft, einen einfachen Aussagesatz zu formulieren?
Das andere Thema, das wir behandelt hatten, war die Form meines Honorars. Als selbständige Detektivin hatte ich eigentlich keine felsenfesten Grundsätze, was die Art der Rechnung betraf, erst recht nicht in einem Fall wie diesem, wo ich an einem anderen Ort arbeitete. Manchmal verlange ich ein Pauschalhonorar, das alle meine Spesen mit abdeckt. Manchmal nehme ich einen Stundensatz und berechne die Spesen extra. Selma hatte mir versichert, daß sie mehr Geld als genug hätte, aber offen gestanden hatte ich Schuldgefühle dabei, wenn ich von Toms Nachlaß profitierte. Andererseits hatte sie ihn überlebt, und ich fand ihr Ansinnen verständlich. Warum sollte sie den Rest ihres Lebens damit zubringen, sich zu fragen, ob ihr Mann etwas vor ihr geheimgehalten hatte? Trauer ist schon allein eine schwere Last, auch ohne zusätzliche Sorgen über ungeklärte Angelegenheiten. Selma hatte genug damit zu kämpfen, mit Toms Tod fertigzuwerden. Sie mußte die Wahrheit wissen und erwartete von mir, daß ich sie ihr lieferte. Begreiflich. Ich hoffte, ich könnte ihr eine Lösung präsentieren, die sie zufriedenstellen würde.
Bis ich abschätzen konnte, wieviel Zeit die Ermittlungen in Anspruch nehmen würden, hatten wir uns auf vierhundert Dollar pro Tag geeinigt. Von Dietz hatte ich mir einen Standardvertrag mitgenommen. Ich hatte das Datum und die Einzelheiten meines Auftrags vermerkt, und Selma hatte mir einen Scheck über fünfzehnhundert Dollar gegeben. Ich würde ihn später auf der Bank überprüfen lassen, bevor ich mich an die Arbeit machte. Leider muß ich zugeben, daß ich es trotz meines Mitgefühls für alle Witwen, Waisen und Zukurzgekommenen auf der Welt für klug halte, sich davon zu überzeugen, daß genug Bares vorhanden ist, bevor man zu jemandes Rettung eilt.
Ich machte die Tür der Hütte zu und sperrte sie ab. Dann ging ich zu meinem Mietwagen und fuhr die neun Kilometer in den Ort. Entlang der Landstraße folgten in größeren Abständen verschiedene Betriebe: Traktorenverkauf, ein Gebrauchtwagenhändler, ein Wohnwagenpark, ein Gemischtwarenladen und eine Tankstelle. Die Felder dazwischen waren goldgelb vom vertrockneten Gras und voller Unkraut. Der weite Bogen des Himmels war von intensivem Blau zu Grau übergegangen, und ein dicker, weißer Nebel verhüllte die Berggipfel. In westlicher Richtung hingen bewegungslos vereinzelte Wolkenfetzen. Sämtliche Hügel in der Nähe waren von einem schmuddeligen Rotbraun und mit weißen Tupfen gesprenkelt. Der Wind rüttelte an den Bäumen. Ich stellte die Heizung im Auto an und drehte das Gebläse auf, bis mir tropische Winde um die Beine wehten.
Für meinen Aufenthalt in Carson City hatte ich für bessere Gelegenheiten meinen Tweed-Blazer und für den Alltag eine blaue Jeansjacke eingepackt. Beides war für diese Gegend zu leicht und zu dünn. Ich fuhr die Einkaufsstraßen im Ort auf und ab, bis ich einen Secondhand-Shop fand. Ich manövrierte den Mietwagen in einen Parkplatz vor dem Geschäft. Im Schaufenster drängten sich Unmengen von Küchenutensilien und Kleinmöbeln: ein Bücherregal, ein Fußschemel, stapelweise unterschiedliche Geschirrteile, fünf Lampen, ein Dreirad, ein Fleischwolf, ein altes Philco-Radio und mehrere rote Werbetafeln von Burma-Shave, die mit Draht zusammengebunden waren. Das oberste auf dem Stapel begann mit Ist Ihr Gatte. Was, dachte ich. Ist Ihr Gatte was? Die Werbeschilder für Burma-Shave waren zuerst in den zwanziger Jahren aufgetaucht, und viele hatten sich sogar bis in meine Kindheit gehalten, stets mit Variationen dieses einprägsamen, holprigen Verses. Ist Ihr Gatte ... unrasiert? ... Sprießt sein Bart ganz ungeniert? ... Sieht er gar aus wie ein Bär? ... dann muß Burma-Shave jetzt her. Oder so ähnlich.
Innen im Laden roch es nach abgelegten Schuhen. Ich bahnte mir den Weg durch Gänge, die eng mit Kleidungsstücken vollgehängt waren. Vor mir erstreckten sich unzählige Ständer voller Einzelteile, die alle entweder im Hinblick auf Zweckmäßigkeit oder einem festlichen Anlaß gekauft worden sein mußten: Abschlußballkleider, Cocktailkleider, Kostüme, Acrylpullover, Blusen und Hawaiihemden. Die Wollsachen wirkten schlaff und die Baumwollstoffe matt, ihre Farben von zu vielen Runden in der Waschmaschine ausgelaugt. Weiter hinten beugte sich eine Stange unter der Last von Winterjacken und Mänteln.
Ich schlüpfte in eine schwere braune Bomberjacke aus Leder. Vom Gewicht her fühlte sie sich an wie eine dieser Bleischürzen, die einem die MTA über den Körper legt, während sie einem aus der Sicherheit eines anderen Raumes heraus die Zähne röntgt. Das Futter der Jacke bestand aus noch kaum verfilztem Vlies, und die Taschen hatten diagonal verlaufende Reißverschlüsse, von denen einer kaputt war. Ich musterte die Krageninnenseite. Die Größe war M, also weit genug für einen dicken Pullover, falls nötig. Das Preisschild war an das braune Strickbündchen an einem der Ärmel gesteckt: vierzig Dollar. Ein echtes Schnäppchen. Ist Ihr Gatte wüst und roh? Kratzt sich den behaarten Po? Wollen Sie ihn baden schicken ... Burma-Shave wird ihn erquicken. Ich hängte mir die Jacke über den Arm, während ich an den anderen Ständern entlangschlenderte. Ich fand ein blaues Flanellhemd und ein Paar Wanderstiefel. Auf dem Weg hinaus blieb ich stehen und löste den Draht, der die Burma-Shave-Schilder zusammenhielt, und las eines nach dem anderen.
Ist Ihr Gatte voller Groll?
Schimpft Ihnen die Ohren voll?
Seine Stimmung wird sich heben,
wenn Sie Burma-Shave ihm geben.
Ich lächelte vor mich hin. Ich hatte sogar Talent für solches Zeug. Mit meinen Einkäufen in der Hand ging ich wieder auf die Straße hinaus. Ein Hurra auf die gute alte Zeit. Neuerdings geht den Amerikanern ein wenig der Humor aus.
Auf der anderen Straßenseite entdeckte ich ein Geschäft für Bürobedarf. Ich ging hinüber, besorgte mir Schreibpapier und ein paar Päckchen Karteikarten. Zwei Häuser weiter sah ich eine Filiale von Selmas Bank, wo ich mich vergewisserte, daß ihr Scheck gedeckt war, und mir ein Bündel Zwanzigdollarscheine besorgte, das ich in meine Umhängetasche steckte. Danach holte ich mein Auto, fuhr los und kreiste um den Block, bis ich in der richtigen Richtung unterwegs war. Der Ort kam mir bereits vertraut vor; er war ordentlich angelegt und sauber. Die Hauptstraße war vierspurig. Die Häuser rechts und links waren meist ein- oder zweistöckig und in uneinheitlichem Stil gebaut. Die Atmosphäre erinnerte entfernt an eine Westernstadt. An jeder Kreuzung fiel mein Blick auf einen Bergkamm, und die schneebedeckten Gipfel bildeten eine Art Vorhang, der den ganzen Ort entlang verlief. Es herrschte nicht viel Verkehr, und mir fiel auf, daß überwiegend Nutzfahrzeuge unterwegs waren: Pickups und Kombis mit Skiständern auf dem Dach.
Als ich wieder bei Selma anlangte, stand das Garagentor offen. Der Parkplatz links war leer. Rechts sah ich einen blauen Pickup neuester Bauart stehen. Als ich aus meinem Wagen stieg, kam zwei Häuser weiter ein uniformierter Hilfssheriff zur Tür heraus. Er überquerte die beiden Rasenflächen zwischen uns und kam auf mich zu. Ich wartete, da ich annahm, daß es sich um Toms jüngeren Bruder Macon handelte. Auf den ersten Blick konnte ich nicht sagen, wieviel jünger er war. Ich schätzte ihn auf Ende Vierzig, aber vielleicht trog sein Äußeres auch. Er hatte dunkles Haar, dunkle Augenbrauen und ein angenehmes, unauffälliges Gesicht. Er war ungefähr einsachtzig groß und von kompakter Statur. Er trug eine schwere Jacke, die an der Taille endete, um schnellen Zugriff zu dem Pistolenhalfter an seiner linken Hüfte zu gewähren. Der breite Gürtel und die Waffe verliehen ihm ein schweres, bulliges Aussehen, das ohne seine Kluft vermutlich nicht entstanden wäre.
»Sind Sie Macon?« fragte ich.
Er reichte mir die Hand. »Genau. Ich habe Sie herfahren sehen und dachte mir, ich komme mal rüber und stelle mich vor. Meine Frau Phyllis haben Sie ja schon kennengelernt.«
»Das mit Ihrem Bruder tut mir leid.«
»Danke. Es war ganz schön hart, das kann ich Ihnen sagen«, erklärte er. Er deutete mit dem Daumen aufs Haus. »Selma ist nicht da. Ich glaube, sie ist vor kurzem zum Markt gegangen. Wollen Sie rein? Die Tür steht meistens offen, aber Sie können auch gern zu uns kommen. Das ist allemal besser, als hier draußen in der Kälte zu stehen.«
»Danke, aber das macht mir nichts aus. Selma kommt bestimmt gleich, und wenn nicht, bringe ich die Zeit auch so herum. Ich würde gern morgen oder übermorgen mal mit Ihnen sprechen.«
»Na klar. Kein Problem. Ich erzähle Ihnen alles, was Sie wissen wollen, obwohl ich gestehen muß, daß wir uns keinen Reim auf Selmas Vorhaben machen können. Worüber zerbricht sie sich eigentlich den Kopf? Phyllis und ich begreifen einfach nicht, was sie ausgerechnet mit einer Privatdetektivin will. Bei allem Respekt, aber das ist doch lächerlich.«
»Vielleicht sollten Sie das mit ihr besprechen«, sagte ich.
»Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, was Sie über Tom herausfinden werden. Er war ein so grundanständiger Kerl, wie man selten einen findet. Die ganze Stadt hat zu ihm aufgesehen, mich eingeschlossen.«
»Dann werde ich mich ja vielleicht nur kurz hier aufhalten.«
»Wo hat Selma Sie untergebracht? Ich hoffe, in einem angenehmen Haus.«
»Nota Lake Cabins. Cecilia Boden ist Ihre Schwester, oder? Haben Sie noch mehr Geschwister?«
Macon schüttelte den Kopf. »Wir waren nur drei«, sagte er. »Ich bin der Jüngste. Tom ist drei Jahre älter als Cecilia und fast fünfzehn Jahre älter als ich. Seit ich denken kann, bin ich hinter den beiden hergerannt. Ich habe erst Jahre nach Tom angefangen, im Sheriffbüro zu arbeiten. In der Schule war’s genauso. Immer bin ich in die Fußstapfen von jemand anderem getreten.« Sein Blick schweifte zur Straße ab, als Selmas Auto auftauchte, langsamer wurde und in die Einfahrt bog. »Da kommt sie, also will ich Sie mal nicht länger aufhalten. Lassen Sie mich wissen, womit ich Ihnen helfen kann. Sie können uns anrufen oder einfach vorbeikommen. Es ist das grüne Haus mit den weißen Zierleisten.«
Inzwischen war Selma in die Garage gefahren und ausgestiegen. Sie und Macon begrüßten einander mit einer kaum wahrnehmbaren Unterkühltheit. Während sie den Kofferraum ihrer Limousine öffnete, verabschiedeten Macon und ich uns und tauschten die typischen Floskeln aus, die das Ende einer Unterhaltung signalisieren. Selma lud eine braune Papiertüte mit Lebensmitteln und zwei Reinigungspaketen aus und schlug den Kofferraum zu. Unter ihrem Pelzmantel trug sie akkurat gebügelte, anthrazitfarbene Hosen und eine langärmlige Bluse aus kirschfarbener Seide.
Während Macon zu seinem Haus zurückging, betrat ich die Garage. »Darf ich Ihnen damit helfen?« fragte ich und griff nach der Tüte mit den Lebensmitteln, die sie mir daraufhin überließ.
»Ich hoffe, Sie stehen noch nicht lange hier«, sagte sie. »Ich bin zu dem Schluß gekommen, daß ich genug Zeit damit zugebracht habe, mir selbst leid zu tun. Das Beste ist, sich zu beschäftigen.«
»Wem gehört der Pickup? War das Toms Wagen?« wollte ich wissen.
Selma nickte und schloß die Tür auf, die von der Garage ins Haus führte. »Ich habe jemanden von der Werkstatt am Tag nach seinem Tod gebeten, ihn hierherzuschleppen. Der Officer, der ihn gefunden hat, hat die Schlüssel abgezogen und den Wagen stehenlassen, wo er war. Ich kann mich nicht dazu überwinden, ihn zu fahren. Wahrscheinlich verkaufe ich ihn irgendwann oder überlasse ihn Brant.« Sie drückte einen Knopf, und das Garagentor fuhr rumpelnd herab.
»Sie haben also Macon kennengelernt.«
»Er ist herübergekommen, um sich vorzustellen«, antwortete ich und folgte ihr ins Haus. »Eines sollte ich noch erwähnen. Ich habe vor, mich mit ziemlich vielen Leuten hier am Ort zu unterhalten, und ich weiß noch nicht, welchen Weg ich einschlagen will. Wenn man Sie auf irgendetwas anspricht, bestätigen Sie es einfach.«
Sie legte ihre Schlüssel wieder in die Handtasche und betrat mit mir im Schlepptau die Waschküche. Dann schloß sie hinter uns die Tür. »Warum wollen Sie nicht die Wahrheit sagen?«
»Das tue ich ja, soweit möglich, aber ich gehe davon aus, daß Tom ein sehr geachtetes Mitglied der Gemeinde war. Wenn ich anfange, mich nach seinen Privatangelegenheiten zu erkundigen, erzählt mir kein Mensch etwas. Deshalb versuche ich es vielleicht mit einem anderen Ansatz. Nicht allzu abwegig, aber eventuell verdrehe ich die Tatsachen ein bißchen.«
»Was ist mit Cecilia? Was sagen Sie ihr?«
»Das weiß ich noch nicht. Mir fällt schon was ein.«
»Die wird Ihnen die Ohren vollquasseln. Im Grunde konnte sie mich nie leiden. Egal, worin Toms Probleme bestanden haben mögen, sie wird mich zur Schuldigen abstempeln, wenn sie kann. Bei seinem Bruder ist es das gleiche. Macon hat Tom ständig um irgendetwas gebeten – einen Kredit, einen Rat, ein gutes Wort für ihn im Büro. Wenn ich nicht eingeschritten wäre, hätte er Tom ausgesaugt. Tun Sie mir einen Gefallen: Nehmen Sie nicht alles, was die beiden sagen, für bare Münze.«
Die Verdrossenen sind ideal. Sie erzählen einem alles, dachte ich.
In der Küche angelangt, hängte Selma ihren Pelzmantel auf eine Stuhllehne. Ich sah ihr zu, wie sie die Lebensmittel auspackte und alles verstaute. Ich hätte ihr ja geholfen, doch sie lehnte mein Angebot mit der Begründung ab, daß es schneller ginge, wenn sie es selbst machte. Die Küchenwände waren hellgelb gestrichen und der Fußboden mit nahtlos verlegtem, weiß-gelbem Linoleum bedeckt. Eine gepolsterte Eßecke aus Chrom und gelbem Plastik füllte eine Nische mit einem Erkerfenster, das mit – ich äugte genauer hin – künstlichen Pflanzen geschmückt war. Sie wies mir einen Platz auf der anderen Seite des Tischs an, faltete die Tüte ordentlich zusammen und legte sie in ein Regal, das bereits von anderen Einkaufstüten überquoll.