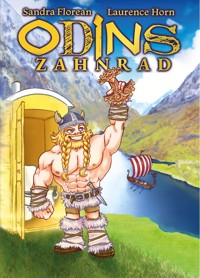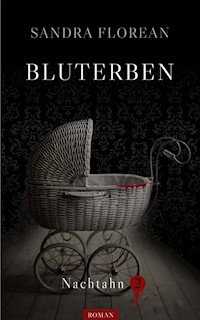2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Sandra Florean
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Dorian Fitzgerald ist reich und gut aussehend. Und er ist der wohl älteste Vampir auf Erden. Er wurde mit sehr mächtigem Blut geschaffen und hat es seit jeher als seine Aufgabe betrachtet, diejenigen seiner Art auszulöschen, die das Geschenk der Dunkelheit, die Dunkle Gabe, nicht verdient haben. Als er die junge Louisa in einer Disco entdeckt, ist er sofort fasziniert und will sie als Mann beeindrucken, nicht als Vampir. Doch ohne seine Vampirmagie muss er Hartnäckigkeit beweisen und ahnt nicht, in welche Gefahr er sie dadurch bringt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Sandra Florean
Mächtiges Blut
Über das Buch:
Dorian Fitzgerald ist reich und gut aussehend. Und er ist der wohl älteste Vampir auf Erden. Er wurde mit sehr mächtigem Blut geschaffen und betrachtet es seit jeher als seine Aufgabe, diejenigen seiner Art auszulöschen, die das Geschenk der Dunkelheit, die Dunkle Gabe, nicht verdient haben. Als er die junge Louisa in einer Disco entdeckt, ist er fasziniert und will sie als Mann beeindrucken, nicht als Vampir. Doch ohne seine Vampirmagie muss er Hartnäckigkeit beweisen und ahnt nicht, in welche Gefahr er sie dadurch bringt.
Die Vampirin Trudy bringt Louisa in ihre Gewalt und versucht, über sie an Dorian und sein mächtiges Blut heranzukommen. Ihr Plan missglückt, doch Dorians Tarnung fliegt beinahe auf. Obwohl er sich geschworen hat, bei Louisa keine Vampirmagie spielen zu lassen, muss er um ihrer selbst willen ihre Erinnerung verändern.
Doch Trudy gibt nicht auf. Sie wendet sich Hilfe suchend an eine ältere Vampirin. Die bösartige Mary, Dorians einzige Nachkommin, sieht ihre Chance gekommen, ihren Schöpfer erneut zu quälen. In ihrem Hass schmiedet sie einen teuflischen Plan …
Die Autorin:
Sandra Florean wurde 1974 in Kiel geboren, wo sie auch aufwuchs. Nach ihrer Fachhochschulreife absolvierte sie eine kaufmännische Ausbildung und arbeitet als Sekretärin.
Zum Schreiben kam sie bereits als Jugendliche, wobei Fantasy und Vampire schon immer ihre Leidenschaft waren. Seit ca. 2011 widmet sie sich ihren erdachten fantastischen Welten intensiver, veröffentlicht regelmäßig in unterschiedlichen Verlagen und ist zudem als Herausgeberin und Lektorin tätig. Ihr Debüt »Mächtiges Blut« wurde auf dem Literaturportal Lovelybooks zum besten deutschsprachigen Debüt 2014 gewählt. 2018 wurde sie für ihre Tätigkeit als Herausgeberin von „The U-Files. Die Einhorn Akten“ mit dem Deutschen Phantastik Preis für die beste Kurzgeschichtensammlung 2018 geehrt. Mehr über die Autorin: www.sandraflorean-autorin.blogspot.de
Mächtiges Blut
Nachtahn 1
Sandra Florean
Roman
Neuauflage
Mächtiges Blut - Nachtahn 1
Sandra Florean
Copyright © 2021 Sandra Florean
Südring 71, 24222 Schwentinental
Copyright © 2014 at Bookshouse Ltd.,
Bildnachweis: Pixabay: AlLes
IStock: Ronald Tijs
Lektorat/Korrektorat: Bookshouse Ltd.
Satz: Sandra Florean
www.sandraflorean-autorin.blogspot.de
Urheberrechtlich geschütztes Material
Dieses Buch widme ich Mama,
weil man alle großen Dinge im Leben
seiner Mama widmen sollte.
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
Danksagung
1
Ah, welch ein Genuss! Wie an vielen Abenden zuvor tauchte ich an jenem Freitag voller Vorfreude ein in das mitreißende Nachtleben der Großstadt, in deren Nähe ich lebte. Angefangen in einem Klub mit dem nichtssagenden Namen R7. Ich genoss das pulsierende Leben um mich herum und sog die von Rauch und menschlichen Ausdünstungen geschwängerte Luft ein. Als ich mich wie üblich an die Tanzfläche stellte, um den Tanzenden zuzusehen, blieb ich an einer unscheinbaren Brünetten hängen. Ich hätte nicht sagen können, warum mein Blick gerade an ihr haften blieb. Im Gegensatz zu den vielen anderen aufgedonnerten Schönheiten wirkte sie eher schlicht. Lange rotbraune Haare, figurbetonte schwarze Bluse mit kurzen Ärmeln, enge Jeans – alles nicht bemerkenswert. Wahrscheinlich hätte sie in einem eng anliegenden Kleid für mehr Aufsehen gesorgt. Die Figur dafür hatte sie allemal.
War es ihr suchender Blick, der unauffällig hierhin und dorthin schweifte, oder ihre hingebungsvolle Art zu tanzen, die einen Mann hoffen lassen konnte, sie auch bei anderen Gelegenheiten so hingebungsvoll erleben zu können? Oder die kraftvollen Bewegungen schlanker Arme, die auf einen starken, eigenwilligen Charakter schließen ließen? Vielleicht war es ihr für mein Empfinden wohlproportioniertes Gesicht: hohe Wangenknochen, volle Lippen, schön geschwungene Augenbrauen. Es war etwas an ihr, das ich nicht erklären konnte, mich aber trotzdem anzog. Das sprichwörtliche gewisse Etwas?
Ich beobachtete sie eine Weile, bis sie die Tanzfläche verließ und zur Bar ging. Mein Blick folgte ihr beinahe ungewollt. Sie hielt das Glas ihres Cocktails fest umklammert und spielte mit dem Strohhalm. Drehte ihn linksherum, rechtsherum, stieß ihn ins Eis, als könnte sie es mit dem Plastikröhrchen zerstoßen. Führte ihn an ihre ungeschminkten Lippen und tat einen kräftigen Zug, ohne den Strohhalm loszulassen. Als müsste sie ihn bändigen, um aus ihm trinken zu können.
Es war wohl die sinnlichste Szene, die sich mir je in so einem Klub geboten hatte. Von einem Geschöpf, auf das die Beschreibung sinnlich nicht passen wollte. Ich war fasziniert.
Ich fing ihren Blick ein und ging zu ihr. In dem Moment, in dem ich sie ansprach, schien ein anderes Wesen die Kontrolle über meine Zunge übernommen zu haben. Ich konnte bei den ersten an sie gerichteten Worten innerlich nur entsetzt mit dem Kopf schütteln. Das war nicht der verführerische, wortgewandte Dorian. Es war ein Wunder, dass sie sich nicht sofort weggedreht hatte.
Keine Ahnung, welcher Teil meiner Persönlichkeit das Sprechen für mich übernommen hatte. Ich hoffte, er versaute es nicht noch ganz. Es gab drei Grundregeln, das hatte ich bereits gelernt, wenn man bei einer Frau landen wollte. Erstens: Gib ihr niemals die Zügel in die Hand. Zweitens: Gib ihr niemals die Zügel in die Hand, und drittens: Gib ihr niemals die Zügel in die Hand. Und mach ihr Komplimente. Das war keine Grundregel, das sollte Mann sowieso tun. Mein anderes Ich schien nicht eine dieser Regeln zu kennen. Das Kompliment, das ihm einfiel, war eine Beleidigung, selbst für mein eher männlich geprägtes Empfinden.
Ich schüttelte innerlich resigniert den Kopf, war ich doch kurzzeitig besessen von einer absolut unerfreulichen Seite meines Selbst – und hatte es tatsächlich versaut.
*
»Dreh dich jetzt bloß nicht um«, rief Annie mir durch die laut dröhnende Musik hinweg zu. »Auf sechs Uhr. Der mit den längeren Haaren starrt dich schon die ganze Zeit an. Sieht sexy aus. Und schicke Klamotten!« Sie riss vielsagend die Augen auf.
Ich drehte mich unauffällig beim Tanzen in die besagte Richtung. Das R7, einer der beliebtesten Klubs der Stadt, war sehr gut besucht, und das ewig flackernde Stroboskoplicht machte es zusätzlich schwer, etwas zu erkennen. »Wer denn?«
»Helle Haare, dunkelblaue Jeans, Designerhemd, hält ein Glas in der Hand. Er hat einen durchdringenden Blick, sieht ziemlich gut aus und lächelt hier herüber.«
Ich starrte sie an. Wahrscheinlich sahen achtzig Prozent der Typen hier so aus. Ich drehte mich noch einmal tanzend und glaubte, ihn entdeckt zu haben. Er war auf den ersten Blick nicht wirklich interessant und entsprach nicht meinem »Beuteschema«. Ich gab Annie ein Zeichen.
Wir verließen die Tanzfläche und gingen an ihm vorbei. Ich war hier, um jemanden kennenzulernen, und machte mir nicht die Mühe, um den heißen Brei herumzureden, beziehungsweise zu laufen. Außerdem musste ich nah genug heran, um etwas erkennen zu können. Das Auge isst schließlich mit, wie man so schön sagt.
Wir schlenderten wie zufällig an ihm vorbei.
Sein Blick folgte uns weiter, nachdem wir die Tanzfläche verlassen hatten. Als ich nah genug herangekommen war, ging ich schnell in Gedanken meine üblichen »Checkpoints« durch, wie wir sie spaßeshalber nannten.
Ein bisschen zu groß – geht gerade noch; schicke, saubere Schuhe und extrem gut sitzende Hose – sexy; nettes Lächeln – aber zu selbstsicher; lange Haare – geht überhaupt nicht. Ich rauschte vorbei und schüttelte den Kopf, als Annie sich kurz zu mir umdrehte. »Nicht mein Typ.«
»Was du immer hast«, sagte sie, nachdem wir an der Bar angekommen waren. »Er könnte sie doch abschneiden.«
Natürlich kannte meine Freundin meine Kriterien, die es zu erfüllen galt, wollte Mann mich beeindrucken. »Wenn er sich erst ändern muss, um mir zu gefallen, kann ich mir auch gleich einen anderen suchen«, erwiderte ich und bestellte uns zwei Cocktails.
»Probier’s doch einfach mal aus. Ich meine, du bist doch eh nicht auf der Suche nach was Festem. Und es sind nur Haare!«
Da hatte sie unrecht. Ich war immer auf der Suche nach etwas Festem, nur die Männer, die ich kennenlernte, für gewöhnlich nicht.
»Er schaut immer wieder rüber.« Annie verpasste mir einen Stoß in die Rippen.
»Au! Wenn ich nichts anderes finde, schau ich mal, ob er mich anspricht. Zufrieden?«, sagte ich, damit sie endlich Ruhe gab. »Oder du baggerst ihn an.«
Annie lachte, wobei ihre blonden Locken wippten. »Mich guckt er aber nicht an. Und ’ne Abfuhr muss ich mir heute nicht unbedingt abholen.«
Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Annie ihm nicht gefallen würde. Sie hatte wunderschöne blonde Locken und ein freundliches rundes Gesicht mit stets leicht geröteten Wangen. Mit einem Meter zweiundsiebzig war sie fast zehn Zentimeter größer als ich und hatte eine weibliche Figur, die sie gern mit engen Tops betonte.
Ich trank meinen Cocktail und spielte mit dem Strohhalm. Der Typ sah verdammt gut aus, da musste ich Annie leider zustimmen. Es waren auch nicht die schulterlangen Haare, die mir nicht gefielen. Ich mochte langhaarige Kerle einfach nicht. In romantischen Ritterfilmen, okay, aber im Bett wollte ich die Mähne eines Mannes nicht im Gesicht haben. Irgendwie wirkte er mir zu selbstsicher. Das gefiel mir nicht. Er wusste genau, dass er gut aussah. Außerdem sah er nach Geld aus. Männer, die wussten, was sie hatten, und wie sie wirkten, spielten nur mit Frauen wie mir. Hier gab es reichlich hübschere Kandidatinnen. Warum sollte er es dann ausgerechnet auf mich abgesehen haben? Bestimmt nur, um mich zu demütigen oder aus Experimentierfreude, oder … wer wusste schon, was sich Männer dachten.
Ich ließ meinen Blick erneut umherschweifen. Weg von dem Langhaarigen mit seinen Designerjeans und seinem Gewinnerlächeln. Und entdeckte auch prompt etwas, das mir wesentlich besser gefiel. Der Abend versprach, doch noch aufregend zu werden. Eben auf der Bühne des Lebens erschienen: kurze braune Haare – so muss ein Mann aussehen; muskulöse Arme – absolut sexy; etwas schlampige Klamotten – Grunge-Look war zwar seit Kurt Cobains Tod out, aber okay; Bierflasche – sehr sympathisch. Ich beobachtete ihn eine Weile, bis er auf die Tanzfläche ging, und schlenderte hinterher, um ihn eingehender unter die Lupe zu nehmen. Annie blieb an der Bar stehen und sondierte weiter aus.
Ich tanzte mich unauffällig in seine Nähe, und was ich sah, gefiel mir. Sehr sogar. Jetzt hieß es herauszufinden, ob er allein hier war. Und wenn ja, seine Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Also stellte ich mich an den Rand der Tanzfläche und hielt nach möglichen Begleitern oder, ärgerlich, Begleiterinnen Ausschau. Ich drehte den Kopf nach rechts, und mein Blick landete in durchdringend blickenden grünen Augen, die mich interessiert musterten und mich einen Moment zu lange festhielten.
Mist, dachte ich und drehte den Kopf weg, doch es war zu spät. Der Langhaarige hatte es als Aufforderung verstanden und sich bereits in Bewegung gesetzt. »Der Typ ist allein hier«, sprach er mich mit einer angenehm tiefen Stimme an.
Ich drehte mich überrascht zu ihm um. »Was?«
»Der Kerl, dem du auf die Tanzfläche gefolgt bist«, erklärte er und wies beiläufig mit seinem Longdrinkglas auf mein Opfer. »Er ist allein hier. Ich hab ihn kommen sehen. Hat aber eine Frau zu Hause. Siehst du den Ring an seinem Finger?«
Ich merkte, dass mir der Unterkiefer herunterklappte, und schloss den Mund schnell wieder. Das war mir natürlich nicht aufgefallen. Nicht bei dem Licht. Empört guckte ich den Langhaarigen an und überlegte, ob ich mich nicht einfach umdrehen und wegmarschieren sollte, doch irgendetwas an seinem Blick ließ mich innehalten.
»Tut mir leid, ich bin einfach ein guter Beobachter«, sagte er mit zerknirschtem Gesichtsausdruck, »und ein Idiot im Umgang mit Frauen.«
Das kann man wohl sagen. Ich stimmte in sein wider Erwarten sympathisches Lachen ein.
»Ich will dir nicht die Tour vermasseln, aber da der Typ vergeben ist … Ich hab dich vorhin schon tanzen sehen und dachte … vielleicht könnte ich dich auf einen Drink einladen?«
Ich deutete mit dem Kopf auf sein volles Longdrinkglas.
Er folgte meinem Blick und leerte es in einem Zug, um es dann auf die Balustrade hinter uns zu stellen. »Wollen wir?«
Ich schüttelte lachend den Kopf und gab mich geschlagen. Für den Moment. Humor hatte er, das ergänzte ich positiv auf meiner imaginären Checkliste. Und ein tolles Lächeln mit einem süßen Grübchen im Kinn.
»Was möchtest du trinken?«
Ich suchte mir den teuersten Cocktail aus, den ich auf der Karte finden konnte. Wollen wir doch mal sehen, ob die maßgeschneiderten Klamotten nur schöner Schein waren. Es gab genügend Männer, die einen den Drink selbst bezahlen ließen, wenn sie einen »einluden«. Er bestellte zwei.
»Hübsche Bluse.«
Ich hätte am liebsten laut aufgestöhnt bei so viel Einfallsreichtum. Wenn er jetzt noch den Blick an mir herunterschweifen lässt, drehe ich mich auf der Stelle um und verschwinde. Aber nein, gerade noch mal Glück gehabt. Er hatte den Blick wieder nach vorn gerichtet und schwieg, als wäre ihm seine Anmache peinlich. Ich sah mich nach dem Barkeeper um, der um diese Uhrzeit einiges zu tun hatte. Außerdem wollte ich ihn möglichst nicht ansehen, um ihn nicht zu sehr zu ermutigen.
»Du bist mir sofort aufgefallen.«
Nun musste ich ihn doch ansehen. Er schien das ernst zu meinen. »Ja. Danke«, erwiderte ich und versuchte ein Lächeln. Du mir nicht.
Wieder schwieg er, und dieses Schweigen wurde langsam unangenehm. Ich blickte mich noch einmal nach dem Barkeeper um, doch der war spurlos verschwunden. Langsam wurde ich ungeduldig, weil die Getränke nicht kamen. Ich versuchte, nicht zu lange in die Richtung des Langhaarigen zu schauen. Dass er mich immer noch ansah, spürte ich an einem leichten Kribbeln im Nacken.
»Bist du öfter hier?«
Das war wohl die plumpste Frage, die man in so einer Situation stellen konnte. Meine Güte! Ich drehte den Kopf ganz weg und die Augen nach oben. Meinte er, dass sein gutes Aussehen alles war? Dass ich ihm sofort um den Hals fallen würde, weil er so schön lächelte und mir einen Drink spendieren wollte, der ja noch nicht einmal geliefert wurde? Oder war er ein bisschen dumm? Also dumm in Sinne von nicht-so-schlau?
»Joa«, antworte ich unbestimmt. »Und du?«
Dämliche Konversation kann ich auch betreiben, wenn es das ist, worauf du stehst, hätte ich am liebsten laut hinzugefügt. Ich schaute zu ihm auf. Seine Haut war ziemlich blass. Er wirkte, als wäre er krank gewesen. Sein Gesicht schmückte noch immer dieses selbstsichere Lächeln, wofür ich ihm am liebsten eine reingehauen hätte. Doch es wirkte wie eine Maske. In seinen grünen Augen spiegelten sich ganz andere Emotionen wider. Interesse sah ich, klar, aber auch Hilflosigkeit. Und Ärger? Sein Blick ließ mir einen Schauder über den Rücken laufen und wollte überhaupt nicht zu dem passen, was er bisher von sich gegeben hatte.
»Bitte schön, ihr beiden.« Die Stimme des Barkeepers ließ uns herumfahren.
Der Langhaarige zückte sofort sein Portemonnaie und bezahlte, gab der Tresenkraft sogar ein Trinkgeld, obwohl ich nicht fand, dass er das verdient hatte. Wahrscheinlich wollte er damit Eindruck schinden. Half aber auch nichts mehr.
War es sehr dreist, jetzt zu gehen? Irgendwie hatte ich bei so etwas immer ein schlechtes Gewissen. Nicht, dass ich das häufiger machte, aber es kam schon mal vor. Er hatte mich auf einen Drink einladen wollen. Das hatte er nun getan, die Unterhaltung mit ihm war mehr als öde, und er war einfach nicht mein Typ. Sollte ich wirklich noch länger hier herumstehen und meine Zeit vergeuden? Oder sollte ich ihm einfach sagen, dass er sich bescheuert angestellt hatte und selbst schuld war, dass ich ging? Ich nahm ihm das Glas aus der Hand und stieß mit ihm an. Wir nahmen einen verlegenen Schluck.
»Ähm, vielen Dank für die Einladung.«
»Gern geschehen«, kam prompt die sahneweiche Antwort.
Ehrlich gemeint. Ich seufzte. Das machte es nicht leichter. Komischer Kauz. »Sei mir nicht böse, aber ich muss zurück zu meiner Freundin. Sie macht sich bestimmt schon Gedanken, wo ich geblieben bin. Vielen Dank noch mal. Und, äh … man sieht sich.« Ich deutete noch einmal kurz auf den Cocktail und machte mich dann schnellstens aus dem Staub, ehe er oder mein aufkeimendes schlechtes Gewissen mich davon abhalten konnte.
*
»Hey, ich glaub, die Kleine steht einfach nicht auf dich«, hörte ich eine höhnisch quäkende Stimme neben mir.
Ich war so vertieft in die Betrachtung des schlichten Geschöpfes und so entsetzt von dem vorübergehenden Kontrollverlust, dass ich nicht auf die Alarmglocke in meinem Kopf gehört hatte. Noch bevor ich mich ganz zu der Stimme umgedreht hatte, wusste ich, dass er ein Vampir war. Ich spürte seine kaum ausgeprägten Kräfte und erkannte, dass es ein sehr junger sein musste.
Er hatte blonde ungepflegte Haare und ein böses Grinsen in einem Gesicht, das hübsch hätte sein können, wäre es nicht durch grausame Züge entstellt. Seine Augen waren milchig blau mit rotgeränderter Iris. Er hatte also getrunken und wahrscheinlich ein sinnloses Blutbad angerichtet, so wie er roch. Und er war berauscht. Es war mehr als ein Opfer gewesen.
Ich fixierte ihn mit durchdringendem Blick. Er glotzte mich an, und ich gab ihm eine kleine Demonstration meiner sehr viel älteren Vampirmacht. Was ich vielen voraushatte, war mein mächtiges Blut, mit dem ich ihr schwaches in Wallungen versetzen konnte. In tödliche Wallungen.
Er biss die Zähne zusammen, um sich nichts anmerken zu lassen.
»Verpiss dich aus meiner Stadt, das hier ist mein Jagdrevier. Und räum das Gemetzel auf, das du angerichtet hast.« Ich gab ihn frei.
Er taumelte ängstlich davon. Diese jungen Vampire! Alles Vollidioten. Keinen Respekt mehr. Abstoßend. Aber er würde tun, was ich ihm geraten hatte, denn er wusste, dass ich ihn tatsächlich töten konnte und es auch ohne mit der Wimper zu zucken tun würde.
Es war nicht leicht, einen Vampir zu töten. Das ließ die meisten Frischlinge auch so ausflippen. Sie fühlten sich unsterblich, unbesiegbar, gottähnlich. Waren sie aber nicht. Alles konnte sterben. Man musste nur wissen, wie. Knoblauch, Kreuze, Holzpflöcke – das konnte man getrost vergessen. Wobei man mit den Holzpflöcken wenigstens Schmerzen verursachen konnte. Da die meisten Vampire jedoch sehr masochistisch veranlagt waren, brachte einen das mit den Holzpflöcken auch nicht weiter. Was einen Frischling todsicher töten konnte, war Feuer. Nur so ließ sich der durch Blut künstlich am Leben erhaltene Körper vollends zerstören. Aus der Asche eines Toten entsteht kein neues Leben mehr. Asche zu Asche, genau. Doch einen Vampir zu verbrennen, war nicht so leicht, da er kaum lange genug stillhalten würde. Außer man verfügte über meine besonderen Kräfte, die es mir ermöglichten, andere Vampire quasi von innen heraus zu verbrennen, indem ich ihr Blut Kraft meines Willens erhitzte. Doch die waren einzigartig auf dieser Erde und ich musste es wissen. Immerhin teilte ich mein Blut so gut wie nie und hatte einen Großteil der anderen mächtigen Vampire ausgelöscht und mit ihrem Blut deren Kräfte in mich aufgenommen. Vampire, die ihr Blut bereitwilliger an solche Schwächlinge weitergaben als ich. Deshalb war es vielleicht verständlich, dass sich diese selbstverliebten Frischlinge unsterblich fühlten und sich benahmen, als könnte sie nichts und niemand aufhalten.
Aber nicht mit mir! Das hier war meine Stadt. Mein Zuhause. Ich wollte diese Schwachmaten nicht in meiner Nähe haben. Genau das hatte ich dem quäkenden Vollidioten eben demonstriert. Deshalb wusste ich, dass er noch heute Nacht verschwinden würde und jedem seiner unterbelichteten Freunde raten würde, das Gleiche zu tun. Er hatte eine Heidenangst vor mir gehabt, und das sollte er auch.
Das Objekt meiner neu erwachten Begierde war mit ihrer Freundin gegangen. Geflohen. Ich Anfänger hatte nicht einmal ihren Duft eingesogen. Einmal bewusst wahrgenommen hätte ich ihn überall wiederfinden können. Vampire wären die perfekten Drogenhunde, sollten wir uns jemals entschließen, einem ehrlichen Handwerk nachzugehen.
Ein sonderbares Geschöpf. Meine ganze Erscheinung war geschaffen, um zu betören, zu gefallen, um angehimmelt zu werden. Ich war ein bisschen wie Batman beziehungsweise Bruce Wayne, nur eben nicht in Strumpfhosen, sondern Designerjeans: reich, schön, gebildet und geheimnisvoll. Jede Frau drehte sich nach mir um und unterlag meinem Charme und meinem Blick. Für menschliche, aber auch vampirische Augen war mein Äußeres umwerfend schön und anziehend. Manchmal ein Fluch, aber ich will mich nicht beschweren. Wer sieht nicht gern auffallend gut aus? Ich fragte mich, warum sie völlig unbeeindruckt von mir war. Wie konnte es sein, dass ich »nicht ihr Typ« war?
*
»Warum hast du’s denn auf einmal so eilig?«, fragte Trudy, als Steve sie am Arm packte, um sie aus dem Klub zu zerren.
»Hier ist ein älterer Vampir.« Steve zog sie weiter hinter sich her. »Lass uns einfach verschwinden.«
Sie verdrehte sich den Kopf, bevor sie die Tür erreicht hatten. »Wo denn?«
»Scheißegal. Nur weg hier. Der macht uns sonst fertig.«
Als sie auf der Straße waren, konnte sie sich endlich aus seinem Griff befreien. Sie zog ihr extrem enges Kleid wieder etwas runter, das ihr beim Laufen so hoch gerutscht war, dass die Leute in der Schlange vor dem R7 beinahe gesehen hätten, was sie darunter trug. Beziehungsweise, was nicht. Sie hatte schon als Sterbliche einen Wahnsinnskörper mit großen Brüsten und einer schmalen Taille gehabt. Aber als Vampir fühlte sich alles so viel besser an, dass sie nie Unterwäsche trug. Sie wirkte so viel anziehender auf alle Männer, was sie genoss, wenn sie mit Steve tanzen ging. Genau das war auch für diesen Abend geplant. Sie ärgerte sich, denn sie waren erst gekommen, und sie hatte sich extra chic gemacht. Das kleine Schwarze mit dem tiefen Ausschnitt angezogen, hochhackige Pumps, die Haare gewaschen und sauber über eine Rundbürste geföhnt und dunklen Kajal aufgelegt. Sie sah absolut sexy aus und wäre wie immer der Hingucker des Abends gewesen. Auch wenn sie ein Vampir war, wollte sie wie normale Leute ausgehen und angebaggert werden.
Sie lief hinter Steve her in eine dunkle Gasse nur wenige Hundert Meter entfernt. Dort hatten sie die drei Leichen achtlos in einen Haufen Kartons und Müllsäcke geworfen.
»Was soll das denn jetzt?«, fragte sie ihn, als er sich an den Dreien zu schaffen machte.
Er stierte sie an. Eigentlich hätte er ganz gut ausgesehen mit seinen blonden kurzen Haaren und dem kantigen Gesicht, wenn er sich nur nicht so gehen lassen würde. Er sah immer ein bisschen schmuddlig aus. Wechselte seine Klamotten nicht häufig genug und wirkte ungewaschen, selbst wenn er geduscht hatte.
»Hol die Scheißkarre, Trudy, wir müssen die hier wegschaffen!«
»Okay, okay, nun reg dich mal nicht auf. Ich geh ja schon.« Arschloch! Regte er sich auf, war er echt ein Dreckssack. Wenn er satt und berauscht und guter Laune war, war er nett und lustig und man konnte viel Spaß mit ihm haben. Aber da gab es noch diese andere Seite an ihm, die immer zum Vorschein kam, wenn etwas nicht so lief, wie er sich das vorgestellt hatte, oder wenn jemand nicht nach seiner Pfeife tanzte. Steve konnte nicht nur ein brutales Arschloch sein, er war auch schlichtweg dumm. Eine gefährliche Mischung.
Das hatte sie bereits als Sterbliche gelernt, bevor er sie zu dem gemacht hatte, was sie jetzt war. Obwohl ihm das sicher nur aus Versehen passiert war. Mittlerweile kümmerte es sie nicht mehr so sehr, wie er sich benahm. Alles, was er ihr antat oder angetan hatte, war der Preis für das größte Geschenk, das er ihr hatte machen können. Ein Vampir zu sein und keine hilflose sterbliche Frau mehr, war das Beste, was Trudy sich vorstellen konnte. Sie war stärker als jeder Kerl, und sie konnte ihnen alles heimzahlen, was sie jemals ihr oder anderen Frauen angetan hatten. Die Macht zu haben, Vergewaltiger und andere Dreckskerle einfach umzubringen, berauschte sie. Sie um ihr Leben wimmern und winseln zu hören, war fast besser als Sex. Endlich war sie stärker!
Stärker als Steve war sie leider nicht, was er ihr auch gern demonstrierte. Sie hätte sich längst von ihm befreit, aber sie wusste nicht, ob sie allein zurechtkommen würde und wie sie ihn loswerden sollte. Einen Vampir tötete man ja nicht einfach so. Aber was hatte Steve da eben gefaselt von einem der alten Vampire? Wenn es hier einen Alten gab, vielleicht würde der ihr helfen, Steve loszuwerden? Vielleicht konnte der ihre Fragen beantworten und sie unterrichten? Neue Hoffnung keimte in ihr auf.
Sie hatte schnell bemerkt, dass sie plötzlich Dinge konnte, die sie als Sterbliche nicht gekonnt hatte. Doch sie hatte keinerlei Kontrolle darüber und wusste nicht, wie sie das alles bewusst und gezielt einsetzen konnte. Als sie Steve von ihren Fähigkeiten erzählte, hatte er sie nur blöde angesehen und ihr eine gescheuert, dass sie quer durch den Raum geflogen war. Die meisten Vampire standen auf Schmerzen, Trudy nicht. Würde sie ihm das zeigen, würde er sie nur noch mehr quälen. Also spielte sie sein Spiel mit, so gut sie konnte.
Rückwärts fuhr sie in die schmale Gasse hinein.
Steve warf die drei Leichen mühelos in den Kofferraum. Er kam zur Fahrertür gestapft. »Rutsch rüber«, schnauzte er sie mit seiner quäkenden Stimme an, die sie stets an dreckige nicht geölte Scharniere erinnerte, und setzte sich hinters Steuer.
Mit quietschenden Reifen fuhr er aus der Stadt heraus zu einer stillgelegten Müllkippe, wo sie die Reste ihrer Mahlzeit schweigend entsorgten. Dann fuhr er im höllischen Tempo zum entgegengesetzten Ende. Normalerweise hätte er sie spätestens jetzt grob betatscht oder gewollt, dass sie ihm einen blies, aber dieses Mal starrte er geradeaus auf die Straße. Trudy hielt lieber ihren Mund.
*
Ich fuhr über den geharkten Kies auf mein prächtiges Anwesen zu. Die kleinen an Bewegungsmelder gekoppelten Lampen rechts und links des Weges beleuchteten meine Niederlage wie zum Hohn. Achtlos ließ ich den Audi A8 vor dem Eingang stehen. Darum konnte sich später der Mechaniker kümmern. Klauen würde ihn hier keiner. Der Zugang zum Haus war mit einer Sicherheitstür und einem Code gesichert. Ich hatte mir die perfekte Fassade eines exzentrischen Selfmade-Millionärs zugelegt. Da gehörte die neueste Sicherheitstechnik quasi zum guten Ton.
Zu meiner sterblichen Identität gehörte auch eine Erklärung, warum ich so viel Geld hatte. Die Leute wurden misstrauisch, wenn man mehr Geld hatte als sie. Vermuteten, dass es nicht rechtmäßig erworben sein konnte. Was in meinem Fall stimmte, wenn man es genau betrachtete. Eben diese genauen Betrachtungen wollte ich nach Möglichkeit vermeiden. Deshalb hatte ich eine Geschichte kreiert, die ich beliebig ausbauen konnte. Ich war Dorian Fitzgerald, hatte mich selbst reich beerbt (was ja keiner wusste, da es keine Fotos von mir gab) und mit dem Verkauf einer Softwarelizenz zusätzlich viel Geld gemacht, das ich in marode Unternehmen investierte, diese erfolgreich sanierte und daran weiterverdiente. Das klang plausibel und langweilig genug, dass die meisten Leute nicht weiter darüber nachdachten. Mein Unternehmen baute auf etlichen Schein- und Tochterfirmen auf, die schwer miteinander in Verbindung zu bringen waren. Dadurch brauchte ich nie in Erscheinung treten, sondern hatte eine Vielzahl Mittelsmänner an der Hand.
Ich hätte mir Einfacheres ausdenken können, aber ich mochte es, mir neue Identitäten zurechtzubasteln. Außerdem gab es heutzutage kaum noch eine legale Möglichkeit, zu Reichtum zu kommen. Was dann schnell wieder Neider und die Finanzbehörden auf den Plan rief. Die moderne Welt war kleiner geworden, auch für uns Vampire und ich wollte möglichst lange von meiner erfundenen Identität profitieren. Mein Unternehmen führte ich bereits in der dritten Generation, und niemandem war es aufgefallen.
Ich ließ die Tür hinter mir zufallen und horchte auf das Klicken des automatischen Schließsystems. Diesen Tag würde ich nicht zur Ruhe kommen, das merkte ich bereits, als ich mich an meinen Mahagonischreibtisch in meinem Arbeitszimmer setzte und den PC anschaltete. Sie würde mich nicht zur Ruhe kommen lassen. Verdammt! Wie hatte ich das so verbocken können? Und wieso schwirrte sie mir noch im Kopf herum? Was war sie denn schon? Ein Menschlein und nicht einmal ein besonders aufregendes. Obwohl … das stimmte nicht ganz. Sie war aufregend. Das musste sie sein, wenn sie mich, einen gut sechshundert Jahre alten Vampir, der so ziemlich alles gesehen und erlebt hatte, derart aufregte.
Der flimmernde Monitor machte mich wütend. Ich stand auf und holte mir aus einem Geheimfach im Kühlschrank meiner teuren Designerküche eine Blutkonserve, an der ich lustlos herumnuckelte. Wenn ich wenigstens ihren Namen wüsste, dann hätte ich sie im Internet suchen können. Aber ich wusste nichts. Nicht ihren Namen, nicht ihre Adresse, nicht wo ich sie wieder treffen könnte. So musste man sich als Sterblicher fühlen, wenn man seine Angebetete gefunden und es vermasselt hatte. Moment mal. Angebetete? Was redete ich da? Ich war nur wütend, weil mein Charme bei ihr nicht funktioniert hatte. Oder etwa nicht?
Ich ließ mich wieder in meinen Ledersessel fallen und drehte den Monitor ein bisschen, um die Füße hochlegen zu können. So starrte ich einen Moment auf die Bilder und Buchstaben. Das Internet war eine absolut grandiose Erfindung! Hätte von mir sein können. Ich liebte es. Es war so … praktisch. Wenn man etwas suchte, tippte man es einfach in eine dieser Suchmaschinen ein und – voilà – erhielt manchmal sogar brauchbare Informationen zu dem Thema. Mit Sicherheit aber jedes Mal ganz erstaunliche andere Dinge. Und all diese Social-Network-Seiten! Großartig. Man konnte jederzeit Gesellschaft haben. Virtuell. Die minutiösen Ergüsse einiger extrem Mitteilungsbedürftiger, die zwar über einen schnellen WLAN-Zugang verfügten, aber dringend eine Generalüberholung ihrer eigenen Festplatte benötigten, waren göttlich. Ich hätte mich so manches Mal totlachen können über diese Flut von bedeutungslosem Schwachsinn, den manche Menschen so von sich gaben.
Wenn ich nicht schon tot wäre.
Es war amüsant und süchtig machend, sich auf das Niveau dieser unterbelichteten, arbeitsfaulen, sozial inkompetenten Stubenhocker herabzubegeben und ihre kleine Welt voller Talkshows, Reality-TV und Teleshopping durcheinanderzubringen. Man brauchte nur eine winzig kleine Kritik zur aktuellen Staffel einer dieser total bescheuerten Ich-bin-ein-Super-Hirni-Talentshows anzubringen und löste damit ganze Lawinen von empörten Diskussionen aus und machte sich zum Staatsfeind Nummer eins. Herrlich!
Also tauchte ich, mit dem Schlauch meines Blutspendebeutels im Mundwinkel und meiner Tastatur auf den Beinen, ein in die Welt des World Wide Web.
*
In ihrem »Zuhause« angekommen, einem renovierungsbedürftigen Reihenhaus, etwas abseits der anderen nicht besser instand gehaltenen Häuser, randalierte Steve wie ein Irrer herum. Das Haus hatte einem älteren Ehepaar gehört, das ein bisschen muffig gerochen und auch so geschmeckt hatte. Sie hatten sie einfach in ihren Fernsehsesseln sitzen lassen, nachdem sie sie ausgesaugt hatten. Trudy fand es abstoßend und machte einen Bogen um sie. Steve schien es nicht zu stören. Er hatte das ganze Haus nach Wertgegenständen durchsucht, doch nicht viel gefunden, und wie ein Tollwütiger Türen eingetreten und Wände eingeschlagen.
Gerade nahm er die Kücheneinrichtung auseinander. »Nun pack schon deine Scheißklamotten. Der wird uns töten, wenn wir nicht noch heute die Stadt verlassen. Seine Stadt. Mann, der hat mir ’ne Scheißangst eingejagt. Dieser Hurenbock. Was glotzte denn so?«
Trudy beeilte sich, ihre wenigen Habseligkeiten zusammenzusammeln. Viel war es nicht. Eine Jeans, ein T-Shirt, ein Pulli, ein knappes rotes Kleid und ein hübsches längeres Kleid mit Blümchenmuster für, tja, das wusste sie auch nicht genau. Ein bisschen Schminke und Geld. Leider waren die Klamotten der alten Dame nicht ihr Stil, sie hatte sich lediglich ein bisschen Schmuck genommen, um ihn zu verkaufen.
Seit sie mit Steve zusammen war, zogen sie kreuz und quer durchs Land. Immer in gestohlenen Autos, deren Eigentümer sie getötet hatten. Sie brachen irgendwo ein, töteten die Hausbesitzer meist im Schlaf. War Steve schlecht drauf, wurde es ein regelrechtes Blutbad. Dann hausten sie einige Tage zusammen mit den mittlerweile toten Bewohnern dort und zogen weiter. Dieses Haus hatten sie erst vergangene Nacht in Beschlag genommen.
Manchmal taten sie sich mit anderen Vampiren zusammen, wenn sie welche fanden. Die meisten waren nicht so schlimm wie Steve. Aber Vampire, die gebildet und kultiviert waren und sich ein richtiges Leben unter den Sterblichen aufgebaut hatten, wollten mit ihnen nichts zu tun haben. Sie hatten sie ausnahmslos verjagt, doch niemals hatte Trudy diese Angst in Steves Augen gesehen. Sie musste unbedingt herausfinden, wer dieser alte Vampir war, und sie musste versuchen, irgendwie an ihn heranzukommen. Steves Wutausbrüche würden sie irgendwann in Gefahr bringen. Bisher hatten sie Glück gehabt, aber das Blatt konnte sich schnell wenden, wie ihr bisheriges Leben gezeigt hatte.
Sie ging zurück in die Küche, wo Steve vor sich hinschimpfte. Er sah zu ihr auf, zog sie am Arm zu sich und küsste sie grob auf den Mund. Dabei grapschte er ihr unter den Rock. Wenn er wollte, konnte er gut küssen und Dinge mit seiner Zunge anstellen, von denen Trudy bisher nur hatte träumen können. Aber wenn er in so einer Stimmung war, wollte er Dampf ablassen und sich wie der Größte fühlen. Es war schneller vorbei, wenn sie ihm gab, was er wollte, also stöhnte sie gekonnt und biss ihm fest in die Unterlippe, bis er blutete. Das heizte ihm für gewöhnlich ein.
Sie öffnete mit einer Hand seine Hose und wollte sich vor ihn knien, doch er hob sie mühelos hoch und drückte sie unsanft auf den Küchentisch, der wie durch ein Wunder trotz all seiner Attacken auf die Küchenmöbel heil geblieben war. Er griff in den tiefen Ausschnitt ihres engen Kleides, riss es ihr im wahrsten Sinne des Wortes herunter, drängte sich zwischen ihre langen Beine und rammte sich in sie.
»Das war mein bestes Kleid.«
»Tut mir leid, Baby«, murmelte er zufrieden.
Wenn er sich ausgetobt hatte, war er sanft und zärtlich. Er wollte kuscheln und ihr sagen, wie froh er war, dass sie bei ihm geblieben war. Trudy kämpfte dann jedes Mal gegen das Verlangen an, ihm ins Gesicht zu treten oder ihm seinen schlappen Schwanz abzubeißen. Vampirwunden heilten jedoch so schnell, dass sie nicht lange Ruhe vor ihm gehabt hätte. Und seine Laune wäre wahrscheinlich auch nicht die beste gewesen.
»Ich kauf dir ’n neues. Versprochen.« Er lag mit runtergelassener Hose auf dem Boden des Wohnzimmers, direkt vor den beiden Leichen, und kratzte sich versonnen die Brust. Sein Zorn hatte sich gelegt.
Jetzt würde sie bekommen, was sie wollte. Sie setzte sich nackt auf ihn. »Wer war denn der Vampir, von dem du gesprochen hast?«
Er war Wachs in ihren Händen. Den Jähzorn hatte er an dem Haus und ihrem Körper ausgetobt, das Blut, das er getrunken hatte, war verbraucht, der Rausch vorbei.
»Dieser langhaarige Typ an der Bar. Mit diesen Etepetete-Klamotten. Ich wusste nicht, dass er ein Vampir ist, bis er …« Er stöhnte, weil sie ihm mit spitzen Fingernägeln die Rippen herunterfuhr und blutende Wunden hinterließ.
Steve war so dämlich. Er konnte nicht einmal andere Vampire spüren. Sie hatte sofort gespürt, dass sich noch einer in dem Klub herumtrieb. Sie hatte nur nicht ausmachen können, wer es war. Das war das Problem mit ihren Fähigkeiten. Sie tauchten eher spontan auf, und sie wusste meistens nichts damit anzufangen. Bei Steve tauchte nur der Jähzorn spontan auf. »Wie konnte er dir denn Angst machen?« Sie sagte das so, als ob das völlig unmöglich wäre. Er grinste selbstgefällig und stierte sie mit geilen Blicken an. Steve war besessen von ihren Brüsten und grapschte mit seinen großen Händen nach ihnen. Natürlich bekam er ohne genügend Blut in seinen Adern keinen mehr hoch, aber daran hatte Trudy eh kein Interesse.
»Ach, so richtig Angst gemacht hat er mir eigentlich nicht. Er sagte, wir sollen aus seiner Stadt verschwinden. Ist eh Scheiße hier. Verdammtes Drecksloch!«
Sie beugte sich hinunter und leckte das Blut aus den tiefen Kratzern, biss ihm in die Brust und saugte noch mehr Blut aus ihm heraus. Er hatte das meiste Blut verbraucht, das er getrunken hatte. Wenn Trudy jetzt den Rest aus ihm heraussaugte, wurde er schwach und träge, das hatte sie schnell begriffen. Sie jedoch nicht. Sie wurde jedes Mal ein bisschen stärker. Er dachte immer, er wäre vom Sex so erledigt. Idiot! »Und war dieses Mädel, mit dem er gesprochen hatte, auch ein Vampir?«
»Wer?«, fragte er und leckte sich über die Lippen, während seine Hände ihre Brüste kneteten, als wären sie Brotteig.
»Na, diese Brünette. Hässliches Ding.«
»Nee, die is ’n Mensch. Der hat sich mit der unterhalten, doch die hat ihn abblitzen lassen«, erwiderte er und lachte dreckig.
Sie stimmte in sein Lachen ein. Der alte Vampir hatte mit einer Sterblichen geflirtet? Wohl kaum. Bestimmt hatte er sie sich als nächstes Opfer ausgesucht und schlug sie nun in seinen Bann. Das war ja interessant. »So ein Schlappschwanz«, sagte Trudy leise und grinste, »der kann nicht mal ’ne Sterbliche anbaggern? Von so einem lässt du dich verjagen? Ich meine, du hast mir das eben zwei Mal so was von besorgt, ich kann gar nicht mehr aufhören, so scharf bin ich immer noch auf dich. Wir müssen doch nicht sofort abhauen, oder?«
Er drückte noch immer ihre Brüste und starrte darauf, als würde er sie zum ersten Mal sehen, und Trudy bewegte sich auf ihm, als wüsste sie nicht, dass aus seinem Schlappschwanz nichts mehr herauszuholen war.
»Aber ich glaub, der merkt das, wenn wir noch da sind.« »Dann gehen wir halt weg, nur nicht so weit, und kommen später wieder her«, flüsterte sie und sah ihn lüstern an. Sie würde bekommen, was sie wollte. Der Preis war, na ja, alles hatte seinen Preis. Aber sie würden in der Nähe bleiben, und Trudy könnte diesen Vampir ausfindig machen. Und das Mädchen. Denn sie hatte bereits einen Plan.
2
Ich wusste nicht, wie ich diesen verfluchten Tag überstanden hatte. Gegen Abend fand mich mein Butler James auf dem Sofa liegend, den riesigen Fernseher und die Anlage mit lauter Musik angeschaltet, und alle viere von mir gestreckt. Eine Blutkonserve lag halb leer neben mir auf dem Marmorboden. Keine Ahnung, warum zum Teufel ich so viel von dem Zeug getrunken hatte. Ich brauchte es nicht. Es hatte mir nicht einmal geschmeckt. Was für eine Verschwendung.
Sie war mir den ganzen Tag nicht aus dem Kopf gegangen. Der Fernseher hatte mich nicht ablenken können. Deshalb hatte ich zusätzlich die Musik auf volle Lautstärke gedreht, sodass mir der Kopf geschmerzt hatte. Die Bässe und die durch die Lautstärke verzerrten Beats hatten das Bild von ihr langsam aus meinem Kopf gedröhnt, und ich war erschöpft aufs Sofa gefallen, wo ich liegen geblieben war, bis James die Musik ausdrehte. Ich stöhnte, als ihr Lachen wieder auferstand, als wäre es nie weg gewesen.
James wusste natürlich, was ich war. Wir hatten nie darüber gesprochen, das Wort Vampir nie ausgesprochen, aber er war ja nicht dumm. James hatte die Ausbildung an einer englischen Schule für Butler mit Auszeichnung absolviert. Die Schule, die ich bezahlt hatte. Ich hatte ihn als Jungen von der Straße aufgelesen und ausbilden lassen. Dass er nun mein Butler war, war nicht mein vorrangiger Plan gewesen. Ich traf ihn in einer, sagen wir mal, großzügigen Minute wieder. Er konnte sich an mich erinnern, als er bei mir anfing – und ich war keinen Tag gealtert. Doch James war ein Profi: korrekt, vertrauenswürdig, kompetent. Bedingungslos loyal und absolut verschwiegen. Er war meine rechte Hand, mein Kontakt zur Außenwelt. Ein bisschen wie Batmans Alfred. Nur dass er James hieß, und nicht so alt war. Er wohnte in einem Extraflügel in meiner Villa und genoss das gute Leben, das er sich dank meines großzügigen Gehaltes leisten konnte. Er hatte mir viel zu verdanken. Ich konnte mich auf seine Diskretion voll und ganz verlassen. »N’ Abend, Alfred, äh, James.«
»Guten Abend, Sir«, sagte James gestelzt. »Hatten Sie einen angenehmen Tag?«
Ich brummte nur. Nee, der Tag war …, ach, einfach nicht daran denken.
»Welchen Wagen soll ich Ihnen vorfahren lassen?«, fragte er wie jeden Samstagabend und räumte meine Hinterlassenschaften weg.
Ich stöhnte und versuchte, nachzudenken. Von dem Konservenblut war mir übel. Ich hatte es zu lange in der Hand behalten. Es war klumpig gewesen und hatte abgestanden geschmeckt. James räusperte sich, als wollte er mir damit sagen, er hätte noch wichtigere Dinge zu tun, als hier zu stehen und auf eine Antwort zu warten. Ich musste schmunzeln. Die berühmt berüchtigte englische Affektiertheit. »Ich weiß nicht. Suchen Sie einen aus.«
»Da Sie gestern den Audi fuhren, würde ich für heute Abend den Aston Martin vorschlagen. Geht es Ihnen gut, Sir?«
Ich lachte leise. James schlug immer den Aston Martin vor. Vielleicht sollte ich ihm einen zu Weihnachten schenken. »Ja, ist schon in Ordnung.«
»Sakko oder sportlich?«
»Sak…«, wollte ich antworten, als sie wieder deutlicher in meine Gedanken trat. »Sportlich.«
»Dann vielleicht doch lieber den Shelby GT?«
»Perfekt!« Ich sprang in einer einzigen blitzschnellen Bewegung vom Sofa auf die Füße und strahlte James an. »Und besorgen Sie mir ein Haarband, oder was Männer heutzutage so benutzen.« Ich hatte ihre Unterhaltung im R7 belauscht und meinte mich zu erinnern, dass sie keine langen Haare mochte.
»Jawohl, Sir.« James nickte beflissen und machte sich an die Arbeit.
Mein persönlicher Alfred. Ich fühlte mich tatsächlich ein bisschen wie Bruce Wayne, als ich singend unter der Dusche stand. Ich hatte einen Plan. Wenn ich einen Plan hatte, erweckte das stets meine Lebensgeister. Auch ich würde mich heute Nacht maskieren und sie vor dem bösen kurzhaarigen Turnschuhträger retten. Ich konnte mir ein ausgelassenes Lachen, das die Wände zum Beben brachte, nicht verkneifen.
James hatte mir eine Auswahl Haargummis und Klammern und anderer Dinge, die ich noch nie gesehen hatte, zusammen mit Ausdrucken dazugehöriger Frisuren hingelegt. Er war wie ich ein Perfektionist. Ich probierte einiges aus, band dann aber nur den oberen Teil meiner Haare zurück. Keine Ahnung, warum sie nicht auf lange Haare stand, aber nun sah ich ein bisschen aus wie dieser Fußballer auf dem Foto. Nur blasser. Und ich konnte kein Fußball spielen. Aber dafür war ich unsterblich. Ich würde sagen, eins zu null für den Vampir.
Perfekt gestylt mit Bluejeans und dunkelblauem langärmligen Pulli und neuer Frisur – meiner Maskerade – machte ich mich auf in die nächtliche Innenstadt.
Es war Samstagabend, und ich schlenderte gelassen durch die Einkaufsstraße und warf hier und dort einen Blick in die Fenster der bereits geschlossenen Geschäfte und schon geöffneten Bars. Nicht, dass ich in einem dieser Warenhäuser jemals etwas gekauft hätte oder kaufen würde. Ich betrachtete einfach mein Spiegelbild. Natürlich haben Vampire ein Spiegelbild. Wir sind ja nicht unsichtbar.
Ich war etwa einen Meter zweiundachtzig groß und schlank, hatte schulterlange mittelblonde Haare, klare grüne Augen mit gepflegten Augenbrauen und einer Denkerfalte in dem ansonsten faltenlosen Gesicht. Mein Teint war nicht zu blass, aber immer noch weit entfernt vom Menschlichen. Mein Kinn war weich aber eckig mit einem kleinen Grübchen in der Mitte, meine Unterlippe eindeutig sinnlicher als meine nicht ganz so volle Oberlippe. Und ich achtete immer auf tadellose Garderobe. Alles in allem sah ich recht ordentlich aus und diese neue Frisur, ja, konnte sich sehen lassen. Ach, was soll die falsche Bescheidenheit. Ich sah umwerfend aus. Ach, ich hätte mich in mich verlieben können. Und ich war bestens gelaunt. Hatte ich doch einen Plan … sie! Durch mein mattes Spiegelbild hindurch sah ich sie plötzlich.
Das schlichte Geschöpf saß in einer Bar, trank einen Cocktail und unterhielt sich mit seiner Freundin. Ich trat rückwärts aus dem Lichtkegel der Straßenlaterne heraus und hastete auf die andere Straßenseite, bevor sie mich entdecken konnte. Es gab doch einen Gott. Und der hatte mich ein zweites Mal direkt zu ihr geführt. Ich musste unbedingt James beauftragen, der Gemeinde hier, keine Ahnung, wem die geweiht war, eine Spende zukommen zu lassen. Eine Große. Konnte ja nicht schaden.
Mein Gehör übertraf alle menschlichen Vorstellungen, aber ich musste genau hinhören, um sie zu verstehen, so sehr nahm mich ihr Anblick gefangen. Dabei sah sie wieder irgendwie schlicht aus. Die langen Haare offen und ordentlich gekämmt und so voll, dass ich am liebsten sofort hineingegriffen hätte. Dezent geschminkt, kein Lippenstift. Sie nahm einen Zug aus dem Strohhalm in ihrem Cocktailglas und sah aus dem Fenster zu mir herüber. Es war dunkel. Ich stand im Schatten der gegenüberliegenden Häuserwand. Sie konnte mich nicht sehen. Aber ich hätte schwören können, dass sich ihr Blick durchdringend und forschend auf mich heftete. Wäre mein Herz nicht bereits vor so vielen Jahren stehen geblieben, jetzt hätte es das nachgeholt.
Verzückt beobachtete ich sie weiter, achtete kaum auf das, was sie sprachen. Bis plötzlich zwei Männer an ihrem Tisch standen und sich zu ihnen setzten.
Moment mal, wo kamen die denn her? Mist, was war bloß los mit mir? Ich hatte nicht zugehört. Nicht ein einziges Wort. Hatte sie nur angestarrt. Diese Annie machte sich gleich über einen der Kerle her. Sie sprach mit dem anderen. Ich konnte mich kaum auf ihre Worte konzentrieren, so geschockt war ich, dass sie sich mit einem anderen Kerl traf.
Aber: Endlich hatte ich einen Namen und er klang wie Musik in meinen Ohren, als ich ihn ganz leise aussprach. Louisa. Ihr schönes Gesicht überzog eine leichte Röte und sie blickte wieder genau in meine Richtung, ohne mich zu sehen. Zumindest hoffte ich, sie würde mich nicht sehen. Sie drehte den Kopf wieder dem Tölpel zu und lachte, wobei sie das Kinn leicht anhob. Dieses Lachen, und welche Wandlung es in ihrem sonst so ernsten Gesicht vollzog, war hinreißend.
Dieser sterbliche Volltrottel machte alles richtig, wie ich wütend feststellen musste. Und was machte sie? Sie lächelte geschmeichelt. Lachte nicht zu laut und wirkte völlig entspannt. Sie wandte ihm immer wieder das Gesicht zu, sodass ich ihr schönes Profil betrachten konnte. Mist, sie flirtete mit ihm und ihre Augen funkelten dabei wie Diamanten in einer graublauen Auslage aus reiner Seide. Das war ihr Geheimnis. Ihre geheime Anziehungskraft. Wenn sie wollte, strahlte ihr Gesicht wie das eines Engels. Aber sie wusste es nicht.
Wie unglaublich bezaubernd!
*
Annie ließ sich auf den leeren Stuhl vor mir fallen. »Kleine Planänderung für heute Abend.«
»Was denn für eine Planänderung?«
Annie zog sich die Jacke aus und nahm einen Schluck von meinem Sex on the Beach. Ironischerweise hatte ich den bestellt. Wenn ich schon keinen Sex hatte, wollte ich wenigstens davon kosten. Ich grinste bei dem Gedanken.
»Kannst du dich noch an die Typen erinnern, die wir gestern Nacht kennengelernt haben?«
»Ehrlich gesagt, nee«, antwortete ich und machte ein bedauerndes Gesicht. Ich war mit einem fürchterlichen Kater aufgewacht und sah meine Befürchtungen bestätigt, dass ich wieder einmal ein bisschen zu viel getrunken hatte. Das passierte mir am Wochenende immer öfter.
Annie verdrehte die Augen. »Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat Joshua, das war der eine, gefragt, ob wir nicht heute alle zusammen ins Kino gehen wollen.«
»Wer ist denn ‚wir alle‘?« Ein feines Kribbeln, wie wenn man von jemandem angeguckt wird, ließ mich nach draußen blicken. Da war niemand. Dennoch hielt das Kribbeln an. Ich versuchte, das Dunkel auf der anderen Straßenseite zu durchdringen. War da nicht ein heller Schimmer, als würde sich jemand im Dunkeln verstecken?
»Hörst du mir überhaupt zu?« Annie berührte mich am Arm.
»Sorry, ich hätte schwören können … Aber, egal. Kino, heute Abend, du, ich und … wer?«
»Joshua und sein Kumpel. Mit dem du gestern rumgeknutscht hast.«
Also hatte ich tatsächlich rumgeknutscht, und ich hatte mir diesen Nachgeschmack von Bier und Aschenbecher nicht eingebildet.
»Bist du dabei?«
»Ja, okay. Wird schon nicht so schlimm werden.« Kino war unkommunikativ. Wenn er mir nicht mehr so gut gefiel wie vergangene Nacht, musste ich wenigstens nicht mit ihm reden. Wenn er mir doch gefiel, konnte ich ihm ja vorweg ein paar Minzdragees kaufen.
»Sie kommen übrigens vorher hierher.«
»Ach so.« Dann würde ich doch mit ihm reden müssen.
»Da sind sie auch schon«, rief meine Freundin und winkte zwei Typen, die von draußen hereinschauten. »Ich hoffe, das macht dir nichts aus?«
»Wenn doch, wär’s jetzt eh zu spät.« Ich guckte nach draußen und beugte mich ein bisschen zur Seite, um noch einen Blick auf sie werfen zu können, ehe sie hereinkamen. »Geiler Hintern.«
»Das hast du gestern auch gesagt«, erwiderte Annie und grinste mich an. »Er heißt übrigens Eric, falls du das auch nicht mehr weißt.«
Wir lachten, als die beiden an unserem Tisch ankamen. Annie umarmte den schmalen Dunkelhaarigen zur Begrüßung. Das musste dann wohl Joshua sein. Sein Freund war glücklicherweise ein gut aussehender Kerl mit kecker Kurzhaarfrisur – sehr schön – und einem freudigen Lächeln. Etwas peinlich berührt gab ich ihm die Hand. Ich hatte den Kerl nie zuvor gesehen. Sie zogen sich zwei Stühle heran und setzten sich zu uns. Eric rückte etwas um den kleinen runden Tisch herum, beugte sich zu mir und fragte mich leise nach meinem Namen.
»Hey, tut mir leid, das ist sonst wirklich nicht meine Art. Aber ich weiß nicht, ich hatte wohl zu viel getrunken und ’nen kleinen Filmriss. Aber du … ich meine … ich hab dann wohl … vergessen …«
»Kein Problem.« Ich grinste. Dass es mir ebenso ging, musste ich ihm ja nicht auf die Nase binden. »Fangen wir einfach von vorn an. Ich bin Louisa.«
»Eric. Hi.«
Wir gaben uns die Hand und lächelten uns an. Große Hände, fester Händedruck – sehr sympathisch.
»Kann ich dir was zu trinken bestellen?«, fragte er, als die Kellnerin an unseren Tisch kam.
»Ja, ich hätte gern Sex … äh, einen Sex on the Beach.«
Wir lachten, und ich war froh, dass Eric sich zu der Kellnerin umdrehte, um die Bestellung weiter zu geben. Sonst hätte er mein rot angelaufenes Gesicht gesehen. Denn als er mich so vornübergebeugt mit seinen blauen Augen angesehen hatte, die kräftige große Hand auf den Oberschenkel gestützt, wollte ich plötzlich genau das. Oder besser, ich fragte mich, wie es mit ihm sein würde. Überrascht von mir, wandte ich mich leicht ab und guckte aus dem Fenster. Ich war tatsächlich rot geworden, und ich spürte noch immer dieses Kribbeln, als würde ich von draußen beobachtet. Doch ich sah nichts. Aber es war auch schon ziemlich dunkel. Es war lange her, dass jemand so etwas wie Begierde in mir geweckt hatte. Bedeutungsloser Sex war eigentlich nichts für mich, auch wenn die Kerle, die ich in letzter Zeit kennengelernt hatte, an kaum mehr interessiert zu sein schienen.
»Hier, dein Sex.« Eric grinste breit und schob mir meinen Cocktail hin. Ich griff nach meiner Tasche, um zu bezahlen, doch er winkte ab. »Ich lad dich ein.«
»Danke schön. Das ist aber nett.«
»Dafür, dass ich deinen Namen vergessen habe, ist das ja wohl das Mindeste.« Er grinste und prostete mir zu.
Was müsste ich dann dir spendieren? Meine Gedanken gingen eindeutig in eine Richtung. Ich warf einen Blick auf Annie und Joshua. Die beiden waren auf dem besten Weg genau dorthin, denn völlig ungeachtet unserer Anwesenheit knutschten sie wild miteinander. Na, toll! Ich warf meine Haare mit einer gewohnten Handbewegung nach hinten, ehe sie mir in den Cocktail fielen, und trank einen großen Schluck.
»Du hast sehr schöne Haare«, sagte Eric und lächelte. Er zwinkerte mir über den Hals der Bierflasche hinweg zu.
Seine strahlend blauen Augen waren wunderschön und standen im starken Kontrast zu den dunklen Haaren und den langen schwarzen Wimpern. Ich lächelte und blickte unauffällig an ihm herunter. Er trug ein T-Shirt, und ich konnte seinen angespannten Bizeps sehen. Auch die enge Jeans spannte stark am Oberschenkel. Er wirkte ziemlich durchtrainiert. Wahrscheinlich hatte er sogar ein Sixpack, überlegte ich und merkte, wie mir ganz warm bei dem Gedanken wurde. Warum konnte ich mich nicht an vergangene Nacht erinnern? Okay, ich hatte, nachdem wir das R7 und diesen komischen Kerl hinter uns gelassen hatten, noch den einen oder anderen Cocktail getrunken. Aber so viele? Vielleicht konnte er auch einfach nicht küssen. Das konnte natürlich alles kaputtmachen. »Du treibst wohl viel Sport?«, fragte ich ihn und warf noch einen Blick auf seinen prallen Oberarmmuskel.
»Ja, ich hab Rugby gespielt, aber musste wegen der Arbeit aufhören«, antwortete Eric. »Hatte einfach keine Zeit mehr. Ich arbeite jetzt bei der Feuerwehr und hab dort Schichtdienst. Was machst du denn beruflich? Ich hoffe, ich hab das nicht vergangene Nacht schon gefragt?« Er sah mich ein wenig zerknirscht an.
Ich schüttelte den Kopf. »Ich arbeite als Sekretärin bei einer kleinen Handwerksfirma. Ja, klingt nicht so spannend, macht aber Spaß.«
Eric zündete sich eine Zigarette an. Das war wohl der Grund, warum ich mich nicht mehr an unsere Küsse erinnern konnte – oder wollte.
Die nächste Runde spendierte ich. Ich wollte ungern das Gefühl haben, in seiner Schuld zu stehen. Annie und Joshua wechselten ab und zu einige Worte mit uns, bis sie sich wieder einander zu wandten. Wir ignorierten sie und unterhielten uns über alles Mögliche. Eric war ein paar Jahre zur See gefahren und hatte viele lustige Geschichten zu erzählen. Ab und zu warf er mir so einen Blick zu, als würde er darauf warten, dass ich ihm irgendein Signal gab. So, als hätte er gern da weitergemacht, wo wir am Abend zuvor aufgehört hatten. Ein-, zweimal war ich auch drauf und dran, ihm einfach mal meine Hand auf seine zu legen, doch dann zündete er sich eine weitere Zigarette an, und der Moment war vorbei. Im Laufe des Abends störte es mich so sehr, dass er rauchte, dass er mir regelrecht unsympathisch wurde. Ich versuchte kein weiteres Mal, unserer Unterhaltung eine andere Dynamik zu geben. Er jedoch auch nicht.
Plötzlich standen Annie und Joshua auf. Sie wollten woanders hin. Annies Augenzwinkern nach zu urteilen, konnte ich mir auch gut vorstellen, was sie in diesem »woanders« vorhatten. Der Plan mit dem Kino war offenbar gestorben. Mir stand eh nicht mehr der Sinn danach. Ich hatte Kopfschmerzen bekommen. Vielleicht von den vielen süßen Cocktails, vielleicht auch vom Zigarettenrauch.
»Wir haben übrigens Karten für das Konzert nächstes Wochenende. Vielleicht wollt ihr beide mitkommen?«, schlug Joshua vor, als er sich seine Jacke anzog.
Annie nickte begeistert und sah mich bedeutungsvoll an. Ich hatte zwar keine Ahnung, von welchem Konzert sie sprachen, und war außerdem der Meinung, sie hätte da auch allein mitgehen können, stimmte aber zu.
»Okay, dann besorg ich euch auch noch Karten. Bis Samstag dann, mach’s gut, Louisa.«
»Ja, viel Spaß noch«, erwiderte ich.
»Euch auch.« Annie grinste mich noch breiter an, ehe sie mit Joshua an der Hand die Bar verließ.
Mit einem beklommenen Gefühl sah ich Eric an. Er machte keine Anstalten, zu gehen. »Ich werde auch nach Hause gehen. Ich glaube, es ist genug für heute«, sagte ich deshalb und stand auf.
Eric erhob sich ebenfalls und kam mit nach draußen. »Soll ich dich nach Hause bringen?«
»Nein, danke. Ich ruf mir ein Taxi.«
Er nahm zögerlich meine Hand und gab mir einen schnellen Kuss auf die Wange, wobei mir wieder diese Wolke aus kaltem Rauch in die Nase stieg. Warum störten mich eigentlich immer die kleinen Dinge? Warum wurden sie so groß, dass man alles andere nicht mehr sah? Eric war ein hübscher Kerl, lustig, nett und vor allem sehr sexy mit seinem offensichtlich durchtrainierten Körper. Es tat mir ein bisschen leid, als ich ihn da stehen ließ. Aber ich ahnte, warum ich mich an diesen Kleinigkeiten festhielt. Weil ich Angst hatte. Ich hatte Angst, dass mir wieder so etwas zustoßen könnte wie vor acht Monaten und zweiundzwanzig, nein, dreiundzwanzig Tagen. Vielleicht wurde es Zeit, endlich daran zu arbeiten und diese Angst ein für alle Mal loszuwerden.
*
Ich quälte mich noch eine Weile, indem ich sie, Louisa, beobachtete, wie sie mit einem anderen flirtete, der ihr offensichtlich gut gefiel. Meine Wut brandete auf, sodass ich die Hände zu Fäusten ballte und wünschte, ich könnte auch Menschen durch die Kraft meiner Gedanken zu Asche verbrennen lassen. Ich hätte diesen Eric hoch auflodern lassen! Leider funktionierte das nur bei Vampiren. So beschränkte ich mich darauf, reglos im Dunkeln zu stehen und meinem Widersacher Pest und Teufel an den Hals zu wünschen.
Bewegung kam in die kleine Gruppe. Und Louisa wollte nach Hause. Mit grimmiger Genugtuung hörte ich, dass sie nicht vorhatte, diesen Eric mitzunehmen. Ich konnte mir ein breites Grinsen voll Häme nicht verkneifen. Sie rief sich ein Taxi, stieg ein und ließ den armen Drops stehen. Tja, das Gefühl durfte ich bereits kennenlernen. Dieses schlichte Geschöpf entpuppte sich als wahre Herzensbrecherin. Nehmt euch in Acht!
Als alle weg waren, ging ich in die Bar und zu dem Stuhl, auf dem sie gesessen hatte. Befühlte das Glas, aus dem sie getrunken hatte, und nahm ihren Duft auf. Sie roch köstlich! Nun kannte ich die Adresse, die sie dem Taxifahrer genannt hatte, und hatte ihren Duft, den ich überall wiederfinden würde. Ich konnte sie jederzeit wiedersehen, wenn mir danach war. Doch jetzt war mir nach etwas ganz anderem. Ich musste jagen! Ich wollte mir ein Opfer aus der Menge ausgucken, es anlocken, betören und meine unauffälligen aber messerscharfen Fangzähne in seinen Hals schlagen und mir, hm, sein köstliches Blut in den Mund laufen lassen.
Zu Beginn meines Vampirdaseins hatte mich die Jagd fasziniert. Die Angst in den Augen meiner Opfer war erregend, und das heiße Blut köstlicher als alles, was ich als Sterblicher jemals gekostet hatte. Was ohnehin nicht viel war. Stets verfiel ich in einen extremen Rausch, der erst endete, wenn das Herz meiner Mahlzeit aufhörte zu schlagen. Noch Stunden später floss das Blut warm durch meinen ansonsten kalten Körper, schärfte meine Sinne, befriedigte mich und ließ mich menschlicher wirken. Im Gegensatz zu anderen Vampiren war ich nach dem Trinken nicht mehr berauscht. Keine Ahnung, warum das bei mir anders war. Aber dieser kurze Blutrausch während des Trinkens war besser als jeder Sex.
Eine Zeit lang hatte ich mich diesem Rausch hingegeben, doch im Laufe der Zeit wurde ich so stark, dass die Herzen meiner Opfer aufgaben, bevor ich überhaupt richtig angefangen hatte. Nach einigen Hundert Jahren exzessiven Bluttrinkens brauchte ich es plötzlich nicht mehr unbedingt. Das war frustrierend! So blieb mir zumindest die Diashow auf ihr jämmerliches Leben erspart. Die bekam ich jedes Mal zu sehen, wenn ich meinen Opfern das Blut aussaugte. Es war wie Kino zum Abendessen, doch den Film konnte man sich nicht aussuchen – und man konnte das Kino auch nicht verlassen, ohne mit dem Abendbrot aufzuhören. Da ich stets ein großes Prozedere veranstaltete und mir Zeit ließ, um das geeignete Opfer zu finden, war ein vorzeitiger Abbruch inakzeptabel.
Im Gegensatz zu meinen Artgenossen ging ich stets unauffällig und in Anbetracht der Tatsachen sanft vor. Viele meiner Opfer spürten nicht einmal, dass sie zu meinem Dinner oder Dessert geworden waren. Andere schon, aber die würden es nicht mehr erzählen können.