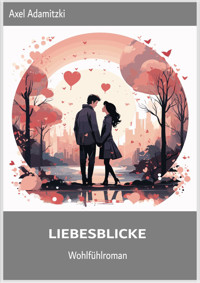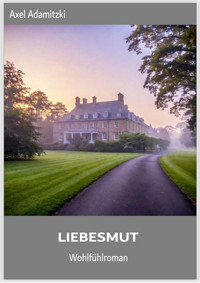1,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die beiden Zwillingsschwestern Mia und Emma, anfänglich fünfzehn Jahre alt, die unterschiedlicher kaum sein können, finden - nacheinander und jede auf ihre sehr eigene Art - »Ihr Leben«. Ein goldener Löffel, ein Brunnen und eine Gegend, die in der Realität nirgends zu finden ist, spielen dabei eine nicht ganz unwichtige Rolle.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mädchen im Brunnen
Ein spiritueller Roman
von
Axel Adamitzki
Beschreibung
Die beiden Zwillingsschwestern Mia und Emma, anfänglich fünfzehn Jahre alt, die unterschiedlicher kaum sein können, finden - nacheinander und jede auf ihre sehr eigene Art - »ihr Leben«.
Ein goldener Löffel, ein Brunnen und eine Gegend, die in der Realität nirgends zu finden ist, spielen dabei eine nicht ganz unerhebliche Rolle.
Ein paar Worte vorab
Sollten Sie an irgendeiner Stelle der nachfolgenden Geschichte mutmaßen, dass das Geschilderte keineswegs so passiert sein kann, weil ihm hier und da ein Schweben zwischen Fiktion und Wirklichkeit innewohnt, mag ich Ihnen nicht einmal widersprechen. Inwieweit sich Träume und Realitäten, Wünsche und Hoffnungen vermischt haben, ist hier, wie in vielen anderen Situation, eine Frage des Wunsches, eine Frage des Glaubens, vielleicht aber auch ganz einfach eine Frage der Spiritualität.
Der Autor
Zum Geleit zwei Worte aus der Bibel:
»Was hat ein Mensch denn davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er selbst dabei aber seine Seele verliert? Er kann sie ja nicht wieder zurückkaufen!« (Matthäus 16,26)
»Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.« (1. Korinther 13,13)
Und abschließend Ödön von Horváth:
»Eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur so selten dazu.«
TEIL 1 – Die Veränderung
Unser beschauliches Leben
Den Tag, an dem mein beschauliches Leben abrupt sein Ende fand, hatte ich so nicht kommen sehen. Glücklicherweise kann ich im Nachhinein nur sagen.
Mein Name ist Mia. Am Anfang der Geschichte, vor etwa zehn Jahren, war ich fünfzehn Jahre alt (bald sechzehn). Ich lebte mit Mama und meiner Zwillingsschwester (meiner »großen« Schwester) Emma in einem kleinen Dorf an einem großen See am Rande der Alpen, im Voralpenland, wie die Gegend gemeinhin benannt wird. Es ist eine beschauliche Gegend. Blauen Himmel mit dahinziehenden Schäfchenwolken, Berge, in den höchsten Höhen weiß gepudert, und davor Seen, die saphirblau glitzern und zum Bade laden, versprechen Ansichtskarten unserer Gegend, die jedes Jahr in rauen Mengen, als Grußbotschaften erholsamer Tage bis in die entlegensten Winkel der Welt versendet werden, und dort sicherlich ein kurzes sehnsüchtiges Innehalten hervorrufen.
Wir, ich, meine »große« Schwester und Mama, hatten wenig, im Grunde gar nichts, mit diesen Ansichtskartenversendern zu tun und auch nicht mit denen, die ihnen hier in unserer Gegend für erholsame Tage »Unterschlupf« gewährten.
Mama, die kurz vor unserer Geburt aus einer weit entfernten Großstadt hierher in unser Haus gezogen war, galt noch immer als Zugereiste. Und wir beide, ich und meine Zwillingsschwester, waren schlichtweg die Kinder der »Zugereisten« – obwohl wir das Licht der Welt im nahegelegenen Kreiskrankenhaus erblickt hatten.
Wir drei lebten sehr zurückgezogen und hatten nur wenig Teilhabe am dörflichen Leben - ich im Grunde gar keine.
Doch möchte ich hier keineswegs den Eindruck erwecken, dass man uns die kalte Schulter zeigte, nein, weit gefehlt, die dörflichen Ureinwohner behandelten Mama und Emma stets mit höflicher Zurückhaltung.
Und was war mit mir?
Nun, abgesehen von unseren direkten Nachbarn (links und rechts) und zwei Klassenkameraden, Henning und Maximilian, kannte ich niemanden in unserem Dorf näher. Viele von denen, die mir, wie gesagt, nicht näher bekannt waren, glaubten aber, mich zu kennen - was für meine Geschichte nicht ganz unwichtig ist.
Und eines gleich vorweg (um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen): Meine Beziehungslosigkeit hatte nichts mit meiner äußerlichen Erscheinung zu tun. Manche Menschen verstecken sich, weil sie einen Sprachfehler haben oder schlechte Zähne oder Pickel im Gesicht, am Ende gar ein hässliches Äußeres - wie sie glauben. Oft glauben nur sie das selbst. Aber all das traf auf mich nicht zu, nein, denn ich versteckte mich nicht, ich war mir schlichtweg nur selbst genug, hätte ich damals jedem gesagt, der mich gefragt hätte. Aber mich hatte niemand gefragt.
Aber bleiben wir hier erst einmal beim Äußeren (dann wäre das schon mal erledigt). Ich war und bin hübsch anzusehen, wie alle Welt sagte und sagt. Emma, meine Zwillingsschwester, war und ist äußerlich ebenso hübsch wie ich, innerlich aber ganz anders.
Ich habe hellblondes Haar, Emma eher rotblondes, wir sind beide ziemlich gleich groß, so um die ein Meter und fünfundsiebzig und schlank (genauere Angaben dazu kann ich leider nicht machen, gewogen hab ich mich noch nie), wobei Emma vielleicht etwa einen Fingerbreit größer ist. Wir haben beide blaue Augen, hübsche blaue Augen, möchte ich betonen. Unsere Gesichter sind nicht rund, aber auch nicht länglich, irgendwas dazwischen, ziemlich ähnlich und eben hübsch anzusehen. Einen Schmollmund haben wir nur dann, wenn uns etwas nicht passt, da gibt es keinen Unterschied zwischen uns, auch heute noch nicht. Normalerweise sind unsere Lippen schwungvoll, wobei die Oberlippe etwas fülliger ist als die Unterlippe.
Doch ganz sicher sind wir uns nicht zum Verwechseln ähnlich, waren es auch nie. An den Nasen kann man uns gut unterscheiden. Meine Nase ist eher klein, etwas hochnäsig kann man sagen und die passt zu mir. Emmas Nase ist etwas größer, strenger, wobei auch die zu ihr passt. Emma ist acht Minuten älter als ich, also bin und war ich von meinem ersten Atemzug an das Küken in unserer kleinen Familie und Emma von ihrem ersten Atemzug an meine »große« Schwester (auch nicht unwichtig!).
Übrigens, einen Papa gab es nicht, gibt es auch heute noch nicht, wurde auch nie vermisst. »Euer Erzeuger hat uns das Haus überlassen und kommt pünktlich jeden Monat seinen Verpflichtungen nach. Mehr Mann brauchen wir nicht in diesem Haus«, sagte Mama immer dann, wenn wir schon mal nachfragten – früher als Kinder.
Dieses Alleinsein, so ohne Partner, nur mit uns Zwillingen, war für Mama damals kein Problem – versuchte sie uns stets zu vermitteln, was wir ihr auch glaubten (Welche Alternative hätte es für uns auch gegeben?). Darüber wurde natürlich gequatscht – im Dorf –, wie ich später erfuhr. Für Mama war es oft nicht leicht gewesen. Vielleicht war das auch ein Grund, sich der dörflichen Gemeinschaft mehr oder weniger zu entziehen. Manchmal, eher selten, war Mama am Abend dann doch irgendwo im Dorf zum Essen eingeladen. Ihr reichte das, so schien es. Ganz konnte und durfte sie sich der dörflichen Gemeinschaft nicht entziehen. Wir, ich und meine »große« Schwester, waren dann zwar allein, hätten aber jederzeit zu Doro, unserer Nachbarin (rechts von uns) und Mamas beste Freundin gehen können; auch hätten wir Mama ohnedies zu jeder Zeit per Handy erreichen können. Sie wissen schon, bei Zahnschmerzen, Nasenbluten, Blinddarmdurchbrüchen und so weiter. Kurz gesagt: Mama war keine Rabenmutter. Bis Mitternacht war sie ohnehin stets zurück. Während der Geisterstunde waren wir nie allein, obwohl die Geisterstunde für uns Zwillinge nie von Bedeutung war. Auch nicht für Mama, die hatte es nicht so mit Geistern. Seien Sie deshalb bitte nicht enttäuscht, das Übersinnliche kommt in dieser Geschichte weiß Gott nicht zu kurz. Und Gott ist in diesem Zusammenhang auch kein zufällig gewählter Terminus.
Nun aber zurück zu mir, zur Fünfzehnjährigen, zum Küken. Mama liebte mich - über alle Maßen. Sie liebte Emma auch, nicht ganz so doll wie mich, aber sie liebte sie auch – halt anders. Mama liebte mich auch deshalb mehr als Emma, weil ich ein wirklicher Dickkopf war – der sie auch gern gewesen wäre. Wenn mir etwas nicht passte, o je, dann war gar nicht gut Kirschen mit mir essen. Schon früh, ich war noch keine fünf Jahre alt gewesen, stampfte ich das erste Mal richtig, wirklich richtig, mit dem Fuß auf. Der Grund dafür ist nicht mehr bekannt, eine Kleinigkeit sicherlich. Es entsprach einfach meiner Natur. Und es unterstrich meinen Dickkopf vernehmbar.
Emma war da ganz anders, mehr so wie Mama meistens war - versöhnlich, gutmütig, betulich, friedfertig, kurz gesagt, sie war langweilig (Fand ich bis vor Jahren noch! Fand Mama wohl lange Zeit auch). Und das war es letztlich, warum Mama mich mehr liebte als Emma; sie war es wohl einfach leid, in Emma ständig ihr Ebenbild vor Augen zu haben. Da sah sie lieber mich an, ihren Augenstern (leider hat sie mich nie ihren Augenstern genannt, ich hatte es mir so sehr gewünscht), schmiegte sich an mich und verwöhnte mich nach Strich und Faden. Ich war eben genau das, was sie gerne gewesen wäre.
Aber zurück zu Emma. Letztlich war sie es ja, die den Schlamassel auslöste, der unser trautes Leben so gänzlich auf den Kopf stellen sollte. Aber halt. Stopp! Entschuldigung. Bevor ich mit der Geschichte durchstarte, hier doch noch ein paar Anmerkungen zu der Art unseres Zusammenlebens, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, an dem alles, restlos alles auf den Kopf gestellt werden sollte. Kleine Ursache, große Wirkung: der Schmetterlingseffekt (Sie verstehen). Ein Sprichwort, das auf unsere kleine Familie regelrecht gewartet hat (leider ohne Schmetterling, das hätte vieles einfacher gemacht).
Also, eine in unserer kleinen Familie musste die Verantwortung für die tägliche Arbeit im Haushalt übernehmen - eine und nur eine (Sie wissen schon, das Prinzip der vielen Köche, die den Brei verderben - das sollte ausgeschlossen werden). Bis zu unserem achten Geburtstag lag alles, was den Haushalt betraf, unbestritten in der Hand unserer Mama, obwohl, wenn ich heute so darüber nachdenke, ganz so unbestritten dann wohl doch nicht. »Ökonomisches Kochen bedarf kurzer Wege in der Küche«, hatte Emma lauthals verkündet – da waren wir sieben Jahre alt gewesen. Weder hatte ich damals gewusst, was man unter dem Begriff »ökonomisch«, noch was unter der Tatsache »ökonomisches Kochen« zu verstehen war. Wie auch? Ich war sieben Jahre alt – keine siebzehn oder siebenundzwanzig oder gar siebenunddreißig. In solchen Momenten bezweifelte ich, dass meine »große« Schwester tatsächlich meine Zwillingsschwester war. Andere Momente, in denen sie viel, viel »kleiner« war als ich, glichen das glücklicherweise aus. Zu einem solchen Moment komme ich gleich, möchte aber eben noch den Gedanken der Verantwortung für die tägliche Arbeit in unserem Haushalt zu einem »runden« Ende bringen.
Nach unserem achten Geburtstag wuchs Emma mehr und mehr in diese Rolle hinein. Anfänglich versuchte Mama noch, ihr das eine oder andere zu zeigen, aber Emma wusste da schon alles besser. Alles, was den Haushalt betraf, riss sie geradewegs an sich. Dieses Verhalten als durch und durch zwanghaft zu bezeichnen, wäre ganz sicher keine falsche Diagnose, würde sie eine anerkannte Psychotherapeutin (oder Therapeut) gestellt haben – ich und Mama hatten nur mit dem Kopf geschüttelt und es letztlich als gegeben hingenommen. Apropos Zwanghaftigkeit: Sicherlich ist jeder Mensch irgendwo zwangsgetrieben oder zwangsgesteuert (ich will mich da nicht so genau festlegen), am Ende der eine oder andere sogar obsessiv. Derartige Verhaltensweisen betrachtete ich bei mir persönlich seit jeher als »Struktur«. Das kam aber nicht von ungefähr, nein, darüber hab ich lange und ausführlich in und mit meinem Tagebuch diskutiert. Ja, Sie lesen richtig: mit meinem Tagebuch diskutiert. Gleich mehr dazu, jetzt aber eben noch kurz zurück zu meiner »großen« Schwester.
Während Emma putzte, wusch und schrubbte, war sie kaum wiederzuerkennen. Putzen, Waschen und Schrubben war ihr Part in unserer kleinen Familie, da ließ sie sich auch nicht reinreden – und ehrlich, das wollten wir, ich und Mama, bald auch nicht mehr (ich sowieso nicht).
Ich dagegen machte ganz andere Sachen, ich sah ewig lange fern, schlief bis in die Puppen, spielte am Computer, installierte neue Apps auf meinem iPad und probierte sie stundenlang aus. Mit Begeisterung schrieb ich auch jeden Tag wichtige und unwichtige Dinge in mein Tagebuch – ebenfalls stundenlang. Oft war mir meine Tagebuch-Welt realer als die Welt in unserem Haus, in unserem Dorf. Ganz sicher war ich da kaum anders als diejenigen, die gern zum Golfspielen gehen oder sich stundenlang ausgefallene Kleider schneidern oder sich beim Aufbau ihrer elektrischen Eisenbahn gänzlich in der Zeit verlieren – zumindest glaubte ich das. Und dieses Tagebuchschreiben war mein absolutes Geheimnis, es war so geheim, dass weder Mama noch Emma wussten, was da wirklich mit mir, in mir geschah - das Diskutieren und so, ich denke, Sie verstehen. Tagebuchschreiben war das Abtauchen in eine Welt, die unendlich erschien. Fragen und Antworten, ganze Geschichten, die nur mir gehörten (und natürlich meinem Tagebuch).
Und wenn mir des Nachts, nach einer ausführlichen Diskussion mit meinem Tagebuch, nach etwas Süßem war, nach einem Schokopudding zum Beispiel, oder wenn ich schlecht geträumt hatte, dann rief ich nach Emma – nicht zu laut natürlich, Mama wollte ich auf keinen Fall wecken - oder klopfte an die Wand (wir hatten jede unser eigenes Zimmer. Das Haus war ja groß genug). Stets kam Emma dann gelaufen und holte mir, dem Küken, etwas Süßes aus der Küche oder schüttelte mir das Bett frisch auf oder hielt mir einfach nur die Hand. Aus Dankbarkeit lächelte ich am nächsten Tag stets ein paar Mal in ihre Richtung. Nur selten sah sie das, sie hatte einfach zu viel zu tun.
Mama leistete mir tagsüber bei meinen vielen wichtigen und unwichtigen Dingen gern und oft Gesellschaft. Außer natürlich beim Schreiben meines Tagebuchs, da musste ich unbedingt allein sein.
Emma leistete uns nie Gesellschaft. Ihr Tagespensum gab die Zeit für längere Unterbrechungen einfach nicht her. Nicht selten kam sie erst nach Mitternacht zur Ruhe.
Nun aber zurück zu dem Tag, an dem sich unser Leben gänzlich änderte. Es war ein Freitag, mitten im Juli. Zwei Tage zuvor hatten die Sommerferien begonnen. Ich und Emma hatten die neunte Klasse erfolgreich hinter uns gebracht (Emma etwas besser als ich – Streberin!). Verreisen wollten wir nicht, vielleicht am Ende der Ferien eine Woche. Aber wohin? Das wussten wir noch nicht. Ich und Mama waren da sehr spontan. Letztlich wohnten wir in einer Gegend, in der andere Menschen furchtbar gern Ferien machten (wie bereits erwähnt und beschrieben).
»Wozu wegfahren, wenn uns das Paradies auf Erden praktisch umschließt«, sagte Mama oft zu Beginn der Ferien.
Und sie hatte natürlich recht. Durch das Panoramafenster im Wohnzimmer hatten wir einen fantastischen Blick auf den See mit den Alpen im Hintergrund. Drei, vier Segelboote standen (an diesem Tag, mitten im Juli) mehr, als dass sie sich bewegten. Viel Wind strich nicht über den See. Anfängern gefiel das, die besseren Segler warteten sicherlich auf eine Brise, gar auf einen wirklichen Wind, der aber wohl leider nicht angekündigt war und auch nicht spontan kommen würde. Schräg rechts, am dortigen Ende des Sees, lag die erste größere Ortschaft - mit etwa 12.000 Einwohnern -, die ich und Mama gern aufsuchten, um in den Fußgängergassen zu shoppen oder einfach nur, um rumzubummeln.
An diesem Freitag war uns aber nicht nach rumbummeln zumute, wir beide wollten einfach nur chillen. Übrigens, Mama musste nicht arbeiten gehen, unser Erzeuger überwies jeden Monat einen Batzen Geld, der locker für einen ganzen Monat reichte. Wir waren auch nicht sehr anspruchsvoll. Neue Schuhe und Klamotten gab es nicht jeden Monat. Wir bestellten das eine oder andere im Internet. Vielleicht zweimal, allerhöchstens dreimal in der Woche hielt der Paketdienst vor unserer Tür. Die großen Pakete waren dann meistens für mich (Schuhe, Hüte und so weiter – was ich halt so brauchte oder zumindest mal ausprobieren wollte – ich probierte viel aus), manchmal auch für Mama; und die kleinen Pakete, die mit den Büchern, waren meistens für Emma. Sie las viel, Biografien – Sauerbruch, Freud, Jung und andere Meister ihres ziemlich merkwürdigen Fachs -, selten, ganz, ganz selten einen Roman und dann war der auch nur eine Biografie in Romanform. Aber wann sie das tat, das Lesen, das war uns, mir und Mama, ein Rätsel. Doch wir fragten nicht nach, wir ließen Emma auch da lieber in Ruhe.
Und an diesem Freitag saßen ich und Mama auf der Couch, die Beine weit von uns gestreckt, tranken Cola, aßen Muffins, die Emma eine Stunde vorher für uns gebacken hatte (Emma konnte fantastisch backen, das sagten wir ihr bald jeden Tag. Sie beantwortete unsere Freundlichkeit oft nur mit einem fragenden Blick. Weiß der Teufel, was sie sich dabei gedacht hat) und sahen einen Film. Mamma Mia. Ein Klassiker. Sicherlich die achte oder neunte Wiederholung. Egal. Einfach nur wunderschön anzusehen. Und wir sangen mit, ich und Mama – sämtliche Lieder. Natürlich wollten wir dabei nicht gestört werden. Aber was nutzen die deutlichsten Worte, die ausdrücklichsten Hinweise, wenn sie nicht beachtet werden?
Unter Missachtung unseres Bedürfnisses nach Ruhe kam Emma gegen Nachmittag (es war, um genau zu sein, kurz nach drei Uhr) aufgeregt ins Wohnzimmer gelaufen. Und mit zittriger Stimme sagte sie:
»Wir haben kein Wasser. Im ganzen Dorf gibt es kein Wasser. Ich hab eben mit Gerd telefoniert. Niemand kennt den genauen Grund. Angeblich hat ein Bagger bei irgendwelchen Aushubarbeiten die Hauptwasserleitung beschädigt, sagte Gerd. Aber Genaueres ist ihm auch nicht bekannt.«
Gerd ist der Nachbarssohn (nicht der Sohn von Doro, nein, er ist der Sohn von Maria, unserer anderen Nachbarin - links von uns), und er war in Emma verknallt, hatte ich damals geglaubt - zumindest war er ihr ständig hinterhergelaufen.
Gerd war zwei Finger breit kleiner als Emma. Nun ja, wo die Liebe hinfällt. Emma hatte damals wohl auch ein Auge auf ihn geworfen.
Übrigens, in unserem Dorf gab es keinen, der mir gefiel.
Dorfjunge? Phh!
Ich wollte später, wenn die Zeit reif sein würde, sowieso in die Stadt ziehen, womit ich nicht an diesen 12.000-Seelen-Ort am Ende des Sees gedacht hatte, nein, ich hatte bei diesem Gedanken eine richtige Stadt vor Augen. Und dort wollte ich mir einen aussuchen, einen, der mir gefiel, einen echten Stadtjungen, der dann mindestens einen halben Kopf größer sein würde als ich. Aber das alles erst später, denn noch war ich mit meinem Leben hier in unserem Dorf und in unserer kleinen Familie sehr zufrieden. Und natürlich konnte ich Mama nicht allein lassen. Mama allein im Dorf, was für eine schreckliche Vorstellung. Ja, so war ich auch, voll empathischer Gefühle (wenn es darauf ankam). Und by-the-way hatte das Bleiben auch noch andere nicht unwesentliche Gründe: Ich ging noch zur Schule (Abi war geplant), und ich war ja auch noch keine achtzehn Jahre alt.
Aber zurück.
»Und nun?«, fragte Mama meine »große« Schwester.
»Ohne Wasser kann ich den Flur nicht wischen, was ich gerade machen wollte oder später kochen. Auch ist der Geschirrspüler voll. Ich wollte ihn noch vor dem Wischen anschmeißen. Aber ohne Wasser ... das geht nicht.«
Manchmal war Emma schon ziemlich kompliziert und wie bereits erwähnt dann auch viel, viel »kleiner« als ich. Und so nebenbei steckte sie uns durch ihre Ausführungen, was sie gleich alles nicht tun konnte, obwohl sie es vorgehabt hat. Ich sage nur: Fishing for Compliments. Ganz schön ausgebufft.
Dass sie dann natürlich nicht auf das Naheliegendste kam, war nicht verwunderlich. Ich und Mama erkannten das sofort, und wie aus einem Mund sagten wir:
»Dann setz dich auf dein Fahrrad und fahr ins Dorf, zum Krämer. Und hol dort ein, zwei Wasserträger. Darauf hättest du aber auch allein kommen können.«
»Bin ich auch. Aber Gerd sagt, da ist alles schon ausverkauft. Erst hinten in der Stadt soll es wohl noch Wasser geben. Aber gewiss ist auch das nicht.«
»Dann geh zum Brunnen und spül wenigstens das ab, was wir heute noch benötigen. Morgen wird der Spuk ja wohl wieder vorbei sein.«
»Ja, ist gut, Mama. Mach ich.«
Kleinlaut zog Emma davon.
Ich und Mama sahen uns an und schüttelten nur den Kopf.
»Die kleinste Kleinigkeit, die ein Stück vom Normalen abweicht. Mein Gott, wie wird das nur mal mit ihr enden?«, sagte Mama sehr nachdenklich.
»Noch sind wir ja für sie da, Mama.«
»Stimmt, mein Liebling«, sagte sie, lächelte und gab mir einen Kuss auf die Hand, die eben nach einem weiteren Muffin griff.
Mehr war nicht nötig, wir verstanden uns einfach – ich und Mama.
Ich drückte auf die Play-Taste, biss in den Muffin und kuschelte mich an Mama an, und sie strich mir liebevoll über die Wange. Ich liebte es, wenn Mama mir über die Wange strich, dann wusste ich, mein Leben war wirklich gut. Mein Augenstern hätte mein Leben in diesem Moment perfekt gemacht. Aber ich wollte nicht undankbar sein.
Minuten später, das Happy End (Sie erinnern sich: Mamma Mia) stand kurz bevor, kam Emma erneut reingerannt. Jetzt war sie blass, leichenblass, und sie zitterte am ganzen Körper. Was war nun wieder passiert?
Sie öffnete den Mund und schluckte drei, vier Mal. Sie schluckte wie ein Fisch auf dem Trocknen. Einen zusammenhängenden Satz brachte sie nicht zustande.
»Etwas Schreckliches, Mama ... es ist ... der goldene Löffel ... ich ... ich war vorsichtig, sehr vorsichtig ... glaube mir ... aber ... ich kann nichts dafür ... bitte, Mama ... ich war vorsichtig.«
»Wofür kannst du nichts?«, fragte Mama mit unheilschwangerer Stimme. Sie hatte sich ein wenig aufgerichtet, sie schien etwas zu ahnen, etwas Schreckliches.
»Er ist mir aus der Hand ... gerutscht.«
»Na gut, dann heb ihn einfach wieder auf«, sagte Mama versucht nebensächlich, doch in ihrer Stimme lag dieses zittrige Lauern, das wir kannten, das wir mehr fürchteten als sonst etwas, es war das Lauern, dass es stets kurz vor einer furchtbaren Explosion gab (wozu sich Mama nur selten hinreißen ließ). Mama schien wohl genau zu wissen, was da eben passiert war, wollte es aber noch nicht wahrhaben.
»Das geht nicht«, sagte Emma kaum vernehmbar.
»Und ... warum nicht?«
»Er ist ... er ist ...« Emma senkte den Kopf und schwieg.
»Etwa im Brunnen?«
Mit gesenktem Kopf nickte Emma kaum erkennbar und sie begann zu heulen, bitterlich zu heulen. Wenn sie Mist gebaut hatte, heulte sie stets bitterlich. So war sie eben, mädchenhaft, verzagt, keinen Arsch in der Hose, kurz gesagt: Sie war ein Weichei.
»Und du bist natürlich gänzlich schuldlos?«
Und ihre Antwort: Tränen und Schluchzen, jammervolles Schluchzen. Und darin war sie perfekt. Manchmal schluchzte sie sogar trocken – ohne Tränen. Perfekt! Und ganz ehrlich? Um dieses trockene Schluchzen beneidete ich sie sogar ein wenig. So bekam ich das nie hin – heute noch nicht. Das mit den Tränen ist ätzend, aber das trockene Schluchzen, das hat so was Weltuntergangmäßiges. Absolut perfekt.
Aber zurück.
Das mit dem goldenen Löffel war natürlich ganz übel. Mama hatte ihn geerbt. Von ihrer Mama. Und die von ihrer Mama. Und die von ... Bis wohin dieses Erbe zurückreichte, war heute nicht mehr bekannt. Anfänglich sollen es wohl mal sechs Löffel gewesen sein. Obwohl sie jeweils wie der Augapfel gehütet worden waren, gingen fünf von ihnen verloren. Und jetzt sollte es keinen mehr geben? Nein, das ging gar nicht.
»Dann hops in den Brunnen und hol ihn raus«, schrie Mama meine »große« Schwester an und sprang dabei hoch. Emma wich zurück und hob unbewusst einen Arm. Sie glaubte wohl, Mama würde ihr noch zusätzlich eine knallen. Das tat sie natürlich nicht, das hat sie noch nie gemacht. Mama nie. Ich hatte meiner »großen« Schwester ab und an schon mal eine geknallt. Das ist wohl wahr. Meistens hatte sie es auch verdient. Zwei Mal hatte sie versucht, mein Zimmer, »den Saustall«, wie sie meine Ordnung stets nannte, aufzuräumen, hatte versucht, alles »sinnvoll« zu ordnen, besser gesagt, war dabei, meine Ordnung, die sie nicht verstanden hatte, durcheinanderzubringen. Da hatte es geknallt. Anders war sie nicht zu stoppen gewesen. Ehrlich.
Aber hier? Das war eine Sache zwischen ihr und Mama. Hier hielt ich mich raus, zumal uns beiden, mir und Emma, klar war, dass, so wie Mama es gesagt (geschrien) hatte, so unglaublich böse, sie es genau so gemeint hat. »Dann hops in den Brunnen.«
Was für ein hübsches Wort, dieses Hopsen, verbunden mit so einer entsetzlichen Vorstellung: In den Brunnen hopsen und nach einem goldenen Löffel suchen - tauchen. Den würde sie doch nie wiederfinden. Nie. Aber Strafe musste sein. Die Frage war nur: Wie lange würde Mama sie sinnlos suchen - tauchen lassen? Drei Tage? Vier Tage? Nein, ganz bestimmt nicht, eher nur bis zum späten Nachmittag. Das war dann wohl Strafe genug. Zumal sie mich ja wohl nicht mitbestrafen wollte. Kein Abendessen wäre eine Strafe gewesen, die ich nicht verdient hätte.
Hab ich etwa den Löffel in den Brunnen fallen lassen?
Nein.
Ich war schuldlos – unschuldig. Aber so war Mama auch nicht, sie konnte unterscheiden.
Das hier war Emmas Party.
Mama war mir gegenüber nicht oft streng, aber wenn doch, dann half mir nicht einmal mein »trauriges« Gesicht. Und aufstampfen wagte ich dann auch nicht - nicht bei Mama (da bin ich ehrlich). Und das trockene Schluchzen hatte ich nicht so gut drauf, um es in einem solchen Moment als empfundenen Weltschmerz anwenden zu können. Aber wie gesagt, das hier, das war glücklicherweise nicht meine Party.
»Ich soll ...?«, sagte Emma ungläubig und kleinlaut.
»Ja. Natürlich sollst du. Zieh dir deinen Badeanzug an und tauche danach. So tief ist der Brunnen ja nicht. Und es ist ja auch nicht kalt draußen. Und eines sage ich dir, solltest du Gerd darum bitten, es für dich zu tun, dann sind wir geschiedene Leute. Und du weißt, was das bedeutet. Also ab marsch. Und trödel nicht herum. Unser Abendessen macht sich nicht von allein.«
Weder ich, noch Emma wussten, was das bedeutete (geschiedene Leute). Aber wie Mama es sagte (stets in solchen Momenten), hieß es nichts Gutes – eher im Gegenteil. Und dieses Gegenteil wollten wir uns nicht ausmalen, ich und Emma. Niemals.
Entsetzt schlich Emma davon.
Tat sie mir leid? Vielleicht ein wenig.
Hätte ich gewusst, wie sehr sich mein Leben heute noch ändern sollte, hätte ich mir sicherlich eher selbst leidgetan.
Sehr sogar!
Emma bringt alles durcheinander
Der frühe Abend nahte. Ich und Mama bekamen langsam Hunger. Vor etwa zwei Stunden war Emma mit gesenktem Kopf zum Brunnen geschlichen. Ich hatte sie durchs Fenster gesehen, gerade als ich die CD gewechselt hatte (Schlaflos in Seattle – auch ein schöner Klassiker). Emma hatte sich tatsächlich ihren Badeanzug angezogen, diesen ekelhaft rosaroten Einteiler mit den schwimmenden Schildkröten in Südseegefilden. Emma ist wirklich noch ein Mädchen, hatte ich noch gedacht und angewidert den Kopf geschüttelt. Ich hatte mir vor Wochen einen schwarzen Einteiler gegönnt, einen, wie ihn Schauspielerinnen und andere Künstlerinnen gern tragen, um sich darin ablichten zu lassen, sehr sportlich, sehr sexy – leider zu sexy. »Den bekommst du wieder, wenn du achtzehn bist und oben herum alles dir selbst gehört«, hatte Mama gesagt. Sie hatte mich erwischt. Vor dem Spiegel. Ich hatte mir den Busen beträchtlich aufgepolstert – zu beträchtlich, hatte ich noch gedacht und wollte gerade ... und ausgerechnet da war Mama ins Bad gekommen. Auch waren ihrer Ansicht nach die Beine zu hoch ausgeschnitten – einfach zu sexy. Ärgerlich, sehr ärgerlich. Zurückschicken ging glücklicherweise nicht mehr, ich hatte ihn nackt anprobiert. Da war Mama sehr pingelig. Aber zur Strafe (das hatte ich mir geschworen) würde ich - bis der Badeanzug endlich mir gehörte - nicht mit ihr und Emma zum Schwimmen gehen.
Das hatte Mama nun davon. Aber das nur am Rande.
Jetzt aber weiter.
Nun war auch dieser Film (Schlaflos in Seattle) an seinem Happy End angekommen. Ende. Aus. Und augenblicklich war es ruhig. Im ganzen Haus.
Wir horchten in die Stille.
Nichts.
Emma machte bei ihren häuslichen Arbeiten schon lange kein wirkliches Gepolter mehr. Wir hatten oft, sehr oft(!) darauf hinweisen müssen, bis sie das endlich begriffen hatte. Das hatte gedauert, das kann ich Ihnen sagen. Aber ganz lautlos war ihr Arbeiten natürlich nicht möglich. Dafür hatten wir ja auch volles Verständnis. Allein, wenn sie zum Beispiel im Obergeschoss den Flur und Mamas Zimmer durchsaugte und dabei kratzend über die eine oder andere Holzdiele fuhr oder wenn sie in der Küche einen Topf hervorkramte, schepperte sie oft unnötigerweise mit dem Deckel. Zeit dafür wäre jetzt ja auch gewesen, nicht unbedingt für das Deckelscheppern, nein, für das Kochen, wenn das Essen nicht zu spät auf den Tisch stehen sollte. Und spät essen, das wusste Emma genau, das mochten wir nicht.
Aber?
Nichts!
Es war mucksmäuschenstill.
Mama wirkte ratlos. Sollte Emma tatsächlich noch immer im Brunnen nach dem Löffel tauchen?, schien sie sich zu fragen.
»Dieses dumme Ding. Am Ende taucht sie noch immer nach diesem vermaledeien Löffel.«
Da! Wie ich´s mir gedacht hatte. Ich kenne doch meine Mama.
Und wieder horchten wir.
Nichts!
Mama sah mich fragend an.
»Sag, mein Schatz, war ich zu streng zu deiner Schwester?«
Mein Schatz! Ich schloss die Augen, und einen Moment war ich selig. Mein Schatz hatte Mama gesagt. Mein Schatz. Das klang beinahe so schön wie Mein Augenstern.
»Mia, hörst du mir zu?«
»Ja doch, Mama. Nein, du warst nicht zu streng zu ihr. Du sagst doch immer: ›Strafe muss sein‹.«
Mama stimmte meinen Worten kopfnickend und mit nachdenklich zusammengeschobenen Augenbrauen zu. Sie stand auf, ging zur Tür, öffnete sie und rief ins mucksmäuschenstille (was für ein hinreißend schönes Wort) Haus:
»Emma, wo bist du? Wir haben Hunger.«
Keine Antwort. Alles blieb ruhig.
Mama sah mich fragend an. Ich zuckte nur die Achseln. Ich hatte noch nie etwas aus einem Brunnen hochgeholt, ich hatte da keine Erfahrung. Und ich wollte mich auch nicht weiter dazu äußern. Wie gesagt, ich hatte da eine gänzlich andere Einschätzung. Der goldene Löffel war futsch. Auf immer und ewig. Punkt. Machte dieser Umstand unser Leben ärmer? Ganz sicher nicht. Dann würde meine »große« Schwester eben keinen goldenen Löffel erben. Ich war dafür sowieso nicht vorgesehen (Sie wissen schon, die acht Minuten und so).
»Wollen wir mal gucken gehen?«
»Ach, ich weiß nicht, Mama. Ist nicht noch was im Kühlschrank?«, sagte ich so als Ablenkung. Der Muffin-Teller war leider leer.
»Müsste ich nachsehen.«
»Machst du das, Mama. Ich leg in der Zwischenzeit einen neuen Film ein. Was hältst du von Love Story?«
Mama hörte kaum zu, sie schien mit ihren Gedanken offensichtlich bei Emma zu sein.
»Ehrlich, Mama, Emma wird ganz sicher nicht ertrunken sein. Sie ist eine gute Schwimmerin und sooo tief ist der Brunnen ja nun auch nicht. Und ihre Koffer wird sie wohl auch kaum gepackt haben. Dafür ist sie viel zu feige. Und wo sollte sie auch hin? Vielleicht ist sie ja gerade in ihrem Zimmer und zieht sich um. Willst du da mal nach ihr sehen?«
Mama schüttelte den Kopf.
»Genau, Mama. Vielleicht ist sie heute ja besonders leise und will uns mit einem vorzüglichen Abendbrot überraschen und sich auf diese Weise entschuldigen. Ich denke, wir sollten ihr die Vorfreude darauf nicht nehmen. Dann hat sich das mit dem Kühlschrank auch erst mal erledigt. Bitte, Mama, komm wieder her.«
Ich klopfte mit der flachen Hand auf den Platz neben mir. Der war sogar noch lauwarm.
Mama lächelte. Nun gut, es war mehr so ein zögerliches Lächeln, das nur einen Mundwinkel erreichte, aber immerhin.
»Na gut, dann warten wir noch eine halbe Stunde.«
»Genau Mama. Lass uns endlich Lovestory ansehen, zumindest den Anfang.«
Mama blickte auf den leeren Bildschirm. Und schließlich sagte sie:
»Nein, bitte nicht Love Story. Da ist das Ende so traurig.«
Endlich, Mama war zurück. Ihre Gedanken und Aufmerksamkeit galten wieder unserer so vertrauten Zweisamkeit.
»Na gut, Mama. Und was ist mit Notting Hill?«
»Notting Hill wäre toll«, sagte sie mit einem so vollen Lächeln, das mir stets das Herz erwärmte.
Mama war damals etwas über vierzig, knapp zweiundvierzig Jahre alt, um genau zu sein, und nicht mehr ganz so schlank wie noch Jahre zuvor, aber das stand ihr. Wir, ich und Emma, waren zu der Zeit bereits zwei, drei Zentimeter größer als Mama. Ihr hellblondes Haar trug Mama bald immer hochgesteckt. Sie hatte zwei schreckliche Wirbel, einen links neben dem Ohr und den anderen hinten in der Mitte am Haaransatz - beide bekam sie nicht in den Griff. Weder mir noch Emma fielen diese Wirbel sonderlich auf (wenn Mama ihr Haar schon mal offen trug), aber was hieß das schon. Wir liebten unsere Mama, und mit den Augen der Liebe betrachtet man Menschen eh ganz anders (ganz schön schmalzig, oder? Ich denke, ich werde diesen Satz wieder löschen. Später. Oder auch nicht). Sicherlich, wie bereits erwähnt, war Mama nicht mehr ganz so schlank, aber mit zweiundvierzig hätte ich auch gern ihre Figur. Und dieses Lächeln, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, es war das Lächeln von Julia Roberts.