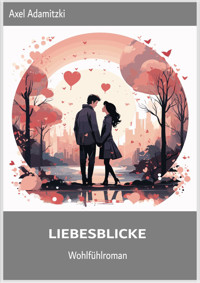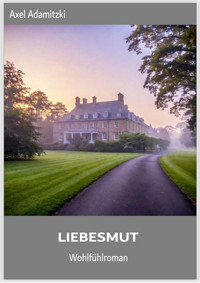1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Silvana Larbang, eine junge Frau unserer Zeit, ist erfüllt mit übersinnlichen Fähigkeiten, die es ihr ermöglichen, lebenden und auch verstorbenen Seelen zu helfen. Darüber hinaus ist es ihr sogar möglich, Seelen zu erlösen. Doch noch ist sie sich dieser unvergleichlichen und verantwortungsvollen Veranlagungen nicht bewusst. Erst der schreckliche und viel zu frühe Tod ihrer besten Freundin Melissa lässt all das langsam erwachen. Mühsam, Schritt für Schritt, betritt sie sodann ihren wahren, tief in ihr ruhenden, Lebensweg, der voller Träume, Selbstzweifel und Überraschungen ist. All das ereignet sich vor dem Hintergrund eines bürgerlichen Lebens, dem Silvana und Melissa entstammen, und einer Welt des egoistisch blasierten Adels, in die Silvanas verstorbene Freundin aus Liebe eingeheiratet hatte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
SEELENFEE - BUCH EINS
Mystischer Roman
Werde, der du bist.
(Friedrich Nietzsche)
Beschreibung
Silvana Larbang, eine junge Frau unserer Zeit, ist erfüllt mit übersinnlichen Fähigkeiten, die es ihr ermöglichen, lebenden und auch verstorbenen Seelen zu helfen. Darüber hinaus ist es ihr sogar möglich, Seelen zu erlösen. Doch noch ist sie sich dieser unvergleichlichen und verantwortungsvollen Veranlagungen nicht bewusst. Erst der schreckliche und viel zu frühe Tod ihrer besten Freundin Melissa lässt all das langsam erwachen. Mühsam, Schritt für Schritt, betritt sie sodann ihren wahren, tief in ihr ruhenden, Lebensweg, der voller Träume, Selbstzweifel und Überraschungen ist.
All das ereignet sich vor dem Hintergrund eines bürgerlichen Lebens, dem Silvana und Melissa entstammen, und einer Welt des egoistisch blasierten Adels, in die Silvanas verstorbene Freundin aus Liebe eingeheiratet hatte.
Buch 1 von 4
1 – Ich bin barfuß und …
… stehe auf einer Blumenwiese. Ich hebe die Arme und betrachte die Ärmel meines weiten, langen Sommerkleides. Es schmeichelt meinem vollschlanken Körper, der nackt darunter atmet. Seit wann besitze ich ein solches Kleid? Es gefällt mir.
Ich lasse die Arme sinken und sehe mich um.
Vor mir, weit hinten am Horizont, erhebt sich ein Gebirge. Die Bergspitzen liegen versteckt unter ewigem Schnee. Hier, auf der Wiese, ist es sommerlich mild. Die Sonne steht schräg hinter mir und wärmt mich. Ich werfe einen langen Schatten, der beinahe bis ans Ende der Wiese reicht.
In aller Ruhe gehe ich los, Schritt für Schritt, ohne Ziel, wie mir scheint. Nein, ich folge einer merkwürdig unbekannten inneren Eingebung. Sie durchströmt mich ohne Unterlass.
Plötzlich … ein Schrei hallt durch die Luft. Ich zucke zusammen.
»Hilf mir, Silv. Komm her und hilf mir.«
Vor mir, irgendwo vor mir oder unter mir … eine Stimme … ja, unter mir, als würde sie aus dem Erdboden kommen und nach mir rufen.
Aufgeschreckt sehe ich mich um und blicke nach unten. Ich bin mir sicher, diese Stimme zu kennen. Aber kann das sein? Ruft hier Melissa, meine beste Freundin, nach mir?
Doch warum? Und wo ist sie?
Vorsichtig öffne ich den Mund. Ich muss ihr antworten. Und ich stoße ein paar Worte in den menschenleeren Landstrich: »Bist du das, Mel? Wo … wo finde ich dich?«
»Ja, Silv, ich bin es, Mel. Komm. Zehn, zwölf Schritte noch. Hilf mir. Bitte!«
Tatsächlich, die Stimme meiner Freundin. Und … Mel braucht mich.
Rasch springe ich ein paar Schritte vor und bleibe an einer steilen Kante stehen. Ich bin mir sicher, eben war sie noch nicht da.
Vor mir erstreckt sich eine weite und tiefe Schlucht. Vorsichtig sehe ich nach unten. An einem Ast, der eine Armlänge unter mir seitlich aus dem Boden ragt, hält Mel sich mit der rechten Hand krampfhaft fest. Im linken Arm wiegt sie ein in weiße Tücher gewickeltes Baby.
»Hilf mir, Silv.«
»Um Gottes willen, Mel! Bleib ganz ruhig. Ich komme«, schreie ich, falle auf die Knie, auf den Bauch und reiche meiner Freundin die Hand.
»Ruhig, Mel«, rufe ich. »Ich hab dich. Ich ziehe dich hoch. Wir schaffen das, Mel.«
»Nein, Silv, bitte, nimm erst mein Baby.«
»Ja, gib es mir. Aber halte durch.«
Melissa reicht mir das Kleine. Es hat die Augen geschlossen, ist vollkommen ungerührt – es scheint zu schlafen. Vorsichtig lege ich es neben mich auf die Blumenwiese und greife dann rasch und entschieden nach der Hand meiner Freundin.
Geschafft, denke ich. Gleich wird alles gut …
Doch in dem Moment, als ich Melissa hochziehen will, lockert sich der Griff, entgleitet mir meine Freundin und … ein Nachfassen ist unmöglich. Erschrocken sehe ich sie an. Erst jetzt bemerke ich, dass sie nackt ist und es keine Möglichkeit gibt, sie irgendwo anders … Auch scheint es dafür zu spät zu sein. Melissa rutscht.
»Mel, reich mir deine andere Hand«, schreie ich sie an. Ich will nicht glauben, was da passiert.
Merkwürdig in sich ruhend blickt meine Freundin mich an, und sie schüttelt nur den Kopf.
Ich verstehe sie nicht. »Mel, Mel, was passiert hier?«, rufe ich entsetzt.
»Pass auf mein Kind auf, versprich mir das, Silv. Pass auf mein Kind auf.«
»Ja natürlich, aber …«
»Versprich es mir!«
»Ich verspreche es, Mel! Aber … du musst … für dein Baby …«
»Leb wohl, Silv.«
»Nein, Mel. Nein!« Fassungslos blicke ich meine Freundin an, die völlig besonnen scheint, mich sogar anlächelt.
Und dann geschieht es: Melissa rutscht … Meine Hände greifen ins Leere.
»Nein, Mel, nein!«, schreie ich erneut … verzagt und hilflos.
Doch es gibt kein Zurück. Melissa fällt, anfänglich gelassen davonschleichend. Aus scheinbar wunschlosen Augen sieht sie mich an und lächelt noch immer.
Eine letzte Frage gibt es dann doch noch: »Warum ich, Mel? Warum ich?«
»Weil nur du es kannst.«
Und endlich schließt sie die Augen, und ihr Körper verliert sich sogleich in der Tiefe der Schlucht.
Und ich schreie … und schreie …
Sie erwachte, hochgeschreckt vom eigenen Schrei, der sich aus der Tiefe ihrer Seele gelöst hatte und sie jetzt angstvoll und entsetzt, festgekrallt irgendwo an der Wand in der dunkelsten Ecke ihres Schlafzimmers, anstarrte. Wieder einmal. Es war grauenvoll.
Sie erhob sich und schwang die Füße aus dem Bett, die sogleich Halt suchend auf dem Boden aufkamen. Und endlich spürte sie es wieder: das wirkliche Leben. Unablässig strömte es vom Boden durch die Fußsohlen in sie hinein, verteilte sich wie ein warmer Hauch in den Beinen, stieg höher, in den Bauch, in die Brust und erreichte bald schon ihre Gedanken – und ließ sie ruhig werden.
Die surreale Welt dieses schauderhaften Traumes lag hinter ihr. Wieder einmal. Für den Moment.
Seit vielen Jahren, seit ihrer Kindheit, seit sie gesehen hatte, wie erschrocken ihre Mutter auf ihre Träume reagiert hatte, hatte sie keinen solchen Traum mehr durchlebt – zumindest konnte und wollte sie sich nicht daran erinnern. Sie hasste es, dass ihre Mutter vor ihr, vor dem, was sie nach solchen Träumen gesagt und erzählt hat, zurückschreckte. Ihr Sehnen galt der Liebe der Mutter.
Deshalb drängte sie als Kind schon all ihre Träume in ein »finsteres Loch«, wie sie es sich heimlich einredete. Etwas, das ihr anfänglich entsetzlich schwerfiel.
Sicherlich waren Träume auch eine Art Wirklichkeit … eine Art zweite Wirklichkeit. Für Silvana waren sie aber schon immer mehr. Fluch und Segen zugleich. Leider. Sie suchte sich das nicht aus … es war in ihr. Andere Menschen können, ohne zu wissen, warum, schnell rennen oder erlernen in zwei Wochen das Klavierspielen. Oder sie sind in der Lage, herrliche Torten zu kreieren, ohne je ein Rezept gelesen zu haben.
Silvana träumte. Nicht wie andere. Neben ihren eigenen Träumen gab es da Bilder oder gar Visionen von Aufgaben in ihrer näheren Zukunft. Verschlüsselt natürlich. Aber Träume waren ja beinahe immer verschlüsselt. Auch träumte sie von der Vergangenheit anderer Menschen, ohne je dabei gewesen zu sein. Diese Träume waren dann undeutlicher. Realität und Illusion vermischten sich. Und immer waren es Botschaften, Hilferufe oder eben Dinge, die sie zu meistern hatte.
Nicht jede Botschaft verstand sie, und nicht zu jeder bekam sie einen Zugang. Vieles von dem Genannten ruhte noch gänzlich unberührt in ihr, wollte erst noch geweckt werden.
Diesen heutigen Traum aber, in seinem ganzen Ausmaß leider nicht zu verdrängen, glaubte sie, zu verstehen. Vielleicht nicht gänzlich. »Weil nur du es kannst«, verstand sie nicht, sollte sie auch noch lange nicht verstehen.
Der Traum war eine Aufgabe und ein Fluch zugleich. Seit letztem Freitag, dem Tag der tragischen Entbindung, verfolgte er sie.
Und er ließ sie erstarren. Immer wieder. Bei Tag und bei Nacht kam er über sie, wann immer er es wollte, ob in der Ruhe des Tiefschlafs oder profan im Auto an einer roten Ampel – oder gar mitten in einem Gespräch. Und der Traum ließ sie bis heute nicht los.
Silvana stand auf, sie musste los. Mel, Melissa, ihre beste Freundin lebte – wahrhaftig – nicht mehr.
Was für ein Unglück!
2 – Langsam, als wehrte er sich …
… gegen die herannahende Endgültigkeit, senkte sich der Eichensarg, Handbreite um Handbreite, in die für ihn auserwählte Grube.
Die weißen und roten Rosen, die den schwarz lackierten Deckel bedeckten, atmeten ein letztes Mal die spätherbstliche Frische, ließen einen letzten Blick auf ihre Schönheit zu. Auf die roten Rosen hatte er ausdrücklich bestanden, gegen die weißen hatte er sich nicht gewehrt.
Ohne es zu verstehen, vernahm Raymond-Lazare Landgraf zu Sipplingsberg den unwiderruflichen Abschied von seiner Frau … Melissa.
Versteinert und blass, um Jahre gealtert, stand der Einunddreißigjährige, umringt von Familie und Dorfbewohnern, von weitläufigen Bekannten und seinen Angestellten an der Familiengruft derer zu Sipplingsberg und schüttelte innerlich den Kopf. Mit siebenundzwanzig stirbt man doch noch nicht, schrie es in ihm. Mit siebenundzwanzig … noch nicht!
Dennoch, seine Liebe war tot, verstorben, als sie … Seine Gedanken rutschten ab.
Melissa bestand auf einer Hausgeburt, freute sich unsagbar darauf, steckte ihn mit ihrer überschwänglichen Vorfreude auf ihr erstes Kind, eine Tochter, jeden Tag aufs Neue an.
Nichts, so schien es bis zum Schluss, sprach gegen eine Geburt im Landhaus.
»Sie sind gesund, Ihre Tochter ist gesund, und Ihr Gatte … um den kümmert sich im Zweifelsfall eine Schwester«, schoben der Arzt und die Hebamme die Ängste und Zweifel immer wieder mit nüchterner Zuversicht und einem Lächeln zur Seite.
Die Komplikationen seien nicht vorhersehbar gewesen. Und als sie dann eintraten … sei es zu spät gewesen … »Auch im Krankenhaus hätten die Ärzte nicht mehr tun können«, versuchte Dr. Berthold anschließend, Raymonds Verzweiflung zu lindern.
Doch die Worte erreichten ihn nicht, drangen nicht bis zu seinem Schmerz vor, verloren sich irgendwo in einem Schleier der Fassungslosigkeit.
Er war bei der Geburt dabei, hielt seiner Frau die Hand, »presste mit« und war voller Zuversicht … bis Melissa drohte das Bewusstsein zu verlieren.
Noch bevor er begriff, was passierte, packte eine Schwester ihn vorsichtig bestimmend am Arm, geleitete ihn hinaus und blieb dann bei ihm; sicherlich auch, um zu verhindern, dass er kopflos und verwirrt das Schlafzimmer erneut betrat.
»Alles wird gut. Wir sind auch auf solche Schwierigkeiten vorbereitet. Jede Hausgeburt ist ein bisschen anders. Aber glauben Sie mir, alles geht seinen Weg«, sagte die Krankenschwester immer wieder und ließ ihn dabei nicht aus den Augen.
Doch nichts wurde gut.
Das Letzte, was er von Melissa vernahm, war ein durchdringender Aufschrei … der einem Hilferuf gleich durch das Gutshaus dröhnte … und ihre flehenden Worte: »Meine Tochter, rettet meine Tochter! Rettet mein Kind!«
»Eine Fruchtwasserembolie«, versuchte der Arzt Stunden später zu erklären. »Das war nicht vorhersehbar. Manchmal ist sie rechtzeitig genug erkennbar. Aber bei Ihrer Frau …« Er schüttelte bedauernd den Kopf. »Alles schien völlig normal.« Nachdenklich atmete er durch und fuhr dann dezent fort: »Es wird Sie nicht trösten, dennoch sollten Sie wissen, dass oft für beide, für Mutter und Kind, keine Chance besteht. Aber mitunter, wie hier, gibt es eine kleine Hoffnung … für … wenigstens einen. Und dann muss augenblicklich entschieden und auch gehandelt werden. Und Ihre Frau … sie hat entschieden. Sie wollte, dass in erster Linie … Ihre Tochter lebt. Und sie lebt, und sie ist kerngesund.«
Natürlich war das kein Trost gewesen, im Gegenteil, diese Worte – »Ihre Frau hat entschieden!« – waren ihr Todesurteil gewesen, von ihr selbst ausgesprochen … ohne ihn zu fragen.
Ohne mich zu fragen, hallte es ihm durch den Kopf.
Entrückt blickte Raymond-Lazare Landgraf zu Sipplingsberg auf die weißen und roten Rosen, die jetzt im Dunkel der Grube auf ihr Ende warteten. Er brachte es nicht über sich, eine Schaufel Sand auf den Sarg fallen zu lassen. Er wollte, dass dieser Albtraum endlich ein Ende fand. Er wollte aufwachen, Melissa in den Arm nehmen, ihr sagen, dass er sie liebte, ihr zuflüstern, dass sie sein Leben war, mit ihr lachen, mit ihr unbeschwert den Tag erleben, sie lieben, von ihr geliebt werden … All das wollte er …
… aber nicht jetzt eine Schaufel Sand auf ihren Sarg fallen lassen.
Nein, kein Abschied. Nicht für immer. Nicht heute. Vielleicht in fünfzig oder sechzig Jahren, aber nicht heute. Man stirbt nicht mit siebenundzwanzig.
Das Leben war ungerecht. Gott oder wer auch immer dafür verantwortlich war … er war ungerecht.
*
»Raymond, komm.«
Seine Mutter hakte sich schwerfällig und seltsam unbeholfen bei ihm ein – unbeholfen für sie, nicht für ihn, für ihn wäre ihre merkwürdige Zuneigung, wenn er darauf geachtet hätte, eher befremdlich gewesen –, und zog ihn zwei Schritte zur Seite, sodass die anderen Trauergäste nun auch Abschied nehmen konnten und anschließend, teilweise mit von Tränen verschmierten Gesichtern, teilweise mit Entsetzen im Blick, ihr Mitgefühl zum Ausdruck bringen konnten.
Raymond-Lazare ließ es geschehen, alles ließ er geschehen, bis Sibylle und Ingmar Scholz stumm vor ihm standen. Melissas Eltern. Aus toten Augen sahen sie ihn anklagend an. Hatten sie ihn überhaupt jemals angesehen? Er konnte sich nicht erinnern.
Sie hatten ihre Tochter verloren, ihr einziges Kind. Und Raymond-Lazare konnte es genau sehen: Sie machten ihn dafür verantwortlich. Er war schuld an allem. Nur er.
Sie waren mit ihm als Schwiegersohn nicht einverstanden gewesen. Nie hatten sie einen Hehl daraus gemacht. Robert Kleinert hätten sie gern an der Seite ihrer Tochter gesehen. Robert Kleinert, einen Zahnarzt. »Er wird dich auf Händen tragen«, hatten sie bis zum Schluss versucht, Melissa von der Heirat mit ihm – diesem Adligen – abzuhalten.
Doch ihre Tochter liebte ihn, nicht den Adligen, nur den Mann, den Mann Raymond – Ray nannte sie ihn liebevoll. All das versuchte sie, ihren Eltern deutlich zu machen. Doch sie verstanden sie nicht, wendeten sich enttäuscht ab.
Dem Anstand gehorchend kamen sie zur Hochzeit. Natürlich, man gab sich keine Blöße, man gab keinen Anlass für Geschwätz. Sie mieden aber danach jeglichen Kontakt. Melissa litt zutiefst darunter.
Die Schwangerschaft, die aufkommende Vorfreude auf das Kind, auf ihr erstes Enkelkind, brach das Eis ein wenig. Nach mehr als sechs Jahren gab es den ersten vorsichtigen Kontakt.
Aber jetzt … war sie tot. Ihre Tochter war tot. Mit siebenundzwanzig Jahre. Und er war schuld. Er, dieser Adlige.
All das las Raymond in ihren verzweifelten Augen, all das schrien ihm ihre Blicke kalt entgegen. Er fühlte sich hilflos.
Nie würden sie verstehen, dass sein Schmerz, der ihn beinahe zerriss, vielleicht ebenso groß war wie der ihre, und nie würden sie glauben, dass ihre Tochter es gewesen war, die diese schreckliche Entscheidung getroffen hatte, auch würden sie nie glauben, dass er diese Entscheidung niemals mitgetragen hätte.
Dennoch waren sie am Ende die Einzigen, die seinen Schmerz hätten nachempfinden können, wenn sie ihm diesen Schmerz zugestanden hätten. Sie hatten ihre Tochter, ihr Fleisch und Blut, verloren, er nur seine Frau, waren Gedanken, die ihnen ins Gesicht geschrieben standen.
Zittrig reichte er Sibylle Scholz die Hand. Worte kamen ihm nicht über die Lippen. Welche auch?
Sie sah ihn nur reglos an. Tot und kalt. Einen lang anhaltenden Moment.
Schließlich wendete sie sich ab, gestützt auf ihren Mann, der ebenfalls ohne versöhnliche Geste blieb. Und mit schleppenden Schritten gingen sie los, verließen sie den Friedhof – ohne Blick zurück.
Was für eine Anklage. Und was für ein Urteil, das sich zusätzlich bleiern auf seine Trauer legte.
*
Eine halbe Stunde später stand nur noch der engste Familienkreis am Grab zusammen. Seine Mutter, Fürstin von Brammen, sein Stiefvater, Fürst von Brammen, seine ältere Schwester Helen-Luciana, Gräfin von Hohenbrugg, mit ihrem Gatten und auch Silvana Larbang, die beste Freundin seiner verstorbenen Frau. Obwohl Silvana nach Meinung seiner Familie nicht hierhergehörte, wurde sie am heutigen Tag für Stunden in ihrer Mitte geduldet.
Raymond kannte Silvana kaum, im Grunde nur aus den überschwänglichen Schilderungen seiner Frau, und natürlich von der Hochzeit – sie war Melissas Trauzeugin gewesen –, doch selbst da hatten sie kaum ein Wort miteinander gewechselt; auch war sie erst vor zwei oder drei Wochen wieder hierher an den Bodensee zurückgekehrt. Mel hatte sich unsagbar darüber gefreut. Vielleicht war es ihm auch deshalb wichtig, sie heute hier, in seiner Nähe, in Mels »engster« Nähe zu wissen.
Alle schwiegen, achteten mit gesenktem Blick nur auf Raymond. Teilnahmsvoll, so schien es. Zutreffender wäre eine andere, nicht so freundliche Umschreibung gewesen. Denn tatsächlich ging es ihnen nur um den Schein, zumal sie Raymonds Frau nicht einmal ansatzweise gekannt hatten, nie hatten kennenlernen wollen. Einen vorsichtigen Versuch, diese »Liaison« zu hintertreiben, die in ihren Augen keine wirkliche Liebe sein konnte, hatte Raymond rasch und vehement unterbunden.
»Diese Frau, Melissa Scholz, liebe ich mehr als alles andere. Sie wird meine Frau, ohne Wenn und Aber. Und wem das nicht passt, der hat bei uns nichts verloren«, hatte er damals unzweideutig verkündet.
Dem Anstand folgend war seine Familie zur Hochzeit gekommen. Auch sie waren nur kurz geblieben. Danach hatten sie kaum mehr als ein-, zweimal im Jahr Kontakt miteinander gehabt. Im Grunde traf man sich nur noch auf Beerdigungen, und auch mehr zufällig auf Vernissagen, Wohltätigkeitsveranstaltungen oder Bällen der Gesellschaft und tauschte dort kaum mehr als Höflichkeiten und Klatsch aus.
Das galt bis heute.
Nur leider konnte man sich diesem bedauerlichen Anlass hier nicht entziehen.
Scholz! Was für ein entsetzlich bürgerlicher Name, und was für entsetzlich bürgerliche Menschen waren hier zusammengekommen. Um eine solche Frau trauerte man nicht in ihren Kreisen; müsste man dann nicht um jede Frau Müller, Schmidt oder Neumann trauern, die sich irgendwann einmal durch ihr Geld oder durch ihr Äußeres einen von ihnen geangelt hatte und am Ende ihres unnützen Daseins ebenso vergraben wurde wie diese Frau hier?
Was für eine erschreckende Vermutung, die seinen Verwandten sicher so und nicht anders durch den Kopf schlich – Raymond hätte seine Hand dafür ins Feuer gelegt.
Auch war seine Frau ja nicht einmal in der Lage gewesen, ein Kind anständig auf die Welt zu bringen. Dieser Gedanke ruhte als unausgesprochene Missbilligung sicher tief in ihren Seelen.
All das konnte man an der hochmütigen Haltung und an den kühlen, unnahbaren Blicken deutlich ablesen. Oh, wie kultiviert ihre Oberflächen doch waren.
Es war lediglich die Landgräfin, Melissas Titel, dem sie versuchten, hier auf dem Friedhof mit Respekt zu begegnen.
Anders verhielt es sich mit Silvana. Ihre Trauer war aufrichtig, und ihr Blick auf Raymond war voller Mitgefühl. Er hatte den wohl wichtigsten und zärtlichsten Teil seines Lebens verloren – sie sah und spürte es.
Schleppend wagte Raymond den ersten Schritt, weg von Melissa, weg von ihrer letzten Ruhestätte.