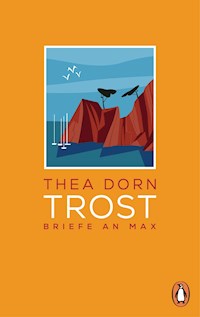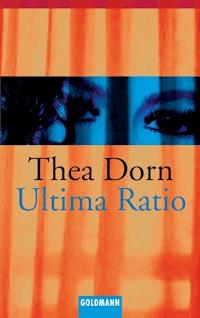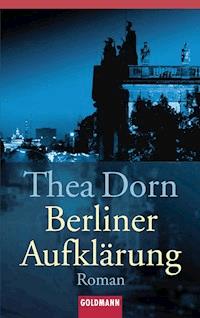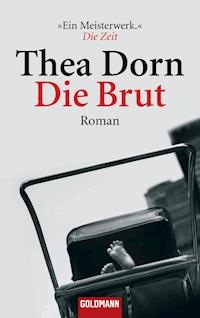19,99 €
19,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manhattan
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Mörder. Sein Opfer. Eine Liebe.
Opfer, Täter oder beides? Thea Dorns neuer Roman zum Thema Stockholm-Syndrom.
Das E-Book Mädchenmörder wird angeboten von Manhattan und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
krimi,thriller,krimis,kriminalromane,psychothriller,heimatkrimi,ebooks,stockholm-syndrom
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2008
3,8 (50 Bewertungen)
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Lob
Schwarzer_Sommer.doc
Vorbemerkung
Gefangen
Copyright
Perhaps man has a greater need of romance than he himself will admit.
Anonymes Zitat, Radsportmuseum Oudenaarde
Schwarzer_Sommer.doc
Vorbemerkung
Ich weiß, Sie alle wollen meine Geschichte hören. Ich werde sie Ihnen erzählen. Und nichts auslassen. Nur das, was so schlimm ist, dass kein Mensch es erzählen kann, wenn er weiterleben will. Aber ich muss Sie warnen. Ich werde alles nur so schildern, wie es wirklich gewesen ist. Das wird nicht immer das sein, was Sie zu wissen glauben. Zu viele Lügen sind verbreitet worden über mich und den Mann, der mich zwei Wochen gefangen gehalten und quer durch Europa geschleppt hat. Das ist der Grund, warum ich keine Interviews mehr gebe. Immer wenn ich etwas gesagt habe, haben die Medien das Gegenteil daraus gemacht. Mittlerweile glaube ich, dass die Medien noch schlimmer sind als der Mann, der mir das alles angetan hat. Sie hätten mir zuhören und meine Geschichte richtig erzählen können. Aber sie haben immer nur das erzählt, was sie erzählen wollten. So, als ob es gar nicht meine Geschichte wäre, sondern eine Geschichte, die sie sich ausgedacht hätten, und ich bloß eine Schauspielerin, die sie dafür bezahlen, dass sie die Hauptrolle spielt in ihrem Film. Aber ich bin die Einzige, die weiß, was in jenen zwei Wochen im September wirklich geschehen ist. Deshalb bin ich die Einzige, die meine Geschichte erzählen darf.
Und noch etwas muss ich sagen, damit es nicht wieder Missverständnisse gibt: Ich erzähle meine Geschichte nicht, um Geld oder Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich erzähle sie im Angedenken an all die Mädchen, die nicht wie ich das Glück hatten zu überleben.
Berlin, im November 2006 Julia Lenz
Gefangen
Ich habe meiner Mutter verziehen, dass sie mir an jenem Abend das Auto nicht geben wollte. Es stimmt: Ich hatte meinen Führerschein erst seit einem halben Jahr. (Allerdings stimmt nicht, dass ich schon einmal betrunken nach Hause gefahren wäre. Ich trinke keinen Alkohol. Ganz einfach, weil mir Alkohol nicht schmeckt.)
Keiner kann sagen, ob ich nicht auch in die Hände jenes Menschen geraten wäre, wenn ich an diesem Abend das Auto gehabt hätte. Vielleicht hätte ich vor Carinas Wohnung keinen Parkplatz gefunden und wäre ihm auf dem Weg zum Auto begegnet. Oder ich hätte eine Panne gehabt, und ausgerechnet er wäre derjenige gewesen, der angehalten hätte, um mir zu »helfen«. Ich glaube, es war mein Schicksal, ihm an jenem Abend zu begegnen. Und seinem Schicksal kann keiner aus dem Weg gehen. Deshalb habe ich aufgehört, mir diese Was-wäre-geschehenwenn -Fragen zu stellen.
Fest steht, dass ich meinem Entführer an der Haltestelle für den Nachtbus begegnet bin. Die Party bei Carina war langweilig gewesen, ursprünglich hatte ich gar nicht hingehen wollen. Kurz vor Mitternacht war Martin, Carinas älterer Bruder, gekommen, und er hatte mich überredet, noch ein bisschen zu bleiben. Später hatte er mir angeboten, mich nach Hause zu fahren.
Von heute aus betrachtet, ist es natürlich Hohn: Ich hatte es abgelehnt, mich von Martin nach Hause bringen zu lassen, weil ich das Gefühl hatte, er würde die Gelegenheit ausnützen, etwas von mir zu wollen. Nicht, dass mir Martin unsympathisch gewesen wäre. Aber ich hatte Angst vor einer Situation, in der er mich bedrängt. Um dieser Situation aus dem Weg zu gehen, rannte ich just jenem Mann in die Arme, der keinerlei Skrupel kannte, mit mir Dinge zu tun, die Carinas Bruder nicht einmal in seinen Alpträumen eingefallen wären.
Vielleicht erscheint es Ihnen unpassend, dass ich solche privaten Dinge über Menschen erzähle, die mit der eigentlichen Geschichte gar nichts zu tun haben. Aber ich will klarmachen, in welcher Gemütslage ich mich befand, als ich in jener Nacht an der Bushaltestelle in Köln-Marienburg saß. An einer Werbefläche hing noch das Plakat vom Express: »Danke für die geile Zick!« (Für Nicht-Kölner: »Zick« heißt »Zeit«.) Ich weiß, dass ich mich gefragt habe, wie lange sie das Plakat noch hängen lassen wollten. Die Weltmeisterschaft war seit fast zwei Monaten vorbei. Und dann fing ich an, Anagramm zu spielen. Also Buchstabenschütteln. Ich hatte gerade aus »Danke« »naked« gemacht und suchte nach einem deutschen Wort, das sich aus den Buchstaben D-A-N-K-E bilden lässt, als ich den zitronengelben Porsche langsam die Bonner Straße heraufkommen sah.
Habe ich etwas geahnt? Ich weiß es nicht. Ich wunderte mich höchstens, dass er mit geschlossenem Verdeck fuhr, denn es war eine warme Nacht, und normalerweise fährt in solchen Nächten jeder, der ein Cabrio hat, offen. Aber natürlich kann ich nicht beweisen, dass ich das in jener Nacht wirklich gedacht habe. Vielleicht sind das viel spätere Gedanken, von denen ich nur glaube, ich hätte sie mir bereits in jenem Augenblick gemacht. In Wahrheit ging alles so schnell, dass ich keine Zeit hatte, irgendetwas zu denken, außer: Das ist nicht wahr. Das ist alles nur ein Scherz. So etwas kann überhaupt nicht passieren.
Hätte ich eine Chance gehabt, wenn ich sofort begriffen hätte, was geschehen würde, als ich die Wagentür auffliegen sah? Wahrscheinlicher ist, dass ich zu keinem Zeitpunkt eine Chance hatte. Auch wenn mein Gedächtnis die unmittelbare Erinnerung an den Anfang meiner Entführung gelöscht hat - ich bin sicher, dass der Mann nur eine Sekunde brauchte, um aus dem Wagen zu springen. Ich hatte kaum Gelegenheit, sein Gesicht zu sehen, mein einziger Gedanke war: Den musst du kennen, warum springt er sonst auf dich zu? Aber du kennst ihn gar nicht! Und dann drückte er mir auch schon etwas ins Gesicht, das wie alter Putzlumpen stank, bloß stechender. Ich bin sicher: Zu diesem Zeitpunkt habe ich versucht zu schreien. Wenn die Anwohner der Bonner Straße die Wahrheit sagen - nämlich dass sie in jener Nacht nichts gehört haben -, bedeutet das, dass ich dazu keine Gelegenheit mehr hatte.
Fast schäme ich mich, es zu erzählen. Aber ich habe versprochen, ehrlich zu sein. Ich verspürte eine Art Erleichterung, als mir schwarz vor Augen wurde und ich gerade noch mitbekam, dass der Mann mich nicht auf den Bürgersteig fallen ließ, sondern auffing.
Mein Unbewusstes hatte bereits begonnen, die erste Lektion von Geiselopfern zu lernen: Sei dankbar für alles Gute, was dein Entführer dir tut. In der Schule hatten die Lehrer stets meine »Störrischkeit« beklagt. In den kommenden zwei Wochen sollte aus mir eine brave Schülerin werden.
Ach ja: Und dann fiel mir noch »Dekan« ein. Mit diesem Wort verabschiedete ich mich aus meinem bisherigen Leben.
Ich erwachte in einem schwarzen, vollkommen lichtlosen Raum. Es stank. Nach Schweiß. Ein bisschen so, wie es in den Jungsumkleiden beim Sport gerochen hatte. Und ich roch noch etwas anderes, das ich erst nicht benennen konnte. Während meiner Bewusstlosigkeit musste ich mich übergeben haben, das merkte ich an dem sauren Geschmack in meinem Mund. Und meine Jeans waren nass. Die neuen, engen Jeans, in denen ich mich früher am Abend noch so lange vor dem Spiegel gedreht hatte, weil ich mir nicht sicher gewesen war, ob sie nicht doch eine Falte am Po machten. Aber auch das war es nicht, was ich roch.
Heute weiß ich: Es war Angst. Und zwar nicht einmal meine. Die war zu frisch, um so zu riechen. Es war kalte, abgestandene Angst. Die Angst der Mädchen, die vor mir in diesem Loch gefangen gehalten worden waren. Als ich den Keller später mit den Polizisten noch einmal betreten musste, konnte ich sie sofort wieder riechen. Die Polizei hat bis heute nicht herausgefunden, wie lange die anderen Mädchen dort tatsächlich gelitten haben. Eine Nacht? Eine Woche? Einen Monat? In jedem Fall muss es lange genug gewesen sein, damit ihre Angst in jede Ritze der nackten Betonwände dringen konnte. Mir gegenüber hat mein Peiniger behauptet, er hätte sie wochenlang in diesem Keller eingesperrt. Aber ich bezweifle, ob das stimmt. Vermutlich hat er das nur gesagt, um mir noch mehr Angst einzujagen.
Mein erster Gedanke war, als ich zu mir kam: Das ist ein Missverständnis! Es muss eineVerwechslung sein! Ich versuchte, in meinen Körper hineinzulauschen, ob sich irgendetwas komisch anfühlte. Aber mein Körper war wie taub, oder genauer: Es war das Gefühl, wie wenn man im Winter kalte Hände hat und diese in heißes Wasser taucht. Das Ameisengefühl. Dennoch war ich nach einer Weile sicher, dass der Mann mir bislang nichts getan hatte. Meine nassen Jeans klebten an meinen Oberschenkeln, das konnte ich fühlen, auch mein langärmliges T-Shirt schien nicht zerrissen zu sein - soweit ich das in der absoluten Dunkelheit ertasten konnte. Was wollte er von mir?
Es musste um Geld gehen. Und plötzlich begriff ich, was geschehen war: Der Mann hatte mich mit Carina verwechselt! Carinas Eltern sind ziemlich reich, der renovierte Bauernhof in der Eifel, auf den sie mich einmal eingeladen haben, hat sogar einen Pool mit einem Dach, das man im Sommer auffahren kann. Meine Mutter dagegen ist nicht reich. Bis zu meiner Entführung hat sie in einem Reisebüro gearbeitet. Und mein Vater ist zwar Professor, aber Millionen hat er auch keine auf dem Konto. Es musste also eine Verwechslung sein. Alles andere ergab überhaupt keinen Sinn. Mein dummes Herz fing an zu hoffen.
Erst da merkte ich, dass ich nicht gefesselt war. Auch das ließ mich Hoffnung schöpfen. Vorsichtig auf allen vieren begann ich, mein Gefängnis zu erkunden. Der Boden musste Beton sein, so rau, wie er sich anfühlte. Ich war vielleicht einen oder höchstens zwei Meter gekrabbelt - Entfernungen sind in der absoluten Dunkelheit schwer zu schätzen, ebenso wie einem das Gespür für Zeit abhanden kommt, (vielleicht sind Sie schon einmal ohne Licht durch einen unterirdischen Gang oder langen Tunnel gelaufen - da konnten Sie nach wenigen Sekunden doch auch nicht mehr sagen, wie weit Sie sich schon bewegt hatten) - ich glaubte also, höchstens zwei Meter gekrabbelt zu sein, als ich gegen ein Hindernis stieß. Ich tastete mit den Händen daran herum und hätte beinahe gelacht. Es war ein Fahrrad!
Der Mann war gar kein Profi-Entführer, sondern hatte mich einfach in seinen Fahrradkeller geworfen! Ich erforschte das Fahrrad, wie wir es mit unbekannten Gegenständen und zugebundenen Augen bei einer Improvisationsübung in der Theater-AG gemacht hatten: Die Reifen erschienen mir sehr dünn - aha, vermutlich ein Rennrad. Ich tastete die Speichen ab, fand oben kein Schutzblech - also wohl tatsächlich ein Rennrad. Ich suchte die Pedale, die nur so ein merkwürdiger Knopf war (heute weiß ich, dass man das »Klickpedale« nennt), und erschrak ein wenig, als ich in die ölige Kette griff - aber nicht sehr, weil ich ja damit gerechnet hatte. Es beruhigte mich, in dieser Dunkelheit einen Gegenstand gefunden zu haben, von dem ich mir ein Bild machen konnte. Dass mein Bild nicht ganz richtig war und dass dieses Fahrrad nicht zufällig herumstand, sondern zu den perversen Spielchen gehörte, die mein Peiniger sich ausgedacht hatte, konnte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen.
Mutiger geworden erkundete ich weiter den Raum. Ich stieß gegen etwas, das bullernd umfiel. Plastikeimer, versuchte mein Hirn mein erschrockenes Herz zu beruhigen: Es ist nur ein Plastikeimer. Schließlich ertastete meine Hand etwas Weiches, das mich nicht so erschreckte wie der Eimer. Dennoch zuckte ich zurück. Und dann setzte mein Herz einige Schläge aus. Das, was meine Finger berührt hatten, fühlte sich nach Stoff an. Ein wenig feucht, klamm, schwer. Was, wenn...
Ich vermute, dass ich zu wimmern begann. Was immer sich unter dem Stoff verbarg - es gab keinen Laut von sich. Nach einer Weile zwang ich mich, meine Hand noch einmal auszustrecken. Und diesmal gelang es meinem Hirn, die Tasteindrücke zusammenzusetzen. Es war eine Matratze. Eine dünne, ganz sicher speckige, alte Matratze. Einerseits war ich erleichtert, dass sich das unbekannte Weiche nicht als das herausgestellt hatte, wofür ich es gehalten hatte. Andererseits ekelte ich mich. Als ich noch ein Kind gewesen war, hatten die Nachbarjungs bei meinen Großeltern mich in den Wald zum Spielen mitgenommen. Sie hatten mir dort die Laubhütte gezeigt, die sie gebaut hatten. Und in dieser Laubhütte hatte ein altes Sesselpolster gelegen. Ich hatte mich tapfer neben die Jungs auf das Polster gesetzt, auf dem Käfer und andere Insekten herumkrabbelten. Ich hatte mich nicht getraut zu sagen, wie sehr ich mich vor diesem Polster ekelte, aus Angst, die Jungs würden mich auslachen.
Über die Matratze freute ich mich also deutlich weniger, als ich mich über das Fahrrad gefreut hatte. Und dies hatte nicht nur mit meinem Ekel vor speckigen Polstern zu tun, sondern damit, dass sich in meinem Hinterkopf die Frage bildete: Was macht eine Matratze in einem Fahrradkeller? Denn ich war doch sicher, aufgrund einer blöden Verwechslung in einem an und für sich harmlosen Fahrradkeller gelandet zu sein.
Ich beschloss, mich ein wenig auszuruhen. Vielleicht war es auch die Angst vor neuen Entdeckungen, die mich davon abhielt, mein Gefängnis weiter zu erkunden. Meine Knie und vor allem meine Hände waren aufgeschürft - eine weiche Unterlage wäre also durchaus willkommen gewesen. Dennoch rollte ich mich in sicherem Abstand zu der Matratze auf dem nackten Betonboden ein. Ich gab mir Mühe, nur an das Fahrrad zu denken. Bei meinem ersten Fahrversuch vor vielen, vielen Jahren, nachdem mein Großvater die Stützräder abgeschraubt hatte, war ich direkt in die Brombeerbüsche gesaust. Die Erinnerung vermochte mich ein bisschen aufzuheitern und beruhigte meine Angst so weit, dass ich in eine Art nervösen Schlaf fiel.
Ich versuche, mich an meine Gedanken zu erinnern, als ich das Gesicht meines Entführers zum ersten Mal richtig sah. Die Fotos, die die Medien von ihm veröffentlicht haben, vermitteln ein völlig falsches Bild. Entweder sind es diese passbildartigen Dinger, auf denen er aussieht, als würde seine Mutter ihm die Hemden bügeln. (Was sie nie getan hat.) Oder es gibt dieses andere Bild - das alle Zeitungen gedruckt haben, Sie kennen es bestimmt -, wo er völlig erledigt irgendwo in Frankreich auf dem Rad sitzt und wirklich wie ein Wahnsinniger ausschaut. Auch das zeigt wieder, wie die Medien arbeiten: Sie haben eine bestimmte Vorstellung davon, wie ein Mann aussehen muss, der Lust daran hat, Mädchen zu foltern und zu töten. Oder besser gesagt: Sie haben eine bestimmte Vorstellung davon, wie ein solcher Mann nicht aussehen kann. Aber die Wahrheit ist, dass er genau so aussah. Wie gern würde ich Ihnen berichten, dass es ein Monster war, das mich entführt hat. Wie gern würde ich schreiben, dass er schmierig aussah, widerlich, gestört. Oder wenigstens: schmierig, widerlich, gestört normal. Aber das alles ist nicht der Fall. Mein Entführer sah außergewöhnlich gut aus. Sportlich. Blond.
Die Medien haben nur ein Bild veröffentlicht, auf dem er ungefähr so ausschaut, wie ich ihn in Erinnerung habe: Es zeigt ihn in jenem Moment, in dem er das einzige Rennen seiner Karriere gewinnt und mit emporgerissenen Armen über die Ziellinie fährt.
Wenn ich versuche, meinen allerersten Eindruck so authentisch wie möglich wiederzugeben, kann ich es nicht leugnen: Ich war erleichtert, dass mich wenigstens kein entstelltes Monster entführt hatte.
Ich muss sehr aufpassen, was ich jetzt schreibe, es gibt schon zu viele Missverständnisse über die »Beziehung«, die zwischen mir und meinem Entführer bestanden haben soll. »Stockholm-Syndrom« ist dann das Wort, das die Medien aus der Schublade ziehen, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Aber was habe ich mit den Geiseln zu tun, die damals in dieser Bank in Stockholm plötzlich anfingen, sich mit ihren Geiselnehmern zu solidarisieren? Nichts! Es gibt auch kein Foto, auf dem zu sehen wäre, wie ich mit meinem Peiniger herumknutsche! Aus dem schlichten Grund, dass ich mit ihm zu keinem Zeitpunkt herumgeknutscht habe!
Vielleicht kann ich Ihnen das, was ich empfand, am besten mit einem Beispiel aus der Tierwelt verdeutlichen. Wie fühlt sich eine Gazelle, wenn ihr klar wird, dass sie dem Löwen nicht mehr entkommt? Spürt sie panische Angst? Versucht sie, doch noch einmal zu fliehen? Oder schaut sie nicht den Löwen im letzten Moment an und denkt: Was für ein schönes, starkes Tier! Sterben muss ich ja sowieso. Ist es da nicht besser, von solch einem Tier gefressen zu werden als einfach zu verrecken?
Ich habe mich tausendmal gefragt, wieso ausgerechnet ich als Einzige von all den Mädchen überlebt habe. Vielleicht nur deshalb, weil ich die Einsicht der Gazelle in mir fand.
Ich habe Ihnen versprochen, alles zu erzählen. Aber ich merke, dass es Dinge gibt, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Dennoch werde ich mich bemühen, so viel zu schildern, dass Sie sich ein Bild machen können.
Bevor mein Entführer ein Wort zu mir sagte, schlug er mir mit der flachen Hand ins Gesicht. Ich will versuchen, mir die Szene zu vergegenwärtigen.
Wie bereits gesagt, war ich neben der Matratze in eine Art Angstschlaf gefallen. Ich wurde von einem Licht geweckt, das so grell war, dass ich die Augen fest zukneifen musste. Weil alles still blieb, keine Stimme kam, die etwas sagte, keiner, der mich anschrie, kein Gelächter nach dem Motto »Juli, ätsch, alles nur ein Scherz gewesen!« - deshalb zwang ich mich, trotz der Schmerzen die Augen zu öffnen. Zunächst sah ich nur seinen Umriss. Ich sah, dass er einigermaßen groß war, aber kein Riese, obwohl er direkt über mir stand. Nach und nach konnte ich erkennen, dass er blonde Haare hatte. Und - wie ich versucht habe, Ihnen zu erklären - dass er ein attraktiver Mann war. (Carina hätte ihn unter anderen Umständen wahrscheinlich als »süß« bezeichnet.) Wir blickten uns einen Moment an, das heißt: Er beobachtete mit einem kalten Lächeln, wie ich ihn anstarrte. Ich war gerade dabei, mich aufzurichten, um ihn zu fragen, was er von mir wolle und ob das alles nicht ein blödes Missverständnis sei - da beugte er sich herunter, zog mich an meinen langen rotblonden Haaren halb in die Höhe und schlug mir mit der Hand direkt ins Gesicht. Mein Kopf flog auf den Boden, ich hörte es krachen.
War es Todesangst, die ich in diesem Moment verspürte? Wut? Ergebenheit? Es war alles zusammen. Sonderbarerweise war mein erster klarer Gedanke, zu dem ich mich aufraffen konnte: Du hast Recht gehabt. Der Boden ist Beton. Genau, wie du ihn dir vorgestellt hast. Auf meinen Lippen schmeckte ich Blut.
Ich hoffe, Sie begreifen nun, warum ich Ihnen die Geschichte mit der Gazelle erzählen musste. Damit Sie mir glauben, dass ich weder geheult noch um Gnade gefleht habe - und mich auch nicht zur Heldin machen will. Es gibt nur einen einzigen Grund, warum ich nichts von alldem getan habe: Ich kam gar nicht erst auf die Idee. Es war nicht so, dass ich den Impuls zu reagieren, wie zu Tode verängstigte Mädchen normalerweise reagieren, unterdrückt hätte - wie Sie wissen, sollte ich in den kommenden Wochen immer wieder Zeugin von solchem Verhalten werden -, dieser Impuls war in mir einfach nicht vorhanden.
Ich kann mich nicht genau erinnern, aber ich vermute, dass wir dieses Spiel - er zieht mich an den Haaren in die Höhe, knallt mir eine, und ich falle zu Boden - dass wir dieses Spiel ein paarmal spielten.
Die ersten Sätze, die ich aus seinem Mund vernahm, werde ich nie vergessen. »Bist du stumm oder was?«
Seine Stimme war nicht unangenehm. Nicht kreischend. Nicht boshaft. Sicher schwang Verachtung mit, als er dies sagte. Aber auch eine Verwunderung, die mir im Rückblick fast rührend erscheint. Dann fing er an, mir in den Magen zu treten.
»Du hältst dich wohl für besonders taff, F…!« (Ich möchte dieses Wort, das ich in den nächsten Wochen ständig hören sollte, nicht wiederholen.)
Als er merkte, dass er auf diese Weise mit mir nicht weiterkam, befahl er mir, mich auszuziehen. An dieser Stelle sprach ich mein erstes Wort.
»Nein.«
Und das Lächeln auf seinem Gesicht verriet mir, dass ich einen Fehler gemacht hatte. Natürlich begann er, darüber zu spotten, dass die »F…« ja doch sprechen könne. Und dass ihn sprechende »F... n« noch mehr anmachen würden als »F... n« im Allgemeinen.
Ich fand das Ausziehen schlimmer als das Geschlagenwerden. Beim Sport habe ich es meistens vermieden, unter die Dusche zu gehen. Oder wenn, habe ich versucht, es so einzurichten, dass ich erst dann unter die Dusche ging, wenn alle anderen fertig waren. Dennoch verzichtete ich darauf, ein zweites Mal zu protestieren.
Er lümmelte sich auf die Matratze und befahl mir, ans andere Ende des Raumes zu gehen, an dem sich ein flaches Holzpodest mit einer senkrechten Metallstange, eine Art Verkehrsschildmast, befand. Im Vorübergehen sah ich, dass das Fahrrad tatsächlich ein Rennrad war. Allerdings stand es nicht einfach so herum, sondern war mit einem Metallgestell auf zwei breiten Kunststoffrollen montiert. Und der Sattel fehlte. (Was ich zu diesem Zeitpunkt völlig arglos registrierte.) Rechts und links von dem Holzpodest, das ich nun betrat, gab es Kraftmaschinen für Arme und Beine. An einer Wand lehnten zwei weitere Fahrräder, eins ohne Reifen. Ich verstand nicht wirklich, an was für einen Ort ich geraten war.
Offensichtlich machte der Mann viel Sport - was erklärte, warum sein Körper so durchtrainiert war. Trotz des rosa Poloshirts und der Jeans, die er trug, konnte ich das sofort erkennen. Dass ich mich im privaten Trainingskeller eines ehemaligen Radrennprofis befand, der diesen Keller um einige andere Funktionen erweitert hatte, nachdem er sein linkes Knie im letzten Frühjahr endgültig kaputt trainiert hatte - das alles erfuhr ich erst, als wir schon viele hundert Kilometer von diesem Ort entfernt waren.
Ich begann, mein T-Shirt über den Kopf zu streifen, und er fragte mich, ob ich blöde »F…« noch nie etwas von Striptease gehört hätte. Er befahl mir, von vorn anzufangen, und zwar diesmal so, dass sich bei ihm irgendetwas »regen« könne. Gegen meinen Willen musste ich ihn dafür bewundern, dass er sich vor der Matratze nicht ekelte, die sich bei Lichte besehen als noch widerlicher erwies, als ich im Dunkeln vermutet hatte. Und ich war ihm dankbar, dass er seine Jeans anbehielt. Ach ja: Das Licht in dem Raum kam von einem Kasten mit mehreren Neonröhren, der an der Decke befestigt war. Klassenzimmerbeleuchtung. Ich fragte mich, wie die Insekten, die in dem Kasten klebten, in den fensterlosen Keller gefunden hatten. Ob der Kasten vorher in einem anderen Raum mit Fenster installiert gewesen war? An solchen Überlegungen hält sich die Seele fest, wenn der Körper gezwungen ist, Dinge zu tun, die sie verletzen.
Als mein Peiniger den schlichten schwarzen Sport-BH sah, von dem ich gleich drei Stück besaß und den ich meistens trug, lachte er und höhnte, was für eine verklemmte »F…« er sich diesmal angelacht hätte.
Eigentlich hatte ich erwartet, dass er aufstehen und mich wieder schlagen würde, aber er befahl mir von seiner Matratze aus, zu dem offenen Pappkarton zu gehen, der hinten auf dem Podest, direkt an der Wand, stand. In dem Karton war Unterwäsche. Rote, schwarze, weiße und gepunktete Slips und BHs, insgesamt vielleicht acht oder neun Stück. Die Sachen waren viel »sexyer« als die Unterwäsche, die ich trug. Aber auch keine richtige Reizwäsche. Der gepunktete Slip mit den Rüschen zum Beispiel hätte ohne weiteres Carina gehören können. In den Wäscheabteilungen der Kaufhäuser hängen solche Teile bei Young Line oder Miss B.
Er fragte mich, ob ich eine Ahnung hätte, warum diese Kiste dort stehe. Ich verneinte, woraufhin er mich abermals auslachte und mir androhte, etwas sehr Schreckliches mit meinen Brüsten zu tun - wenn ich sowieso nicht wisse, was ich mit den Dingern anfangen solle. Ich versuchte, meine eigenen Kleider so schnell wie möglich ausund den gepunkteten BH mit dem Slip anzuziehen.
Dann geschah etwas, von dem meine Therapeutin meint, dass es mir womöglich das Leben gerettet hat. Ich rede nicht gern darüber, aber: In den Monaten vor meiner Entführung war es mir nicht so gut gegangen. Ich war sehr unzufrieden mit mir gewesen, vor allem mit meinem Körper, den ich viel zu fett und schwammig fand. Deshalb hatte ich begonnen, ein wenig an meinen Oberschenkeln herumzuritzen. Nicht an den Handgelenken oder so. Es hatte mir einfach gut getan, dieses weiße Fleisch zu verletzen.
Mein Peiniger entdeckte die Narben sofort. Ich hatte das Gefühl, dass sie ihn erregten. Meine Therapeutin vermutet, dass ihm die Narben eher »den Wind aus den Segeln« genommen hätten. Weil es die meisten Sadisten angeblich frustriert, wenn sie sehen, dass ihr Opfer bereit ist, sich selbst Schmerzen zuzufügen. Irgendwie soll es in der Logik solcher Menschen weniger Spaß machen, ein Mädchen zu quälen, das sich selbst quält, als eins, das um keinen Preis gequält werden will. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig wiedergebe. So ganz habe ich die Argumentation meiner Therapeutin nicht verstanden.
Als ich endlich in der gepunkteten Unterwäsche auf dem Podest stand, fragte er mich, ob ich wisse, wem diese gehöre. Ich verneinte die Frage, weil ich tatsächlich ahnungslos war.
Obwohl ich zu dieser Zeit noch nicht Opfer der Medien gewesen bin, habe ich auch damals schon keine Zeitungen oder Zeitschriften gelesen. Ich habe ein bisschen ferngesehen, aber auch nicht besonders viel. Deshalb hatte ich nichts gehört von den beiden Mädchenleichen, die im April und Juni in Waldstücken in Luxemburg und den belgischen Ardennen gefunden worden waren. Wie ich später erfuhr, hatten die Medien auch nicht groß darüber berichtet. Die Sache war während der WM untergegangen. Oder - wie ein Journalist später zu Recht anklagend schrieb: Wahrscheinlich hatte die Polizei schon den Verdacht gehabt, dass ein Serienmörder unterwegs sein könnte, aber während der WM wollte sie keinen großen Wirbel machen. Und in den Wochen unmittelbar vor meiner Entführung war ja auch keine neue Leiche mehr aufgetaucht.
Inzwischen weiß man, wer die beiden Mädchen gewesen sind, die in den Waldstücken gefunden wurden. Die erste hieß Sandrine Roubaix, einundzwanzig Jahre alt, eine Studentin aus Lüttich. Die zweite hieß Janina Berger, sie war so alt wie ich, also neunzehn. Eigentlich hatte sie eine Ausbildung zur Friseurin begonnen, dann aber zu viele Drogen genommen und war auf dem Strich gelandet. Ein Zeuge behauptete später, sie sei freiwillig in den zitronengelben Porsche gestiegen.
Die Unterwäsche mit den rosa Punkten, die ich mir ausgesucht hatte - und die mir ein wenig zu groß war, vor allem der BH -, hatte Sandrine Roubaix gehört. Das offenbarte mir mein Peiniger in jener Nacht. (Die Polizei hat später herausgefunden, dass er nicht gelogen hat.)
Möglicherweise hat es zu meiner Rettung beigetragen, dass ich von den beiden Morden nichts gehört hatte. Ich glaubte wahrzunehmen, dass mein Peiniger ein wenig enttäuscht war, als er den Namen Sandrine Roubaix aussprach und ich nicht stärker zu zittern begann, als ich ohnehin schon zitterte, weil es in dem Keller trotz der warmen Außentemperaturen ziemlich kalt war. Allerdings ließ er den Namen nicht lange im Raum schweben. Wütend erklärte er mir, was er mit dieser »F…« alles gemacht habe. Und dass er beabsichtige, mit mir dasselbe zu tun.
Ich weiß wirklich nicht, wie ich über diese Dinge schreiben soll. Ich kann und will nicht im Detail nacherzählen, was in jener Nacht geschah. Aber wenn ich es nicht tue, gehen die unglaublichen Vorwürfe weiter, ich wolle mich nur wichtig machen, denn in Wahrheit sei mir doch gar nichts so Schreckliches widerfahren. Schließlich sei ich mit einem »blauen Auge« davongekommen.
Gestatten Sie, dass ich jenen grässlichen Keller für einen Moment verlasse. Nicht, um Luft zu schnappen. Sondern um meiner Wut Luft zu machen. Meiner Wut darüber, wie die Medien mit mir umgesprungen sind. Und immer noch umspringen. Bis heute kann ich nicht begreifen, was geschieht. Wie kann es sein, dass ich in den Tagen nach meiner Rückkehr das »arme Opfer« war, das durch ein »unvorstellbares Wunder« und »Gott sei Dank« überlebt hatte? Das Opfer, das alle bemitleideten, für das Spendenkonten eingerichtet wurden und so weiter und so weiter. Wie kann es sein, dass ich dann - obwohl meine Geschichte doch dieselbe ist und es ewig bleiben wird - wie kann es sein, dass ich dann plötzlich nicht mehr »das Opfer« war, sondern »eine verwirrte junge Frau«, an deren Geschichte »berechtigte Zweifel« angebracht seien? Wie verdorben müssen Journalisten sein, um so etwas zu schreiben? Habe ich ihnen als Opfer nicht genügend Unterhaltung geboten? Warum demütigen sie mich auf ihre Weise fast so schlimm, wie mein Peiniger mich gedemütigt hat? Fühlen sie sich abends besser, wenn sie den ganzen Tag Lügen über mich verbreitet haben?
Und deshalb: Ja, ich werde noch einmal in diese Hölle hinabsteigen, werde ihre verdammte Sensationsgier befriedigen, werde mich selbst erniedrigen, nur damit diese Lügen endlich aufhören!
Das erste Körperliche, was mein Peiniger mir antat, war, dass er mich zwang, mich zu rasieren. Und zwar nicht einfach so, sondern ich musste mich auf eine der beiden Kraftmaschinen setzen und die beiden schwarzen Bügel mit meinen Oberschenkeln auseinanderdrücken. Jedes Mal, wenn mich die Kraft verließ, und die Gewichte meine Beine zusammenschnellen ließen, schnitt ich mich. Er fragte lachend, ob das nicht viel mehr Spaß machen würde als meine albernen Schenkelritzereien. (Muss ich wirklich erwähnen, dass ich es widerlich fand, mich an dieser Stelle zu rasieren? Und wie sehr ich meine Mitschülerinnen verachtet hatte, die, kaum dass ihnen die ersten Haare gesprossen waren, schon damit geprahlt hatten, wie »geil« es sei, »da unten« rasiert zu sein, oder noch schlimmer: die eine von diesen obszönen Landebahnen stehen ließen?)
Er befahl mir, mich zu schminken, ohne Spiegel, mit einem knallroten Lippenstift, von dem er behauptete, dass er ebenfalls einem seiner Opfer gehört habe. Mit der Begründung, meine Übungen an der Metallstange und den Kraftmaschinen würden ihn allmählich langweilen, begann er abermals, mich zu schlagen.
Schließlich musste ich zu einem Regal gehen, in dem bestimmt zehn Paar Fahrradschuhe standen, die offensichtlich alle ihm gehörten und mir deshalb viel zu groß waren. Als ich die Verschlüsse nicht richtig zubekam, schlug er mich wieder und zwang mich, auf das Fahrrad zu steigen. Ja. Auf das Fahrrad, an dem er seine kleine sadistische Veränderung vorgenommen hatte. Da ich weder mit diesen Schuhen noch mit den komischen Pedalen die geringste Erfahrung hatte, rutschte ich wieder und wieder ab. Er wollte sich ausschütten vor Lachen. Endlich gelang es mir loszutreten. Im Stehen. Ich wusste, was geschah, wenn ich müde wurde. (Um es an dieser Stelle zum letzten Mal zu sagen: Ich hatte noch mit keinem Jungen geschlafen. Ich war Jungfrau, als ich meinem Peiniger in die Arme lief.)
Zum Glück war ich im Juni und Juli ziemlich viel Rad gefahren. Auf meinem Fahrrad. Einem billigen Mountainbike mit ganz normalen altmodischen Pedalen. (Ich glaube nicht, dass ich jemals wieder auf ein Rad steigen kann. Neulich - hier in Berlin traue ich mich langsam wieder, auf die Straße zu gehen, weil die Leute mehr mit sich beschäftigt sind und weniger gaffen als in Köln -, neulich also blieb ich an einer Fußgängerampel stehen, die gerade rot geworden war. Ein Fahrradkurier versuchte, schnell vor den Autos loszufahren - und dabei rutschte er aus einem der Klickpedale. Diese Bewegung am Rande meines Blickfelds löste eine derartige Panik in mir aus, dass mir schwindlig wurde und ich sofort nach Hause gehen musste.)
Fast schien es mir, als würde es meinen Peiniger beeindrucken, dass ich so lange durchhielt. Gleichzeitig machte es ihn wütend. Er kam und stellte die Gangschaltung schwerer. Bis meine Beine nicht mehr konnten. Mit Schlägen zwang er mich, trotzdem weiterzutreten, immer weiter. Die ganze Zeit brüllte er: »Siehst du jetzt, wie schwach du bist, du F…? Und du bildest dir ein, mich anmachen zu können?«
Und dann sah ich, dass er seine Jeans geöffnet hatte. Er zerrte mich vom Fahrrad. Der Rest ging Gott sei Dank schnell.
Natürlich habe ich darüber nachgedacht, mich umzubringen. Der Wille, das alles überleben zu wollen, kam erst später. Aber verraten Sie mir mal, womit Sie sich in diesem schwarzen Kellerloch getötet hätten? Nachdem mein Peiniger seine Bedürfnisse ausreichend an mir befriedigt und mich allein gelassen hatte, brachte mich nichts mehr in die Nähe des abscheulichen Fahrrads. Und selbst wenn ich dieses Monstrum jemals wieder freiwillig angefasst hätte: Ich bezweifle, dass es mir gelungen wäre, die Kette oder das Kettenblatt (damals nannte ich es einfach »dieses vordere Zahnrad«) herunterzubekommen. Und dann? Die einzige Tür des Raumes hatte keine Klinke, an der ich die Kette hätte befestigen und mich vielleicht erhängen können. Und ich weiß nicht, ob es schon mal jemandem gelungen ist, sich mit einem Kettenblatt die Pulsadern aufzuschneiden.
Natürlich habe ich auch an Flucht gedacht. Aber der Raum war tatsächlich fensterlos. In den Minuten - oder waren es doch eher Stunden gewesen? -, die ich mit meinem Peiniger verbracht hatte, hatte ich genügend Geistesgegenwart besessen, nach Fluchtwegen Ausschau zu halten. Doch die Tür war aus Stahl, und ich hatte gehört, wie er sie beim Verlassen zweimal abgeschlossen hatte. Meine Kleider hatte er außerdem mitgenommen. Ich fror.
Und dann machte ich eine eigenwillige Erfahrung: So nackt, zitternd und geschändet, wie ich war - mir fiel tatsächlich dieses altmodische Wort ein, das ich sonst nur aus dem Deutsch-Leistungskurs kannte, in dem wir die Dreigroschenoper gelesen hatten und Mackie Messer in seiner berühmten Ballade singt: »Wachte auf und war geschändet, oh Mackie, welches war dein Preis?« - während mir diese Zeile im Kopf herumspukte, fiel mir auf, dass ich mich nicht länger vor der Matratze ekelte, auf die mich mein Peiniger geworfen hatte, sondern sie im Gegenteil beinahe als etwas Tröstliches empfand. (Ich will nicht vorausgreifen, aber in der kommenden Zeit sollte ich immer wieder die Erfahrung machen, dass Dinge, die mir bislang als der Gipfel des Ekligen erschienen waren, plötzlich alles Abstoßende verloren. Inzwischen nenne ich das meine private Relativitätstheorie.)
Das Scheusal hatte mir versichert, dass ich seinen Keller nicht lebend verlassen würde. Mein Schicksal würde sein, von ihm für was auch immer so oft benutzt zu werden, wie es ihm gefiel. Sobald er die Lust an mir verlor, würde er mich »entsorgen«. Das waren seine Worte gewesen. Zum Schluss hatte er noch gedroht, dass es an mir liegen würde, wie schnell er die Lust verlor. Allerdings wusste ich nicht recht, was ich mit dieser Drohung anfangen sollte. Ohne die Dinge bereits so zu durchschauen, wie ich sie heute - auch dank meiner Therapeutin - durchschauen kann, hatte ich damals bereits den Verdacht, dass er eigentlich nicht gemeint haben konnte, dass ich seine perversen Spielchen williger mitspielen sollte. Denn auf dieser Welt gibt es doch so viele Perverse, auch perverse Frauen, dass er - zumal mit seinem Aussehen - leicht eine gefunden hätte, die alles mit sich hätte machen lassen. Im schlimmsten Fall hätte er ihr Geld dafür bezahlen müssen. (Damals wusste ich noch nicht, dass er bankrott war. Der Porsche hatte mich zu der Annahme verleitet, er müsse reich sein.) Wirklich »mitspielen« konnte er also nicht meinen. Ich vermutete, dass ich mich stärker wehren sollte. Dass ich beim ersten Mal einen Fehler gemacht hatte, indem ich alles einfach über mich ergehen ließ. Außer meinen frühen »Neins« hatte ich nämlich keinen Widerstand mehr geleistet. Und wahrscheinlich war es gerade das, was er suchte: Widerstand.
Doch nachdem ich mit meinen Gedanken an diesem Punkt angelangt war, stellte sich mir wieder die grundlegende Frage: Wollte ich überhaupt, dass er noch lange Lust an mir fand? Wäre es nicht besser, rasch »entsorgt« zu werden? Und obwohl ich mir darunter nichts Genaues vorstellen konnte, wuchs in mir, je länger ich darüber nachdachte, die Überzeugung, dass es weniger schlimm sein müsse, »entsorgt« zu werden als weiter Gegenstand seiner Lust zu sein.
Ich habe nie besonders auf Schlitzer- oder Splatterfilme gestanden. Obwohl ich zum Glück also keine konkreten Bilder vor Augen hatte, was Menschen den Körpern anderer Menschen antun können, ahnte ich, dass mein Peiniger mich vielleicht noch grausamer behandeln würde, wenn ich ihn langweilte. Dass es also doch mein oberstes Ziel sein musste, ihn nicht zu enttäuschen. Und plötzlich verlor die Vorstellung, »entsorgt« zu werden, ihren Trost und wurde zum Horror, den es um jeden Preis zu vermeiden galt. (Ich wusste damals noch nicht, dass er die Mädchen vor mir erwürgt und in einsamen Waldstücken abgelegt hatte, zum Ende hin also eine fast schon friedliche Methode benutzt hatte.) Es machte mich wahnsinnig, nicht zu begreifen, was er von mir erwartete. Vielleicht war die Sache mit dem Widerstand ja völliger Unsinn? Hatte er mich nicht am allerheftigsten geschlagen, als ich die wenigen Male »nein« gesagt hatte? Erwartete er nicht vielleicht doch, dass ich so tat, als würde ich alles, was er mit mir anstellte, mögen? Oder wollte er, dass ich ihn auf Knien um Gnade anflehte?
Meine Gedanken hüpften hin und her und drehten und verwickelten sich, als würde ich nicht in einem Folterkeller liegen, sondern im Pausenhof mit anderen Mädchen Gummitwist spielen, wie ich es früher gern getan hatte.
Ich stellte mir vor, wie es wäre, tot zu sein. Ich malte mir aus, wen ich am meisten vermissen würde. Meinen Vater? Meine Mutter? Oder doch meine Tinka, die beste Seele von einem Hund, die es je auf diesem Planeten gegeben hat? (Ich wünschte, Sie könnten sie sehen, wie sie jetzt neben mir liegt. Anfangs habe ich überlegt, ob ich sie wirklich nach Berlin mitnehmen soll, schließlich ist sie nicht mehr die Jüngste, und Berlin ist eine fremde Stadt. Aber der Gedanke, meine Tinka noch einmal im Stich zu lassen, hat so weh getan, dass ich sie einfach mitnehmen musste.)
Die allergrößte Sehnsucht, die ich in jener Nacht verspürte, war die nach Licht und Luft. Ich war schon immer gern in der Natur gewesen, und die Vorstellung, womöglich nie wieder einen Baum oder die Sonne zu sehen, nie wieder die saubere Luft unmittelbar nach einem Sommerregen - oder wenigstens frische Luft überhaupt - zu atmen, ließ mich fast ersticken. Ich hatte jetzt schon jegliches Zeitgefühl verloren, hatte keine Ahnung, ob es Morgen, Tag oder wieder Nacht war.
Zu meinem Geburtstag im Juli hatte mein Vater mir die komplette Ausgabe von Marcel Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit geschenkt. (Immerhin hatte ich ihn überzeugen können, mir nicht das französische Original, sondern wenigstens die deutsche Übersetzung zu schenken.
Verlagsgruppe Random House
Manhattan Bücher erscheinen im Wilhelm Goldmann Verlag, München, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH
1. Auflage Februar 2008
Copyright © 2008 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Die Nutzung des Labels Manhattan erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Hans-im-Glück-Verlags, München
eISBN : 978-3-894-80450-3
www.goldmann-verlag.de
Leseprobe
www.randomhouse.de