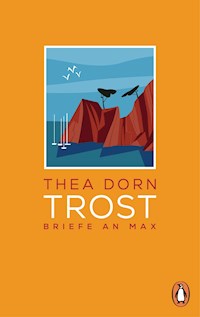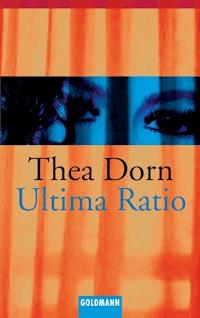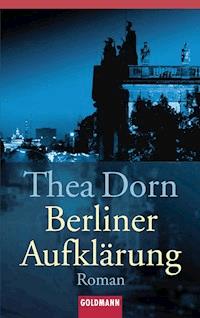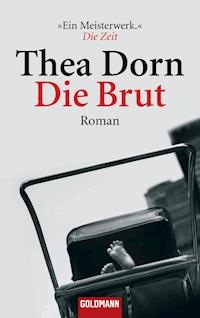Inhaltsverzeichnis
Titel
Verehrte Frau Dorn,
Das Beta-Tier – Thea Dorn reist in den Busch und sieht bekannte Gesichter.
Leben unter Vorbehalt – Thea Dorn fragt sich, wie die Generation, die mit ihrer ...
Das heimliche Aschenputtel
»Sag mir, wo die Prinzen sind...«
Entscheiden lernen
SOS Multikulti – Thea Dorn geht nicht zum Karneval der KulturenStattdessen ...
Die Rot-Grün-Blindheit – Angela Merkel kandidiert zum ersten Mal fürs ...
Gute Deutsche – Der deutsche Intellektuelle warnt vor dem deutschen Staat. Thea ...
Neuer Feminismus – Thea Dorn träumt von einer Frauenbewegung, die alle ...
»Wenn Sie ertrinken, bitte rufen Sie um Hilfe!« – Thea Dorn streift durch Tokio ...
Sommerfußball – In Deutschland ist die Welt zu Gast bei Freunden. Thea Dorn ist ...
I. Die Sache mit der Hymne
II Deutschland, einig Katerland.
III. Der Ball soll’s richten
IV Kinder, Küche Kicker,
Ein starkes Signal – Angela Merkel ist seit einem Jahr Kanzlerin. Thea Dorn ...
Tor! Tor!! Tor!!! – oder: Das Wunder von Bayreuth – Thea Dorn lauscht Wagners ...
Fundamentalistin der Aufklärung – Thea Dorn stellt sich vor die ...
Lasst Kunstblut fließen! – Thea Dorn plädiert für dreckige Kunst.
Vier Stunden mit Fritzl – Thea Dorn macht einen Ausflug nach Niederösterreich.
Geliebter Mörder – Thea Dorn wagt sich in Blaubarts Burg und entdeckt eine ...
Feudaler Wüstling sucht gehorsames Weib
Aufgewecktes Frauenzimmer sucht Abenteuer
Gefallener Engel sucht rettenden Engel
Frau, einsam, gelangweilt, sucht Mann, gern auch Schwerverbrecher
Beherzte Vagabundin sucht männliche Pendant
Seichtgebiete – Thea Dorn hat genug vom Bullshit auf der Agora.
Schämt euch! – Thea Dorn schaltet den Fernseher ein und errötet.
Deutschland, keine Denker – Thea Dorn vermisst den öffentlichen Intellektuellen ...
Willkommen im Kindergarten! – Europa redet von der Energiesparlampe. Thea Dorn ...
Schneller, höher, weiter! – Thea Dorn hat Verständnis für Doping im Sport Kein ...
Wollt ihr die totale Revision? – Thea Dorn erklärt, wieso die Erde kein ...
Ein Männlein steht im Walde – Thea Dorn wundert sich über den Mann, der endlich ...
Verdruckster Patriarch – Thea Dorn erinnert sich an Helmut Kohl.
Vulgärpazifismus – Thea Dorn misstraut den deutschen Friedenstauben.
Mutter Vader – Angela Merkel will zum zweiten Mal Kanzlerin werden Thea Dorn ...
Die demokratische Eisdiele – Thea Dorn isst ein Eis und geht zur Bundestagswahl.
Streiten in Harmonistan – Thea Dorn sehnt sich nach streitbaren Zeitgenossen.
Der große Unernst – Thea Dorn ist des Theaters überdrüssig.
Die Kanzlerin der Lebkuchenherzen – Angela Merkel verspricht, die Kanzlerin ...
Textnachweis
Copyright
Verehrte Frau Dorn,
ich verstehe den Titel Ihres Buches nicht. Wollen Sie andeuten, dass es in Deutschland zu harmonisch zuginge? Das können Sie ja wohl nicht meinen. Bei uns vergeht doch kein Tag ohne Zank und Streit. Vor allem in der Politik nicht. Von echter Harmonie ist dieses Land sehr, sehr weit entfernt. Ich würde mir allerdings von Herzen wünschen, dass es harmonischer zuginge, deshalb verstehe ich nicht, warum Ihr Buchtitel so klingt, als ob Harmonie etwas Schlechtes wäre. Vielleicht können Sie mir das erklären.
Mit freundlichen Grüßen, Erika Mustermann
Verehrte Frau Mustermann,
haben Sie herzlichen Dank für Ihren Brief! Ich stimme Ihnen zu: In diesem Land wird gezankt, was das Zeug hält. Allerdings bin ich überzeugt, dass die allgemeine Verzanktheit – die unserer politischen Klasse im Besonderen – nichts anderes ist als ein Ausdruck der allgemeinen Verzagtheit. Dass in diesem Land ernsthaft gestritten würde, kann ich nicht erkennen.
Was aber ist ernsthafter Streit, werden Sie fragen. Inwiefern lässt er sich vom Zank unterscheiden? Und sind nicht beide das Gegenteil von Harmonie?
Zank widmen sich Menschen, deren Auseinandersetzung keinen anderen Inhalt kennt als das persönliche Interesse, den jeweiligen Eigennutz: Der eine will mehr Sozialleistungen erhalten, der andere weniger Steuern zahlen. Letztlich folgen solche Zwistigkeiten der Logik des Sandkastens. Das eine Kind plärrt, weil es nicht erträgt, dass ein anderes Kind ein größeres, schöneres, bunteres Eimerchen hat. Das privilegierte Kind beginnt zu plärren, sobald das benachteiligte Kind anfängt, an seinem Eimerchen zu zerren. Kaum sind die Mütter – Väter? – herbeigeeilt, ist der Zankfunke auch schon übergesprungen. Die Mutter des benachteiligten Kindes wird der Mutter des privilegierten Kindes in schrillen Worten vorhalten, wie ungerecht und unzumutbar es sei, dass deren Kind ihrem eigenen Kind, das mit einem alten schäbigen Eimerchen vorliebnehmen muss, mit seinem nagelneuen Luxuseimerchen vor der Nase herumwedelt. Der Gedanke, ihrem Kind zu erklären, dass schicke Eimerchen nicht das Wichtigste auf der Welt sind – oder dass ein Leben geprägt von Anstrengung und Leistungswille vor ihm liegen wird, strebt es bei seiner Herkunft danach, eines Tages ebenfalls in den Besitz funkelnder Eimerchen zu gelangen -, dieser Gedanke wird der Mutter des benachteiligten Kindes vielleicht kurz in den Sinn kommen. Sie wird ihn als unzeitgemäß verwerfen.
Die Mutter des privilegierten Kindes wiederum wird der Mutter des benachteiligten Kindes in gleichfalls schrillen Worten darlegen, dass es eben Pech sei, wenn die andere ihrem Kind zum Spielen nur ein altes Eimerchen mitgeben könne. Da sie jedoch ungern als neoliberale bitch dastehen möchte, wird sie ihr Kind fragen, ob es das benachteiligte Kind nicht doch zehn Minuten mit seinem schönen Eimerchen spielen lassen könne. Das Kind wird den mütterlichen Vorschlag zur Güte plärrend ablehnen. Wie sollte es sich auch anders verhalten, hat es doch nie gelernt, ein »Nein« zu akzeptieren.
Letztlich hoffen alle, dass die oberste Sandkastenaufseherin eingreifen und die Harmonie wiederherstellen wird – indem sie eine Runde Eiskrem für alle verspricht.
Mit dem Schlichtungsmodell »Eiskrem für alle« hat die deutsche Politik den Sandburgfrieden in den letzten Jahrzehnten erfolgreich aufrechterhalten. Was aber tun, wenn die Zeichen der Zeit darauf hindeuten, dass die Eiskrem knapp wird? Offensichtlich lässt sich in einer Demokratie Harmonie – zumindest an der Oberfläche – erkaufen. Anordnen lässt sie sich nicht. Der Weg de r Zwangsharmonisierung ist Diktaturen vorbehalten.
Wir können gern weiterhin rufen: »Harmonie! Harmonie über alles!« Dieser Ruf mag sogar von einer freundlichen Grundgesinnung zeugen. Letztlich wird er nur dazu beitragen, dass wir noch unfähiger werden, als wir es ohnehin schon sind, real existierende Differenzen auszutragen, Widerspruch und Ablehnung auszuhalten und so zu bändigen, dass sie nicht in Gewalt und Chaos enden. Materieller Wohlstand und das Zerfallen der geschlossenen Weltanschauungssysteme haben uns in Sachen Streit zu Analphabeten gemacht.
Echter Streit kann nur von Personen ausgetragen werden, die für etwas streiten, das den engen Horizont ihres unmittelbaren eigenen Vorteils übersteigt. Altmodisch ausgedrückt: Streiten können nur Menschen, die für eine Idee einstehen, die größer ist als sie selbst. Die Hotelsteuerermäßigung und die Frage, unter welchen Umständen das Sozialamt die Kosten fürs Kabelfernsehen übernimmt, zählen nicht dazu.
Streiter für die große Sache laufen allerdings stets Gefahr, sich in der schweren Rüstung der Ideologie zu verschanzen, so dass man mit Recht fragen kann, ob in diesen Rüstungen überhaupt noch lebendige, wahrnehmende, denkende Wesen stecken. Das metallische Scheppern früherer Zeiten, wenn die Phrasenpanzer aufeinanderkrachten, war kein schönes Geräusch. Wenn wir heute jedoch auf den Turnierplatz schauen, sehen wir nur mehr Haken schlagende Hasen und gerissene Igel – in der Sprache der Politik: Moving targets, die sich auf keine Position festlegen lassen. Die unschönen Geräusche sind seltener geworden – dafür herrscht jetzt enervierendes Dauerrauschen.
Mit dem Ende des Kalten Kriegs hat sich ein postideologisches Vakuum ausgebreitet. Der einzige Weg, neue Gedanken in diesen geistigen Leerraum hineinzulassen, wäre es, unideologisch, aber dennoch ernsthaft um Überzeugungen und Haltungen zu ringen. Warum nutzen wir die Abkehr vom alten ideologischen Rüstzeug nicht, uns der Realität samt ihrer Widersprüchlichkeit mit unbewaffnetem Auge zu stellen? Trotz aller postmodernen Unkenrufe: Es gibt sie noch, die gute alte Wirklichkeit. Auch wenn es uns bisweilen so scheinen mag, als ob sie hinter all den Bildschirmen verloren gegangen wäre – solange wir als sterbliche, leidensanfällige Wesen aus Blut und Fleisch existieren, solange es nicht Manna vom Himmel regnet, sind wir noch von dieser Welt. Es geht darum, dem Dasein Sinn zu verleihen, ohne Zuflucht in einem religiösen, philosophischen oder politischen Walhall zu suchen.
Es ist gut, dass wir im Begriff sind zu verlernen, wie man sich hinter Kommunismus, Konservatismus, Feminismus oder irgendeinem anderen Ismus verbarrikadiert. Dennoch brauchen wir Weltanschauungen, die stabil genug sind, uns Rückgrat und Richtung zu verleihen. Der relativistische Luftikus, dem alles gleich lieb und letztlich alles egal ist, ist nicht weniger obsolet als der Betonschädel, der nicht bereit ist, über seine Festungsmauern hinauszuschauen.
Für eine Überzeugung geradezustehen, heißt nicht, sich die eigene Nachdenklichkeit zu verbieten. Ein begründeter, für andere nachvollziehbarer Wandel der eigenen Position ist kein Opportunismus. Der Opportunismus, wie wir ihn nicht nur in der Politik, sondern auch in anderen Bereichen der öffentlichen Auseinandersetzung erleben, fängt dort an, wo niemand mehr eine Überzeugung vertritt, weil er wirklich überzeugt ist, weil sie zum Bestandteil seiner Identität geworden ist und sich mit dieser entwickelt. Sondern dort, wo jeder nur noch die Meinung vertritt, die ihm den größten Applaus beim Publikum, sprich: bei der jeweiligen Mehrheit, beschert. Die Popularität einer bestimmten Meinung ist aber kein Ersatz für deren Wahrheit, Richtigkeit und Wahrhaftigkeit. In früheren Zeiten befragten Denker, Religionsstifter und manchmal sogar Staatsmänner ihr Gewissen, bevor sie eine Entscheidung trafen. Heute rufen sie beim Markt- und Meinungsforschungsinstitut an – und beschweren sich dann, wenn der öffentliche Wirbelwind sein launiges Herbstspiel mit ihnen treibt.
Immer hektischer werden die Umfragen, Online-Votings und sonstigen Mätzchen, die dem »User« einflüstern, seine Stimme würde gehört. Entwickelte, komplexere, widerspenstige Positionen samt den dazugehörigen Persönlichkeiten haben schlechte Karten. Was zählt, ist die flexible adhoc-Stellungnahme zu diesem und jenem Thema. Während der »User« das fragwürdig triumphale Gefühl genießt, Politiker, Verleger, Fernsehintendanten und andere »Meinungsmacher« mit seinen wöchentlichen, täglichen, stündlichen Abstimmungsergebnissen vor sich her zu treiben, beklagt er das kopflose Hickhack, das er selbst mit produziert. Wer sich nach aufrechteren, klareren Positionen sehnt, möge seinen Zeigefinger für eine Weile zu anderen Dingen nutzen, als ständig den Voting-Button zu drücken. Was auf den ersten Blick mustergültig basisdemokratisch zu sein scheint, trägt in Wahrheit dazu bei, die Demokratie auszuhöhlen.
Verehrte Frau Mustermann, selbstverständlich halte ich echte Harmonie für nichts Schlechtes. Im Gegenteil: Ich halte sie für etwas Kostbares und Großes. Doch wie alle kostbaren und großen Dinge ist sie nicht der Normal-, sondern der Ausnahmezustand. Wird Harmonie zur Ideologie erhoben, bekommt sie etwas Totalitäres. Sie kaschiert, was unter der Oberfläche brodelt. Sie gaukelt uns eine Sicherheit vor, die nicht existiert. Sie befördert Opportunisten, Karrieristen und Duckmäuser. Wenn die Mächtigen den Streit mit denen scheuen, die sie für ihre Klientel halten, weil sie sich die Gunst ihres Publikums nicht verscherzen wollen, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als untereinander zu zanken. Weil keiner mehr für die richtigen Ziele streitet, verzetteln sich alle im Zank um Nebensächlichkeiten.
Was wären aber die richtigen Ziele, für die es sich lohnt, aufrecht und entschlossen zu streiten? Meine Antwort ist einfach: Es geht um den Erhalt oder gar die Verbesserung einer offenen Gesellschaft. Denn sie ist die einzige, die es Menschen gestattet, mit all ihren Vielschichtigkeiten und Widersprüchen zu leben. Dies bedeutet, allen Feinden der Komplexität entgegenzutreten. Dazu gehören diejenigen, die nicht willens sind, die Verantwortung für ihre Lebenskämpfe in erster Linie selbst zu übernehmen, weil sie ihnen als Zumutung erscheinen. Dazu gehören diejenigen, die Komplexität mit Beliebigkeit verwechseln und den muslimischen Frauenschinder für einen ebenso wertvollen Charakter halten wie die junge Muslima, die ihre Emanzipationskämpfe mit ebendiesem austragen muss. Dazu gehören biologistische und religiöse Dogmatiker, die uns einreden, dass wir im Leben ohnehin keine Wahlmöglichkeiten hätten. Dazu gehören die Apokalyptiker, die an unserer offenen Lebensform kein gutes Haar lassen und uns die Umkehr zu vormodernen Lebenseinstellungen predigen.
Der Streitsüchtige und der Harmoniesüchtige leiden unter demselben Defizit: Sie wissen nicht, wer sie sind. Sie können sich selbst nicht leiden. So wie der hässliche Deutsche sein hohles Ego aufblähte, indem er überall »Parasiten« witterte und sich aufmachte, diese zu vernichten, hat der gute Deutsche von heute vor seinem hohlen Ego kapituliert und legt sich vorsichtshalber mit überhaupt niemandem mehr an, auch wenn dieser Jemand ihm ins Gesicht sagt, wie sehr er ihn verachtet.
Verehrte Frau Mustermann, ich suche keinen Streit. Ich finde ihn.
In diesem Sinne grüßt berzlichIhre Thea Dorn
Das Beta-Tier
Thea Dorn reist in den Busch und sieht bekannte Gesichter.
Schilder warnen vor den Löwen. »Waarskuwing! Leeus indiearea!« Der freundliche Wildhüter springt vom Jeep, um das schwere Tor zu öffnen, das eher zur Werkseinfahrt von Messerschmidt-Bölkow-Blohm passt als zu einem Tierreservat im südafrikanischen Busch. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen, die Berge am Horizont lassen sich lediglich erahnen, Kameldornbäume krümmen sich, als hätten sie in der Nacht bei Quasimodo gelernt. Mein Begleiter und ich sind sehr still, als der Wildhüter den Jeep über die Schwelle rollen lässt. Wir hören das metallische Schnalzen, mit dem sich das Tor hinter uns schließt. Der Anfang von Jurassic Parc III fällt mir ein und des hellsichtigen Paläontologen Prognose, dass es stets mit »aaah!« und »oooh!« beginnt – um stets mit »kreisch!« und »renn!« zu enden. Wir fahren los.
Die Luft ist kühl, außer den Kameldornbäumen und ein paar flachen Schwarzdornbüschen gibt es nichts zu sehen. Die Fauna ziert sich. Ich versuche mich an das zu erinnern, was ich vor Jahren in der logisch-semantischen Propädeutik gelernt habe. War es kein gültiger Umkehrschluss: Wenn etwas nicht mit »aaah!« und »oooh!« beginnt, wird es auch nicht mit »kreisch!« und »renn!« enden? (Hoffnung und Logik sind schlechte Bettgefährten.)
Eine beim Morgenspaziergang aufgeschreckte Warzenschweinfamilie entlockt meinem Begleiter den Anflug eines »Aaah!« Schnell halte ich ihm den Mund zu.
Nach einer Stunde Fahrt durch ruppiges Buschgelände haben wir eine weitere Warzenschweinfamilie, fünf Giraffen und eine Herde der unvermeidlichen Springböcke gesehen. Von Löwen noch immer keine Spur. Der freundliche Wildhüter scheint zu befürchten, wir wären enttäuscht, und beginnt zu erzählen: Achtzehn Löwen gäbe es im Reservat. Fünf männliche, dreizehn weibliche. Sieben der Tiere seien Jungtiere, in den letzten zwölf Monaten hier im Reservat geboren.
»Gab’s schon mal Ärger?«, will ich wissen.
»Ärger?« Der Wildhüter lacht, während er den Jeep einhändig über einen Schwarzdornbusch hinwegrumpeln lässt. »Nicht wirklich. Nur einmal, als wir den Beta-Löwen frisch ins Reservat geholt hatten, da war die Hölle los.«
»Den Beta-Löwen?«, hake ich nach.
»Der ist völlig ausgerastet. Eine Woche lang hat er immer wieder versucht, den etablierten Alpha-Löwen zu verdrängen. Am Ende bestand er nur noch aus Fell- und Fleischfetzen.«
»Der Beta-Löwe«, stelle ich klar.
Der Wildhüter nickt. »Als er endlich eingesehen hat, dass es nichts wird mit der Alpha-Position, ist er ausgebrochen.«
»Ausgebrochen?« Meine Stimme wird schrill. »Aber wir sind doch vorhin durch dieses Monstertor gefahren, und Sie haben gesagt, das ganze Reservat sei mit einem Starkstromzaun gesichert.«
Der Wildhüter lächelt mir zu, wie er vermutlich schon Hunderten von dummen Touristen zugelächelt hat. »Das ist es auch, dieser Zaun gibt Schläge mit zehntausend Volt ab. Unser Beta-Löwe hat sich lieber sein restliches Fell weggrillen lassen, als noch eine Stunde länger im Revier des Löwen zu bleiben, der ihn besiegt hat.«
»Und was ist dann passiert?«
»Er hat die halbe Rinderherde des benachbarten Farmers niedergemacht. Und das nicht, weil er hungrig war. Sondern einfach so. Um seinen Frust abzubauen. Wir haben einen ganzen Tag gebraucht, um ihn einzufangen und wieder ins Reservat zurückzubringen.«
»Und dann? War Ruhe?«, frage ich hoffnungsvoll. Zwei Oryxantilopen, die merken, dass sie trotz Hornpracht nicht beeindrucken können, wenden sich beleidigt ab.
»Von wegen.« Der Wildhüter jagt den Jeep durch ein Feld Teufelsdorn, als wollte er die gelben Blüten für etwas bestrafen. »Der Beta-Löwe ist noch in derselben Nacht wieder durch den Zaun gebrochen. Das gleiche Spiel von vorn. Ein Alpha-Löwe würde nur so ausrasten, wenn sein Rudel angegriffen würde. Die meisten Löwen sind Gamma-Tiere und als solche ohnehin harmlos. Aber ein Beta-Löwe ist nicht ruhig zu stellen. Bevor der aufgibt, bringt er sich lieber selber um.«
Um zwölf beginnt im Busch die Siesta. Ich ziehe mich ans schattige Ende der Sonnenterrasse zurück, dorthin, wo der Blick ungehindert grasen kann. Am benachbarten Wasserloch entdecke ich ein paar Antilopen und bin stolz, dass ich sie sofort als Nyalas identifizieren kann. Über der Frage, ob es nicht vielleicht doch Impalas oder gar weibliche Kudus sein könnten, dämmre ich weg.
Anscheinend habe ich tatsächlich geschlafen. Als ich hochschrecke, spüre ich, dass etwas nicht stimmt. Die Antilopen sind verschwunden. Nicht einmal eins der verlässlichen Eichhörnchen lässt sich blicken. Doch halt. Dort hinter dem Schwarzdorn blitzt ein Schnurrbart hervor. Mit einem Schlag sitze ich aufrecht. Der Beta-Löwe!, schießt es mir durch den Kopf. Er muss wieder ausgebrochen sein. Warum habe ich Idiotin vergessen, den Wildhüter beim Mittagessen zu fragen, was aus dem Beta-Löwen geworden ist. Auf unserer Morgensafari hatte plötzlich das einzige schwarze Nashorn des Reservats vor uns gestanden und die Beta-Löwen-Diskussion abrupt beendet.
Ein Schweißtropfen löst sich in meinem Nacken. Ich versuche, so flach wie möglich zu atmen und starre in den Schwarzdornbusch hinein. Da ist er wieder. Der Schnurrbart. Es muss an der Hitze liegen. Ich schließe die Augen. Als ich sie wieder öffne, ist die Erscheinung verschwunden. Zitternd lasse ich mich in den Liegestuhl zurücksinken. Doch dann weiß ich, dass ich nicht halluziniert habe. Jürgen Möllemann! Ich habe im Schwarzdornbusch den Schnurrbart von Jürgen Möllemann gesehen! Mit einem Mal wird mir klar, dass ich heute Morgen keinem Wildhüterlatein, sondern einer Weltformel gelauscht habe.
Die Einzigen, die wirklich Arger machen, sind die Beta-Tiere.
Plötzlich ergibt alles einen Sinn: Der ewige Stellvertreter im Schatten von Genscher. Nach dessen Abgang nun endlich wenigstens Vizekanzler. Doch was tut Möllemann? Benutzt sein ministerielles Briefpapier, um deutschen Supermärkten Einkaufswagen-Chips eines Vetters zu empfehlen! Rücktritt. Die nächste Attacke: Strategie 18. Kanzlerträume. Doch wieder spürt er den heißen Atem eines Rivalen: Guido Westerwelle. Aber ist der nicht selbst ein Beta-Tier? Warum wird dann dieser und nicht er, Jürgen Möllemann, Bundesvorsitzender der FDP? Der letzte Versuch, doch noch ganz nach oben zu kommen: Ein Flugblatt gegen die zionistische Weltverschwörung. Das Parteirudel hat genug und schickt den Troublemaker in die Savanne. Einsam hebt er ab, kein Fallschirm soll ihn mehr aufhalten: »Ich springe heute einen Einzelstern.«
Ein Beta- Tier gibt nicht auf. Lieber bringt es sich selber um.
In einem nahen Korallenbusch raschelt es. Zwei vorwitzige Ohren leuchten auf. Ein Kaphase? Nein! Marco Pantani ist es, der gerade davonspringt. Ilpirata, der italienische Radprofi mit dem Piratenkopftuch. Einmal konnte er die Tour de France gewinnen, dann kam Lance Armstrong und stellte klar, wer ab sofort das Alpha-Tier im Peloton ist. Wie geriet il pirata außer sich, als der Amerikaner ihm am Mont Ventoux gnädig den Tagessieg überließ, und zwang ihn bei der nächsten Bergetappe in so selbstzerstörerische Zweikämpfe hinein, dass beinahe beide totvom Rad gefallen wären. Doch auch diese Tour gewann Armstrong. Im Februar desselben Jahres, in dem der Alpha-Rivale zum sechsten Mal als Sieger in Paris ankommen sollte, nahm Pantani sich in einem schäbigen Hotelzimmer in Rimini das Leben.
»Aber was ist mit Jan Ullrich?«, flüstert es aus einem flachen Honigbusch, »ist er nicht der ewige Zweite und damit das eigentliche Beta-Tier?«
»Unser Ulle!?«, rufe ich zurück. »Ach was! Hast du schon einmal gehört, wie es klingt, wenn der erklärt, in diesem Jahr wolle er es Armstrong wirklich zeigen? Es klingt wie bei Asterix, wenn die verdroschenen Römer auf Kommando murmeln, dass die Gallier diesmal aber echt nix zu lachen hätten. Und außerdem. Was hat unser Ulle schon angestellt? Er hat mal seinen Porsche besoffen in einen Radständer gesetzt. Nein, nein. Unser Ulle ist ein friedliches Gamma-Tier, das aus Versehen mit den stärksten Waden der Welt und einer viel zu großen Lunge geboren wurde.«
Der Honigbusch schweigt. Doch von einem der weiter entfernten Schäferbäume ertönt ein Lockruf. »La-lo-lä!«, trillert es. »La-lo-lä!«
Klar! Oskar Lafontaine! Des Saarlands pfiffiges Napoleönchen, das Seite an Seite mit dem Alpha-Tier Schröder das Gamma-Tier Scharping am Nasenring herumführte, als dieses sich in einem Anfall von Selbstüberschätzung für spitzentauglich hielt. Und das anfing rot zu sehen, als Alpha-Schröder immer hartnäckiger Kanzler wurde: Schröder soll zurücktreten! Das Volk lässt sich nicht auflösen! Ich werde eine eigene Partei gründen! Links von der SPD!
Vom Horizont her höre ich eine Hyäne lachen. Was will sie mir sagen? Dass ich die Beta-Tiere in der CDU nicht vergessen darf? Die Herren vom Andenpakt, die gleichfalls lieber die eigene Partei zerlegen werden, bevor sie sich dem Alpha-Weibchen aus Ostdeutschland unterwerfen?
Ich halte mir die Ohren zu. Hinter den Bergketten kündigt sich ein Gewitter an.
Das Beta-Tier wird niemals verkraften, kein Alpha-Tier zu sein.
Geht nicht aus allen Biografien von Serien- und Massenmördern hervor, dass sie sich für die geborenen Alpha-Tiere halten, dass dies außer ihnen selbst nur leider niemand erkennen will? Glaubte der Amok-Schüler von Erfurt, Robert Steinhäuser, nicht fest an seine natürliche Überlegenheit, während der Schuldirektor ihn längst abgeschrieben hatte? Wollte der aus einer braven kleinbürgerlichen Gamma-Familie stammende Magnus Gäfgen nicht unbedingt bei den Kindern der Frankfurter Alpha-Familien mitspielen, so sehr, dass er eins von ihnen, den Bankierssohn Jakob von Metzler, entführte und tötete?
Das Beta- Tier nimmt keine Rücksicht auf Verluste. Weder auf eigene, geschweige denn auffremde.
Ein erster Tropfen trifft mich auf der Stirn. Unbewegt bleibe ich sitzen. Ich weiß, dass es keine Adlereule ist, die mich vom fahlen Bastardkameldorn herab anstarrt. Es ist das Urbild der neusten Terroristenspezies: der Mohammed-Atta- Täter. Junge Männer, im nahen Orient zusammen mit viel zu vielen anderen jungen Männern geboren. Mamas kleiner Alpha-Tyrann, schon bevor er gehen kann, Papas Fünftgeborener – oder war er doch nur der Siebte? Vielleicht ist der Witz, warum Busse zehn Meter breit und nur einen Meter lang sind (weil alle neben dem Fahrer sitzen wollen) gar kein ostfriesischer, sondern ein muslimischer. Irgendwann merkt Mamas kleiner Tyrann, dass alle wichtigen Positionen in Papas Erdöl-Imperium schon mit seinen älteren Brüdern besetzt sind und für ihn selbst bei Lichte besehen nur die Rolle des Gamma-Bruders bleibt. Und so geht er entweder zu den Muslimbrüdern, die ihn als Einzelnen zwar gnadenlos noch nicht einmal zum Gamma-, sondern gleich zum Omega-Tier zurechtstutzen, aber ihm zum Ausgleich erzählen, dass sie – alle zusammen – Alphaplus sind. Oder Mamas kleinerTyrann ist noch cleverer und geht erst einmal in den Westen. Denn im verkommenen Westen darf sich selbst der Beta-Muslim als Alpha-Tier fühlen. Doch irgendwann merkt Mamas kleiner Tyrann, dass der Westen seinen gottgegebenen Alpha-Anspruch nicht anerkennen will, sondern ihn – nun ja: bestenfalls als Beta-Tier behandelt. Das ist der Moment, in dem Mamas kleiner Tyrann den Pilotenschein macht. Landeerlaubnis unnötig.
Als ich das nächste Mal nach oben schaue, ist der Himmel schwarz. Es regnet, als habe irgendwer beschlossen, aus der Steppe ein Meer zu machen. Ich lasse meinen durchweichten Sonnenstuhl stehen und renne davon.
Beim Abendessen ist mir bereits übel, bevor ich erfahre, dass der Fleischauflauf, den es gab, aus Springbock gemacht war. Draußen sind überall Pfützen, und meine Schuhe sind gerade getrocknet, dennoch gehe ich los, um den Wildhüter zu suchen. Er steht auf der Terrasse und schaut der dampfenden Erde zu.
»Sie haben heute Morgen die Geschichte nicht zu Ende erzählt«, rufe ich, bevor er mich hat kommen hören. »Was ist aus dem Beta-Löwen geworden?«
Der Wildhüter dreht sich um. »Aus unserem Troublemaker?« Er lächelt ein trauriges Lächeln. »Er ist noch ein drittes Mal ausgebrochen. Dann haben wir ihn in den Hochsicherheitstrakt gebracht.«
»In den Hochsicherheitstrakt?«, frage ich. Der Horizont glüht.
»Ja. Unser Beta-Löwe sitzt jetzt in Johannesburg«, sagt der Wildhüter und wendet sich der fast versunkenen Sonne zu. »Im Zoo.«
Leben unter Vorbehalt
Thea Dorn fragt sich, wie die Generation, die mit ihrer Freiheit nichts anzufangen weiß, doch noch erwachsen werden kann.
Vor Kurzem lernte ich auf einer Party eine Frau kennen. Nina ist Anfang dreißig, lebt in Berlin, hat längere Beine als Marlene Dietrich, ein ansteckenderes Lachen als Liselotte Pulver, und als ich erfuhr, dass sie Bezirksmeisterin in Karate war und gerade an einer Reportage über »moderne Piraten« schreibt, war ich endgültig beeindruckt.
Wir verabredeten uns für die folgende Woche auf einen Kaffee, und ich dachte: »Endlich mal eine entspannte, souveräne Frau.«
Als ich Nina im Cafe traf, war ich wieder beeindruckt. Sie erzählte von ihrer Reise durch Indonesien, Sumatra, Malaysia, die sie im letzten Sommer (allein) unternommen hatte, und bei der ihr die Idee zu der Reportage gekommen war. Vielleicht enthielte die Geschichte sogar genügend Stoff für ein Buch.
Irgendwann später-wir waren vom Kaffee auf Gin Tonic umgestiegen – erklärte sie, dass das mit dem Beruf doch alles nicht so wichtig sei. Im Übrigen sei ohnehin völlig unklar, ob sie die Reportage, geschweige denn das Buch, jemals unterbringen würde. Außerdem hänge ihr die ganze Schreiberei zum Hals heraus. Im Grunde sei sie nur deshalb beim Journalismus gelandet, weil ihr damaliger Freund auch geschrieben habe, und sie das Gefühl gehabt habe, sie müsse »ihm das Wasser reichen«. Wenn sie ehrlich wäre, würde sie viel lieber etwas ganz anderes machen: Yogalehrerin zum Beispiel. Oder einen Weinladen eröffnen. Berlin könne sie auch nicht mehr ertragen – andererseits sei sie in den letzten zehn Jahren elfmal umgezogen, und die ewige Umzieherei hänge ihr noch mehr zum Hals heraus als die Schreiberei. Die Wahrheit sei, dass sie endlich einen richtigen Mann kennenlernen wolle, und nicht immer nur solche »Hallöchens«, mit denen man ein paar Wochen Spaß haben könne, die aber niemals für »was Ernsthaftes« infrage kämen. Das sei nämlich die »Wahrheit zwei«: Sie wolle Kinder, und es kotze sie an, wie unzuverlässig die Kerle seien. Aber vielleicht liege es ja auch an ihr, sie selbst sei schließlich unfähig, sich dauerhaft zu binden – sie bringe es nicht einmal fertig, eine Zimmerpflanze so zu gießen, dass sie nicht nach einem Monat die Blätter hängen ließe. Inzwischen sei sie so weit, dass sie ihre Schwester, die in einer süddeutschen Kleinstadt lebt, seit zehn Jahren verheiratet ist, in der Arztpraxis ihres Mannes mithilft und sich ansonsten einfach nur um ihre drei Kinder und den Garten kümmert – dass sie diese Schwester, die sie früher stets verachtet hatte, um ihr Leben beneiden würde.
Auf dem Heimweg war ich einigermaßen ratlos. Nicht, weil mir diese Anwandlungen, das Gefühl, im Vorspiel zum eigentlichen Leben steckengeblieben zu sein, gänzlich fremd wären. Auch ich habe zwischen verschiedensten Jobs, Wohnungen, Beziehungen gelebt, als sei das Leben ein Cabrio, das man nach misslungener Testfahrt wieder beim Autohändler zurückgibt, um es beim nächsten Mal lieber mit einem Geländewagen zu versuchen. Allerdings liegt diese Lebensphase hinter mir. Und ich bin froh, dass ich keine Energie mehr darauf verschwenden muss, mir auszumalen, was ich alles tun werde, »wenn ich groß bin« – sondern dass ich meine ganze Kraft in die Gestaltung jenes Lebens stecken kann, das ich tatsächlich führe: Mit dem Beruf, den ich liebe, mit dem Mann, den ich liebe, in der Stadt, in der ich heimisch geworden bin.
Habe ich einfach nur Glück gehabt? Oder gibt es einen Grund, warum ich mich mit Ende dreißig in meinem Leben angekommen fühle – und das, obwohl mir alle Attribute der klassischen, »bürgerlichen« Arriviertheit fehlen: Weder bin ich verheiratet, noch habe ich Kinder oder ein Eigenheim – während Nina von dem Gefühl gehetzt wird, sich in der Warteschleife zu ihrem eigentlichen Leben verheddert zu haben?
Das heimliche Aschenputtel
Anfang der 8oer Jahre veröffentlichte die amerikanische Psychotherapeutin Colette Dowling ein Buch, in dem sie analysiert, warum so viele scheinbar emanzipierte, beruflich durchaus erfolgreiche Frauen mit ihrem Leben unzufrieden sind – unabhängig davon, ob sie in Beziehungen leben oder nicht, und unabhängig davon, ob sie Kinder haben oder nicht. Es heißt Der Cinderella-Komplex, und die Autorin kommt zu dem ernüchternden Ergebnis: »Im tiefsten Inneren will ich nicht selbst für mich sorgen. Ich möchte, dass es jemand anders tut.«
Gerade jüngere Frauen verdrehen allerdings genervt die Augen, wenn man den Verdacht äußert, dass sie, fünfundzwanzig Jahre später, immer noch an diesem »Cinderella-Komplex« litten. Ich bin sicher: Auch ich hätte in meinen Zwanzigern angefangen loszufauchen, hätte mir jemand unterstellt, auf dem Grunde meines rebellisch spätpubertären Herzen ein Aschenputtel zu sein. Als ich das Buch vor einigen Jahren las, musste ich jedoch an meine eigenen, völlig missratenen Beziehungsversuche der damaligen Zeit denken. Nach allem, was ich heute weiß, bin ich wohl tatsächlich nicht auf der Suche nach einem »Beschützer« im klassischen Sinne gewesen – aber hatte ich von meinen »Partnern« nicht insgeheim erwartet, dass sie mich mit mir versöhnten? Dass sie mir endlich zeigten, was in mir steckt? Wer ich wirklich bin?
Bei den Gesprächen, die ich zu meinem Interviewbuch Die neue F-Klasse geführt habe, war ich überrascht, als Sarah Wiener, die erfolgreiche Köchin und Unternehmerin, die gewiss nicht im Verdacht steht, ein Aschenputtel zu sein, unverblümt zugab: »Obwohl meine Mutter zu mir [...] immer gesagt hat: >Heirate bloß nie!<, habe ich meine Internatszeit im Wesentlichen damit zugebracht, von dem tollen Typen zu träumen, der eines Tages kommen und mich auf seinen starken Händen endlich in mein Leben hineintragen wird. [...] Als Jugendliche dachte ich nur: Ich kann nichts und bin nichts. Gleichzeitig hatte ich tief in mir drin das Gefühl: Aber eigentlich bin ich ja etwas ganz Besonderes und Tolles. Vielleicht war ich so eine Art Froschkönigin. Ich dachte, wenn der Prinz auf dem weißen Schimmel angeritten kommt und mich küsst, dann bricht mein Lebensglück, dann brechen Glanz und Gloria endlich hervor.«
Auf meine Nachfrage, ob es denn so gekommen sei, antwortete Sarah Wiener lachend: »Ich muss meinen beiden Ehemännern wirklich dafür danken, dass sie keine Mr. Rights waren. Wer weiß, wenn sie zuverlässiger, >perfekter< gewesen wären, hätte ich vielleicht noch viel länger gebraucht, um zu erkennen, was eigentlich jedes Horoskop-Abziehsprüchlein weiß: >Dein wahres Glück, liebe Sarah, das liegt nur in dir selbst.«‹
An diese Selbsterkenntnis und an Ninas Unglück musste ich denken, als mir das Buch Neue deutsche Mädchen von Jana Hensel, Jahrgang 1976, und Elisabeth Raether, Jahrgang 1979, in die Hände fiel. Anfangs ärgerte ich mich über den Titel, weil ich es für einen albernen Verlagseinfall hielt, ein Buch über dreißigjährige Frauen Neue deutsche Mädchen zu nennen. Doch im Laufe der Lektüre wurde mir klar, dass derTitel keinem bloßen Marketingkalkül entsprungen war, sondern dass die Autorinnen sich tatsächlich eher als unbehauste, suchende »Mädchen«, denn als gestandene Frauen begriffen.
So schreibt etwa Elisabeth Raether: »Ich blieb in keiner