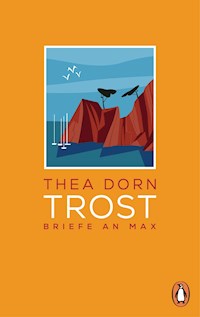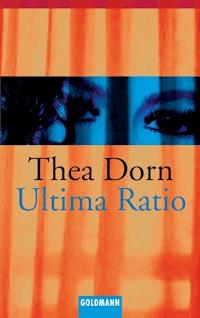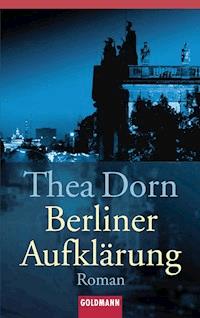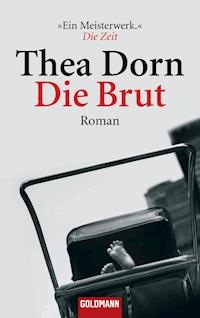19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaus
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Von Gemütlichkeit und Grundgesetz, von Abendbrot bis Zerrissenheit. Alles was deutsch ist.
So ein Buch hat es noch nicht gegeben. Zwei Autoren, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten, erkunden liebevoll und kritisch, kenntnisreich und ohne Berührungsängste, was das eigentlich ist, die deutsche Seele. Sie spüren sie auf in so unterschiedlichen Begriffen wie »Abendbrot« und »Wanderlust«, »Männerchor« und »Fahrvergnügen«, »Abgrund« und »Zerrissenheit«. In sechzig Kapiteln entsteht auf diese Weise eine tiefgründige und facettenreiche Kulturgeschichte des Deutschen.
Alle Debatten über Deutschland landen am selben Punkt im Abseits: Darf man das überhaupt öffentlich sagen, etwas sei »deutsch« oder »typisch deutsch«? Kann man sich mit dem Deutschsein heute endlich versöhnen? Man muss es sogar, meinen Thea Dorn und Richard Wagner. Sie verspüren eine große Sehnsucht danach, das eigene Land wirklich kennen zu lernen, und machen Inventur in den Beständen der deutschen Seele. Ihr Buch ist eine erkenntnisreiche und unterhaltsame Reise an die Wurzeln unseres nationalen Erbes und geht durchaus ans Eingemachte. Obwohl es sich auch als Enzyklopädie lesen lässt, sind die Texte nicht aus nüchterner Distanz geschrieben. Auf diese Weise entstehen leidenschaftliche Plädoyers für bestimmte Merkmale des Deutschen, für ein damit verbundenes Lebensgefühl. Diese »Liebeserklärung« der Autoren ist ein sinnliches, reich bebildertes Buch, das die deutsche Seele einmal nicht seziert, sondern sie anspricht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 862
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Lieber Leser
sei gewarnt! Dies ist ein Buch, in dem du nicht gewarnt wirst vor dem Deutschen. Wir wollen dieses Land nicht in den Sektionssaal schieben, wir beugen uns nicht im weißen Kittel mit spitzem Werkzeug darüber, um einzig die kranken Stellen herauszuschneiden und unter dem Mikroskop zu betrachten. Wir sind keine Pathologen – wir sind Beteiligte. Getrieben von der Sehnsucht, die Kultur, in der wir leben, in all ihren Tiefen und Untiefen, in ihrer Größe und Schönheit, in ihren Schrullen und Fragwürdigkeiten zu erkunden.
Luft ist uninteressant, solange sie selbstverständlich ist. Erst wenn sie dünn wird, beginnst du, sie zu spüren. Erst wenn du sie zu vermissen beginnst, spürst du, dass da etwas ist, das du nicht verlieren willst.
Wir machen uns keine Sorgen, dass Deutschland sich abschafft. Wir sehen nur, dass es sich herunterwirtschaftet. Sein Gedächtnis verliert. Die einen haben die deutsche Scham, die keiner ablegen kann, der diesem Land entstammt, zum Schuldpanzer verhärtet, hinter dem sie sich verschanzen. Die Verbrechen des Nationalsozialismus sind ihnen weniger Schmach und Schmerz als der Beweis, dass alles Deutsche mit der Wurzel ausgerissen gehört. Die anderen tummeln sich in dem Kahlschlag, den die wohlmeinenden Nashörner angerichtet haben. Ihnen fehlt nichts, solange der Fernseher läuft und im Kühlschrank genügend Bier steht. Und dennoch spüren wir ein wachsendes Deutschlandsehnen.
Das Fußball-Sommermärchen hat uns gezeigt, dass wir die Scheu im Umgang mit Fahne und Hymne ablegen dürfen, und die Welt uns dennoch nicht erneut zu hassen beginnt, im Gegenteil. Aber was ist mit diesem »fröhlichen Patriotismus« gewonnen, wenn er sich darauf beschränkt, dass wir alle vier Jahre die schwarz-rot-goldenen Fähnchen aus dem Schrank holen? Haben dieses Land, seine Geschichte und seine Kultur uns nicht unendlich mehr zu erzählen?
Seit Jahren streiten wir darüber, welche Einwanderer dazugehören und welche nicht. Dient diese ganze Debatte nicht letztlich dem Zweck, von dem abzulenken, worüber wir eigentlich diskutieren müssten: Was von Deutschland noch zu Deutschland gehört? Was dieses Land ist jenseits der lexikalischen Auskunft, es sei ein föderalistischer, freiheitlich-demokratischer und sozialer Rechtsstaat in der Mitte Europas, gebildet aus 16 Bundesländern? Wir machen es uns zu einfach, wenn wir die Frage »Was ist deutsch?« reflexhaft abwehren und sie einzig im Verborgenen rumoren lassen. Jemand, der nicht weiß, wo er herkommt, kann auch nicht wissen, wo er hinwill. Er verliert die Orientierung, die Selbstgewissheit, den Lebensmut.
Deshalb sind wir auf Wanderschaft gegangen. Haben uns auf die Suche nach der deutschen Seele gemacht. Eine solche Suche kann keinem geraden Weg folgen. Wir haben uns leiten lassen von Begriffen, in denen uns das Deutsche am deutlichsten aufzublitzen scheint: Von »Abendbrot« bis »Männerchor«, von »Bruder Baum« bis »Fahrvergnügen«, von »Abgrund« bis »Zerrissenheit«.
Lieber Leser, folge auch du deiner Sehnsucht, deiner Neugier, deiner Leidenschaft! Du kannst das Buch mit jedem Artikel beginnen, dort weiterlesen, wohin es dich trägt. Du kannst aber auch den Wegweisern folgen, die wir am Ende eines jeden Textes aufgestellt haben.
Die Gedanken sind frei.
Berlin, im Sommer 2011Thea Dorn und Richard Wagner
ABENDBROT
Es ist karg. Es ist ein wenig pedantisch. Es ist liebevoll.
Seine Zubereitung erfordert keinen großen Aufwand, aber die wenigen Zutaten müssen mit Bedacht gewählt sein: Roggen-, Roggenmisch- oder Vollkornbrot, zu acht Millimeter dicken Scheiben geschnitten. Ein bisschen Butter. Käse (Tilsiter), Schinken (Schwarzwälder), Wurst (Jagdwurst). Und schön wäre eine saure Gurke, zum Ende hin blättrig aufgefächert. Die Brote werden mit der Butter dünn bestrichen, auf eins wird der Käse gelegt, auf eins der Schinken, auf eins die Wurst. Idealerweise entsprechen Form und Größe der Käse-, Schinken- und Wurstscheibe Form und Größe der Roggen-, Roggenmisch- oder Vollkornbrotscheibe. Nur so entsteht die Harmonie, die ein echtes Abendbrot auszeichnet.
Auch wenn man sein Abendbrot allein einnimmt, sollte man es keinesfalls stehend in der Küche oder vor dem Fernseher hinunterschlingen. Ein Abendbrot ist ein Abendbrot und kein Sandwich. Bei christlicher Neigung besinnt man sich aufs letzte Abendmahl, während man das Brot zwar nicht bricht, sondern voll Sorgfalt schneidet. Die protestantische Diätweisheit »Frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein Fürst, Abendessen wie ein Bettelmann« verliert alles Trostlose. Nicht weil man ans Schlankbleiben bzw. -werden denkt. Weil man sich freut, dass Schlichtes glücklich macht.
Anfängern, die das bloße Abendbrot nicht in die rechte Gemütslage zu bringen vermag, empfiehlt es sich, ein Bier zu öffnen. »Ich Geringer trinke täglich zum Abendbrot ein Glas helles Bier und reagiere auf diese anderthalb Quart so stark, dass sie regelmäßig meine Verfassung durchaus verändern. Sie verschaffen mir Ruhe, Abspannung und Lehnstuhlbehagen, eine Stimmung von ›Es ist vollbracht! ‹ und ›Oh, wie wohl ist mir am Abend!‹«, schrieb Thomas Mann im Jahre 1906.
Der musikalisch versierte Abendbrötler wird das Stichwort des Schriftstellers sogleich aufnehmen. Im Geiste singt er Kanon mit sich selbst: »O wie wohl ist mir am Abend, / Mir am Abend, / Wenn zur Ruh’ die Glocken läuten, / Glocken läuten, / Bim, bam, bim, bam, bim, bam!«
Doch auch der musikalisch weniger Versierte muss mit seinem Abendbrot nicht im Stillen sitzen bleiben. Er kann seine Stereoanlage aufdrehen und Sven Regener mit dessen Band Element of Crime lauschen: »Braungebrannte Arme brechen jeden Tag / Das harte Brot der Wirklichkeit, als wär’s das letzte Mal [...] Zum Abendbrot / Zum Abendbrot [...]«
Bild 137
Kerzenständer »Abendbrot«, entworfen vom Hamburger Designerduo Thesenfitz & Wedekind.
Die Tendenz, meditative Mahlzeit der Einsamen zu sein, hatte das Abendbrot seit je. Gleichzeitig war der Abendbrottisch jahrhundertelang der Ort, an dem der Hausvater die Familie versammelte, um über die Ereignisse des Tages zu berichten und sich berichten zu lassen, auf dass im Anschluss gerichtet werde. Spuren davon haben sich bis in die Gegenwart erhalten, weshalb das Abendbrot dem Spätpubertierenden, der dem Elternhaus entronnen ist, als Inbegriff spießigen Schreckens erscheint. Er schwört, des Abends künftig alles zu essen von kalten Dosenravioli bis hin zu drei Tage altem Sushi. Nur nie wieder ein belegtes Brot.
Dass belegte Brote einst in den erlesensten Zirkeln gereicht wurden, wenn man über Literatur, Politik und die großen Fragen der Welt plauderte, ist vergessen. Voll Stolz berichtete Johanna Schopenhauer ihrem Sohn Arthur, der zu jugendlicher Großmannssucht neigte, dass in ihrem Weimarer Salon nichts Kostspieliges, sondern lediglich Tee mit Butterbroten gereicht wird. Auch Rahel Varnhagen, die berühmteste Gastgeberin im romantischen Berlin, servierte Schlichtes, wenn sie die Größen ihrer Zeit zum »Teetisch« empfing. Die anschaulichste Beschreibung des gehobenen Abendbrots findet sich bei dem Juristen und Schriftsteller Felix Eberty, der uns in seinen Jugenderinnerungen eines alten Berliners in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts mitnimmt: »Bei den gewöhnlichen geselligen Abendzusammenkünften begnügte man sich [...] mit einer Tasse Tee und Butterbrot, und setzte einige sehr zierlich, aber auch recht sparsam mit Wurstscheibchen, Braten und Schinkenschnitten belegte Teller auf die Tafel.«
Geiz spielte bei dieser frugalen Sitte die unwesentlichste Rolle. Man wollte sich bewusst absetzen von den Abendschlemmereien in katholischen Ländern wie Frankreich, und ganz im Ernst: Wen interessieren Austern, gebratene Wachteln oder Petits Fours, wenn er die Wahl zwischen Johann Wolfgang von Goethe und Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Wilhelm und Alexander von Humboldt, Heinrich Heine und Bettine von Arnim hat? Kein Zufall also, dass die großbürgerlichen Gastgeberinnen erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als der deutsche Geist feister geworden war, ihren Ehrgeiz daransetzten, mit immer ausgefinkelteren Menüfolgen zu glänzen.
Den endgültigen Niedergang des geistigen Abendbrots bezeugte der Nachkriegs-Kabarettist Wolfgang Neuss, als er verkündete: »Heut’ mach ich mir kein Abendbrot, heut’ mach ich mir Gedanken.« Wie schön wäre es, sich zur Abwechslung wieder einmal Gedanken zum Abendbrot zu machen.
[td]
► ABENDSTILLE, BIERDURST, FEIERABEND, GEMÜTLICHKEIT, ORDNUNGSLIEBE, VEREINSMEIER, WURST
ABENDSTILLE
Hinter den Fenstern flackern die Bildschirme. Blaue Stunde. Der Zeiger der Fernsehuhr springt auf die Zwölf. Abendstille überall, nur am Bach die Nachtigall singt ihre Weise klagend und leise durch das Tal.
Ein gut frisierter Sprecher begrüßt den Pflüger, der vor seiner Hütte ruhig im Schatten sitzt. Dem Genügsamen raucht sein Herd. Gastfreundlich tönt dem Wanderer im friedlichen Dorfe die Abendglocke. Wohl kehren jetzt die Schiffer zum Hafen auch in fernen Städten.
Der Versuch, die gekaperte Loreley Zwei zu befreien, ist blutig gescheitert.
Fröhlich verrauscht des Markts geschäftiger Lärm. In der Euro-Schuldenkrise ist das Schlimmste überwunden. Doch gestürzt sind die goldenen Brücken und unten und oben so still! Es will mir nichts mehr glücken, ich weiß nicht mehr, was ich will. Von üppig blühenden Schmerzen rauscht eine Wildnis im Grund, da spielt wie in wahnsinnigen Scherzen das Herz an dem schwindlichten Schlund.
Die Unruhen in der Brust gehen auch nach der Aussprache des Herzens weiter. Das Auswärtige Amt rät von allen nicht notwendigen Reisen ins Innere der Brust ab.
Beim Bundesliga-Nordderby kam es zu Ausschreitungen, nachdem die Schwalbe sich zum Abendliede auf das Stänglein unterm Dach geschwungen hatte. Ordnungskräften gelang es, den Frieden im Feld und in der Stadt rasch wiederherzustellen. Die Schlachtenbummler konnten ohne weitere Zwischenfälle zum Bahnhof geleitet werden.
Der schnelle Tag ist hin. Die Nacht schwingt ihre Fahn’ und führt die Sterne auf. Der Menschen müde Scharen verlassen Feld und Werk. Wo Tier und Vögel waren, trau’rt itzt die Einsamkeit. Wie ist die Zeit vertan! Dem Port naht mehr und mehr sich zu der Glieder Kahn. Gleich wie dies Licht verfiel, so wird in wenig Jahren ich, du, und was man hat, und was man sieht, hinfahren. Dies Leben kommt mir vor als eine Renne-Bahn.
Und nun die Wetteraussichten: Über allen Gipfeln ist Ruh’. In allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vöglein schweigen im Walde. Warte nur, balde ruhest du auch.
Bild 1
Abendlandschaft mit zwei Männern, Caspar David Friedrich, ca. 1830.
(Die Redaktion der Tagesschau bedankt sich für die Mitarbeit an der heutigen Ausgabe bei Otto Laub, Friedrich Hölderlin, Joseph von Eichendorff, Friedrich Rückert, Andreas Gryphius und Johann Wolfgang von Goethe.)
[td]
► ABENDBROT, FEIERABEND, HEIMAT, SEHNSUCHT, WALDEINSAMKEIT
ABGRUND
Eben noch hatte der Deutsche festen Grund unter den Füßen. Er vertraute der Welt, vertraute sich selbst, seinem Können, seinem Mutterwitz, doch im nächsten Augenblick: alles weg. Die ruhige Gewissheit ins Nichts gerissen, der Boden schwankend oder gleich zum gähnenden Schlund geöffnet. Es geht ihm wie dem armen Soldaten Woyzeck bei Georg Büchner, der auf freiem Feld Stöckchen schneiden will, doch plötzlich aufstampfen muss, weil er spürt: »Alles hohl da unten.« Und wenn er seine Geliebte anschaut, die ihn betrogen hat (oder auch nicht), denkt es in ihm: »Jeder Mensch ist ein Abgrund, es schwindelt einen, wenn man hinabsieht.«
»Die Welt oder wenigstens den Menschen an den Abgrund zu führen, war von jeher Sache der Deutschen«, schreibt der zu Unrecht vergessene Literat Friedrich Sieburg 1954 in seinem Essay Die Lust am Untergang. Und weiter: »Der Abgrund mochte schrecken oder locken, er mochte die Tiefe des eigenen Wesens sein oder den Untergang bedeuten, stets war der Deutsche bereit, Gedanken auszusprechen und in Umlauf zu setzen, vor denen es die Menschheit schauderte, sei es nun vor Wonne über ihre Größe oder vor Entsetzen über ihre Bodenlosigkeit.«
Knapp vierzig Jahre zuvor, mitten im Ersten Weltkrieg, formuliert es Sieburgs Vorbild Thomas Mann in den Betrachtungen eines Unpolitischen noch knapper und störrischer: »Das Deutsche ist ein Abgrund, halten wir fest daran.«
Festhalten am Abgrund: Gibt es einen Gedanken, der selbst abgründiger ist – und deutscher? Klüfte, Schlüfte, Schlünde, Grüfte – die deutsche Sprache läuft zur Höchstform auf, wenn es darum geht, das Bodenlose in den Begriff zu bekommen. Wie kein Zweiter kreist der wohl deutscheste aller deutschen Philosophen, Martin Heidegger, über den Abgründen des Denkens und Seins. Er verurteilt die Philosophie, die nach Letztbegründungen sucht, die hofft, ihre Sicherungshaken in irgendeiner unverbrüchlichen Idee vom Guten, Wahren oder Schönen einschlagen zu können. Der Philosoph muss den Schwindel aushalten, der ihn erfasst, wenn er erkennt, dass es keinen verlässlichen Grund gibt: »Das Seyn ist der Ab-grund, darin erst die Not alles Grundlosen ihre Tiefe und die Notwendigkeit jeder Gründung ihre Gipfel hat.«
Sätze wie dieser sind nicht geschrieben, um im schlichten Sinne verstanden zu werden. Denn Heidegger appelliert nicht an den Verstand, will nicht einleuchtende Gründe für oder gegen etwas benennen. Er appelliert an die tief sitzende Lebensangst, die sich der Mensch mit seinen alltäglichen Routinen und Versicherungssystemen sorgsam zugestellt hat: das Grauen, dass seine scheinbar stabile Welt einschließlich der eigenen Existenz jederzeit einstürzen kann. Und, noch trostloser: dass der Mensch auf die Frage, warum es ihm den Boden unter den Füßen weggerissen hat, keine sinnvolle Antwort erwarten darf. Die Anrufung des »Ab-grunds« läuft auf nicht weniger hinaus als auf die Verabschiedung des Kausalitätsprinzips: Halte dich nicht länger mit Grübeleien auf, aus welchem Grund etwas geschehen ist – lerne, mit dem Gefühl der Grundlosigkeit zu leben! Wie unerquicklich diese philosophische Haltung werden kann, wenn sie sich in die Politik hinauswagt, wird sich zeigen.
Jede Religion versucht zu erklären, warum die Welt ist, wie sie ist – wie Gott/die Götter sie gut erschaffen hat/haben, und die Menschen sie pervertieren und mit entsprechenden Strafen rechnen müssen. Seit Platon beteiligt sich auch die Philosophie an diesem erbaulich-kritischen Unterfangen. Heidegger macht endgültig Schluss damit. Der Philosoph soll der Angst vor dem nihilistischen Schlund nicht länger zu entkommen versuchen, indem er Gewissheitstürme errichtet, von deren Zinnen aus er die Lage zu überblicken glaubt. Im Gegenteil: Er soll sich mit Begeisterung in die Tiefe stürzen – das Leben im Sturzflug erfassen. Bis es an einer Klippe zerschmettert.
Bild 2
Denker im Abgrund: Friedrich Nietzsche, 1899.
Bild 3
Denker des »Ab-grunds«: Martin Heidegger, 1933.
In seinen Dionysos-Dithyramben lässt Friedrich Nietzsche, der deutsche Denker, der ein halbes Jahrhundert vor Heidegger dazu aufrief, mit dem Hammer zu philosophieren, einen Raubvogel höhnen: »Man muss Flügel haben, wenn man den Abgrund liebt.« Und Zarathustra, an anderem Ort noch als Verkünder des Übermenschen gefeiert, zagt das Herz. Er hängt fest, in sich, in der Welt, weiß, dass er den Sturzflug nicht überleben wird.
Nietzsche ahnt wohl bereits, dass seine Versuche, das Nichts zu umarmen, bald dazu führen werden, dass er in Turin auf offener Straße einen geprügelten Gaul umarmt. »Wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein«, schreibt er noch hellsichtig in Jenseits von Gut und Böse. Die eigene Warnung verhallt. Sein Geist verabschiedet sich ins unergründliche Dunkel des Wahnsinns.
Aber geht er damit den riskanten Weg nicht konsequenter zu Ende als sein Nachfolger Heidegger, der – zumindest für kurze Zeit – glaubt, über den Abgrund ließe sich im Braunhemd hinwegmarschieren? Oder verfällt der Denker des »Ab-grunds« der nationalsozialistischen Bewegung nur deshalb, weil er spürt, dass es sich bei der »Herrlichkeit und Größe dieses Aufbruchs«, die er in seiner berüchtigten Freiburger Rektoratsrede von 1933 beschwört, in Wahrheit und von Anfang an um jenes »wunderbare Sehnen dem Abgrund zu« handelt, wie es sein Idol, der andere im Wahnsinn verdämmerte Friedrich (Hölderlin), bei ganzen Völkern ausgemacht hat? Heidegger selbst widersteht dem letzten Sog der Tiefe, indem er immer wieder ins erdverbundene Dasein flieht: in seine einsame Hütte bei Todtnauberg im Schwarzwald, in der er selbst Holz machen und Wasser vom Brunnen holen muss.
Doch auch dieser vermeintlich un-abgründige Ort wird in den späten 1960er Jahren zum Schauplatz einer durch und durch abgründigen Begegnung: Paul Celan, der deutschsprachig-jüdische Dichter aus der Bukowina, dessen Eltern von den Nazis deportiert und ermordet wurden, besucht Heidegger in Todtnauberg. Was immer sich der Autor der Todesfuge von einer Begegnung mit dem Autor von Sein und Zeit erhofft hat – Gründe, warum sich Heidegger mit dem Faschismus eingelassen hat, bekommt Celan auch an jenem Ort nicht genannt, an dem der Philosoph so »gegründet« ist wie nirgends sonst. Stattdessen notiert dieser, dass es »heilsam« wäre, »Paul Celan auch den Schwarzwald zu zeigen«.
Nun sind die Deutschen wahrlich nicht die Einzigen, die es in die Tiefe zieht, deren Geist durch die Vorstellung, unter der vertrauten Oberfläche lauere etwas, das sich kaum in Worte bannen lässt, ebenso erregt wird wie erschreckt. Die antiken Griechen vermuten den Hades im Erdinneren, Dante schreibt sich im ersten Teil seiner Göttlichen Komödie in immer tiefere Höllenkreise hinab. Doch weder vom griechischen Sänger Orpheus, der vergeblich versucht, seine geliebte Eurydike aus der Unterwelt ans Tageslicht zurückzuholen, noch vom italienischen Dichter werden diese unterirdischen Reiche sehnsüchtig oder gar hoffnungsvoll besungen. Bei aller Faszination bleiben sie Orte des Grauens. Auch Immanuel Kant, der klare Kopf aus Königsberg, spricht ohne Verlangen in der Stimme vom »Abgrund des Verderbens«.
Bild 104
Als politische Ikone hat der alte Barbarossa ausgedient, sein Denkmal auf dem Kyffhäuser bleibt eines der meistbesuchten Deutschlands. Liegt es auch daran, dass Architekt Bruno Schmitz den Bruch, aus dem der Sandstein geschlagen wurde, nicht zuschütten, sondern als lockenden Abgrund offen ließ?
Je mehr die deutsche Seele aber zerfranst und sich vom Diesseits abwendet, ohne auf den Trost im himmlischen Jenseits zu setzen, desto mächtiger zieht es sie zum unterirdischen Jenseits, zum Abgrund hin, in dem alles möglich scheint. Wer den Erdrücken als kalt und unwirtlich empfindet und den Himmel für eine allzu wolkige Utopie hält, der sucht sein (vermeintliches) Heil im Schoß der Erde. Die unentfremdete, wahre Heimat wandert in die Tiefe ab.
Bis heute gibt es zahlreiche schlesische Volkstanz-, Trachten- und sonstige Vereine, die sich in wehmütiger Erinnerung an den verschrobenen Erdgeist, der im Innern des Siebengebirges hausen soll, »Rübezahl« nennen. Ihren wirkmächtigsten politischen Ausdruck findet die Sehnsucht nach einer unterirdischen Heimat aller Deutschen jedoch im Barbarossa-Mythos.
Nüchtern betrachtet dürfte der Stauferkönig, der von den Deutschen hochverehrte Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, im Jahre 1190 beim Dritten Kreuzzug auf dem Weg nach Jerusalem in einem Fluss ertrunken sein. Seit dem 16. Jahrhundert meint die Legende allerdings zu wissen, dass der Rotbärtige sich lediglich in den Kyffhäuser-Gebirgszug im Harz zurückgezogen habe und dort in unterirdischer Kammer schlafend auf seine Rückkehr warte. Diffuse, aber starke Hoffnungen ranken sich um den Schlummerkaiser: Die Aufständischen des ausgehenden Mittelalters haben ihn im Sinn, wenn sie auf tief greifende Veränderung der sozialen Verhältnisse drängen. Deutsch-nationale Kräfte von den Befreiungskriegen gegen Napoleon bis ins zweite deutsche Kaiserreich verbinden mit ihm den Wunsch nach nationaler Einheit und Größe. Zur »Kultfigur« erhebt ihn der Dichter Friedrich Rückert, indem er ihm 1817 jene Ballade widmet, die seine berühmteste werden sollte: »Der alte Barbarossa / Der Kaiser Friederich, / Im unterird’schen Schlosse / Hält er verzaubert sich [...]«
Für immer heim ins »unterird’sche Schlosse« schicken die Nazis den alten Barbarossa, indem sie ihren verheerenden Russlandfeldzug unter seinem Namen führen.
Wie gefährlich es ist, den Abgrund anzurufen, ahnen sensiblere Schwarmgeister lange vor Stalingrad. Zwar starren auch sie in die Tiefe, als würde sich dort der wahre Himmel spiegeln – die Furcht, es könnte am Schluss doch nur die Hölle sein, der sie sich verschreiben, werden sie nicht los.
Seit dem Mittelalter lauschen die Deutschen der Legende vom Tannhäuser, vom »guten Ritter«, der in den Venusberg einzieht, um dort mit der heidnischen Göttin der Liebe »Wunders was« zu tun. So exquisit die Freuden sein mögen, die Tannhäuser im Innern des Hörselbergs nahe der Wartburg erlebt – er beginnt zu spüren, dass es eine teuflische Welt ist, die ihn in ihrem Bann hält. Sein Treiben erscheint ihm plötzlich sündig, also pilgert er nach Rom und fleht den Papst um Vergebung an. Doch dieser lässt ihn abblitzen: Für solch abgrundtiefes Vergehen kann er keine Absolution erteilen – so wenig wie sich der Stab in seiner Hand jemals wieder begrünen wird. Tannhäuser kehrt verzweifelt an den Ort seiner Sünde zurück: Und die Göttin der sinnlichen Liebe zeigt sich milder als der irdische Statthalter des Christengotts; sie lässt den Ritter wieder ein in ihre Höhle. Während der Ritter für immer im Venusberg verschwindet, kommen Boten aus Rom, um von einem unerhörten Wunder zu berichten: Der päpstliche Stab habe frische Blätter getrieben ...
Ihre große Zeit erlebt diese Ode an den erotischen Abgrund, die das züchtige Kleid eines christlichen Lehrstücks von päpstlicher Härte und göttlicher Gnade übergestreift bekommt, in der Romantik. Achim von Arnim und Clemens Brentano nehmen die Volksballade in ihre Liedersammlung Des Knaben Wunderhorn auf, die Brüder Grimm erzählen sie in ihren Deutschen Sagen nach, Ludwig Tieck dichtet den ritterlichen Irrgang in die »Sündenherrlichkeit« zum Kunstmärchen hoch. Selbst Heinrich Heine erliegt dem Zauber der Venus-Tannhäuser-Geschichte, als er das alte Lied zum ersten Mal vernimmt: »Es war mir, als hätte ich in einem dumpfen Bergschacht plötzlich eine große Goldader entdeckt, und die stolzeinfachen, urkräftigen Worte strahlten mir so blank entgegen, dass mein Herz fast geblendet wurde von dem unerwarteten Glanz [...] Dieses Lied ist wie eine Schlacht der Liebe und es fließt darin das roteste Herzblut.«
Bild 4
»Der verdammte Abgrund der Lust«: Tannhäuser vor dem Venusberg. Holzstich von 1891.
Wie ist es möglich, dass ausgerechnet Heine, der sonst kaum eine Gelegenheit auslässt, mit dem romantischen Hang zu christlichem Mittelalterkitsch abzurechnen, sich vom Tannhäuser dermaßen rühren lässt? Ihn fasziniert der »Abgrund der verdammten Lust«, in den sich einer »blindlings« stürzt, wobei Verdammnis für ihn nichts mit christlichem Höllenfeuer zu tun hat. Die Verdammnis besteht in der Lust selbst, in der »Allgewalt«, mit der Heines Tannhäuser Frau Venus verfallen ist, obwohl er weiß, dass unzählige Helden vor ihm den »lilienweißen Leib« bereits genossen haben – und unzählige ihm nachfolgen werden. Doch es geht um mehr als um männliche Eifersucht. Der Ritter mag die Göttin »unsterblich lieben«, wie man so sagt – er selbst bleibt sterblich. Seine Liaison mit der Unsterblichen kann nichts anderes sein als eine groteske Mesalliance. Die schönen Tage, in denen antike Götter ihre Lieblingshelden zu sich in die Unsterblichkeit holten, sind vorbei.
Dieselbe Verzweiflung treibt den Tannhäuser in Richard Wagners romantischer Oper aus dem Venusberg hinaus: »Doch sterblich, ach! bin ich geblieben, / Und übergroß ist mir dein Lieben. / Wenn stets ein Gott genießen kann, / Bin ich dem Wechsel untertan«, lässt Wagner seinen Sängerritter klagen.
Falls es so etwas wie einen gemeinsamen Glutkern aller Romantiker gibt, ist es der – ewig scheiternde und dennoch unermüdlich betriebene – Versuch, die begrenzte, armselig umrissene Wirklichkeit so zu betrachten/gestalten/verzaubern, dass sich in ihr das Gefühl der Unendlichkeit einstellt. Und was wäre besser geeignet, dieses paradoxe Gefühl eines ewigen Augenblicks zu erzeugen, als die selbstvergessene Hingabe in der Lust? Doch Tannhäuser muss erkennen, dass die ewige Aneinanderreihung solch ewiger Augenblicke nicht den Horizont in die Ewigkeit öffnet. Dauererektion ist keine Erlösung, sondern peinliche Erstarrung.
Bei Wagner wird Tannhäuser diese Erlösung erst in einem ganz anderen Abgrund finden – im Abgrund der reinen Liebe einer irdischen Jungfrau zu ihm, die so unermesslich ist, dass die »heilige« Elisabeth aus Kummer um ihn stirbt. Und Tannhäuser stirbt dem gebrochenen Herzen gleich hinterher, anstatt in die Lusthölle der Frau Venus zurückzukehren. Liebestod als letzte Erlösungsphantasie für diejenigen, die sich am kleinen Tod sattgestorben haben.
Diesen erzromantischen Pas de deux ins Nichts verweigert Heinrich Heine seinem Tannhäuser. Hier hört der Dichter auf, Nachtigall zu sein, und wird zur Spottdrossel. Sein Ritter kehrt nach der päpstlichen Abfuhr in Rom flugs in den Hörselberg zurück – und legt sich erst einmal ins Bett, während Frau Venus in die Küche geht und dem Erschöpften eine Suppe kocht. Wo Wagner den Abgrund der verdammten Lust im Abgrund des gemeinsamen Liebestods übersteigert, erzählt Heine: alles halb so wild. Schau dir den Venusschlund nur genauer an, und du wirst sehen: am Ende eine ganz gewöhnliche Zweierbeziehung, allenfalls mit Tendenz zur Ehehölle. Weder Verdammnis noch Erlösung, sondern das Übliche, finde dich ab damit! Als einziges Überlebensmittel für diese Gewöhnlichkeit gibt Heine seinem Tannhäuser das Geschichtenerzählen an die Hand. Im langen Schluss des Gedichts lässt er den gescheiterten Pilger von den Stationen seiner Reise so launig berichten, dass man meint, man lausche bereits dem Heineschen Epos Deutschland. Ein Wintermärchen.
Bei Wagner also: die Flucht vorm Abgrund nach vorn, der berauschte Sprung ins Nichts. Bei Heine dagegen: die Entlarvung des Abgrunds als biedere Senke, die sich jedoch ertragen lässt, wenn man eine Vergangenheit hat, von der man erzählen kann, »denn die Vergangenheit ist die eigentliche Heimat [der] Seele«.
Werfen wir hier einen Blick in die Kluft, die das Teutonisch-Deutsche vom Jüdisch-Deutschen trennt? Der eine schickt seine Figuren, deren Sehnsucht nach Versöhnung von Endlichkeit und Ewigkeit im Diesseits enttäuscht ist, in den Untergang, während der andere sich damit begnügt, seinem Helden den Gang in die Geschichte zu empfehlen. Tut sich dieselbe Kluft auf zwischen Sigmund Freud, dem postromantischen Archäologen der Seele, der seine Patienten dazu animiert, ihre verschüttete(n) Geschichte(n) ans Tageslicht zu bringen, und Friedrich Schlegel, der das deutsch-romantische Verhältnis zu den Abgründen der Seele exemplarisch so zusammenfasst: »Lass ruh’n in Nacht, reiß nicht ans Licht, was in des Herzens stiller Tiefe heilig blüht!« Gewiss ist, dass deutsch-österreichische Juden lange vor dem Holocaust bei aller eigenen Faszination fürs Verschüttete ein sicheres Gespür dafür entwickelten, der deutschen Faszination für den heiligen Abgrund zu misstrauen und dieser die Kraft der Analyse, der Entlarvung entgegenzusetzen.
Abgrund – Lust – Stillstand der Zeit; oder wie Nietzsche seinen Zarathustra rufen lässt: »Alle Lust will Ewigkeit – will tiefe, tiefe Ewigkeit!« In keinem Motiv ertönt dieser Dreiklang feierlicher als in jenem vom »Bergmann zu Falun«. Die Geschichte taucht in Deutschland zum ersten Mal im Jahre 1807 auf, als der Arzt und romantische Naturphilosoph Gotthilf Heinrich Schubert in Dresden bei abendlichem Kerzenschein seine Vorlesungen über die »Nachtseiten der Naturwissenschaft« hält. Die Vorlesungen sind ein Feldzug gegen die mechanistische Weltsicht der sich entwickelnden modernen Naturwissenschaften und versprechen im Gegenzug, »das älteste Verhältnis des Menschen zu der Natur, die lebendige Harmonie des Einzelnen mit dem Ganzen« darzustellen. Es geht um Somnambule und Magnetisierer, um Träume, um die Übergänge von lebloser Materie in belebte und umgekehrt. In diesem Zusammenhang erzählt Schubert auch vom Schicksal jenes jungen Bergmanns aus dem schwedischen Städtchen Falun, der 1670 tief im Stollen verschüttet wurde – und dessen Leiche, als sie ein halbes Jahrhundert später durch einen Zufall entdeckt wurde, vollkommen erhalten gewesen sein soll. Zwar interessiert sich der Naturwissenschaftler schon dafür, wie dieses »Wunder« zu erklären ist – der Leichnam soll von Eisenvitriol durchdrungen gewesen sein. Weit mehr interessiert ihn jedoch, wie die Geschichte weitergeht: Niemand vermag die geborgene Leiche zu identifizieren, bis eine Greisin auf Krücken naht – und ihren ehemaligen Verlobten wiedererkennt. Schubert beschließt seine Darstellung mit der Bemerkung, dass »bei der fünfzigjährigen Silberhochzeit der noch jugendliche Bräutigam starr und kalt, die alte und graue Braut voll warmer Liebe gefunden wurde«.
Diese anrührend bizarre Begebenheit wird zu Beginn des 19. Jahrhunderts mitnichten unter der Rubrik »Vermischtes aus aller Welt« abgelegt – die zeitgenössischen Dichter von Johann Peter Hebel über Friedrich Rückert und Achim von Arnim bis hin zu E. T. A. Hoffmann stürzen sich auf den Stoff, als hätten sie in ihm ihre lang vermisste Braut wiedergefunden. Nicht allein, dass hier eine Liebesgeschichte den drögen Strom der Zeit so aberwitzig durcheinanderwirbelt, macht den Stoff für deutsche Romantiker magisch. Mindestens ebenso wichtig ist der Ort, an dem sich das Drama ereignet: ein Bergwerk.
Es ist einer der eigentümlichsten Nebenstollen der deutschen Geistesgeschichte um 1800, mit welcher Begeisterung nicht nur Forscher, sondern auch Dichter und Denker das Bergwerk als »geheimnisvoll offenbaren« Seelenort entdecken. Der berühmteste, der immer wieder in die finsteren, von ungesunden Dämpfen erfüllten Gruben »einfährt«, ist Johann Wolfgang von Goethe. 36 Jahre seines Lebens beschäftigt sich der Geheimrat mit dem Bergwerk in Ilmenau am Nordhang des Thüringer Waldes, von 1780 bis 1813 ist er gar Direktor der dortigen »Bergwercks-Commission« – und kann nicht verhindern, dass das Unternehmen aufgrund von Wassereinbrüchen, Stollenbrüchen und ständigem Kapitalmangel im Debakel endet.
Der junge Alexander von Humboldt dagegen macht in Preußen in den 1790er Jahren Karriere als höchst effizienter Oberbergrat. Als Goethe sich in seiner Verzweiflung an den erfolgreicheren Bergbaukollegen wendet, erteilt ihm dieser jedoch einen Korb: Das zwanzig Jahre jüngere Universalgenie will nicht nach Thüringen, um dem älteren zu helfen, sondern träumt bereits von seiner Entdeckungsreise ans andere Ende der Welt.
Bild 5
Erzbergwerk im sächsischen Freiberg. Kupferstich von 1820.
Novalis, der zarte, im Alter von 28 Jahren verstorbene Dichter der Hymnen an die Nacht, arbeitet tagsüber als Bergassessor in der Salinenverwaltung in Weißenfels. Wer von der geistigen Elite nicht berufsbedingt in den Berg einfahren darf, will dies zumindest auf seinen Bildungsreisen nachholen: Wilhelm Heinrich Wackenroder besucht 1793 zusammen mit seinem frühromantischen Wander- und Herzensbruder Ludwig Tieck die Eisenmine »Gabe Gottes« in Oberfranken. Hingerissen schreibt er in einem Brief an die Eltern: »Mir war’s, als sollte ich in irgendeine geheime Gesellschaft, einen mysteriösen Bund aufgenommen [...] werden.« Auch Joseph von Eichendorff, der große Poet des Waldes, nimmt die Grubenlampe selbst in die Hand, um in der Unterwelt »mit frommer Ehrfurcht« dem »Geisterlispeln« zu lauschen, jenem monotonen Tropfen, das Stalagmiten zu »menschenähnlichen Gespenstergestalten« formt. Selbst Heinrich Heine folgt 1824 bei seiner Harzreise der Empfehlung des damals populären Taschenbuchs für Harzreisende, Bergmannskluft anzulegen (die Heine als »Delinquententracht« bezeichnet) und die Clausthaler Silberminen »Dorothea« und »Carolina« zu besichtigen. Zwar witzelt er: »Ich war zuerst in die Carolina gestiegen. Das ist die schmutzigste und unerfreulichste Carolina, die ich je kennengelernt habe.« (Ein Schelm, wer dabei an die beiden Schriftstellerinnen – und für allerlei erotische Verwirrungen sorgenden Zentralmusen der romantischen Clique – Dorothea Schlegel und ihre zeitweise Schwägerin Caroline Schelling, geschiedene Schlegel, denkt.) Gegen Ende seines Grubenberichts preist Heine das Leben der Bergleute jedoch ganz unironisch als »wahrhaftes, lebendiges Leben«. Bereits im Jahre 1737 fährt die Poetin Sidonia Hedwig Zäunemann, die zweite Frau, die mit dem Ehrentitel »Kaiserlich gekrönte Dichterin« ausgezeichnet wird, in jenes Ilmenauische Bergwerk ein, dessen späterer Direktor Goethe heißen soll. Mit einem hymnischen Gedicht kehrt sie über Tage zurück: »Des Bergwerks Schönheit nimmt mich ein; / Ich will, ich muss ein Bergmann sein.«
Dass es sich bei dieser Bergwerksverzückung um einen spezifisch deutschen Zug handelt, wird klar, wenn man dagegen liest, was Henry Crabb Robinson, der erfahrenste britische Deutschlandreisende des frühen 19. Jahrhunderts, in seinem Tagebuch festhält: »In Sankt Andreasberg stillte ich meine Neugier durch den Abstieg in eine Mine, wobei ich erfuhr, dass dies ein ermüdendes, wenig lehrreiches und außerordentlich uninteressantes Spektakel ist. Allgemein gesprochen kenne ich keinen Anblick, der die Mühe so wenig lohnt.«
Es mag äußere Gründe geben, wieso der Brite dort, wo seine deutschen Zeitgenossen ins Rhapsodieren geraten, mit stiff upper lip reagiert: Bergbau weckt bei einem Briten völlig andere Assoziationen als bei einem Deutschen. Auf der Insel dominiert der Kohlebergbau, während in Deutschland vorrangig Edelmetalle gefördert werden. (Die Kohlevorkommen an der Ruhr, die den gewaltigen Industrialisierungsschub Deutschlands in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ermöglichen, sind zu Beginn jenes Jahrhunderts noch nicht entdeckt.) Außerdem ist Deutschland, genauer gesagt die »Königliche Bergakademie in Freiberg«, das Mekka der damaligen Bergbaukunde. Studenten und Spezialisten aus ganz Europa und sogar Amerika strömen nach Mittelsachsen, um dort u. a. bei dem charismatischen Mineralogen und Geologen Abraham Gottlob Werner – bei dem auch Novalis und Alexander von Humboldt studierten – alles über »Geognosie« (Lehre von der Struktur und der Zusammensetzung der Erde) und »Oryktognosie« (Lehre von der Klassifizierung der Mineralien) zu erfahren. (Die älteste montanwissenschaftliche Universität der Welt existiert übrigens immer noch. Heute nennt sie sich im Untertitel »Ressourcenuniversität« – und ist damit ihren Wurzeln treu, schließlich war es ihr Gründer, der Oberberghauptmann Hannß Carl von Carlowitz, der bereits im Jahre 1713 den Begriff der »Nachhaltigkeit« prägte.)
Doch die Tatsache allein, dass Deutschland um 1800 herum die führende Nation in Sachen Bergbau/Montanwissenschaften ist, erklärt nicht den Überschwang, mit dem der deutsche Geist jener Zeit in den Berg einfährt. Der erotische Subtext genügt ebenfalls nicht, auch wenn in den Bergwerkserzählungen von E. T. A. Hoffmann und Ludwig Tieck »unterirdische Königinnen« mit ihrer Schönheit, die nicht von dieser Welt ist, melancholische Jünglinge zu sich in den Abgrund ziehen, und Sigmund Freud in Die Traumdeutung erklären wird, dass jeder Abstieg in einen Bergwerksschacht ein Symbol für den Akt des Koitus sei.
»Nach innen geht der geheimnisvolle Weg«, schreibt Novalis in seinem ersten veröffentlichten Text, den Blütenstaub-Aphorismen. Dies ist keine touristische Empfehlung, die von ihm beaufsichtigten Salinenstollen in Weißenfels zu besuchen, sondern gemeint ist, dass wir uns in die unbekannte »Tiefe unseres Geistes« versenken sollen. Liest man jedoch Novalis’ Hymne an den Bergbau in seinem Romanfragment Heinrich von Ofterdingen, scheint es kein besseres Hilfsmittel zu geben, den geheimnisvollen »Weg nach innen« zu finden, als tatsächlich den Gang in den Berg anzutreten. So heißt es dort über den Bergmann: »Sein einsames Geschäft sondert ihn vom Tage und dem Umgange mit Menschen einen großen Teil seines Lebens ab. Er gewöhnt sich nicht zu einer stumpfen Gleichgültigkeit gegen diese überirdischen tiefsinnigen Dinge und behält die kindliche Stimmung, in der ihm alles mit seinem eigentümlichsten Geiste und in seiner ursprünglichen bunten Wunderbarkeit erscheint.« Nirgends stellt sich das Gefühl für die Verbundenheit des Einzelnen mit der Schöpfung – das sich die Menschen über Tage längst verbaut haben, obwohl es doch das einzige Gefühl ist, das ihre Seele in rechte Schwingungen versetzen kann – stärker ein als im Schoß der Erde. Bei Novalis ist dieser Gedanke nicht allein naturromantisch, sondern ebenso christlich gemeint: Er stattet seinen alten Bergmann im Ofterdingen mit Grubenlampe und Kruzifix aus, bevor er ihn sein erstes »inniges« Bergwerkserlebnis machen lässt.
Heinrich Heine wittert in seiner Geschichte der Philosophie und Religion in Deutschland, dass es einen Zusammenhang geben muss zwischen Martin Luther als Erfinder des Protestantismus, des radikal nach innen gewandten Christentums, und der Tatsache, dass Luthers Vater Bergmann gewesen ist: »Da war der Knabe oft bei ihm in der unterirdischen Werkstatt, wo die mächtigen Metalle wachsen und die starken Urquellen rieseln, und das junge Herz hatte vielleicht unbewusst die geheimsten Naturkräfte in sich eingesogen.«
Die Erfahrung jener »geheimsten Naturkräfte« ist es auch, die Goethe an den Bergbau fesselt. Der Morphologe Goethe behauptet – hier ganz Naturromantiker – eine unmittelbare Kontinuität vom Granit als dem »ältesten, festesten, unerschütterlichsten Sohn der Natur« bis zum menschlichen Herzen als dem »jüngsten, mannigfaltigsten, beweglichsten, veränderlichsten, erschütterlichsten Teil der Schöpfung« und preist deshalb alle Situationen, in denen diese Einheit spürbar wird – sei es beim Gang ins Bergwerk hinunter oder auf einen granitenen Gipfel wie den Brocken im Harz hinauf: »Hier ruhst du unmittelbar auf einem Grunde, der bis zu den tiefsten Orten der Erde hinreicht, keine neuere Schicht, keine aufgehäufte, zusammengeschwemmte Trümmer haben sich zwischen dich und den festen Boden der Urwelt gelegt.« Und so wird der Abgrund in paradoxer Umkehrung zum sichersten Grund, den der entfremdete Mensch gewinnen kann. Aber – das weiß der gescheiterte Bergwerksdirektor Goethe am allerbesten – es ist ein Missverständnis zu glauben, beim Bergbau ginge es in erster Linie darum, der Natur unterirdische Tempel zu errichten, in denen sich weihevolle Verschmelzungs- und Selbstfindungsrituale zelebrieren lassen. Es geht darum, wie Goethe in einer seiner Bergwerksreden selbst sagt, »die tief liegenden Gaben der Natur an das Tageslicht« zu fördern.
Das alte Übel, die Schöpfung und damit auch die eigene Seele ausbeuterisch zu zerstückeln, schießt damit direkt in die Tiefe. Nicht zufällig lässt Goethe im zweiten Teil der Faust-Tragödie, den er im Eindruck seines Ilmenauer Scheiterns geschrieben hat, einen Chor der Gnome auftreten, die sich ironisch als »Felschirurgen« bezeichnen und ätzen: »Doch bringen wir das Gold zutag / Damit man stehlen, kuppeln mag.« Der faustische Drang zu erkennen, »was die Welt im Innersten zusammenhält« – und den sich der Bergwerksdirektor selbst attestiert, indem er zum Dienstjubiläum eines ehemaligen Kollegen dichtet: »Im engsten Stollen, wie in tiefsten Schachten / Ein Licht zu suchen, das den Geist entzünde / War ein gemeinsam köstliches Betrachten / Ob nicht Natur zuletzt sich doch ergründe?« –, dieser faustische Drang erschöpft sich nicht in interesseloser Erkenntnisfreude, sondern schreibt das Drehbuch zur Naturbeherrschung. Aus eben diesem Grund hat ja der Bergbau seit der Antike seinen üblen Ruf. Die Klage, die Ovid und Seneca gegen dieses gottlose Gewerbe führen, setzt sich fort bis zu Jean-Jacques Rousseau, der den Bergmann als frühen Turbokapitalisten verurteilt, der »die Eingeweide der Erde« durchwühlt, um »bei Gefahr seines Lebens und auf Kosten seiner Gesundheit in ihrem Innern nach eingebildeten Schätzen« zu suchen. Der britische Dichter William Blake spricht von Bergwerken gleich als »dark Satanic mills« – als »dunklen Fabriken Satans«.
Wie anders klingt dagegen, was unser Bergassessor Novalis in seinem Heinrich von Ofterdingen ausrufen lässt: »Der Bergbau muss von Gott gesegnet werden! Denn es gibt keine Kunst, die ihre Teilhaber glücklicher und edler machte!«
Spinnen die Deutschen?
Jedenfalls glauben sie daran, dass es dem Menschen gelingen kann, sich sein Gemüt rein zu bewahren, obwohl er von kapitalistischen Versuchungen umstellt ist. »Arm wird der Bergmann geboren, und arm gehet er wieder dahin. Er begnügt sich zu wissen, wo die metallischen Mächte gefunden werden, und sie zu Tage zu fördern; aber ihr blendender Glanz vermag nichts über sein lautres Herz. Unentzündet von gefährlichem Wahnsinn, freut er sich mehr über ihre wunderlichen Bildungen und die Seltsamkeiten ihrer Herkunft und ihrer Wohnungen als über ihren alles verheißenden Besitz. Sie haben für ihn keinen Reiz mehr, wenn sie Waren geworden sind, und er sucht sie lieber unter tausend Gefahren und Mühseligkeiten in den Festen der Erde, als dass er ihrem Rufe in die Welt folgen und auf der Oberfläche des Bodens durch täuschende, hinterlistige Künste nach ihnen trachten sollte.«
Diese Liebesverklärung der Bergmannszunft entspringt nur zum Teil einer spezifisch Novalis’schen Schwärmerei. Bereits der Renaissance-Gelehrte Georgius Agricola aus Glauchau verlangt in seinem Erstlingswerk De re metallica, dem ältesten Lehrbuch der Bergbaukunde, dass der Bergmann der beste aller Werktätigen sein müsse, sowohl dem Bauern als auch dem Handwerker moralisch überlegen, gerade weil er es mit Rohstoffen zu tun hat, die zu schlimmstem Frevel verlockten: Wegen Gold würden Kriege geführt, wegen Gold ermordeten sich Menschen mit Waffen, die aus Erzen gefertigt sind. Agricola besitzt – wie Novalis – genügend Gottvertrauen, um den lauteren Bergmann für möglich zu halten.
Auch Goethe zeigt sich in seinem zweiten monumentalen Alterswerk, in Wilhelm Meisters Wanderjahre, zuversichtlicher als in Faust II, dass es nicht zu Mord und Totschlag führen muss, wenn der Mensch den Bodenschätzen nachspürt. Der »Steinklopfer« Montan lebt in diesem Roman einsiedlerisch in den Bergen und versenkt sich in Felsklüfte, um »mit ihnen ein stummes, unergründliches Gespräch zu führen«. Denn er weiß: »Um einen Gegenstand ganz zu besitzen, zu beherrschen, muss man ihn um seiner selbst willen studieren.« Zwar geht es auch hier ums »Besitzen« und »Beherrschen« – aber gerade nicht im Sinne einer zweckrationalen Weiterverwertungslogik, sondern gemäß einer Geisteshaltung, die der Komponist Richard Wagner zu der kompakten Formel zusammenfasst: »Deutsch sein heißt, eine Sache um ihrer selbst willen zu tun.«
Zum »innigen« Ort, zum stabilen Grund kann der Abgrund nur für denjenigen werden, der ihn als Selbstzweck begreift. Ist der Abgrund bei Heidegger das schlechthin Grundlose, ist er hier das schlechthin Zweckfreie. Wer in den Berg mit Hintergedanken – gleich welcher Art – einfährt, kommt darin um. Bei Joseph von Eichendorff wird der habgierige Schatzgräber im Stollen verschüttet, während »Hohnlachen wild erschallte / Aus der verfallnen Kluft«. Und in E. T. A. Hoffmanns Die Bergwerke zu Falun endet der arme Elis Fröbom als jugendlich konservierte Stollenleiche, weil er die Prophezeiung des alten Bergmanns in den Wind schlägt, dass ein Unglück geschehen wird, wenn er den Bergmannsberuf nur ergreift, um seine Angebetete heiraten zu dürfen, und nicht aus »wahre[r] Liebe zum wunderbaren Gestein und Metall«.
In rührend naiven Deutungsvolten versuchen die Deutschen, den Bergbau dem kapitalistischen Schlund zu entreißen, Naturausbeutung mit Naturanbetung zu versöhnen. Und weil sie ahnen, dass dies allein nicht reichen könnte, wird der Bergbau auch noch zum sozialromantischen Projekt überhöht. Mit gönnerhaftem Pathos erklärt Goethe, als er sein Bergwerksengagement beginnt, dass er den »armen Maulwurfen« in Ilmenau helfen will, »dass das zweideutige Metall, das öfter zum Bösen als zum Guten angewendet wird, nur zu seiner Ehre und zum Nutzen der Menschheit gefördert sein möge«. Die Sozialromantik findet ihr jähes Ende, als Goethe scheitert und das Bergwerk abermals geschlossen werden muss – nicht zuletzt, weil es ökonomisch nicht straff genug geführt wurde.
An dem Versuch, den Bergbau als ebenso sozial(istisch)es wie romantisches Unternehmen zu betreiben, scheitert lange nach Goethe der DDR-Schriftsteller Franz Fühmann, den es gleichfalls unwiderstehlich in den Berg hinabzieht. Allerdings scheitert er mit umgekehrten Vorzeichen, scheitert als Schriftsteller. Zehn Jahre recherchiert er in den Kupfer- und Kalischächten im Mansfelder Land und in Thüringen, im Juni 1974 darf er – als erbetenes Honorar für eine Dichterlesung in der Gewerkschaftsbibliothek in Sangerhausen – zum ersten Mal in den Thomas-Müntzer-Schacht einfahren. Begeistert schreibt er seiner Frau: »Ursula, ich war im Berg! Es ist für mich eine Offenbarung! Hier zieh ich her!« Und seiner Lektorin kündigt er an: »Ich habe das Thema meines Lebensrestes: Im Berg!«
Das überschwängliche Vorhaben, dem Fühmann den Arbeitstitel Bergwerk gibt und das sein abschließendes Alterswerk hätte werden sollen, bleibt Fragment. Nicht nur, weil der Autor 1984 stirbt. Wenige Wochen vor seinem Tod gesteht er gegenüber einem der ehemaligen Kumpel: »Also Bergwerk ist nichts mehr [...] Die Anlage ist völlig verfehlt und auch nicht mehr ausbesserbar. Ich kann Dir nicht erklären, warum; nimm es als Fakt.«
Liest man die 1993 postum unter dem Titel Im Berg herausgegebenen Texte und Textfragmente, kristallisiert sich jedoch ein erschütternd deutliches Bild heraus, warum der Schriftsteller »nicht-proletarischer Herkunft«, der einst aus sozialistischer Überzeugung Bürger des deutschen »Arbeiter- und Bauernstaates« geworden war, an seinem letzten großen Buchprojekt scheitern musste. Verzweifelt analysiert er: »Der sozialistischen Gesellschaft zu dienen, war Gebot meines Lebens, Schaffen von Literatur dessen Sinn geworden, doch beides zu vereinen oder besser: ihr bislang selbstverständliches Eins-Sein zu wahren wurde immer mehr mein Problem.« Der Dichter mit den bildungsbürgerlichen Wurzeln geht den Bitterfelder Weg, mischt sich unter die proletarischen Kumpel – und stellt beschämt fest, dass er im Schacht nicht etwa daran denkt, ob die Norm zum Wohle des Staates erfüllt wird, sondern daran, mit welcher Lebensgier und Todessehnsucht sich E. T. A. Hoffmann, Tieck, Novalis und all die anderen romantischen Schwarmgeister in den Berg gestürzt haben. Hinabgesunken zu Ruinen und der Zukunft abgewandt ... So verklingt die stolze Hymne für den desillusionierten DDR-Schriftsteller.
Bild 105
»Glück auf! Glück auf! Der Steiger kommt!« SPD-Parteitag im Oktober 2008.
Wie viel leichter hat es da sein Generationskollege Michael Ende, der im freien Westen sogar eine »unendliche Geschichte« zum Weltbestseller zu Ende erzählen kann! Der seine Helden hemmungslos nach Phantásien und dort ins »Bergwerk der Bilder« schicken darf, in dem ein blinder Bergmann nicht über Volkseigentum, sondern über die »vergessenen Träume der Menschenwelt« wacht. Auch Fühmann erlaubt sich zu träumen, »die Literatur sei ein Bergwerk, durch Jahrtausende Generationen befahren, und jeder Schriftsteller selbst sei eine Grube, und das Flöz, drin er haue, sei seine Erfahrung«. In einem Interview kurz nach dem Ende der deutschen Teilung gibt Michael Ende demselben Gedanken eine explizit nationale Wendung: »Ich bin der Meinung, dass die Romantik die bisher einzig original deutsche Kulturleistung war. Alles andere haben wir in Deutschland mehr oder weniger aus dem Ausland übernommen. In der Romantik ist zum ersten Mal etwas gelungen, das auch das Ausland interessiert hat. Deswegen habe ich versucht, dort anzuknüpfen, weil ich mich durchaus als deutscher Autor verstehe und weil ich der Überzeugung bin, dass diese Stimme, die eben typisch deutsch ist, nicht im Konzert der Nationen untergehen sollte.«
Was ist geblieben von den romantischen Abgründen, aus und in denen unzählige deutsche Dichter und Denker ihren Rohstoff bezogen? Die Angst vor Atommüllfässern, die in den Salzstöcken bei Gorleben vor sich hin rotten? Der sozialromantische Hauch, der kurz zu spüren ist, wenn die Genossen bei ihren SPD-Parteitagen immer noch das alte Bergmannslied Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt! anstimmen? Oder müssen wir uns damit abfinden, dass die romantischen Schächte ebenso versiegelt sind wie das gespenstische Reich aus Bunkern und Fabrikstollen, mit dem die Nazis ihren größenwahnsinnigen Traum vom »Dritten Reich« untertunnelt haben?
Günter Grass, der nobelpreisgekrönte Chefmoralist der Bundesrepublik, dem seine eigene Vergangenheit in der Waffen-SS jahrzehntelang entfallen war, hat unmittelbar nach dem Krieg in einem Kalibergwerk in der Nähe von Hildesheim gearbeitet. In seinem Roman Hundejahre, dem 1963 erschienenen letzten Teil der Danziger Trilogie, wird ein Bergwerk, »das weder Kali, Erz noch Kohle fördert und dennoch bis zur Achthundertfünfzigmetersohle in Betrieb ist«, zur grellen Zentralmetapher für die Bundesrepublik, die in den alten Stollen mit einem Furor weiterproduziert, als hätte es kein Gestern gegeben. Die unterirdische Fabrik, auf die der »bergfremde« Besucher nur mit dem Ausruf »Mein Gott, das ist die Hölle! Die wahrhaftige Hölle!« reagieren kann, stellt Vogelscheuchen für den Export in alle Welt her – deutsche Vogelscheuchen aus deutschem »Schrott«, die mal die berühmte Heideggersche Zipfelmütze tragen und schnarrend übers »Ge-scheuch-sein« dozieren, mal als Bamberger Symphoniker in brauner Arbeitskluft etwas aus der Götterdämmerung spielen und mal über die Artikel des Grundgesetzes belehrt werden. Klar, dass der Hund, der am Schluss in dieser Hölle zurückbleiben muss, nur »Pluto« heißen kann.
Noch finden sich die Hundejahre nicht im »Oberrieder Stollen«, jenem stillgelegten Silberbergwerk im Schwarzwald, das die Bundesrepublik seit den 1960er Jahren zu ihrer unterirdischen »Schatzkammer der Nation« ausbaut und dem sich auch in Friedenszeiten kein militärisch Uniformierter auf drei Kilometer nähern darf. Atomkriegssicher, auf Mikrofilm gebannt, versiegelt in sechzehnfach verschraubten Edelstahlfässern, schlummern hier tief unter der Erde mittlerweile über eine Milliarde Dokumente, die nach Einschätzung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe geeignet sind, der Nachwelt zu zeigen, was es mit der deutschen Kultur und Geschichte auf sich hatte, sollte das Land eines Tages ausgelöscht werden. Dank des Kulturbunkers kann der interessierte Wiederentdecker auch in 1500 Jahren noch den Vertragstext des Westfälischen Friedens studieren, die päpstliche Bannandrohungsbulle gegen Martin Luther, die Baupläne des Kölner Doms, Handschriften von Schiller und Goethe oder Partituren von Johann Sebastian Bach. Ebenso ist es dem Kulturbeflissenen der fernen Zukunft vorbehalten, jene Originalwerke von fünfzig zeitgenössischen deutschen Künstlern wie Jörg Immendorff und Christoph Schlingensief zu betrachten, die 2004 im Rahmen der Aktion »Verschluckung« edelstahlverschraubt in den »Oberrieder Stollen« gebracht wurden.
Unheimlich? Ja, wenn man an den Großbaumeister der Nazis, Albert Speer, und seine »Theorie des Ruinenwerts« denkt, die besagt, dass nur Baumaterialien verwendet werden dürfen und statische Überlegungen angestellt werden müssen, die ermöglichen, dass »Germania« in Hunderten (oder Tausenden ...) von Jahren eine mindestens so pittoreske Ruine ergibt wie das antike Rom.
Auch wenn die Deutschen nicht die Einzigen sind, die nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen haben, Kunstkonserven endzulagern – die »Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten« aus dem Jahre 1954 ruft ausdrücklich dazu auf –, schimmert das alte Mentalitätsbild »gründlich, unergründlich, abgründlich« noch einmal durch.
Die Leidenschaft für den Abgrund darf keine unbedarfte sein. Jeder, der sich an die Absturzkante heranwagen will, sollte die beiden behutsamsten Verse im Sinn haben, mit denen der Abgrund je in der deutschen Literatur beschworen worden ist. Sie stehen zu Beginn des Gedichts Geheimes Deutschland von Stefan George. Ob der George-Jünger und gescheiterte Hitler-Attentäter Claus Schenk Graf von Stauffenberg an sie gedacht hat, als er am 21. Juli 1944 kurz vor seiner Hinrichtung im Berliner Bendlerblock rief: »Es lebe das geheime Deutschland!«? Sie lauten:
»Reiss mich an deinen rand
Abgrund – doch wirre mich nicht!«
[td]
► ARBEITSWUT, BERGFILM, DOKTOR FAUST, GERMAN ANGST, MUSIK, ORDNUNGSLIEBE, DAS UNHEIMLICHE, VATER RHEIN, WALDEINSAMKEIT, DAS WEIB
Bild 106
Castor oder Castorp? Mit deutschem Kulturgut gefüllte Fässer auf dem Weg in ihr Endlager bei Oberried im Schwarzwald.
ARBEITSWUT
1990 reiste ich von Frankfurt am Main nach Mailand. Mit dem Zug. Außer mir saß ein schwäbisches Ehepaar im Abteil, kurz hinter Mannheim stieg ein weiterer Mann hinzu, Italiener, wie sich bald herausstellte. Während die schwäbische Ehefrau den mitgebrachten Apfel entkernte und in gleichmäßige Schnitze zerteilte, begann ihr Ehemann, der noch an der zuvor hinübergereichten Wurststulle kaute, ein Gespräch mit dem Italiener. Dieser war Gastarbeiter, seit über zwanzig Jahren in Deutschland, und ja, er liebe Germania. Der schwäbische Ehemann versicherte ihm strahlend, dass er wiederum Italia liebe. Er und seine Frau seien zwar nur einmal dort gewesen, zwei Wochen Adria, aber die italienische Art habe ihm sofort imponiert. Er könne es nicht besser sagen: Der Italiener verstehe es einfach zu leben! Der so Gelobte bedankte sich mit einem höflichen Lächeln. Da murmelte die Ehefrau, die bislang geschwiegen hatte, ohne von ihrem Apfelschnitzwerk aufzublicken: »Abr schaffa muass mr scho.«
Bis heute weiß ich nicht, ob ich in jener Apfelschnitzerin eine zwanghaft verfehlte oder eine in höchstem Maße erfüllte Existenz sehen soll. Sicher bin ich nur, dass sie über den alten Berliner Witz: »Was für ein Geschäft treibt Ihr?« – »Wir treiben keins, Herr. Es treibt uns«, nicht gelacht hätte.
Seit Anbeginn spaltete die Frage das Abendland, ob Arbeit im alttestamentarischen Sinne eine schweißtreibende Strafe Gottes oder im vitalistischen Sinne eine beglückende Tätigkeit ist, in der sich der Mensch erst wahrhaft als Mensch verwirklicht. Die Deutschen haben beide Positionen bis ins Extrem verfolgt.
Für die erste wirkmächtige Übersetzung der alttestamentarischen Auffassung ins Deutsche sorgte Martin Luther: »Unser Leben währet siebzig Jahre / wenn’s hoch kommt, so sind’s achtzig Jahre, / und wenn’s köstlich gewesen ist, / so ist’s Mühe und Arbeit gewesen, / denn es fahret schnell dahin, / als flögen wir davon.« So poetisch und unbarmherzig zugleich klingt der neunzigste Psalm in der Luther-Bibel. Vor dem Reformator hatten bereits die Mystiker die Arbeit aufgewertet, selbst – oder gerade – wenn sie in schäbigstem Gewand daherkam. So hatte schon Meister Eckhart erklärt, dass auch Nesselnsammeln Gotteslob sein kann, wenn dabei nur das Herz gen Himmel gerichtet ist. Dennoch hielten die Mystiker – in aller Demut – daran fest, dass ihre kontemplativ-asketische Lebensweise dem weltlichen Ackern und Rackern überlegen sei.
Bild 6
Martin Luther und andere Reformatoren als gute Arbeiter im Weinberg des Herrn.
Im Hintergrund: katholische Geistliche als schlechte Weinbauern. Allegorisches Gemälde von Lucas Cranach d. J., 1569.
Mit dieser Auffassung machte erst Luther Schluss. Rabiat ging er mit dem Mönchstum ins Gericht, das sich einbildete, den direkteren Pfad zum Seelenheil einzuschlagen, weil es die alltäglichen Geschäfte hinter sich gelassen und sein ganzes Leben dem Streben nach Heiligkeit gewidmet habe: »Unangesehen aller heiligen Exempel und Leben soll ein jeglicher warten, was ihm befohlen ist, und wahrnehmen seines Berufs. O, das ist so eine nötige, heilsame Lehre! Es ist ein Irrtum fast gemeint, dass wir ansehen die Werke der Heiligen, und wie sie gewandelt haben, wollen wir hiernach meinen, es sei köstlich wohl getan.«
Diese Predigt aus der Kirchenpostille von 1522 sollte für das deutsche Berufsverständnis dramatische Konsequenzen haben. Noch der junge Luther, der Augustinermönch, hatte das Wort »Beruf« für jene Zusammenhänge reserviert, die von einer göttlich-spirituellen Berufung erzählen. Dass er – seit seiner Bibelübersetzung – plötzlich auch dort von »Beruf« sprach, wo es um schlichte Erwerbsarbeit ging, war keine Reformation mehr – es war eine Revolution. Die Ausweitung des »Berufs« auf die weltliche Sphäre begründete der Theologe so: Jesus habe nicht gewollt, dass sich alle zu seiner Nachfolge auf dem Weg der Heiligkeit berufen fühlten. »Ich will mancherlei Diener haben, sollen aber nit alle eines Werkes sein«, lässt Luther Jesus in der bereits zitierten Predigt sagen. »Gott will nit Opfer, sondern Gehorsam haben. Daher kommt’s, dass eine fromme Magd, so sie in ihrem Befehl hingeht und nach ihrem Amt den Hof kehret oder Mist austrägt, [...] stracks zu gen Himmel geht, auf der richtigen Straß, dieweil ein anderer, der zu Sankt Jakob oder zur Kirche geht, sein Amt und Werk liegen lässt, stracks zu zur Hölle geht.« Erst durch Luther entfaltete die Paulus-Stelle aus dem ersten Brief an die Korinther, in welcher der Apostel einen jeglichen ermahnt, »in dem Beruf« zu bleiben, »darin er berufen ist«, ihre verfleißigende Wirkung.
Das protestantische Arbeitsethos, zu dem Luther das Fundament gelegt hatte, führte im 16. und 17. Jahrhundert allerdings noch nicht zu der allgemeinen Emsigkeit, für die die Deutschen später berühmt (und gefürchtet) werden sollten. Vergeblich warnten lutherische Pfarrer wie Joachim Westphal vor dem »Faulteufel« und forderten, dass man »das Fleisch dämpfen, töten und von seinen bösen Listen und Werken zur Arbeit leiten, ja zwingen« müsse, oder malten wie Johannes Mathesius die Albträume des Müßiggängers an die Wand, der sich im Schlaf fürchten, alsbald wütend und unsinnig werden, alles Getränk verwerfen und schließlich wie ein Hund bellen würde. Auch mit rigiden Polizeiordnungen war der im ganzen Land verbreiteten Bettelei nur bedingt beizukommen. Zwar bildete sich daneben tatsächlich der Typus des deutschen Schaffers heraus, blühte vor allem in den Reichsstädten das Handwerk, trieben Kaufleute von Hamburg bis Augsburg regen Handel, doch der Dreißigjährige Krieg bereitete diesem ersten deutschen Wirtschaftswunder ein Ende. In dem verwüsteten Land machten sich Schlendrian und Verwahrlosung breit. Zusätzlich verhinderte das mittelalterliche System der Zünfte die Modernisierung von Arbeitsprozessen. Eher begünstigte es kollektive Saufexzesse nach Feierabend. Die einzige Wirtschaft, die von ihm noch profitierte, war die Gastwirtschaft: Um 1700 herum war es keine Seltenheit, dass eine Kleinstadt mit zweihundert Häusern über dreißig bis vierzig Kneipen verfügte.
Erfolgreich legte den Deutschen erst wieder der Pietismus die disziplinierenden Daumenschrauben an, und zwar auf konsequentere Weise, als Luther dies getan hatte. Das Weltbild des Reformators, der selbst Speis und Trank nicht abhold gewesen war, hatte noch genügend Raum für Sinnesfreuden gelassen. Außerdem schützte ihn seine Gnadenlehre, die besagte, dass es am Schluss einzig und allein von Gottes unermesslichem Willen und nicht von meinem Tun abhinge, ob ich im Jenseits zur Seligkeit gelange, davor, das gesamte Leben einem eisernen Regiment zu unterwerfen. Gnade ließ sich für Luther allenfalls durch zutiefst empfundene Reue ob der eigenen Sündhaftigkeit erflehen – systematisch erarbeiten ließ sie sich nicht.
Und auch in ihren Anfängen zielte die – ohnehin höchst uneinheitliche – Bewegung des Pietismus noch nicht so sehr darauf, den Menschen zum Arbeitstier im Namen Gottes zu dressieren. Vielmehr ging es ihr darum, die Herzen wieder zum Schwingen und Beben zu bringen, seit das offiziell gepredigte Luthertum zur leblosen Schuldoktrin erstarrt war. Die zentralen Erlebnisse für jeden »wiedergeborenen« Christen waren der »Bußkampf« – so weit, so Luther – und der anschließende »Durchbruch«. Indem die Pietisten fest darauf vertrauten, dass Gottes Reich auf dieser Welt errichtbar und damit eine Art Vorstufe zur Seligkeit schon im Dies- und nicht erst im Jenseits zu erreichen sei, setzten sie sich vom Luthertum ab. Philipp Jacob Spener, die wichtigste frühe Kraft dieser neuprotestantischen Strömung, die sich in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts bildete, blieb allerdings insofern Luther treu, als er in rastloser Tätigkeit die Gefahr witterte, menschliches Wirken zu vergötzen. Ihm zufolge musste dem Gemüt die rechte Ruhe, »so es in Gott haben sollte«, gegönnt werden.
Dieses Innehalten, das dem kontemplativen Spener noch wesentlich war, wurde bald rigoros verabschiedet: Arbeitsdienst und Gottesdienst wurden eins. 1695 ging der dreißig Jahre jüngere August Hermann Francke daran, in Glaucha bei Halle eine pietistische Musterstadt zu errichten. Anfangs als Waisenhaus konzipiert, wuchsen sich die Franckeschen Stiftungen bald zu einem dreigliedrigen Schulsystem aus, in dem nicht nur die Kinder verarmter Leute von der Straße geholt und erzogen wurden, sondern in das auch der preußische Adel seine Sprösslinge schickte, auf dass sie dort kerzengerade heranwüchsen. Daneben stärkte die »Stadt Gottes« den Wirtschaftsstandort Halle: Neben den Erziehungseinrichtungen gab es eine Apotheke, die bald begann, Medikamente in größerem Stil zu exportieren, ebenso eine Buchdruckerei mit angeschlossener Buchhandlung.
Bild 7
König Friedrich Wilhelm I. prügelt den Torschreiber von Potsdam aus dem Bette. Holzstich von 1889.
Zum flammenden Befürworter und Förderer der Franckeschen Stiftungen wurde König Friedrich Wilhelm I. Das Lebensmotto des »Soldatenkönigs«, der im Berliner Schloss aus Sparsamkeit nur wenige Zimmer bewohnte und den maroden Staatshaushalt, den sein kunst- und wissenschaftsbegeisterter Vater hinterlassen hatte, auch sonst konsequent sanierte, lautete: »Parol’ auf dieser Welt ist nichts als Müh’ und Arbeit.« Der König, der dafür gefürchtet war, schon mal vom Pferd zu steigen, um einen Untertanen, den er beim Müßiggang ertappte, eigenhändig mit dem Stock zu verprügeln, fand in August Hermann Francke einen Gesinnungsbruder, lautete dessen Credo doch: »Wir müssen in unserem ganzen Leben schaffen, dass wir selig werden.«
Damit wurde die berufliche Rastlosigkeit zum ersten Mal in Deutschland zur frömmst-möglichen Lebensform gekürt, die keiner Ergänzung oder Überhöhung durch besinnliche Phasen mehr bedurfte. Sicher wurden die Zöglinge der Franckeschen Stiftungen zu regelmäßigem Gebet und frommen Gesängen angehalten. Sicher vermittelten die Schulen – zumindest die mittlere »Lateinische Schule« und die Elitenschmiede des »Pädagogium Regium« – eine für damalige Verhältnisse exzellente Bildung. Im Kern ging es jedoch darum, die Kinder von klein auf an konsequentes Arbeiten zu gewöhnen. Nur wer arbeitete, sündigte nicht. »Auch ist’s mit der Kinderarbeit nicht allein darum zu tun, dass sie etwas erwerben und das Brot nicht so vergeblich auf die Seele fressen, sondern vielmehr darum, dass man mit der Arbeit vielen schändlichen und schädlichen Lastern, darein sie sonst durch Müßiggang fallen möchten, wehre und zuvorkomme, als da sind: Lügen, Trügen, Saufen, Spielen, Tauschen, Buhlen, Stehlen und dergleichen.« Diese Überzeugung, die bereits der Lutheraner Justus Menius in seiner Oeconomia Christiana festgeschrieben hatte, übernahm Francke und setzte sie in seiner »Stadt Gottes« konsequent um.
Der Soziologe Max Weber vertrat in seiner berühmten Studie von 1904/05 die These, dass sich der Geist des Kapitalismus aus der protestantischen Ethik entwickelte habe. So triftig die These im Allgemeinen ist, so unscharf bleibt sie, was die Rolle angeht, die der Pietismus bei der Entstehung des Kapitalismus gespielt hat. Präziser äußerte sich Carl Hinrichs. In verschiedenen Abhandlungen untersuchte der Historiker die Frage, wie sich der deutsche Pietismus vom angelsächsischen Puritanismus unterschied, und kam zu dem Ergebnis: »Eine Religion, die individuelles Erfolgsstreben stimulierte und rechtfertigte, aber war der Pietismus letztlich nicht. Das unterscheidet ihn von den gleichzeitigen Spätformen des calvinistischen Puritanismus. Der deutsche Pietismus heiligt die Arbeit ›für andere‹, der spätere angelsächsische Calvinismus die Arbeit ›an sich‹.« Oder noch deutlicher: »In England beginnt mit dem Puritanismus auch der Kapitalismus, in Deutschland der Sozialismus.«
In der Tat teilte Francke mit den späteren sozialistischen Menschheitsverfleißigern den missionarischen Furor, dass Arbeit, die nur dem eigenen Seelenheil dient, wertlos, wenn nicht gar sündhaft sei. Der pietistisch Bekehrte hingegen habe verinnerlicht, »dass er sein ganzes Leben Gott zu Ehren und seinem Nächsten zum Dienst und Nutzen führen möge, dass er sich als ein Opfer in dem Dienst Gottes und seines Nächsten gleichsam verzehre«. Jeder müsse »alles, was nach seinem Beruf und Stand möglich ist, zu seiner und anderer Errettung aus dem feuerbrennenden Zorne Gottes getreulich anwenden«.