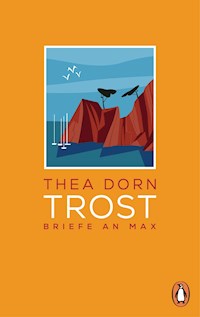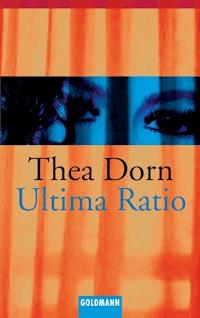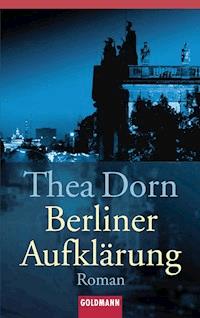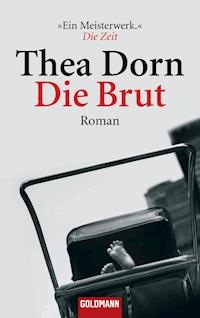15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Albrecht Knaus Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Heimat, Leitkultur, Nation: Thea Dorn will diese kontroversen Themen nicht den Rechten überlassen
Seit Jahren streiten wir, und der Ton wird rauer: Befördert die Rede von Heimat und Verwurzelung oder gar Patriotismus ein rückwärtsgewandtes, engstirniges Denken, das über kurz oder lang zu neuem Chauvinismus, Rassismus und Nationalismus führen wird? Oder ist das Beharren auf unseren kulturellen, historisch gewachsenenen Besonderheiten in Zeiten von Migration, Globalisierung und Technokratisierung nicht vielmehr Grundbedingung dafür, jene weltoffene Liberalität und Zivilität zu wahren, zu der das heutige Deutschland ja inzwischen längst gefunden hat? Anknüpfend an Themen, die sie bereits in ihrem Bestseller „Die deutsche Seele“ (zusammen mit Richard Wagner) erkundet hat, wendet Thea Dorn sich nun den aktuellen Schicksalsfragen unserer Gesellschaft zu - differenziert, unaufgeregt und dennoch leidenschaftlich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 470
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Heimat, Leitkultur, Nation: Thea Dorn will diese kontroversen Themen nicht den Rechten überlassen.
Seit Jahren streiten wir, und der Ton wird rauer: Befördert die Rede von Heimat und Verwurzelung oder gar Patriotismus ein rückwärtsgewandtes, engstirniges Denken, das über kurz oder lang zu neuem Chauvinismus, Rassismus und Nationalismus führen wird? Oder ist das Beharren auf unseren kulturellen, historisch gewachsenen Besonderheiten in Zeiten von Migration, Globalisierung und Technokratisierung nicht vielmehr Grundbedingung dafür, jene weltoffene Liberalität und Zivilität zu wahren, zu der das heutige Deutschland ja inzwischen längst gefunden hat? Anknüpfend an Themen, die sie bereits in ihrem Bestseller »Die deutsche Seele« (zusammen mit Richard Wagner) erkundet hat, wendet Thea Dorn sich nun den politischen Schicksalsfragen unserer Gesellschaft zu – differenziert, unaufgeregt und dennoch leidenschaftlich.
Autorin
Thea Dorn, geboren 1970, studierte Philosophie und Theaterwissenschaften in Frankfurt, Wien und Berlin. Sie schrieb eine Reihe preisgekrönter Romane (zuletzt »Die Unglückseligen«), Theaterstücke und Essays. 2011 veröffentlichte sie (zusammen mit Richard Wagner) »Die deutsche Seele«, eine enzyklopädische Kulturgeschichte des Deutschen von Abendbrot bis Zerrissenheit. Seit März 2017 ist sie festes Mitglied im »Literarischen Quartett«. Thea Dorn lebt in Berlin.
Thea Dorn
Deutsch, nicht dumpf
Ein Leitfaden für aufgeklärte Patrioten
Knaus
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2018 Albrecht Knaus Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt Satz: Uhl + Massopust, Aalen ISBN 978-3-641-23025-8 V003 www.knaus-verlag.de
Inhalt
Vorbemerkung
Kapitel 1 Deutsche Kultur – gibt es sie überhaupt?
Kapitel 2 Leitkultur – kann es sie überhaupt geben?
Kapitel 3 Identität – glücklich, wer keine braucht?
Kapitel 4 Heimat – glücklich, wer eine hat?
Kapitel 5 Europa – unser besseres Wir?
Kapitel 6 Weltbürgertum – unser bestes Wir?
Kapitel 7 Die deutsche Nation – warum es sie gibt
Kapitel 8 Patriotismus – warum wir ihn brauchen
Vorbemerkung
Dürfen wir unser Land lieben? Dürfen wir es gar »Heimat« nennen? Falls ja: Was meinen wir damit? Das Fleckchen Erde, auf dem wir zufällig geboren wurden? Die Kultur, die uns geprägt hat? Das Umfeld, das uns vertraut ist und in dem wir einander vertrauen? Den Ort, an dem wir unseren Lebensunterhalt verdienen? Das soziale Netz, das uns auffängt, wenn wir straucheln? Den Staat, der uns eine freiheitliche, demokratische Verfassung beschert?
Wenn aber jeder unter »Deutschland« etwas anderes versteht, von wem reden wir dann, wenn wir »wir« sagen? Und hat Patriotismus – verstanden als die Haltung, dass ich meinem Land mindestens so viel schulde, wie es mir schuldet – überhaupt noch eine Chance in Zeiten, in denen es von jedem Funkmast zwitschert: »Ich bin doch nicht blöd!«?
Das Gelände gleicht einem Irrgarten. Zögernd, vorsichtig setzen wir Fuß vor Fuß, wohl wissend, dass wir uns nicht nur zwischen dornigen Hecken verfranzen können, sondern dass etliche Fallgruben darauf warten, uns einbrechen zu lassen.
Aus der Tiefe rufen dumpfe Stimmen zur Jagd, raunen, »Volk und Land zurückzuholen«. Aus der Höhe mahnen sorgentrunkene Chöre, das mit dem »Volk und Land« doch bitte ganz sein zu lassen, auf dass alle Menschen nun aber wirklich Brüder werden mögen – und Schwestern sowieso.
Dieser Leitfaden sei allen gewidmet, die sich nicht irremachen lassen wollen:
– die weder Rattenfängern noch Wolkenkuckucksheimern folgen;
– die nicht davon träumen, das Buch der deutschen Vergangenheit zuzuschlagen;
– die daran festhalten, dass es in diesem Buch finstere und helle Kapitel gibt – und dass das finsterste Kapitel zwischen 1933 und 1945 geschrieben wurde;
– die überzeugt sind, dass nichts dagegenspricht, deutsch und zivilisiert zu sein;
– die den syrischstämmigen Förster ebenso willkommen heißen wie den urdeutschen;
– die, auch wenn sie aus Syrien oder der Türkei, Tunesien, Marokko oder sonst einem Land stammen, die Vorstellung, sie selbst oder eines ihrer Kinder, eines ihrer Geschwister, könnte Förster beziehungsweise Försterin im deutschen Wald werden, nicht kategorisch ablehnen;
– die mit Freude in einem Land leben, in dem die Geschlechterrollen und Familienverhältnisse ins Tanzen geraten sind – sei’s, weil sie selbst zu den Tänzern gehören, sei’s, weil sie akzeptieren, dass nicht hinter jedem heimischen Herd eine Frau steht, dass nicht jede Frau Mutter ist, dass nicht alle Kinder in einer Vater-Mutter-Familie leben und manche sogar zwei Mütter oder zwei Väter haben, dass Schwule und Lesben keine »Invertierten« sind;
– die nie auf die Idee kämen, die gesellschaftliche Mehrheit, die traditionelle Herkünfte hat oder in traditionellen Verhältnissen lebt, als rückschrittlich zu verspotten;
– die ahnen, dass die gegenwärtige deutsche Liberalität und Weltoffenheit ein ethisch-kulturelles Fundament haben – und dass wir dabei sind, dieses Fundament zu untergraben;
– die bezweifeln, dass der Humanität besser gedient ist, wenn wir uns verbieten, zunächst an unser eigenes Land zu denken, sondern stets Europa oder gleich die ganze Welt im Sinn haben sollen;
– die befürchten, dass hässliche Zeiten vor uns liegen, wenn wir den öffentlichen Diskurs den Schreihälsen überlassen;
– die sich in Zeiten der Radikalisierung nach vernünftiger Orientierung sehnen;
– die nicht erwarten, dass auf komplizierte Fragen simple Antworten zu haben sind.
Berlin, im März 2018
Thea Dorn
Kapitel 1 Deutsche Kultur – gibt es sie überhaupt?
Ich wünschte, ich könnte mit etwas Schönem beginnen. Damit, wie mein Herz höherschlägt, wenn ich an einem nebligen Herbsttag durchs Elbsandsteingebirge wandere; wie ich versinke, wenn ich höre, wie Richard Wagner Tristan und Isolde in ihrer Liebe ertrinken lässt; wie ich mich freue, seit ich mich freuen kann, wenn die deutsche Nationalmannschaft bei einer Fußballweltmeisterschaft gewinnt (von meinem Vater hatte ich gelernt, dass sich ein anständiger Deutscher nur freut, wenn »die Deutschen eins auf den Deckel bekommen«); wie mir ein glückliches, ja dankbares Lächeln übers Gesicht huscht, wenn ich auf Berliner Straßen nahezu täglich Menschen begegne, die Hebräisch reden; wie ich aus dem Denken nicht mehr herauskomme, wenn ich anfange, Kant, Nietzsche, Adorno zu lesen; wie meine Geschmacksknospen aufblühen, wenn ich nach Wochen im Ausland zum ersten Mal wieder in eine Scheibe Schwarzbrot beiße und dazu ein – nach deutschem Reinheitsgebot gebrautes – Bier trinke.
Aber unsere politisch-mediale Gegenwart nötigt mich, mit etwas Hässlichem zu beginnen: mit etwas Ahnungslos-Dummem und etwas Niederträchtig-Dummem, das mir in seiner wechselseitigen Verstrickung allerdings ein trauriges Muster dafür zu sein scheint, wie der öffentliche Diskurs entgleist, sobald es nicht mehr um Verständigung geht, sondern darum, wer sich besser ins rechte Licht der Skandalscheinwerfer zu rücken weiß.
Deutschland, im Frühjahr 2017: Bald beginnt der Bundestagswahlkampf, sechs Parteien suchen nach ihren Themen. Und wie immer seit einer Weile, wenn in Deutschland nach politischen Themen gesucht wird, wirft ein Vertreter des eher konservativen Lagers den Köder »Leitkultur« in den nationalen Karpfenteich. Und wie immer beginnt es sogleich zu blubbern und zu brodeln.
Die Rolle »Aufschrei/Abwehr« war 2017 mit Aydan Özoğuz schnell und plausibel besetzt. In einem Zeitungsartikel erklärte die in Hamburg geborene SPD-Politikerin und Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, warum sie es ablehne, über »Leitkultur« zu diskutieren: »Sobald diese Leitkultur aber inhaltlich gefüllt wird, gleitet die Debatte ins Lächerliche und Absurde, die Vorschläge verkommen zum Klischee des Deutschsein. Kein Wunder, denn eine spezifisch deutsche Kultur ist, jenseits der Sprache, schlicht nicht identifizierbar.«
Der Sommer ging ins Land, der Wahlkampf mit ihm, bis AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland – einstiges CDU-Mitglied, das ausgezogen ist, seine alte Partei das Fürchten zu lehren – erkannte, dass die Position des aggressiven Gegenstürmers noch immer vakant war. »Das sagt eine Deutschtürkin!«, giftete er also bei einer Wahlkampfveranstaltung im Thüringischen. »Ladet sie mal ins Eichsfeld ein und sagt ihr dann, was spezifisch deutsche Kultur ist. Danach kommt sie hier nie wieder her, und wir werden sie dann auch, Gott sei Dank, in Anatolien entsorgen können.«
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich möchte mir an dieser Stelle jedes Haar einzeln raufen. Wie kann ein deutscher Bildungsbürger glauben, seinem Land – dessen Wohl ihm und seiner Partei angeblich so sehr am Herzen liegt – einen Dienst zu erweisen, indem er sich in die Tradition jener Barbaren stellt, die, wenn sie oft genug »deutsch« sagen, bald schon davon schwadronieren, Menschen, deren Haltungen ihnen nicht passen, »entsorgen« zu wollen?
Wie kann eine Deutsche, deren Eltern vor einem halben Jahrhundert hierhergekommen sind, um sich eine neue Existenz aufzubauen, glauben, ihrem Land – für dessen Wohl sie als Regierungsmitglied eine besondere Verantwortung trägt – einen Dienst zu erweisen, indem sie Einwanderern erklärt, es habe sie in ein kulturelles Niemandsland verschlagen?
Und wie können wir, alle miteinander, glauben, dass es unser Land nicht zerreißt, wenn wir weiterhin gelangweilt, resigniert oder gar amüsiert zuschauen, wie grobe Vereinfacher ihre Reißzähne in es hineinhauen?
Die rüden Kräfte, die bereits am Werk sind, bändigen wir nicht, indem wir uns jeweils auf die Seite schlagen, die beim Zerren gerade etwas Unterstützung brauchen könnte. Auf Ignoranz aus dem linken Lager antwortet man nicht mit rechter Bestialität. Und rechte Bestialität bekämpft man nicht, indem man aus Entsetzen noch weiter nach links rückt. Oder den rechten Leitwölfen mit eingekniffenem Schwanz hinterherhechelt.
Ebenso ist es unmöglich, der Logik von Skandal und Gegenskandal zu entkommen, wenn sich die politische Klasse parteiübergreifend in ein Lager der Krachmacher und ein Lager der Konsensverwalter spaltet. Destruktiv eskalierendes Gezänk beende ich nicht, indem ich eine halbwegs vernünftige oder auch bloß verzweifelte Position als »alternativlos« behaupte und damit allen Streit für obsolet erkläre. Im Gegenteil. Konstruktive Auseinandersetzungen – die wir, so wie unsere Welt verfasst ist, dringend brauchen – können wir erst wieder führen, wenn wir uns Klarheit darüber verschaffen, was wir konkret meinen, wenn wir Reizworte wie »deutsche Kultur« oder gar »deutsche Leitkultur« verwenden. Wem es genügt, dem Gegner die eigene Position mit möglichst lautem »Klatsch!« um die Ohren zu schlagen, der möge zum Zirkus gehen und sich als Watschenclown bewerben. Ernsthaft miteinander ringen können wir nur, wenn wir erkennen, worum es bei den aktuellen Reizthemen dem Kern nach geht.
In diesem Sinne möchte ich mit dem Schürfen beginnen, indem ich versuche herauszufinden, worüber wir eigentlich streiten, wenn wir uns über der Frage entzweien, ob es eine »spezifisch deutsche Kultur« gibt.
Deutsche Begriffsverwirrung und Denkhilfe aus Österreich
Wenn zwei Parteien sich nicht einigen können, ob es ein bestimmtes Phänomen – sagen wir: Einhörner – gibt, liegt dies häufig daran, dass sie sich bereits nicht einigen können, bei wem die Beweislast liegt. Muss derjenige, der behauptet, dass es Einhörner gibt, beweisen, dass diese tatsächlich existieren? Oder muss der Einhornskeptiker dem Einhorngläubigen beweisen, dass Letzterer einem Trugbild anhängt?
Ich vermute, viele würden sagen: So nett die Vorstellung von Einhörnern auch ist, ihre reale Existenz ist nicht bezeugt und so wenig wahrscheinlich, dass in diesem Falle die Beweislast beim Einhorngläubigen liegt.
Was aber, wenn Sie es mit einem Gegner zu tun haben, der behauptet, er glaube nicht an die Existenz von Mänteln? Würden Sie da nicht sagen: Verzeihung, aber wie kommen Sie denn zu dieser absurden Einschätzung? Ich habe nicht den geringsten Zweifel daran, dass es Mäntel gibt, in diesem Augenblick zum Beispiel trage ich einen.
Sie ahnen, worauf ich hinauswill. Offensichtlich gibt es in unserem Land Menschen, denen die Behauptung, es gebe eine »deutsche Kultur«, so lächerlich erscheint wie die Behauptung, es gebe Einhörner. Diese treffen auf Menschen, denen die Existenz einer deutschen Kultur wiederum so selbstverständlich ist wie dem Mantelträger die Existenz von Mänteln. Was bleibt den beiden Parteien anderes übrig, als die jeweils andere für komplett gaga zu halten?
Versuchen wir, die Lage zu entspannen, indem wir beide Seiten in ein Gespräch bringen, bei dem wir frei nach Bertolt Brecht weder Anmut noch Mühe, weder Leidenschaft noch Verstand sparen.
Lieber Skeptiker, so könnte ein Gesprächsbeginn lauten, darf ich nachfragen, ob Sie generell nicht an die Existenz von Kulturen glauben? Nicht an die Existenz einer französischen Kultur, nicht an die Existenz einer italienischen Kultur, nicht an die Existenz einer türkischen Kultur?
Bejaht der Skeptiker diese Nachfrage, wissen wir, dass wir es mit einem waschechten Skeptiker zu tun haben. Für ihn ist das Goethe-Institut lediglich eine deutsche Sprachschule im Ausland, ebenso wie das Institut français seine Aktivitäten auf französischen Sprachunterricht beschränken sollte, das Istituto italiano di cultura die seinen auf italienischen Sprachunterricht und die diversen türkischen Kulturvereine in Deutschland nichts außer türkischen Sprachkursen im Programm haben sollten. Er ist so konsequent wie der Einhornskeptiker, der ja auch nicht behauptet, lediglich die Existenz gescheckter Einhörner infragezustellen, an die von gestreiften, gepunkteten und karierten hingegen zu glauben.
Ich befürchte allerdings, dass es unter den hiesigen Kulturskeptikern nicht wenige gibt, die exakt diese sonderbare Inkonsequenz an den Tag legen; die der Meinung sind, dass man von einer »französischen«, »italienischen« oder »türkischen Kultur« durchaus reden könne, aber eben nicht von einer »deutschen«.
Lassen wir die Kulturchauvinisten außer Acht, deren Inkonsequenz auf der Überzeugung beruht, einzig die Hervorbringungen und Lebensformen ihres eigenen (Herkunfts-)Landes verdienten die Bezeichnung »Kultur«, während im Rest der Welt Barbarei herrsche. Beschäftigen wir uns lieber mit denen, die ihre spezifische Skepsis gegenüber einer »deutschen Kultur« nicht einfach nur behaupten, sondern bereit sind, diese zu begründen.
Das erste Argument, das in diesem Zusammenhang regelmäßig angeführt wird, lautet: Deutschland ist so hochgradig regional geprägt, dass sich nicht sinnvoll von einer gemeinsamen »deutschen Kultur« reden lässt, sondern allenfalls von einer »bayerischen«, einer »rheinischen«, einer »westfälischen«, einer »sächsischen« usw.
Auf den ersten Blick hat das Argument, die deutsche Kultur erschöpfe sich in Regionalkulturen, einiges für sich. Wie der Philosoph und Soziologe Helmuth Plessner es so schön auf den Begriff brachte, handelt es sich bei Deutschland um eine »verspätete Nation«, sprich: Bis 1871 war Deutschland ein bunter – manche sagen: grotesker – Flickenteppich aus Königreichen, Großherzog-, Herzog- und Fürstentümern; ein Kurfürstentum, eine Landgrafschaft und ein paar freie Städte kamen noch hinzu. Kein Wunder also, dass regionale Eigenheiten das Bild der deutschen Kultur stärker geprägt haben, als dies etwa im zentralistischen Frankreich der Fall ist – wobei ich mir auch da nicht sicher bin. Ich bezweifle, dass sich der Bretone dem Pariser tatsächlich inniger verbunden fühlt als der Bayer dem Berliner.
Wenn man sich mit der deutschen Geschichte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts beschäftigt, verliert das Argument der bloßen Regionalkulturen an Plausibilität. Die Zeit zwischen den Befreiungskriegen gegen die napoleonisch-französische Besatzung und der liberal-demokratischen deutschen Revolution, die in der Paulskirche ihren allzu kurzen Frühling erlebte, war die Blütezeit der volkstümlichen Vereinsgründungen. (Die »Patriotischen Gesellschaften«, »Gelehrten Gesellschaften« oder »Lesegesellschaften«, die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts allenthalben zwischen Nordsee und Bodensee entstanden, waren hingegen eine rein bildungsbürgerliche Angelegenheit.) Die zahllosen Männergesangsvereine etwa, die nach 1813 entstanden, widmeten sich mit derselben Inbrunst der Pflege des regionalen wie des überregional-deutschen Liedguts. Ihren sicht- und hörbarsten Ausdruck fand diese Einheit des Vielfältigen in den immer gigantischer werdenden deutschen Sängerfesten, bei denen auch die Frage: »Ist das noch Biedermeier oder schon Vormärz?«, immer schwieriger zu beantworten wurde. Aus allen deutschen Landen reisten Männerchöre an, um ihre Kunst einzeln darzubieten. Doch irgendwann kam der Moment, an dem alle gemeinsam singen, sich zu einem einzigen Chor vereinigen wollten. Eine der bevorzugten Hymnen jener Zeit war Der Jäger Abschied, die kongeniale Vertonung des Eichendorff-Gedichts durch Felix Mendelssohn Bartholdy. Spätestens, wenn zweitausend und mehr Männer beim finalen Refrain angekommen waren und unter freiem Himmel ihr letztes »Schirm dich Gott, du deutscher Wald« in die Nacht hauchten, spielte es keine Rolle mehr, ob man Friese, Sachse, Pfälzer oder Kurpfälzer war – und, dies sei ebenfalls erwähnt, ob man Christ oder Jude war. Ein knappes Jahrhundert, bevor die Nationalsozialisten den Fackelzug zum schaurigen Sinnbild einer barbarisch gewordenen deutschen Kultur machten, geleiteten die Teilnehmer des »Ersten Sängerfests zu Cöln« eben jenen Felix Mendelssohn Bartholdy, der das Amt des Chefdirigenten freudig übernommen hatte, mit einem Fackelzug zu seiner Unterkunft.
Mir sind solche Episoden der deutschen Vergangenheit lieb und kostbar, aber ich vermute, den eingefleischten Skeptiker werde ich damit nicht überzeugen. Und tatsächlich lässt sich einwenden, dass die Geschichte des deutschen Gesangsvereinswesens eine interessante Ausnahme sein mag. Von den diversen deutschen Trachtengruppen sei nicht überliefert, dass sie sich je danach gesehnt hätten, alle in einem deutschen Tanz aufzugehen. Auch dies stimmt natürlich nur bedingt, schließlich gab es einst einen »Deutschen Tanz«, aus dem später der Walzer wurde, der womöglich mit dem Ländler verwandt ist und auf verschlungene Weise vielleicht sogar mit dem Schuhplattler.
Aber bevor wir aufs Glatteis der Diskussion geraten, wie sich die deutsche Kultur mit einem klaren Strich von der österreichischen abgrenzen lässt, schlage ich vor, dem noch immer skeptischen Skeptiker eine einfache Frage zu stellen, die fürs Erste rein gar nichts mit Geschichte zu tun hat. Dafür allerdings mit Österreich, denn der Philosoph, den ich zu Hilfe rufen will, heißt Ludwig Wittgenstein.
Frei nach Wittgenstein will ich den Skeptiker fragen: Du hast Schwierigkeiten, den Begriff »deutsche Kultur« zu verstehen. Hast du auch Schwierigkeiten, den Begriff »Spiel« zu verstehen?
Lieber Skeptiker, sagen Sie jetzt bitte nicht: Hä?! Ihr Argument gegen den Begriff »deutsche Kultur« war schließlich, dass diese »schlicht nicht identifizierbar« sei. Ich möchte Sie also lediglich auffordern, mir eine schlichte Identifikation – in diesem Fall können wir ruhig sagen: eine schlichte Definition – dessen zu geben, was Sie unter »Spiel« verstehen. Wie lautet der gemeinsame Nenner von Schach, Fußball, Murmelspiel, Hamlet und World of Warcraft? Anders gefragt: Was haben ein strategisches Brettspiel, bei dem zwei Personen gegeneinander antreten, eine Rasen-/Ballsportart, bei der zwei Mannschaften gegeneinander antreten, ein Kind, das selbstvergessen Glaskugeln über den Boden kullern lässt, ein Schauspiel, bei dem verschiedene Menschen in die Rollen von Figuren schlüpfen, die ein englischer Dichter vor über vierhundert Jahren erfunden hat, und ein Computerspiel, bei dem allein vor ihren Bildschirmen sitzende Menschen virtuelle Identitäten annehmen, um sich in einer digitalen Welt zu bekämpfen oder Allianzen zu schließen – was haben alle diese Phänomene gemein?
Bevor wir uns den Kopf zerbrechen, möchte ich ausführlicher auf Wittgenstein zurückgreifen. In seinen Philosophischen Untersuchungen fordert er uns auf: »Betrachte z. B. einmal die Vorgänge, die wir ›Spiele‹ nennen. Ich meine Brettspiele, Kartenspiele, Ballspiel, Kampfspiele, usw. Was ist allen diesen gemeinsam? – Sag nicht: ›Es muss ihnen etwas gemeinsam sein, sonst hießen sie nicht ‚Spiele‘‹ – sondern schau, ob ihnen allen etwas gemeinsam ist. – Denn wenn du sie anschaust, wirst du zwar nicht etwas sehen, was allen gemeinsam wäre, aber du wirst Ähnlichkeiten, Verwandtschaften, sehen, und zwar eine ganze Reihe. Wie gesagt: denk nicht nach, sondern schau! – Schau z. B. die Brettspiele an, mit ihren mannigfachen Verwandtschaften. Nun geh zu den Kartenspielen über: hier findest du viele Entsprechungen mit jener ersten Klasse, aber viele gemeinsame Züge verschwinden, andere treten auf. Wenn wir nun zu den Ballspielen übergehen, so bleibt manches Gemeinsame erhalten, aber vieles geht verloren. – Sind sie alle ›unterhaltend‹? […] Oder gibt es überall ein Gewinnen und Verlieren, oder eine Konkurrenz der Spielenden? Denk an die Patiencen. In den Ballspielen gibt es Gewinnen und Verlieren; aber wenn ein Kind den Ball an die Wand wirft und wieder auffängt, so ist dieser Zug verschwunden. Schau, welche Rolle Geschick und Glück spielen. Und wie verschieden ist Geschick im Schachspiel und Geschick im Tennisspiel. […] Und so können wir durch die vielen, vielen anderen Gruppen von Spielen gehen. Ähnlichkeiten auftauchen und verschwinden sehen. Und das Ergebnis dieser Betrachtung lautet nun: Wir sehen ein kompliziertes Netz von Ähnlichkeiten, die einander übergreifen und kreuzen. Ähnlichkeiten im Großen und Kleinen.«
Meines Wissens taucht im Werk von Wittgenstein die Beschäftigung mit dem Begriff der »Kultur« oder gar der »deutschen« beziehungsweise »österreichischen Kultur« nirgends auf, dennoch scheinen mir seine Überlegungen für unser Problem ausgesprochen hilfreich zu sein: Zum einen führen sie uns weg von dem Holzweg, eine schlichte Definition dessen zu verlangen beziehungsweise zu suchen, was »deutsche Kultur« ist, sondern eröffnen uns, dass wir es mit einem »komplizierten Netz von Ähnlichkeiten, die einander übergreifen und kreuzen« zu tun haben. Zum anderen machen sie deutlich, dass wir den Begriff »deutsche Kultur« niemals abstrakt verstehen können, sondern nur, indem wir uns anschauen, wie er verwendet wurde und wird.
2011 haben der Schriftsteller Richard Wagner und ich ein Buch veröffentlicht, das Die deutsche Seele heißt. In 64 Kapiteln von »Abendbrot« über »Arbeitswut«, »Fachwerkhaus«, »Gemütlichkeit«, »Kirchensteuer«, »Narrenfreiheit«, »Ordnungsliebe«, »Pfarrhaus«, »Reinheitsgebot« und »Strandkorb« bis hin zur »Zerrissenheit« spüren wir dem nach, was die deutsche Kultur ausmacht. Ohne die Wittgenstein’sche Sprachphilosophie damals im Sinn gehabt zu haben, haben wir in unserem Buch unbewusst genau den Prozess nachvollzogen, von dem Wittgenstein zeigt, dass er unerlässlich ist, wenn wir einen Begriff tatsächlich verstehen und souverän mit ihm umgehen wollen: Wir haben uns die unterschiedlichen Phänomene, von denen wir trotz ihrer Unterschiedlichkeit die Vermutung hatten, dass sie konkrete Erscheinungsformen der deutschen Kultur sein könnten, genau angeschaut, indem wir ihre jeweilige Geschichte von der Entstehung bis in unsere Gegenwart verfolgt haben. Anders ausgedrückt: Wir haben uns auf die Suche nach dem gemacht, was Wittgenstein so schön »Familienähnlichkeiten« nennt.
Auf diese Weise haben wir zum Beispiel herausgefunden, dass zwischen den scheinbar höchst verschiedenen deutschen Kulturerrungenschaften wie dem Kindergarten, der Jugendherberge, dem Schrebergarten und der Freikörperkultur eine verblüffend enge Verwandtschaft besteht: Alle vier Phänomene sind Reaktionen auf die Sorge, dass der Mensch, vor allem der junge Mensch, sich im Zuge der Industrialisierung und mit dem Anwachsen der Großstädte zu weit von der Natur entfernt.
Hat man dies erkannt, erkennt man auch, dass der Kindergarten, die Jugendherberge, der Schrebergarten und die Freikörperkultur allernächste Verwandte der urdeutschen Liebe zur Natur, insbesondere zum Wald sind. Die Liebe der Deutschen zum Wald wiederum ist ein so komplexes Thema, dass sie Verbindungen zu nahezu allen Ausprägungen der deutschen Kultur hat: Fünfhundert Jahre, bevor das »Waldsterben«, eine der berühmtesten deutschen Ängste, Karriere machte, befürchtete schon Martin Luther, den Deutschen könne es eines baldigen Tages an »wildem Holze« mangeln; nichts besingt der Männerchor – außer der Liebe und der Heimat – lieber als den Wald; kein Romantiker, der nicht Tag und Nacht im Wald umherwandelt; der Schriftsteller Elias Canetti war der Ansicht, dass vom wohlgeordneten deutschen Forst ein unmittelbarer Weg zum preußischen Militarismus führe; und die Forstwissenschaft – eine Disziplin, die von einem Deutschen begründet wurde – macht den Förster zum überraschend nahen Cousin des deutschen Tüftlers und Technikers, der überzeugt ist, für jedes Problem eine saubere, wissenschaftlich fundierte Lösung zu finden. Der deutsche Techniker verbeugt sich seinerseits vor der Natur, indem er etwa wie Carl Benz beim ehrgeizigen Projekt des »pferdelosen Wagens« – sprich: des Automobils – durchaus auch an die armen Vierbeiner dachte, die der Mensch bis dahin vor seinen Karren gespannt hat. Selbst das heute so populäre Konzept der »Nachhaltigkeit« entstammt der Forstwissenschaft – in der Sylvicultura oeconomica des sächsischen Oberberghauptmanns Hannß Carl von Carlowitz taucht es 1713 zum ersten Mal auf.
Sämtliche Bücher, die sich in den vergangenen Jahren ernsthaft bemüht haben, anschaulich zu machen, was unter »deutscher Kultur« sinnvollerweise verstanden werden könnte, sind dick. Sehr dick. Unsere Deutsche Seele ist mit ihren 560 Seiten noch eine vergleichsweise schmale Lektüre. Einzig der Althistoriker und Kulturwissenschaftler Alexander Demandt bleibt mit seinem Buch Über die Deutschen knapp darunter. Der britische Kulturhistoriker Peter Watson etwa braucht gut 1000 Seiten, um den »deutschen Genius« zu beschreiben; der deutsche Germanist Dieter Borchmeyer benötigt nahezu 1100 Seiten, um die Frage »Was ist deutsch?« zu beantworten; und die von den französisch-deutschen Historikern Etienne François und Hagen Schulze herausgegebene Anthologie Deutsche Erinnerungsorte hat deutlich über 2000 Seiten.
Ich sehe, wie der Skeptiker spöttisch die Mundwinkel verzieht, getreu dem Motto: Wer klar weiß, was er meint, kann sich auch kurzfassen. Ich wiederhole es noch einmal: Wenn der Skeptiker solch ein Freund des Sich-Kurzfassens ist, dann soll er mir bitte in 140 oder meinetwegen auch 280 Zeichen erklären, was ein »Spiel« ist. Oder er möge auch dieses Wort künftig aus seinem Sprachschatz entfernen.
Ich hingegen frage mich, wie aberwitzig gehetzt oder denkfaul wir sind, wenn wir den Umstand, dass sich die deutsche Kultur eben nicht in einem Atemzug beschreiben lässt – und auch nicht in zwei oder drei –, polemisch gereizt gegen sie verwenden, anstatt ihre Komplexität als ihren größten Reichtum aufzufassen? Denn so wie ich niemals zu einem reichen, nuancierten Verständnis dessen kommen werde, was »Spiel« meint, wenn ich nur Fußball und World of Warcraft im Kopf habe, komme ich zu keinem reichen, nuancierten Verständnis der »deutschen Kultur«, wenn ich sie mit ein paar dürren Worten abfertige, anstatt sie mit allen Mitteln der deutschen Sprache, in allen Farben und Formen anschaulich zu machen.
Und deshalb, Herr Gauland, ist Ihre vergiftete Einladung an Aydan Özoğuz, sie möge ins Eichsfeld kommen, dann werde sie schon sehen, was »deutsche Kultur« ist, populistischer Quatsch. Ein Besuch im Eichsfeldischen kann anschaulich machen, was in diesem Fleckchen unseres vielfältigen Landes unter Kultur verstanden wird – und nicht mehr.
Aus denselben Gründen bin ich eine Gegnerin sämtlicher Versuche, auf einer halben Zeitungsseite oder in einem Zwei-Minuten-Statement erklären zu wollen, was deutsche Kultur ist. Die öffentliche Crux beginnt jedoch in dem Moment, in dem dies abgehackte, zwangsläufig oberflächliche Gestammel alles ist, was unsere Medien noch für druck- oder sendbar halten.
Offen für Veränderung
Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass der eingefleischte Skeptiker nicht nur die in der Tat unergiebigen Schrumpfdiskurse meint, sondern generell dazu neigt, »Klischee« zu rufen, sobald ihm einer zu erzählen versucht, was deutsche Kultur ist. Ich vermute, Frau Özoğuz und alle, die ihrer Haltung zustimmen, würden auch mir vorwerfen, dass ich lediglich ein »Klischee des Deutschseins« reproduziere, wenn ich, wie eben geschehen, etwa von der »urdeutschen Liebe zur Natur, insbesondere zum Wald« spreche. Aber offen heraus: Ich verstehe nicht, was sie mir damit sagen wollen. Wenn ich »deutscher Wald« höre, gehen mir sogleich hunderterlei Bilder, Gerüche, Geschichten, Klänge durch den Kopf: Ich sehe die herrlichen Wälder vor mir, die zwischen Kühlungsborn und Warnemünde bis an den Ostseestrand reichen; mir fallen Grimms Märchen ein; in Gedanken steige ich im Morgengrauen auf den Kickelhahn und flüstere dabei: »Über allen Gipfeln ist Ruh’ …«; mir kommt mein deutsches Lieblingswort »Waldeinsamkeit« in den Sinn; ich höre nicht nur veritable Waldvöglein zwitschern, sondern höre auch Robert Schumanns Waldszenen; ich sehe den schwarzen, schweigenden Wald, den Caspar David Friedrich gemalt hat, und muss an den scheinbar sachlichen Waldbilder-Zyklus von Gerhard Richter denken, und so weiter und so fort. Seitenlang könnte ich darüber schwärmen, was der deutsche Wald alles ist! Das ist doch kein Klischee! Das ist Seelenreichtum!
Außerdem würde ich mir nie anmaßen zu behaupten, dass alle Deutschen in der Waldfrage so empfinden wie ich. Ohne jeden Zweifel gibt es Hunderttausende oder vielleicht sogar Millionen von Deutschen, die den Wald meiden wie die grüne Hölle.
Einen klischeehaften Begriff vom Deutschen hätte ich doch nur, wenn ich Sätze sagen würde wie: Deutsche Kultur bedeutet, samstags Bundesliga zu schauen, sonntags Tatort und montags pünktlich zur Arbeit zu erscheinen. Oder: Deutsche Kultur bedeutet, im Frühjahr Spargel zu essen, im Sommer nach Bayreuth zu fahren, im Herbst das Reformationsfest zu feiern und im Winter auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Aber noch einmal: Nichts liegt mir ferner als derartige Pauschalisierungen und Verkürzungen.
Deshalb vermute ich, liebe Frau Özoğuz, dass Sie mit Ihrem Klischeevorwurf eigentlich etwas anderes meinen – und dass wir uns damit dem Kern unseres Dissenses nähern: Sie werfen mir vor, dass sich meine Inventur der deutschen Kulturphänomene auf solche Phänomene beschränkt, die in Deutschland schon seit Längerem zum »Bestand« gehören. Dass ich nicht von den »neuen deutschen« Kulturphänomenen rede. Nicht von Moscheen. Nicht von melancholisch dahingezupften Saz-Klängen. Nicht von dampfendem, süßem Çay – und nicht von Rock ’n’ Roll und nicht von Spaghetti carbonara und nicht von Yoga-Studios, um gar nicht erst den beliebten Fehler zu machen, uns auf Phänomene aus dem islamischen Kulturkreis zu fixieren.
Aber ganz ehrlich: Würden Sie mich nicht für eine groteske Kulturkannibalin halten, würde ich plötzlich behaupten, der Rock ’n’ Roll sei eine typisch deutsche Musikrichtung, so wie Spaghetti carbonara bevorzugt in der deutschen Küche anzutreffen seien? Würde ich plötzlich sagen, der Hodscha Nasreddin und seine Geschichten gehörten nicht länger zur türkischen, sondern zur deutschen Kultur, würden Sie mir nicht entgegnen: Liebe Frau Dorn, kein Deutscher türkischer Abstammung käme auf die Idee, Till Eulenspiegel der türkischen Kultur einzuverleiben, also lassen Sie die gierigen Germanenfinger bitte auch vom Nasreddin.
Und ich würde Ihnen antworten: Liebe Frau Özoğuz, Sie haben vollkommen recht. Und wenn Sie mögen, können wir uns bei Gelegenheit zusammensetzen, und Sie erzählen mir die Nasreddin-Geschichten, die Ihnen Ihre Eltern oder Großeltern erzählt oder vorgelesen haben, und ich erzähle Ihnen ein paar von Till Eulenspiegels Streichen, die mir meine Eltern und Großeltern vorgelesen haben. Vielleicht stellen wir dann irgendwann zwischen gemütlichem Bier, einem Gläschen Raki und/oder Çay fest, dass beide Schlitzohren einmal versucht haben, einen Wirt mit dem Klang von Geld um die Zeche zu prellen, und am Schluss könnten wir uns vielleicht sogar darauf einigen, dass es der Freundlichkeit unserer Begegnung keinen Abbruch tut, wenn wir den Nasreddin bis auf Weiteres in seinem türkischen und den Eulenspiegel in seinem deutschen Kulturkreis zu Hause sein lassen.
Denn selbstverständlich verändern sich Kulturen! Die französische Philosophin Catherine Malabou hat für komplexe Wandlungsprozesse den Begriff der »Plastizität« geprägt. Im Anschluss an den deutschen Großdenker Georg Wilhelm Friedrich Hegel unterscheidet sie zwei falsche Arten, wie sich ein Mensch zu seiner Umwelt verhalten kann: Entweder er lehnt jeden neuen Einfluss ab und erstarrt, oder er nimmt alles an, lässt sich beständig verformen und wird beliebig. Als einzige produktive Einstellung gegenüber dem Neuen, dem »Fremden«, macht Malabou die »Plastizität« aus: jene Haltung, sich für Veränderungen zu öffnen, ohne sich dabei zu deformieren.
In diesem Sinne ist auch die deutsche Kultur ein plastisches Gebilde. Das beste Beispiel dafür, wie etwas, das lange Zeit für höchst »undeutsch« gehalten wurde, nach und nach zum Inbegriff einer deutschen Leidenschaft wurde, ist der Fußball. Ein ganzes Jahrhundert, von 1810 bis zum Ersten Weltkrieg, war Turnen der Inbegriff deutscher Körperertüchtigung. Als der Gymnasiallehrer Konrad Koch 1874 das runde Leder aus England nach Deutschland mitbrachte, wurde das neue Spiel von konservativen Sportsfreunden als proletarische »Fußlümmelei« niedergemacht. Es brauchte einige Jahrzehnte, bis sich die »Spielbewegung« gegen die »Turnbewegung« durchsetzen konnte. Zum nationalen Kult wurde Fußball erst mit dem »Wunder von Bern«, der überraschend gewonnenen Weltmeisterschaft von 1954, die den moralisch und militärisch vernichteten Deutschen zum ersten Mal seit Ende des Zweiten Weltkriegs das Gefühl gab: »Wir sind wieder wer!«
Oder, um das extremste Beispiel eines deutschen Wandels zu benennen: Zwischen 1933 und 1942 gehörten KZs, zwischen 1942 und 1945 KZs und Vernichtungslager zur deutschen Kultur. (Inwiefern der Begriff »Kultur« in diesem mörderischen Zusammenhang angemessen ist, darauf werde ich im nächsten Kapitel eingehen.) Seit dem Ende der Naziherrschaft sind Phänomene wie Wiedergutmachung, Vergangenheitsbewältigung, KZ-Gedenkstätten, das Holocaust-Mahnmal und die spezielle Verantwortung gegenüber dem Staat Israel wichtige Bestandteile deutscher Kultur. (Auch darauf werde ich im Kapitel über »Leitkultur« näher eingehen, dennoch sei bereits an dieser Stelle klipp und klar gesagt: Ich hielte es für ein Anzeichen neuerlich drohenden Unheils, sollte an diesen Bestandteilen der deutschen Kultur noch heftiger gerüttelt werden, als dies im antizionistisch-antisemitischen Milieu jeglicher Provenienz heute bereits der Fall ist.)
Selbstverständlich gibt es auch harmlosere Beispiele für kulturellen Wandel: Bis vor zwanzig Jahren durfte man nicht unbedingt erwarten, etwas Trinkbares ins Glas zu bekommen, wenn man eine Flasche deutschen Weins öffnete. Heute darf sich das Bier nicht mehr sicher sein, den Gipfel deutscher Vergärungskunst dazustellen.
Ich spüre meine Gegner ungeduldig werden. Was hat diese Art von kulturellem Wandel denn mit dem kulturellen Wandel zu tun, den wir meinen?, werden sie sagen, mit dem Wandel, der durch Migration beziehungsweise Einwanderung entsteht? Der Fußball kam ja nicht durch zugewanderte Engländer nach Deutschland, sondern wurde durch einen Ur-Braunschweiger importiert.
Richtig! Aber schon beim Wein ist die Lage komplizierter. Die Winzerkunst ist ganz gewiss nicht auf deutschem Mist gewachsen, sondern kam vor über zweitausend Jahren durch die Römer nach Germanien. Später waren es die Franzosen, die als führende Weinmacht der Welt – und nicht immer geliebte europäische Nachbarn – auch das deutsche Winzertum entscheidend beeinflussten. Der Wandel von Nazi-Barbarei zur Einsicht, dass Deutschland historische Schuld auf sich geladen hat, wäre ohne den Einfluss der Alliierten – allen voran der Amerikaner – in dieser Weise vermutlich nie geschehen.
Ich will auf Folgendes hinaus: In der Tat wäre es absurd zu verlangen oder lediglich zu behaupten, dass Kulturen ihren Wandel stets aus sich selbst heraus vollbringen müssten. Auch für Kulturen gilt: Inzest ist der sicherste Weg in die Degeneration. Befruchtung von außen muss sein. Aber sämtliche Wandlungen der deutschen Kultur, selbst diejenigen, die durch Fremdherrschaft (Römer) oder Besatzung (Franzosen, Amerikaner) bewirkt wurden, konnten sich nur vollziehen, weil sie in Deutschland irgendwann auf fruchtbaren Boden gefallen sind. Römische oder französische Viticulteurs hätten noch so Druck in der Kelter machen können, wenn die Deutschen nicht irgendwann Lust auf das neue Getränk bekommen und Lust daran gefunden hätten, es selbst herzustellen – und am Schluss vielleicht sogar die Lehrmeister in der Kunst zu übertrumpfen! –, dann hätte eine eigenständige deutsche Weinkultur niemals entstehen können. Selbst im Falle der »Reeducation«, die von vielen Deutschen nach 1945 zunächst als beleidigende Schmach empfunden wurde – und von heutigen Rechtsauslegern noch immer als solche empfunden wird –, gilt: Hätte die deutsche Gesellschaft in ihrer großen Mehrheit nicht irgendwann selbst eingesehen, dass sie sich tödlich verrannt hatte und sich deshalb ernstlich neu besinnen musste, hätte die Mehrheit der Deutschen keinen Gefallen an Jazz und Rock und Mickey Mouse gefunden, wären all die amerikanischen Umerziehungsversuche für die Katz gewesen. Oder hätten, schlimmer noch, dazu geführt, dass die Deutschen eines Tages versucht hätten, ihre Befreier in einem blutigen »Befreiungskrieg« abzuschütteln, anstatt sie ein halbes Jahrhundert später mit friedlichen Volksfesten – und zum Teil sogar mit Wehmut – zu verabschieden.
Deshalb muss ich nun aussprechen, was ich lieber nicht aussprechen würde, aber hilflose Beschönigungen haben wir in den letzten Jahren genug gehört, und sie haben nicht dazu beigetragen, die Stimmung in unserem Land freundlicher zu machen: Fünfzig bis sechzig Jahre, nachdem die ersten türkischen Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind, müssen wir nüchtern feststellen, dass die deutsche Kultur nahezu nichts von der Kultur in sich aufgenommen hat, die diese Gastarbeiter mitgebracht haben.
Es gibt Schriftsteller wie Emine Sevgi Özdamar oder Feridun Zaimoglu, die der deutschen Sprache ein aus dem Türkischen stammendes Wort wie »Mutterzunge« beschert oder gezeigt haben, dass von der »Kanaksprak« ein gar nicht so weiter Weg zur Luther’schen Wortwütigkeit führt. Es gibt Filmemacher und Regisseure wie Fatih Akin oder Züli Aladağ, die den leicht anämisch gewordenen deutschen Film durch den Mut zum Pathos, zum Drama, den sie mitbringen, aufregender machen. Es gibt mittlerweile an fast jeder Ecke zwischen Delmenhorst und Friedrichshafen Dönerimbisse, und in einer Stadt wie Berlin gibt es auch ein paar hervorragende türkische Restaurants. Aber sind die deutsche und die türkische Kultur jenseits der eher elitär bleibenden künstlerischen Verbindungen, die ich zuerst genannt habe, auch auf breiter kultureller Ebene Verbindungen eingegangen?
Sicher, uns verbindet die Liebe zum Fußball. Wenn ich türkischstämmige Freunde besuche, beschleicht mich der Verdacht, dass wir eine gewisse Faszination für Sauberkeit teilen. »Hüzün« und Weltschmerz verstehen sich an einem grauen Berliner Herbsttag ganz ausgezeichnet, besonders im Hamam. Falls wir deren jeweiligen Humor teilen, können wir über die Scherze von Comedians wie Kaya Yanar oder Bülent Ceylan gemeinsam lachen. Aber reicht dies, um stabile kulturelle (Ver-)Bindungen zu schaffen?
Die Frage ist viel zu heikel, als dass ich sie hier schon beantworten könnte, deshalb wird sie uns bis zum Ende des Buchs immer wieder begegnen, und ich habe die Hoffnung, später einen Vorschlag machen zu können, wie wir mit einer real existierenden »Multi-Kulti«-Situation produktiver umgehen könnten, als wir es derzeit tun. Aber jetzt schon will ich sagen, dass Sprachkosmetik ganz sicher kein Weg ist, die Distanzen zu überbrücken. Die gut gemeinten Aufforderungen, künftig einfach alles »deutsche Kultur« zu nennen, den Döner, das Minarett, die Hennanächte, heilen nichts, sondern sorgen eher dafür, dass sich die Wunde unter dem rhetorischen Make-up weiter entzünden wird. Ebenso wenig bringen Schuldzuweisungen. Sätze wie »die deutsche Kultur ist böse und borniert, weil sie nichts von der türkischen aufnehmen will« oder »die türkische Kultur ist einfach zu rückschrittlich, als dass sie mit der deutschen produktive Verbindungen eingehen könnte«, dienen einzig und allein der Frontverhärtung.
Dieses Reizthema hat mich in einen Nebengang geraten lassen, aber ich hatte ja gewarnt, dass wir uns in einem Irrgarten bewegen. Und der »Leitfaden« im Untertitel bedeutet lediglich, dass ich Ihnen verspreche, Sie hindurchzuführen, nicht dass dies auf dem einfachsten Weg geschehen wird. Versuchen wir also, an die Kreuzung zurückzufinden, an der wir abgezweigt sind.
Es ging um das Argument, eine »spezifisch deutsche Kultur« sei nicht zu bestimmen, weil es entweder nur regionale deutsche Kulturen gibt beziehungsweise die einzelnen kulturellen Erscheinungsformen des Deutschen so unterschiedlich sind, dass sich der Oberbegriff »deutsche Kultur« verbietet. Ich hoffe, mit Wittgenstein gezeigt zu haben, dass dieses Argument auf einem Missverständnis beruht. Und ich hoffe gezeigt zu haben, dass der Vorwurf, bei der Beschreibung der deutschen Kultur reproduziere man lediglich Klischees, nur dort berechtigt ist, wo tatsächlich verkürzt und pauschalisiert wird.
Wer bin ich?
Nun gibt es aber noch ein drittes Argument gegen die Rede von der »deutschen Kultur«, das in fast allen Diskussionen zu diesem Thema auftaucht und das erste Argument gewissermaßen auf den Kopf stellt: Lautete dieses, die deutsche Kultur sei in sich zu disparat, als dass man sie mit einem gemeinsamen Oberbegriff versehen dürfe, lautet jenes nun, die deutsche Kultur sei nicht spezifisch genug, als dass sie sich von anderen Kulturen abgrenzen ließe. Alles, was sich über die deutsche Kultur sagen ließe, ließe sich ebenso gut über viele andere Kulturen sagen. Die Liebe zum Fußball etwa sei doch auf der halben oder vielleicht sogar der ganzen Welt zu Hause. Ebenso gebe es zig andere Länder, in denen man gern Auto fährt und Bier trinkt. Oder in denen man keine Hemmungen habe, sich nackt an den Strand zu legen.
So weit kann ich dem nicht widersprechen. Aber ich möchte Sie zu einem kleinen Spiel einladen. Es ist eine Variante von »Wer bin ich?«, nur dass sich hinter dem »ich« hier eine Kultur verbirgt. Wir können es also: »Welche Kultur bin ich?« nennen. Der Einfachheit halber fangen wir mit der Frage nach dem Fußball an, und ich antworte: Ja, ich bin fußballverrückt. Wie gesagt, damit ist noch mindestens der halbe Globus im Spiel. Doch schon, wenn ich auf die Bierfrage antworte: O ja, Bier ist eines meiner Lieblingsgetränke! wird klar, dass ich vermutlich nicht die saudi-arabische oder die iranische Kultur bin. Bei der leidenschaftlich bejahten Frage nach der Freikörperkultur sind zahlreiche weitere Kulturen aus dem Rennen. (Hinter den knappen Bikinis, wie sie etwa zur brasilianischen Samba- und Strandkultur gehören, verbirgt sich ein völlig anderes Konzept »freier Körperlichkeit«.) Aber ich könnte zum Beispiel immer noch die norwegische Kultur sein. Oder die österreichische. Fragen wir deshalb nach etwas ganz anderem: Gibt es bei dir viele Opernhäuser? Abermals würde ich heftig mit dem Kopf nicken. Damit wäre Norwegen raus. Weil Sie mittlerweile einen konkreten Verdacht haben, fragen Sie nun: Geht man bei dir gern zum Heurigen? – und ich schüttle traurig den Kopf. Vielleicht rutscht mir noch ein leises »Aber es gibt bei mir ganz viele Weinfeste und Weinköniginnen« heraus.
Ich denke, wir können den Spaß an dieser Stelle beenden. Und wir hätten ihn noch viel rascher beenden können, wenn die Fragen gelautet hätten: Gibt es auf deinen Autobahnen kein generelles Tempolimit? Stehen bei dir die meisten Opernhäuser der Welt? Hast du einen Völkermord auf dem Gewissen, der dir tatsächlich auf dem Gewissen liegt? Ich vermute, nicht einmal der skeptischste Skeptiker in Sachen »deutsche Kultur« würde, nachdem ich alle drei Fragen bejaht hätte, behaupten, es könne ebenso gut von China die Rede sein. Oder von Österreich.
Nichts liegt mir ferner, als die unterschiedlichen Kulturen durch Mauern voneinander trennen zu wollen. Mir liegt nur daran zu zeigen, dass sie sich, obwohl wir sie nicht streng eingrenzen können, sinnvoll identifizieren lassen. Dass sie trotz ihrer Durchlässigkeit, trotz ihrer Plastizität nicht beliebig sind. Deshalb zum Schluss noch einmal Wittgenstein, der in seinen Philosophischen Untersuchungen auf die Frage, ob ein »Begriff mit verschwommenen Rändern« überhaupt »Begriff« genannt werden darf, mit folgenden Gegenfragen antwortet: »Ist eine unscharfe Photographie überhaupt ein Bild eines Menschen? Ja, kann man ein unscharfes Bild immer mit Vorteil durch ein scharfes ersetzen? Ist das unscharfe nicht oft gerade das, was wir brauchen?«
Kapitel 2 Leitkultur – kann es sie überhaupt geben?
Im ersten Kapitel habe ich gezeigt, dass es gute Gründe gibt, von einer »spezifisch deutschen Kultur« zu sprechen. Wir haben aber auch gesehen, dass die trennenden Kräfte, die von Kulturen ausgehen, mindestens so groß sind wie die verbindenden. Gleicht vor diesem Hintergrund nicht jede Forderung nach einer »deutschen Leitkultur« dem Versuch, Feuer mit Benzin zu löschen? Würde die Ausrufung einer »deutschen Leitkultur« diejenigen, die der deutschen Kultur eher fremd gegenüberstehen, obwohl sie in Deutschland leben, nicht noch weiter von denjenigen entfernen, die sich in der deutschen Kultur ganz selbstverständlich zu Hause fühlen? Anders gefragt: Folgt aus dem Umstand, dass es eine deutsche Kultur gibt, zwangsläufig, dass man diese zur Leitkultur erheben sollte?
Die zentrale Crux der Leitkulturdebatte liegt darin, dass keiner genau weiß, was er mit dem Wort »Kultur« eigentlich meint. Und zwar geht es mir hier nicht wieder um die vermeintliche Unklarheit, was eine spezifisch deutsche Kultur sein soll. Sondern es geht um die Unklarheit, die der Begriff »Kultur« selbst in sich trägt.
Auch ich habe ihn bislang unkritisch benutzt, das heißt, ich habe ihn in dem Sinne verwendet, für den der britische Literaturtheoretiker Terry Eagleton den präzisierenden Begriff »Kultur-als-Lebensweise« vorschlägt. Dieser Kulturbegriff ist ebenso umfassend wie unordentlich. Er umfasst Kunstwerke wie Freizeitbeschäftigungen, Ikonen des Geistes wie solche des Alltags, wohlbegründete Prinzipien wie bloße Schrullen, religiöse Gedankengebäude wie volkstümliches Brauchtum, kurz: Das Hehrste geht Hand in Hand mit dem Profansten. Hier trifft der Spitzenriesling auf die Currywurst, Helene Fischer auf die Matthäus-Passion, Faust II auf Fack ju Göhte 3, der Ebbelwei-Bembel auf August Bebel; die Lutherbibel kann ohne Weiteres im Strandkorb liegen, Immanuel Kant sich auf dem Oktoberfest betrinken, die Autobahn mitten durch den Teutoburger Wald führen und der Bildungsbürger vor Schadenfreude wiehern. Für dieses Verständnis von Kultur gilt, was Johann Gottfried Herder vor über zweihundert Jahren von der Nation gesagt hat: Sie ist ein »Sammelplatz von Torheiten und Fehlern so wie von Vortrefflichkeiten und Tugenden«. Oder, schöner noch: Sie ist »ein großer, ungejäteter Garte[n] voll Kraut und Unkraut«.
Im ersten Kapitel habe ich dafür plädiert, Kultur in diesem weiten, unordentlichen Sinn zu verstehen, denn nur so ergibt sich ein reicher Kulturbegriff, nur so kann Kultur Geist und Herz und alle Sinne erfassen – nur so kann Kultur Heimat sein. Aber, wie schon Herder feststellte: Diese Art von Kultur ist nicht vor »Torheiten und Fehlern« gefeit. Und auch nicht vor Bestialität und Massenmord, wie man mit Blick auf die deutsche Kultur zu Zeiten des Nationalsozialismus ergänzen muss. Verstanden als der »große, ungejätete Garten voll Kraut und Unkraut«, kann man also durchaus davon sprechen, dass Judenverfolgung und -vernichtung einmal zur deutschen Kultur gehört haben. Oder dass Zwangsverheiratungen und »Ehrenmorde« immer noch zu fast allen Kulturen gehören, die vom Islam geprägt sind.
Selbst wenn wir die verbrecherischen Exzesse von Kulturen ausklammern, zeigt sich das erste Dilemma der Leitkulturdebatte: Gerade die Auffassung von Kultur, die nötig ist, um zu einem reichen, vielfältigen Verständnis von »Kultur« zu kommen, taugt in keiner Weise, um daraus einen sinnvollen Begriff von »Leitkultur« zu gewinnen. Niemand kann ernsthaft behaupten, dass die Vorliebe für Currywurst oder der Hang zum Nacktbaden Teil einer deutschen Leitkultur werden sollten.
Hier müsste also ein rabiater Gärtner her, der sich anmaßt, das »Kraut« treffsicher vom »Unkraut« zu unterscheiden und Letzteres konsequent zu jäten. Aber ich zucke bereits zusammen, während ich dies schreibe. Denn haben wir in Deutschland nicht die allerschlimmsten Erfahrungen mit dieser Art von paranoidem Gärtnertum gemacht? Es kann nur Bocksbeiniges dabei herauskommen, wenn Politiker sich zum Kulturgärtner machen wollen. Einen »Zwingherrn zur Deutschheit« – um die drastisch-plastische Formulierung des Philosophen Johann Gottlieb Fichte zu zitieren – ist das Letzte, was wir brauchen.
Genauso wenig können wir es allerdings brauchen, wenn uns Politiker kulturrelativistischer Provenienz die gesamten ungejäteten Gärten voll Kraut und Unkraut, die auch die nicht-deutschen Kulturen darstellen – Stichwort: archaischer Ehrbegriff, mangelnde Säkularisierung –, undifferenziert als »Bereicherung« anpreisen. Wer verhindern will, dass von »Leitkultur« in misslich-undifferenzierter Weise geredet wird, muss aufhören, in derselben misslich-undifferenzierten Weise von »kultureller Bereicherung« zu sprechen.
Ich verstehe die regelmäßig wiederkehrenden, unergiebigen Leitkulturdebatten der letzten knapp zwanzig Jahre so: Sie sind Beschwichtigungsversuche in Richtung der deutschen Mehrheitsgesellschaft, die den Eindruck hat, dass ihre Kultur durch Globalisierung, vor allem aber durch Einwanderung, einem allzu raschen, allzu forcierten Wandel unterworfen werde. Die Alteingesessenen brummen – über sämtliche Dialektgrenzen hinweg –, »mia san mia«, und der konservative Politiker ruft bestätigend zurück: Und das ist auch gut so!
Der Bereicherungsdiskurs wiederum ist ein Beschwichtigungsversuch in Richtung der deutschen Minderheiten, die seit einer bis drei Generationen in diesem Land leben und den Eindruck haben, immer noch nicht als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft akzeptiert zu sein. Sie beklagen sich: Die Deutsch-Deutschen mögen uns nicht!, und die progressive Politikerin ruft in ihre Richtung zurück: Fürchtet euch nicht! Für mich seid ihr, so wie ihr seid, ein Geschenk!
Gegen Beschwichtigungsversuche ist an und für sich nichts einzuwenden. Das Problem ist bloß, dass das, was die Ängste des einen beschwichtigen soll, die Ängste des anderen umso heftiger entfacht. Sprich: Wer sich danach sehnt, dass die Dominanz der deutschen Kultur klar anerkannt wird, kriegt Zustände, wenn ihm ständig etwas von »Bereicherung« durch andere Kulturen erzählt wird. Umgekehrt schrillen bei dem, der sich in Deutschland ohnehin nicht wirklich beheimatet fühlt, sämtliche Alarmglocken, wenn ihm nun auch noch eine deutsche Leitkultur aufgedrückt werden soll.
Wieder einmal sind wir in einer Sackgasse gelandet. Natürlich könnte man einfach sagen: Lasst uns einen Waffenstillstand vereinbaren, indem wir ab sofort sowohl den Begriff »Leitkultur« als auch den der »kulturellen Bereicherung« ruhen lassen. Aber ich fürchte, dies würde zu keinem wirklichen Frieden führen, sondern diente lediglich der Konfliktvertuschung.
Das kulturelle Klima
Gehen wir das Problem unter einer anderen Perspektive an. Wenn ein Mensch in ein ihm ungewohntes Klima kommt, spricht man davon, dass er sich akklimatisieren muss. Darf man analog davon reden, dass ein Mensch, der in eine ihm ungewohnte Kultur kommt, sich akkulturieren muss? Selbstverständlich ist es heikel, die Kategorien »Klima« und »Kultur« identisch zu behandeln. Dem Klima ist es egal, ob ein Mensch sich an es gewöhnen kann oder dauerhaft unter ihm leidet. Einer Kultur sollte es nicht egal sein, wenn Menschen sich nicht an sie gewöhnen können und dauerhaft unter ihr leiden. Dennoch halte ich es für keine fahrlässige Naturalisierung, vom »kulturellen Klima« eines Landes zu sprechen. Wenn dies aber zulässig ist, ist es dann nicht ebenfalls zulässig, eine Art kultureller Klimakatastrophe für möglich zu halten, wenn diesem Klima zu viele Einflüsse auf einmal zugemutet werden, die es aus seinem ohnehin fragilen Gleichgewicht bringen? Wenn eine Kultur gleichzeitig und innerhalb kurzer Zeit all dies auffangen soll: ein sich rapide wandelndes Verständnis von Geschlechterrollen und sozialen Hierarchien; einen technologischen Fortschritt, der mittlerweile so rasant ist, dass man ihn wohl richtiger als »technologische Hatz« bezeichnen sollte; die Auswirkungen der sich vollendenden Globalisierung und Digitalisierung an allen Fronten von den Finanzmärkten über die Arbeitsmärkte bis hin zu den reißend angeschwollenen Nachrichtenströmen; verstärkte Migrationsbewegungen; und in unserem speziellen deutschen Falle noch hinzukommend: die tatsächliche Überwindung einer vierzig Jahre währenden staatlichen Teilung? (Auf Letzteres werde ich noch näher eingehen, es scheint mir ein Aspekt zu sein, der in den gegenwärtigen Deutschlanddiskussionen notorisch unterschätzt wird.)
Ist es also statthaft, die vielen, die laut oder leise flehen: Um Himmels willen, halt! Das geht mir alles zu schnell! Weiß denn keiner mehr, wo die Bremse ist?, mit einem achselzuckenden: Gewöhn dich dran, so ist sie halt, die neue Zeit!, abzufertigen? Oder süffisanter noch zu sagen: Liebe Deutsche, wer ein generelles Tempolimit auf Autobahnen für Freiheitsberaubung hält, sollte doch sofort Verständnis dafür haben, dass sich auch der kulturelle Wandel das Rasen nicht verbieten lassen will.
Wie im ersten Kapitel betont: Kulturen müssen sich wandeln, um vital zu bleiben, Kulturwandel ist also das Gegenteil einer Kulturkatastrophe. Allerdings bin ich überzeugt, dass dies lediglich für Formen des Wandels gilt, die von denjenigen, die ihn mitvollziehen müssen und überdies realen oder »gefühlten« wirtschaftlichen Nachteilen ausgesetzt sind, noch als irgendwie organisch empfunden werden. Der als forciert empfundene Wandel hingegen wird in den Köpfen und Herzen derjenigen, die sich überrollt und überfordert fühlen, sehr wohl Katastrophenalarm auslösen.
Das Wahrnehmungsgenie Johann Wolfgang von Goethe spürte bereits vor knapp zweihundert Jahren, dass ein Zeitalter teuflischer Geschwindigkeiten heraufzog, und prägte dafür den nicht minder genialen Begriff des »Veloziferischen«.
Soll all dies heißen, dass ich nun plötzlich und klammheimlich doch einen Ritter und Retter der deutschen Leitkultur heraufbeschwören will? Einen, der so wie weiland Luther keine Skrupel kannte, den Kampf zu führen »wider das Papsttum zu Rom, vom Teufel gestiftet«, heute keine Skrupel kennt, den Kampf zu führen wider die Geschwindigkeitsteufel der Gegenwart, gestiftet von Emanzipation, Technologisierung, Digitalisierung, Globalisierung und Migration?
Gemach! Gemach!, rufe ich mich selbst zur Ordnung und packe die Teufelsrhetorik sogleich wieder ins Tintenfass. Denn so kraftvoll verlockend sie ist – sie birgt Unheil. Wer glaubt, gegen »Teufel« zu kämpfen, lässt in der Tat alle Skrupel fahren. Er ist nicht länger bereit, den Zweifel für seinen wertvollsten Verbündeten zu halten, sondern denunziert ihn als Laschheit und Schwäche. Er ist, ehe er dreimal »Weiche, Satan!« rufen kann, selbst jener »Teufelslist« erlegen, die – frei nach Thomas Mann – schon einmal dafür gesorgt hat, dass das Beste der deutschen Kultur in ihr Bösestes umschlug.
Helles Deutschland, dunkles Deutschland
Wie kein anderer deutscher Intellektueller hat Thomas Mann mit der Frage gerungen, ob es möglich sei, das zu sein, was ich in meiner Vorbemerkung behauptet habe: zugleich deutsch und zivilisiert. Deshalb wird Mann in diesem Buch immer wieder eine wichtige Rolle spielen, ja, er scheint mir der vorzüglichste Spiritus Rector zu sein, auf den wir uns berufen können, wenn wir das Deutsche begreifen und für den künftigen Gebrauch retten wollen.
Im Mai 1945 hielt der von den Nazis ins Exil getriebene Schriftsteller, der mittlerweile die amerikanische Staatsbürgerschaft hatte, in der Washingtoner Library of Congress einen berühmt gewordenen Vortrag. Darin versuchte er, sich, den Deutschen und seinem amerikanischen Publikum zu erklären, wie es zu der deutschen Barbarei hatte kommen können. Eine der zentralen Passagen lautet: »Es [gibt] nicht zwei Deutschland […], ein böses und ein gutes, sondern nur eines, dem sein Bestes durch Teufelslist zum Bösen ausschlug. Das böse Deutschland, das ist das fehlgegangene gute, das gute im Unglück, in Schuld und Untergang. Darum ist es für einen deutsch geborenen Geist auch so unmöglich, das böse, schuldbeladene Deutschland ganz zu verleugnen und zu erklären: ›Ich bin das gute, das edle, das gerechte Deutschland im weißen Kleid, das böse überlasse ich euch zur Ausrottung‹. Nichts von dem, was ich […] über Deutschland zu sagen oder flüchtig anzudeuten versuchte, kam aus fremdem, kühlem, unbeteiligtem Wissen; ich habe es auch in mir, ich habe alles am eigenen Leibe erfahren.«
Obwohl ich Thomas Manns Rede über Deutschland und die Deutschen oft gelesen und speziell diese Sätze mehrfach zitiert habe, ergreifen sie mich immer noch. Weil sie so klug sind. So schonungslos. So verzweifelt und dennoch so unweinerlich. Weil sie mir die einzige Form deutscher Selbstkritik zu sein scheinen, die uns die Tür in eine bessere Zukunft des Deutschen aufstößt.
Denn steht Thomas Mann nicht mit seinem gesamten Leben, Denken und Schreiben dafür ein, dass es einen Weg gibt vom Deutschen, der nichts von »Zivilisation« wissen will, ja: diese rundheraus als das Gegenteil »deutscher Kultur« verachtet, zum Deutschen, der ein leidenschaftlicher Verfechter eben dieser früher verachteten »Zivilisation« wird? Anders gesagt: Ist Thomas Mann nicht der leibhaftige Beweis dafür, dass es möglich ist, zivilisiert zu werden und trotzdem deutsch zu bleiben? Doch – nun kommt das Entscheidende – eben nicht, indem man sich hinstellt und verkündet: »Ich bin das gute, das edle, das gerechte Deutschland im weißen Kleid, das böse überlasse ich euch zur Ausrottung.« Eben nicht, indem man sich auf die Brust klopft und sagt: Ich helles Deutschland – du Dunkeldeutschland!
Auch ich empfinde ein ebenso jähes wie tiefes Entsetzen, wenn ich Bilder von deutschen Horden sehe, die sich vor Flüchtlingsunterkünften zusammenrotten; wenn ich in den »Wir-sind-das-Volk«-Sprechchören, die »Pegida« & Co. anstimmen, die niederschmetternd engherzig gewordene Reprise der ostdeutschen Befreiungssprechchöre von 1989 höre. In diesem Sinne kann ich nachempfinden, wieso sich unser damaliger Bundespräsident Joachim Gauck im August 2015 beim Besuch einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Wilmersdorf gedrängt fühlte zu sagen: »Es gibt ein helles Deutschland, das sich leuchtend darstellt gegenüber dem Dunkeldeutschland.« Dennoch, bei allem Respekt: Dieser Satz war nicht klug.
Abgesehen davon, dass er ein Schmähwort aus den 1990er-Jahren reproduziert, das damals von manchem Westdeutschen zur Bezeichnung der »Neuen Bundesländer« benutzt wurde – wenn man ernsthaft darüber nachdenken will, wie der Begriff des »Deutschen« im 21. Jahrhundert nach dem mörderischen Missbrauch, der mit ihm im 20. Jahrhundert getrieben wurde, neu belebt werden könnte, darf man die Komplexität nicht unterbieten, die Thomas Mann mit seiner Diagnose von 1945 vorgegeben hat, zumal nicht als ein oberster Repräsentant unseres Landes.
Abermals muss ich mich selbst unterbrechen. Denn lässt sich nicht sofort einwenden: Und was machen denn, bitte schön, Sie, wenn Sie auf einen Buchumschlag setzen lassen: »Deutsch, nicht dumpf«?
Die Frage hat mich, als ich über den richtigen Titel für diesen Leitfaden nachgedacht habe, bis zuletzt beschäftigt. Um welche Bestimmung des Deutschen es mir geht, ist mir durch ein Bild klar geworden, das Heribert Prantl, Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung und Leiter des Meinungsressorts, im Zusammenhang mit Deutschland immer wieder und zuletzt nach der Bundestagswahl im September 2017 verwendet hat. In seinem Kommentar zum Einzug der AfD in den deutschen Bundestag beschreibt er, warum ihm dieser bedrohlicher erscheint als der Rechtsradikalismus/-extremismus, mit dem sich derzeit fast alle Länder Europas und die USA herumzuschlagen haben. Seine Erklärung: »Deutschland ist in der Situation des Alkoholikers. Wenn der wieder trinkt, wird es gefährlich.«
Beim ersten Lesen dachte ich: Welch treffliches Bild! Doch je länger ich darüber nachdachte, desto unklarer wurde mir, was mir der Autor damit sagen will. Wofür soll die Metapher »Alkohol« nun wirklich stehen? Für Rechtsextremismus? Aber ist es denn tatsächlich weniger bedrohlich, wenn ein Geert Wilders in niederländischen Wahlkämpfen die Stimmung aufheizt, indem er – vor jubelnden Anhängern – vom »marokkanischen Abschaum in Holland« spricht? Wenn eine Marine Le Pen in Frankreich den »nationalen Aufstand« heraufbeschwören will? Wenn sich in Rom auf der Piazza del Popolo Tausende Aktivisten der Lega (Nord) versammeln und keiner der Demonstranten daran Anstoß nimmt, dass sich auch italienische Neofaschisten ins fahnenschwingende Treiben mischen?
Oder sollen mit »Alkohol« jegliche patriotischen Gefühle gemeint sein? Dann würde die Warnung lauten: Deutsche, lasst ihr die Finger vom Patriotismus! Ihr seid trockengelegte Nationalisten und Völkermörder, und deshalb werdet ihr, sobald ihr wieder anfangt, Fahnen zu schwenken, auch wieder anfangen: »Deutschland, Deutschland über alles!« zu brüllen.
Ich vermute, dies ist es, was Prantl sagen will. Und eine Entgleisung wie die Gauland’sche, die ich im ersten Kapitel zitiert habe, scheint dieser Befürchtung nur allzu recht zu geben. Trotzdem: Liegt der Metapher vom »Alkoholiker Deutschland« nicht die problematische Auffassung zugrunde, dass es so etwas wie ein »deutsches Wesen«, eine unveränderbare »Essenz« des Deutschen gibt? Neudeutsch ausgedrückt: dass es zur »DNA« des Deutschen gehört, sich nicht mäßigen zu können? Müsste das richtige Bild nicht lauten: Wir heutigen Deutschen wissen, dass das Deutschland unserer Väter und Mütter beziehungsweise unserer Großväter und Großmütter oder für viele mittlerweile: unserer Urgroßväter und Urgroßmütter einem mörderischen Nationalismus verfallen war. Weil wir um diese erbliche Belastung wissen, ist es an uns, besonders achtsam zu sein, wenn wir die Flasche mit der Aufschrift »Patriotismus« öffnen. Aus diesem Wissen folgt aber nicht, dass wir die Hände von jeglichem Patriotismus lassen sollten.
In diesem Sinne will ich dazu auffordern, »deutsch, nicht dumpf« zu sein! Ich begreife das Deutsche nicht als schlichten Gegensatz zum Dumpfen, so wie es geschieht, wenn das »helle Deutschland« gegen »Dunkeldeutschland« in Stellung gebracht wird. Vielmehr will ich das Deutsche inständig ermahnen, nicht ins Dumpfe umzuschlagen, ebenweil ich ein Bewusstsein davon habe, dass es stets gefährdet ist; weil ich davor warnen will, sich auf der sicheren Seite zu wähnen; weil ich weiß, dass jeder, der trinkt, zum Alkoholiker werden kann – zumal, wenn unter seinen jüngeren Vorfahren krasse Alkoholiker gewesen sind; weil ich trotz allem überzeugt bin, dass daraus nicht folgt, in der zweiten, dritten, vierten Generation als Abstinenzler leben zu müssen; weil ich daran glaube, dass es erwachsenen, mündigen Menschen erlaubt sein muss und möglich ist, mit Genuss und Augenmaß zu trinken.
Damit will ich Patriotismus nicht zu einem berauschenden Genussmittel erklären, das wir uns gönnen, um am Feierabend zu entspannen. Im letzten Kapitel werde ich zu zeigen versuchen, dass im Gegenteil eine Gesellschaft ohne Patriotismus auf wackligen Beinen steht. Einstweilen möchte ich nur die Ermunterung anführen, die Thomas Manns Antipode Bertolt Brecht uns Deutschen mit seiner Kinderhymne – die natürlich alles andere als eine »Kinder