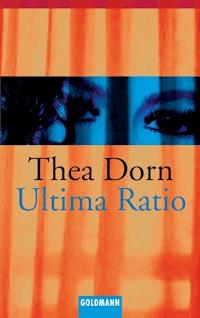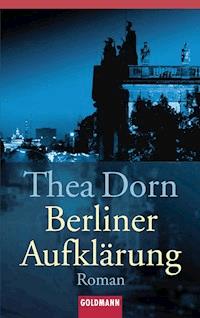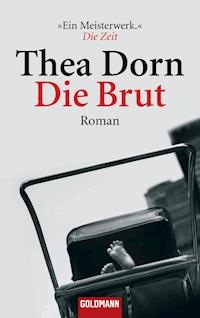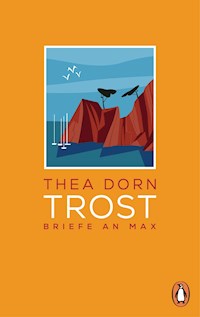
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Buch der Stunde für alle Untröstlichen
»Wie geht es Dir?« Als Johanna von Max, ihrem alten philosophischen Lehrer, eine Postkarte mit dieser scheinbar harmlosen Frage erhält, bricht es aus ihr hervor: die Trauer über den Tod ihrer Mutter, die Wut, dass man ihr im Krankenhaus verwehrt hat, die Sterbende zu begleiten. Provoziert durch weitere Postkarten, beginnt Johanna, sich den Dämonen hinter ihrer Verzweiflung zu stellen.
In einem einzigartigen Postkarten-Briefroman erzählt die Literatin und Philosophin Thea Dorn von den vielleicht größten Themen, die der gottferne, von seinen technologischen Möglichkeiten berauschte Mensch verdrängt: von der Auseinandersetzung mit der Endlichkeit, von der Suche nach Trost in trostlosen Zeiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 135
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2021 Penguin Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenGrafik, Satz und Umschlaggestaltung: Oliver Schmitt, Mainz
Umschlagabbildung: Gary Godel
ISBN 978-3-641-27987-5V002
www.penguin-verlag.de
Für J.
7. Mai
verzeih, dass ich so lange nichts von mir habe hören lassen. Aber ich weiß ja, was Du von wütenden, verzweifelten Menschen hältst. Nur ist es leider so, dass ich seit Wochen nicht anders kann, als zu wüten und zu verzweifeln. Deshalb habe ich Dir lieber gar nicht geschrieben. Doch jetzt, da Deine Postkarte angekommen ist, wirst Du mich und meine Gefühle wohl ertragen müssen.
Meine Mutter ist tot. Gestorben, weil sie sich in ihrem verdammten Leichtsinn für unsterblich hielt. Gestorben, weil blinde Politiker nicht sehen wollten, welche Gefahr auf uns zukommt. Gestorben, weil Wissenschaftler fröhlich verkündet haben, mit ein bisschen Händewaschen und In-die-Armbeuge-Niesen sei dieses Virus schon auszutricksen. Gestorben, weil unsere Krankenhäuser von einer Seuche heillos überfordert sind.
Ich gestehe: Als die ersten Meldungen hereinkamen, dass in China wieder einmal irgendeine Vogel-Viecher-Grippe ausgebrochen ist, und auch bei uns in der Redaktion die Panikgänse losschrien, gehörte ich zu denjenigen, die dachten: Ach ja, lass sie schreien. Die nächste Sau, die sie durchs Dorf jagen können. Selbst als es in Italien losging, dachte ich noch: Ist diesmal halt eine besonders prächtige apokalyptische Sau, die lässt sich eben auch ein bisschen länger jagen.
Herrgott, Max! Ich glaube, ich bin zum ersten Mal so weit, dass ich begreife, warum Du meinen gesamten Berufsstand verachtest, warum Du beschlossen hast, Dich vollständig zu entnetzen. Zwar halte ich Deine selbst gewählte Inseleinsamkeit noch immer für einen elitären Witz – apropos: Was soll diese Karte? Falls das Deine Art ist, mir zu verstehen zu geben, dass Du durchaus mitbekommst, was auf der Welt passiert, und dass Du Dir Sorgen machst, ist es eine ziemlich absonderliche Art. Aber egal. Zum ersten Mal beginne ich zu begreifen, warum Du der Welt Lebewohl gesagt hast.
Seit Jahren schreien wir »Feuer!«, obwohl Mutter Natur oder wer auch immer bloß ein bisschen gezündelt hat. Über diesem Daueralarm haben wir völlig vergessen, dass es wirklich einmal brennen kann. Unsere famosen Entscheidungsträger stehen da wie eine Truppe Feuerwehrdarsteller, die plötzlich merkt, dass sie keinerlei Ahnung hat, wie man einen echten Brand löscht. Und während sich bei den Feuerwehrdarstellern langsam Panik breitmacht, sitzen wir noch immer vor den Bildschirmen und schauen halb gebannt, halb gelangweilt den Katastrophen-Clips zu, ohne zu begreifen, dass wir selbst es sind, denen wir zuschauen. (Welche Dinosaurierart war es, die interessiert verfolgt hat, wie sich eine andere Dinosaurierart in ein Bein weit unten verbeißt – bis irgendwann in ihrem Hirn die Nachricht angekommen ist, dass es ihr eigenes Bein ist, das da gerade gefressen wird?)
Ich will mich nicht weniger gefahrenblind, nicht weniger abgestumpft machen, als wir alle es sind: Trotzdem habe ich irgendwann – nein, nicht irgendwann, sondern relativ bald begriffen: Diesmal ist es ernst. Diese Toten, die sich in Norditalien in den Krankenhauskellern stapeln, die sind kein Sensationsgesums. Die gibt es wirklich. Die stapeln sich sonst dort nicht. Es wird gefährlich. Auch für uns.
Aber meine Mutter, meine brillante, dauerumtriebige, vierundachtzigjährige, bescheuerte Mir-kann-keiner-was-anhaben-Mutter – sie musste stur nach Italien fahren, obwohl sich dieses Land bereits mit einem Bein im Ausnahmezustand befand. Obwohl es bereits Reisewarnungen gab.
Aufgekratzt wie ein Backfisch bei seiner ersten Italienreise rief sie mich an: Stell dir vor, Liebes, wo ich gerade war! In den Uffizien! So leer ist es dort seit Urzeiten nicht mehr gewesen! Ich ganz allein mit meinem »Bacchus«! Die neuen Caravaggio-Säle sind überhaupt ein Traum! Komm her, das musst du dir anschauen! Und das kleine Restaurant, in dem wir deinen vierzigsten Geburtstag gefeiert haben, erinnerst du dich noch? Wo der Fisch göttlich, aber die Kellner solche Schnösel gewesen sind? Die haben sich dermaßen gefreut, dass überhaupt ein Gast vorbeikommt, sagenhaft! Am Schluss haben wir eine ganze Flasche Grappa zusammen leer gemacht! Komm, setz dich in den Flieger, ich zahl dir die Reise!
Selbstverständlich bin ich nicht nach Florenz geflogen. Ich hätte es auch gar nicht mehr gekonnt. Ein paar Tage später wurde in ganz Europa der Flugverkehr eingestellt. Wurden die Grenzen dichtgemacht. Die Museen geschlossen. Die Theater. Die Kinos. Nur meine Mutter musste weiter durch Italien tingeln. Irgendeinen alten Schauspielfreund besuchen, den sie seit Ewigkeiten unter Vertrag hat. Jeden Tag habe ich ihr gesagt, dass sie schleunigst nach Hause kommen soll, aber sie hat nur gelacht: Liebes, es ist nicht die Pest. Die schlimmste Seuche unserer Tage ist die Angst.
Erst als der Freund sie mehr oder weniger hinausgeworfen hat, hat sie sich ins Auto gesetzt und ist heimgefahren. Beleidigt.
Ich weiß nicht, wann sie gemerkt hat, dass sie sich das verdammte Virus eingefangen hat. Ich vermute, sie muss die ersten Symptome schon auf der Rückfahrt gespürt haben. Aber sie hat ja immer gehustet. COPD. Chronic Obstructive Pulmonary Disease oder »COPD Blue«, wie meine Mutter zu sagen pflegte. (Du brauchst den Witz nicht zu verstehen, ist eine Anspielung auf eine amerikanische Polizeiserie aus den Neunzigern.) Liebes, hat sie immer gesagt, lass mir mein COPD Blue in Ruhe! Was dem Rumvögler sein Tripper, ist der Kettenraucherin ihr COPD Blue. Von Krankheiten, die man sich so mühsam erarbeitet hat, trennt man sich erst in der Urne.
Ein Wunder, dass die Österreicher sie überhaupt noch haben durchfahren lassen. Als ich sie abends angerufen habe, hat sie zwar nicht schlimmer gehustet als sonst, sie war auch nicht kurzatmiger, aber ich habe gemerkt, dass sie sich sehr anstrengen musste, ihr übliches Kraftselbst herauszukehren. Witze über die österreichischen Beamten zu machen, die sich schlimmer als die DDR-Grenzer an der Transitstrecke benommen hätten. Selbst die Pinkelpause wollten sie mir verbieten, Liebes, stell dir das vor!
Warum habe ich nicht erkannt, dass sie da schon krank war? Welcher Krieg in ihrem Körper begonnen hatte? Warum habe ich mir nicht in derselben Nacht noch einen Mietwagen genommen und bin nach München gefahren? Warum wollte ich partout glauben, es wäre nur die lange Reise, die sie so müde klingen ließ? Und warum war sie in den nächsten Tagen zu stolz, mir zu sagen, dass es ihr immer schlechter ging?
Als sie ins Krankenhaus eingeliefert wurde, war es schon zu spät. Ihr Assistent hat mich sofort angerufen, ich bin in den nächsten Zug gestiegen, aber die Strecke von Berlin nach München bleibt auch im schnellsten ICE die Strecke von Berlin nach München. Als ich endlich im Krankenhaus ankam – – –
Bislang ist es mir gelungen, mich zusammenzureißen, die tapfere Tochter zu geben, die mit allen Geisteswassern gewaschene Schülerin, die bei Dir nicht nur das Denken, sondern fürs Leben gelernt hat. Aber ich kann nicht mehr. Was im Krankenhaus passiert ist, ist so schlimm, dass ich nur noch schreien kann.
SIEHABENMICHNICHTZUIHRGELASSEN!!!!
Den Sicherheitsdienst haben sie gerufen, als ich versucht habe, trotzdem in das Gebäude reinzukommen. Irgendwo da drinnen hing meine Mutter an irgendwelchen beschissenen Maschinen, war am Ersticken, Verrecken, und sie haben mich nicht zu ihr gelassen!!!! Infektionsrisiko!!! Das Infektionsrisiko sei zu hoch – – –
***
Lieber Max, so, jetzt geht’s wieder. Ich bin zum Schlachtensee geradelt und hineingesprungen, obwohl es eigentlich viel zu kalt dafür ist. Das hat ein bisschen geholfen. Eigentlich halte ich es überhaupt nur in der Natur aus. Am erträglichsten ist es im Wald. Wenn der Wind durch Äste und Blätter geht. Wobei: In den ersten Wochen hat mich jeder grüne Trieb, jedes Blatt, das sich entrollen will, vor Schmerz und Zorn heulen lassen. Kein Mensch sollte im Frühling sterben dürfen.
Aber ich will versuchen, Dir zu berichten, was geschehen ist. Wenn mir das gelingt, gelingt es mir vielleicht auch, nicht wahnsinnig zu werden. (Die Bruchstücke, die ich vorhin in die Tasten gehauen habe, lasse ich einfach so stehen. Nimm sie, wenn Du willst, zum Anlass für einen Deiner berüchtigten, mitleidig-verächtlichen Blicke, nimm sie, wenn Du willst, als Hinweis darauf, wie es mir in Wahrheit geht.)
Nachdem sie mich in München aus dem Krankenhaus geworfen hatten, habe ich sofort den Anwalt angerufen, der sowohl die Agentur als auch meine Mutter bei ihren privaten Rechtsstreitigkeiten vertreten hat. (Muss ich erwähnen, dass der Mann an meiner Mutter blendend verdient hat?) Das feige Frettchen erklärte, es könne mich leider nicht persönlich treffen, es habe eine »Hypertonie«, und man höre ja so viel darüber, dass dieses Virus nicht nur die Lunge, sondern womöglich auch das Herz angreife. Aber es wolle versuchen, einen Eilantrag gegen das Besuchsverbot einzureichen.
Wenn ich an jenem Tag eine Waffe gehabt hätte, ich hätte sie benutzt. Und wenn ich ehrlich bin: Ich wünschte, ich hätte an jenem Tag eine Waffe gehabt. Wie barbarisch darf ein Staat werden, der sich so viel darauf zugutehält, ein Rechtsstaat zu sein? Einer Tochter verbieten, bei ihrer sterbenden Mutter zu sein? Einen Menschen zum einsamen Tod in einem Maschinensaal verdammen? In den USA haben sogar Todessträflinge einen Anspruch darauf, dass Angehörige dabei sein dürfen, wenn der Staat ihnen das Gift in die Vene haut. Aber hier? Jetzt, bei uns? Die grassierende Staatsräson ist um kein Haar weniger brutal als die von König Kreon, der Antigone verbieten will, ihren toten Bruder zu bestatten. Nur dass unser Staatsfeind Nr. 1 ein Virus ist.
Wochenlang sind unsere Verantwortlichen blind für die Gefahr gewesen. Jetzt sind sie blind vor Rettungseifer. Wie eine Horde durchgegangener Sanitätsnashörner überbieten sie sich im Menschenlebenrettenwollen – und merken nicht, dass sie dabei die Menschlichkeit tottrampeln.
KEINSTAATDIESERWELTHATDASRECHT, EINENMENSCHENZUMEINSAMENTODZUVERDAMMEN!!!
KEINMENSCHENLEBENRETTENWOLLENRECHTFERTIGTES, EINERTOCHTERZUVERBIETEN, BEIIHRERSTERBENDENMUTTERZUSEIN!!!
Ich muss nicht heulen. Es ist das erste Mal, dass ich nicht heulen muss, wenn ich davon berichte, was geschehen ist. Deine Missbilligung ist mir egal. Es tut gut, wenn mein Zorn so glühend wird, dass jede Träne an ihm verdampft.
Der Anwaltsfeigling hat natürlich nichts erreicht. Eilantrag abgelehnt. Er wollte es mir als großen Sieg verkaufen, dass ich meine Mutter wenigstens noch als Leiche sehen dürfe. Aber ich wollte meine Mutter nicht als Leiche sehen. Nicht in diesem Krankenhaus, nicht in dieser verzweifelten Gralsburg der Lebensrettung, die in Wahrheit keine wundertätigen Ritter birgt, sondern panische Stümper, die einem zuerst den Eintritt verwehren und dann, wenn sie versagt haben, die Zugbrücke runterlassen und sagen: Bitte, jetzt können Sie zu ihr, Sie finden die Leiche im Plastiksack. Und hier ist die Plastikvollmontur, die Sie, bitte, selbst anlegen müssen.
Du brauchst mir nicht zu antworten, dass ich ungerecht bin. Dass die Ärzte und Pfleger und Schwestern im Krankenhaus weder etwas für die Seuche noch für die Seuchenverordnungen können. Dass sie bestimmt ihr Bestes versucht haben, um meine Mutter zu retten. Dass ich, wenn ich mich einen Moment beruhigen würde, selbst zugeben müsste, dass es vernünftig ist, wenn Krankenhäuser in Seuchenzeiten die Zugbrücke hochziehen. Dass es nichts hilft, wenn ich in meinem Zorn, der mindestens ebenso meiner Leichtsinnsmutter gilt, einäugig wie ein Zyklop gegen das Krankenhaus wüte. Dass ich den tragischen Knoten mit meinem Zorn nicht zerschlagen werde.
Aber ich schreibe hier keine Doktorarbeit! Ich will von dem altklugen Scheiß, den ich fabriziert habe, als ich noch vollkommen ahnungslos gewesen bin, was Verzweiflung ist, nichts mehr wissen!
»Im tragischen Konflikt geht es darum anzuerkennen, dass beide Seiten im Recht sind, dass jede Seite, indem sie ihr Recht ausübt, der Gegenseite ein Unrecht antut und somit einen unversöhnten Rest produziert. Sollen die Folgen eines tragischen Konflikts einhegbar sein, muss die Seite, die ihr Recht bekommen hat, jeglichen Gestus der Selbstgerechtigkeit unterdrücken und vielmehr alles daransetzen, den unversöhnten Rest zu versöhnen.«
Gott, Max! Wenn ich daran denke, wie leidenschaftlich wir über diese Worthülsen gestritten haben! Über diese Worthülsen, die noch nicht einmal die Hülsen von Platzpatronen sind! »Unversöhnter Rest«! »Gestus der Selbstgerechtigkeit«! »Einhegbar«! Nichts als Blabla!
Denn jetzt steig ich in meinen Busen nieder,
Gleich einem Schacht, und grabe, kalt wie Erz,
Mir ein vernichtendes Gefühl hervor.
Darum geht’s! Der Raserei ihrRecht zu lassen!
Muss ich noch von der Beerdigung berichten? Wie auf das Unrecht, das an meiner sterbenden Mutter begangen worden ist, das Unrecht an der Toten getürmt wurde?
Auch wenn sie sich in Wahrheit für unsterblich hielt: Seit ich mich erinnern kann, sprach sie davon, wie sie einmal bestattet werden möchte: mit einem großen Fest. Vor Capri wollte sie ins Meer gestreut werden, und all ihre Freunde – ihre vielen, vielen Freunde – sollten sich versammeln und drei Tage und drei Nächte tanzen und trinken, bis sie selbst ins Meer fielen.
Natürlich war das nicht ernst gemeint, war das nur eine von ihren Geschichten. Aber wer war meine Mutter, wenn nicht ihre Geschichten? Je weniger sie wusste, wer sie war, desto genauer wusste sie, wer sie sein wollte. Diese Bilder von sich, die hat sie wie einen Speer vorausgeschleudert – und kaum hat sie die Faust gelöst, ist sie selbst schon hinterhergerannt. Das hat ihrem Leben immer eine Richtung gegeben, hat sie in Schwung gehalten.
Und jetzt? Soll ich Dir von der absurden Veranstaltung erzählen, die uns die Ordnungsmacht gestattet hat?
Als ich am Bogenhausener Friedhof ankam, sah ich als Erstes die Boulevardgeier, Hälse und Kameras schreiend gereckt, auf dass ihnen ja kein trauerndes Prominentengesicht, ja keine zu versilbernde Träne entgehe. Mit diesem Anblick hatte ich gerechnet, und als ich mich zwischen zwei Metallabsperrungen Richtung Friedhof durchschob, dachte ich kurz: Vielleicht hat dieses ganze Komm-mir-nicht-zu-nah (vulgo: »Social Distancing«) doch sein Gutes, immerhin hält es auch den Geierschwarm auf Abstand. Womit ich nicht gerechnet hatte: Wie kalt mich der nächste Anblick erwischte – obwohl mich das Anwaltsfrettchen vorgewarnt beziehungsweise mir erklärt hatte, welch fantastischer Erfolg es sei, dass überhaupt eine Beerdigung mit mehr als zehn Trauergästen stattfinden dürfe. Wie versprengte schwarze Schäfchen standen Mutters Schauspieler, Mutters Freunde, Mutters »Geschöpfe« auf den beiden Straßen um den Friedhof herum. Ausgesperrt von den Mauern. Bewacht von mindestens zwanzig Ordnungshütern, die peinlich darauf achteten, dass der Schmerz die Schäfchen nicht zur Trost- und Trauerherde zusammentrieb.
Ein paar der guten Hygienehirten gingen mit Klemmbrettern und »Kontaktlisten« herum, in die sich jeder, der den verwegenen Wunsch äußerte, meiner Mutter tatsächlich amGrab die letzte Ehre zu erweisen, mit Namen, Adresse und Telefonnummer eintragen musste. Einer Schauspielerin, die versucht haben will, mit »Daisy Duck, Leck-mich-am-Arsch-Straße 1a, 00000 Entenhausen« durchzukommen, soll ein aufgeweckter Hirte entgegnet haben: »Naa, Sie san net die Frau Duck. I seh Sie do imma im Tatort!«
Als der Friedhofsaufseher die Urne mit der Asche meiner Mutter auf die offene Grabstelle zutrug, gefolgt einzig von mir und der ersten Neunerkohorte – ja, es durften tatsächlich nur zehn Trauergäste auf einmal ans Grab, und die nächsten neun außer mir durften erst in den Friedhof hinein, sobald die ersten neun wieder draußen waren –, da hätte ich mir die Urne am liebsten wie einen Football geschnappt und wäre mit ihr bis nach Capri gerannt.
Aus Gründen, die einzig die Hygienegötter kennen, durfte keiner Erde ins Grab werfen. Nur Blumen. Und alles, was ein Hofstaat eben sonst noch als würdige Grabbeigaben für seine Königin betrachtet. (Wenn ich es richtig gesehen habe, hat einer von Mutters Nachwuchsstars seine goldene Armbanduhr ins Grab versenkt. Aber ich habe mich bemüht, bei derlei Exaltiertheiten wegzusehen.)
Immerhin besaßen die meisten von Mutters alten Haudegen und Diven, die mich noch aus Kindertagen kennen, die Größe und den Mut, mir nicht bloß aus anderthalb Meter Entfernung zuzunicken, pathetische Beileidsworte hinzuhauchen oder irgendwelches Kondolenz-Distanz-Theater aufzuführen – mittlerweile werde ich rabiat, wenn jemand zur Begrüßung dieses alberne Ellbogen-an-Ellbogen-Gerubbel veranstalten will, das uns als »das neue Cool« verkauft wird –, ausgerechnet die Alten, die »Vulnerablen«, wie man sie neuerdings auch nennt, hatten das Herz, mich schlicht und einfach zu umarmen. Trotzdem weinte ich an jenem Vormittag nicht nur aus Trauer, sondern auch, weil alles so trostlos war.
Bis endlich Theo, das wunderbare Walross, Schlachtross