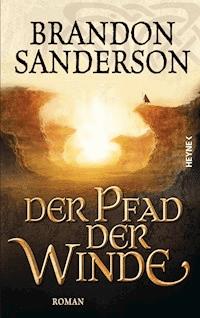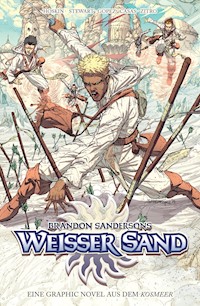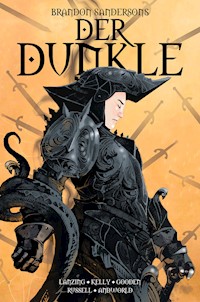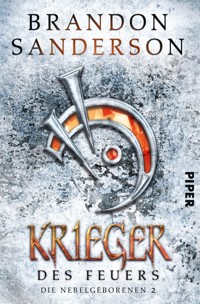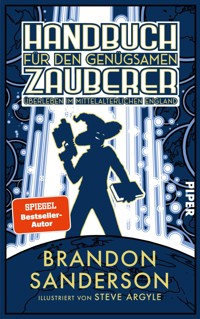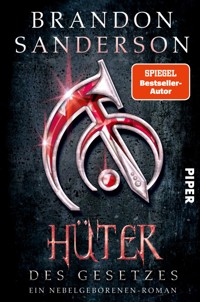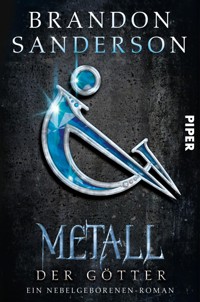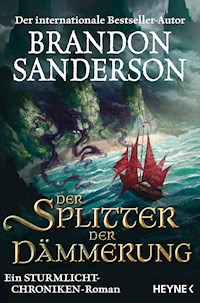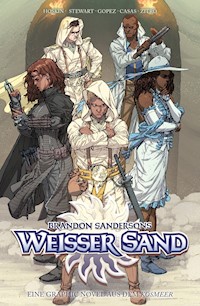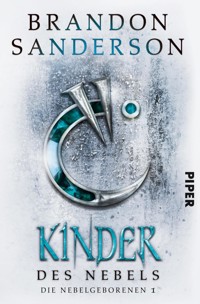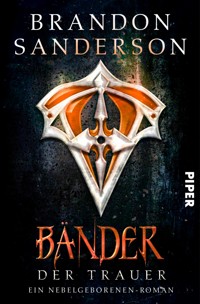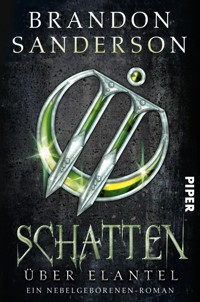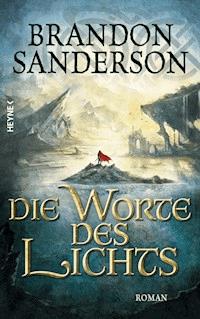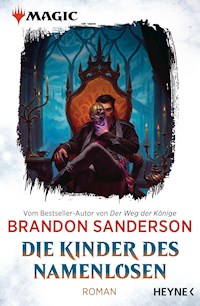
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: MAGIC™: The Gathering - Die Romane
- Sprache: Deutsch
Von klein auf hat Tacenda die Gabe, einen starken Zauber zu wirken, der sie und ihre Familie vor den Monstern in den Wäldern schützt. Doch diese Macht ist zugleich ihr Fluch, denn Tacenda ist dazu verdammt, ein Leben in ewiger Finsternis zu führen: Sobald die Sonne aufgeht, verliert sie ihr Augenlicht, bis es wieder dunkel wird. Eines Nachts versagt der Schutzzauber, und Tacendas Familie wird von den Ungeheuern getötet. Tacenda glaubt, dass der neue Lord, der vor einiger Zeit den alten Herrscher abgelöst hat, dafür verantwortlich ist. Angeblich steht er mit Dämonen im Bunde. Sie bricht in sein Herrenhaus ein, um Rache zu nehmen. Doch schnell muss sie erkennen, dass der Lord alles andere als von dieser Welt ist, und dass sehr viel dunklere Mächte für den Tod ihrer Familie verantwortlich sind …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Das Buch
Von klein auf hat Tacenda die Gabe, einen starken Zauber zu wirken, der ihr Dorf Verlasen vor den Monstern in den Wäldern schützt. Doch diese Macht ist zugleich ihr Fluch, denn Tacenda ist dazu verdammt, ein Leben in ewiger Finsternis zu führen. Sobald die Sonne aufgeht, verliert sie ihr Augenlicht, bis die Nacht erneut hereinbricht. Bei ihrer Zwillingsschwester Willia ist es umgekehrt: Die starke Kriegerin kann tagsüber sehen und das Dorf verteidigen, doch nachts ist sie völlig blind. Kurz nachdem Davriel Cane, der neue Lord, ins Herrenhaus in der Nähe von Verlasen gezogen ist, geschehen die ersten Morde. Eine neue, unbekannte Macht kommt Nacht für Nacht aus dem Sumpf und den Wäldern und streckt binnen Wochen alle Dorfbewohner nieder. Nicht einmal Tacendas Schutzlied kann sie aufhalten. Wie durch ein Wunder überlebt sie als einzige den letzten, fatalen Angriff – und schwört blutige Rache an Davriel Cane. Schließlich ist allgemein bekannt, dass er mit Dämonen im Bunde steht! Doch Tacenda muss schnell erkennen, dass viel dunklere, ältere Mächte für den Tod ihrer Familie verantwortlich sind …
Der Autor
Brandon Sanderson, 1975 in Nebraska geboren, schreibt seit seiner Schulzeit fantastische Geschichten. Er studierte Englische Literatur und unterrichtet Kreatives Schreiben. Sein Debütroman Elantris avancierte in Amerika auf Anhieb zum Bestseller. Seit seiner Steelheart-Trilogie und den epischen Sturmlicht-Chroniken ist Brandon Sanderson auch in Deutschland einer der großen Stars der Fantasy. Der Autor lebt mit seiner Familie in Provo, Utah.
BRANDON SANDERSON
Ein Roman aus demMAGIC: The Gathering-Multiversum
Aus dem Amerikanischen übersetztvon Christiansen & Christiansen
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Titel der amerikanischen Originalausgabe:CHILDRENOFTHENAMELESS
Aus dem Amerikanischen übersetzt und bearbeitet von Christiansen & Christiansen
Wizards of the Coast, MAGIC: The Gathering, their respective logos, MAGIC, and characters’ names and distinctive likenesses are property of Wizards of the Coast LLC in the USA and other countries. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.
MAGIC: The Gathering is a trademark of Wizards of the Coast LLC and is used with permission. © 2018 Wizards of the Coast. All Rights Reserved.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe 05/2020
Copyright © 2020 der deutschsprachigen Ausgabe undder Übersetzung by Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: DASILLUSTRAT, München,unter Verwendung des Originalmotivs von Chris Rahn
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN 978-3-641-25942-6V001
www.heyne.de
TEIL EINS
Prolog
Es gab zwei Arten von Finsternis, und Tacenda fürchtete die zweite mehr als die erste.
Die erste war die gewöhnliche Finsternis. Die Finsternis von Schatten, wohin kein Licht reichte. Die Finsternis hinter einer Schranktür, die einen Spalt offen stand, oder die eines alten Schuppens am Waldrand. Die erste Finsternis war die Finsternis der Abenddämmerung, die sich mit dem Anbruch der Nacht ins Haus schlich wie ein unwillkommener Gast, dem man dennoch Einlass gewähren musste.
Die erste Finsternis hielt Gefahren bereit, insbesondere in diesem Land, wo die Schatten atmeten und des Nachts düstere Dinge heulten. Doch es war die zweite Finsternis – jene, die Tacenda jeden Morgen überwältigte –, die sie wahrlich fürchtete. Ihre Blindheit war unmittelbar mit dem Aufgehen der Sonne verknüpft: Sobald deren erstes Licht erstrahlte, begann Tacendas Blick sich zu trüben. Dann kam die zweite Finsternis sie holen: eine reine, unentrinnbare Schwärze. Trotz aller Versicherungen seitens ihrer Eltern und der Priester wusste sie, dass etwas Schreckliches sie aus dieser Dunkelheit heraus beobachtete.
Willia, ihre Zwillingsschwester, verstand sie. Willias Fluch war das genaue Gegenstück zu Tacendas: Sie konnte während des Tages sehen, doch bei Nacht holte sich die zweite Finsternis ihre Sicht. Nie konnten sie beide zur gleichen Zeit sehen. Und so konnten die beiden Mädchen, obwohl sie Zwillinge waren, einander auch nie in die Augen blicken.
In ihrer Jugend versuchte Tacenda ihre Angst vor dieser zweiten Finsternis zu bannen, indem sie das Musizieren lernte. Sie sagte sich immer wieder, sie könne ja wenigstens noch hören. Und tatsächlich: Blind vermeinte sie den natürlichen Klang des Landes besser zu vernehmen. Das Knirschen der Kiesel unter einer Sohle, die einen Schritt tat. Das kraftvolle Tremolo eines Lachens, wenn ein Kind an ihrem Platz in der Mitte des Dorfes vorbeilief. Manchmal meinte Tacenda sogar das Wachsen der uralten Bäume zu hören – ein Geräusch wie von dicken Tauen, die ineinander verdreht wurden –, begleitet vom sanften Seufzen der zur Ruhe kommenden Blätter.
Doch sie wünschte sich, wenigstens einmal die Sonne sehen zu können. Ein gewaltiger, strahlender Feuerball hoch am Himmel, der noch heller als der Mond war? Sie spürte seine gewaltige Hitze auf der Haut. Daher wusste Tacenda, dass es ihn geben musste, doch wie fühlte es sich wohl für alle anderen an, ihr ganzes Leben lang diese gewaltige Feuersbrunst über sich am Himmel zu sehen?
Als die Bewohner des Dorfes vom spiegelverkehrten Fluch der Mädchen erfuhren, galten diese fortan als gezeichnet. Man munkelte, sie würden das Mal des Sumpfs tragen. In gewisser Weise war dies etwas Gutes: Die Zwillinge waren gesegnet worden, sie gehörten einer anderen Macht.
Tacenda fiel es schwer, das Mal als einen Segen zu betrachten, bis zu jenem Tag, an dem sie ihr wahres Lied fand. Schon als sie noch ein Kind gewesen war, hatten die Leute aus dem Dorf ihr Trommeln bei einem fahrenden Händler gekauft, damit sie für sie singen konnte, wenn sie auf den Staubweidenfeldern arbeiteten. Es hieß, die Dunkelheit zwischen den Bäumen wiche zurück, wenn sie sang, und sogar die Sonne schien heller zu strahlen. Doch eines Tages fand Tacenda in sich eine ganz besondere Kraft und begann ein wunderschönes, herzerwärmendes Lied der Freude zu singen. Irgendwoher wusste sie, dass es vom Sumpf stammte. Ein Geschenk, das mit ihrem Fluch der Blindheit einherging.
Willia flüsterte ihr zu, dass sie ebenfalls eine Kraft in sich spürte. Eine sonderbare, Ehrfurcht gebietende Stärke. Wenn sie mit dem Schwert in der Hand kämpfte, konnte sie es sogar mit Barl, dem Schmied aufnehmen – obwohl sie gerade einmal zwölf Jahre alt war.
Willia war seit jeher ein Wildfang gewesen. Zumindest während der hellen Stunden des Tages. Wenn die zweite Finsternis sie nachts holte, bebte sie vor einer Angst, die Tacenda nur allzu gut kannte. Während dieser langen Nächte sang Tacenda für ihre Schwester, während das Mädchen zitterte, weil es – wider besseres Wissen – fürchtete, das Licht würde nie zurückkehren.
Es war in einer solchen Nacht, kurz nach ihrem dreizehnten Geburtstag, dass Tacenda ihr zweites Lied entdeckte. Während draußen vor der Tür ein Ding aus dem Wald heulte, kratzte und tobte, flog es ihr einfach zu. Nachts kamen Bestien aus dem Wald, brachen in Häuser ein und holten sich jene, die darin wohnten. Es war der Preis, den man dafür zahlte, in den Anfurten zu leben: Das Land verlangte seinen Tribut in Blut. Man konnte wenig mehr tun, als die Tür zu verriegeln und zum Sumpf oder dem Engel – je nachdem, was einem lieber war – um Errettung zu beten.
Doch in jener Nacht – als sie die Angst ihrer Schwester spürte und das Schluchzen ihrer Eltern hörte –, trat Tacenda der Bestie entgegen, als sie durch die Tür brach. Sie hörte die Musik im Bersten und Brechen der Tür, in der Brise, die durch die Bäume strich, in ihrem eigenen Herzschlag, der ihr in den Ohren dröhnte. Sie öffnete den Mund und sang etwas Neues. Ein Lied, bei dem die Bestie vor Schmerzen schrie und sich zurückzog. Ein Lied voller Trotz, ein Lied der Abwehr, ein Lied des Schutzes.
Am nächsten Abend bat das Dorf sie, ihr Lied in der Finsternis zu singen. Und ihre Musik schien den Wald zur Ruhe zu bringen. Von jener Nacht an kam nichts mehr aus dem Wald. Zuvor war ihr Dorf die kleinste der drei Siedlungen in den Anfurten gewesen, doch ihr Zuhause begann nun zu wachsen, als die Leute von seinen Zwillingsverteidigerinnen hörten: der wilden Kriegerin, die sich tagsüber ertüchtigte, und der ruhigen Sängerin, die die Nacht zähmte.
Zwei Jahre lang genoss das Dorf einen bemerkenswerten Frieden. Niemand wurde in der Nacht geholt. Keine Bestien heulten den Mond an. Der Sumpf hatte Wächterinnen geschickt, um sein Volk zu behüten. Niemand hatte noch groß davon Notiz genommen, als ein neuer Fürst, der sich selbst der Herr des Herrenhauses nannte, aufgetaucht war, um den Platz des alten einzunehmen. Das Gezänk zwischen Fürsten war nichts, was das gemeine Volk zu hinterfragen hatte. Tatsächlich schien sich dieser neue Herr des Herrenhauses in erster Linie mit sich selbst zu beschäftigen: eine Verbesserung gegenüber dem alten Fürsten. Zumindest hatten sie das gedacht.
Doch dann, gerade als die Zwillinge fünfzehn geworden waren, nahmen die Dinge ihren verhängnisvollen Lauf.
Kapitel Eins
Tacenda
Die Wisperer erschienen unmittelbar vor der Abenddämmerung, und Tacendas Lied reichte nicht aus, um sie aufzuhalten.
Sie schrie den Refrain des Schutzlieds und ließ die Hände über die Saiten ihrer Gambe wandern – ein Geschenk ihrer Eltern zu ihrem vierzehnten Geburtstag.
Ihre Eltern waren nun beide nicht mehr, vor zehn Tagen von jenen sonderbaren Kreaturen getötet, die gerade das Dorf angriffen. Kaum hatte Tacenda diese Trauer verwunden, hatten sie auch Willia geholt. Nun hatten sie es auf das ganze Dorf abgesehen.
Da die Sonne noch nicht ganz untergegangen war, konnte sie sie nicht sehen, doch sie konnte ihre leisen, einander überlappenden Stimmen hören, als sie um die Stelle herumströmten, an der sie saß. Sie sprachen in rauen Tönen – leise, die Worte unverständlich – wie eine Untermalung ihres eigenen Liedes.
Sie verdoppelte ihre Anstrengungen und zupfte mit wundgespielten Fingern ihre Gambe. Sie saß an ihrem üblichen Platz in der Mitte des Dorfes bei der gurgelnden Zisterne. Das Lied hätte reichen sollen. Zwei Jahre lang hatte es jede Schrecklichkeit und jedes garstige Übel aufgehalten. Die Wisperer jedoch klangen gleichgültig, als sie um Tacenda herumglitten. Und bald schwollen menschliche Schreckensschreie zu einem Chor des Grauens an.
Tacenda versuchte, lauter zu singen, doch ihre Stimme wurde heiser. Sie hustete, als sie das nächste Mal Luft holte. Sie keuchte, zitterte, rang mit sich, um …
Etwas Kaltes streifte sie. Der Schmerz in ihren Fingern ließ diese taub werden, und sie sog Luft durch die Zähne, sprang zurück und presste sich die Gambe gegen die Brust. Alles um sie herum war schwarz, doch sie konnte das Etwas ganz in der Nähe hören. Tausende sich überlagernder Stimmen wie die raschelnden Seiten eines Buches, jede einzelne so gedämpft wie der letzte Atemzug eines Sterbenden.
Dann bewegte es sich fort, ohne weiter auf sie zu achten. Die restlichen Bewohner des Dorfes hatten nicht so viel Glück. Sie hatten sich in ihren Häusern eingeschlossen, wo sie nun schrien, beteten und flehten … bis sie einer nach dem anderen verstummten.
»Tacenda!«, rief eine Stimme in der Nähe. »Tacenda! Hilfe!«
»Mirian?« Tacendas Stimme war nur ein raues Krächzen. Aus welcher Richtung war dieser Laut gekommen? Tacenda wirbelte in der Finsternis herum und trat klappernd ihren Hocker um. »Tacenda!«
Da! Tacenda bewegte vorsichtig einen halben Meter entlang der Mauer der Zisterne, um deren behauene Steine zu erspüren und sich so zu orientieren. Danach brach sie in die Finsternis auf. Sie kannte dieses Areal gut, und es war Jahre her, seit sie bei der Überquerung des Dorfplatzes das letzte Mal gestrauchelt war. Dennoch konnte sie nicht vermeiden, dass sie bei ihrem Voranschreiten eine stechende Furcht verspürte. Auf ihrem Weg hinaus in diese Finsternis, die sie nach wie vor in Angst und Schrecken versetzte.
Würde sie dieses Mal in eine große Leere hineinschreiten, aus der sie nie wieder zurückkehrte? Würde sie weiter durch eine unermessliche, unergründliche Schwärze stolpern, verloren für sämtliche natürliche Empfindungen und ohne je wieder etwas zu berühren?
Stattdessen erreichte sie die Wand eines Hauses, genau dort, wo sie mit ihr gerechnet hatte. Sie betastete sie mit wunden Fingern, berührte das Fensterbrett, spürte Mirians Kräuterpflanzen, die aufgereiht in ihren Töpfen standen. Einen stieß sie in ihrer Hast versehentlich hinunter. Er zersprang auf dem Kopfsteinpflaster.
»Mirian!«, schrie Tacenda und tastete sich weiter an der Wand entlang. Andere Schreie gellten noch immer durch das Dorf: Manche Leute riefen um Hilfe, andere kreischten panisch. Zusammen waren die Laute wie ein Sturm, auch wenn jeder Einzelne von ihnen so einsam wirkte.
»Mirian?«, sagte Tacenda. »Warum steht deine Tür offen? Mirian!«
Tacenda ertastete sich den Weg in das kleine Haus hinein und stolperte dann über einen Körper. Mit tränennassen Wangen kniete sie nieder, die Gambe noch immer in der einen Hand. Mit der anderen erspürte sie den Spitzenrock, den Mirian eigenhändig bestickt hatte, während der gelegentlichen Abende, in denen sie aufblieb, um Tacenda Gesellschaft zu leisten. Sie bewegte die Hand zum Gesicht der Frau.
Es war keine Stunde her, dass Mirian Tacenda Tee gebracht hatte. Und nun … war ihre Haut irgendwie schon kalt geworden und ihr Körper starr.
Tacenda ließ die Gambe fallen und wich ruckartig zurück. Sie prallte gegen die Wand und stieß etwas um. Der herunterfallende Gegenstand bekam hörbar einen Sprung, als er auf dem Boden aufkam – ein Geräusch beinahe wie Musik.
Draußen erstarben nach und nach die letzten Schreie.
»Tötet mich!«, rief Tacenda und tastete sich in Richtung Tür vor. An einer scharfen Ecke kratzte sie sich den Unterarm blutig und zerriss sich den Rock. »Tötet mich, so wie ihr es mit meiner Familie getan habt!« Sie stolperte wieder hinaus auf den Dorfplatz, und da nun immer mehr der panischen Rufe verklangen, war sie in der Lage, eine leisere Stimme wahrzunehmen. Eine Kinderstimme.
»Ahren?«, rief sie. »Bist du das?«
Nein. Sumpf, erhöre mein Gebet. Bitte …
»Ahren!« Tacenda folgte dem leisen, angsterfüllten Geschrei zu einem anderen Gebäude. Die Tür war verschlossen, doch dies schien die Wisperer nicht aufzuhalten. Sie waren irgendeine Art von Geistern oder Gespenstern.
Tacenda tastete sich bis zum Fenster vor, wo sie eine kleine Faust gegen das Glas hämmern hörte. »Ahren …«, sagte Tacenda und legte die Hand flach gegen die Scheibe. Eine Kälte streifte sie.
»Tacenda!«, schrie die gedämpfte Stimme des kleinen Jungen. »Bitte! Es kommt!«
Sie holte Luft und versuchte, sich durch ihre Schluchzer hindurch ein Lied aus der Kehle zu zwingen. Doch das Schutzlied wollte nicht kommen. Vielleicht … Vielleicht etwas anderes?
»Schlichte … Schlichte Tage in der warmen Sonne …«, hob sie an, als sie es mit ihrem alten Lied versuchte. Das heitere, das sie ihrer Schwester und den Leuten aus dem Dorf vorgesungen hatte, als sie noch ein Kind gewesen war. »Und Licht, das einem bringt viel Wonne …« Sie stellte fest, wie ihr die Worte auf den Lippen verendeten. Wie konnte sie über eine warme Sonne singen, die sie nicht zu sehen vermochte? Wie konnte sie versuchen, ruhig zu bleiben und Freude zu bringen, wenn überall um sie herum Leute starben?
Dieses Lied … Sie konnte sich nicht mehr an dieses Lied erinnern. Ahren hörte auf zu weinen, als im Innern des Gebäudes ein dumpfes Poltern zu hören war. Draußen brachen die allerletzten Schreie ab.
Und das Dorf wurde still.
Tacenda wich von dem Fenster zurück und hörte Schritte hinter sich.
Schritte. Die Wisperer machten solche Geräusche nicht. Sie wirbelte in Richtung der Schritte herum und hörte das Rascheln von Kleidung von jemandem ganz in der Nähe, der sie offenbar beobachtete.
»Ich höre Euch!«, schrie Tacenda die unsichtbare Gestalt an. »Herr des Herrenhauses! Ich höre Eure Schritte!«
Sie hörte Atemzüge. Selbst die Geräusche der Wisperer verklangen. Doch wer immer da auch war und alles beobachtete, schwieg.
»Tötet mich!«, brüllte Tacenda der zweiten Finsternis entgegen. »Nun bringt es schon zu Ende!«
Stattdessen entfernten sich die Schritte. Ein kalter, einsamer Hauch wehte durch das Dorf. Tacenda spürte die letzten Sonnenstrahlen schwinden und die Luft kühler werden. Als die Nacht anbrach, kehrte ihre Sicht zurück. Sie blinzelte, als die Schwärze sich in einfache Schatten verwandelte, der Himmel noch immer warm vom letzten Sonnenlauf, der eben erst geendet hatte. Wie die kleinen Fünkchen, die sich noch kurz an einen Kerzendocht klammerten, nachdem die Flamme erloschen war.
Tacenda stellte fest, dass sie unweit der Zisterne stand, ihr Gesicht voller Tränen und das braune Haar zerzaust. Ihre kostbare Gambe lag mit zerkratztem Lack gleich hinter der Eingangstür zu Mirians Haus.
Das Dorf war still. Leer bis auf Tacenda und die Leichen.
Kapitel Zwei
Tacenda
Tacenda brachte etwa eine halbe Stunde damit zu, in Häuser einzubrechen und dort vergebens nach Überlebenden zu suchen. Selbst jene Familien, die in die Kirche geflohen waren, waren gefallen. Sie stieß auf Leichnam um Leichnam, das Licht in den Augen erloschen und die Wärme aus dem Blut gestohlen.
Ihre Eltern hatten vor zehn Tagen dasselbe Schicksal erlitten. Sie waren gemeinsam mit Willia unterwegs gewesen, um dem Sumpf Opfergaben darzubringen. Der Herr des Herrenhauses hatte sie abgefangen und angegriffen, aus völlig unerfindlichen Gründen. Er hatte Willia überwältigt, die – trotz ihrer ungewöhnlichen Stärke – seiner schrecklichen Magie nicht gewachsen gewesen war.
Willia war entkommen und auf der Suche nach Hilfe zur Priorei gelaufen. Als sie mit den Kirchensoldaten zurückgekehrt war, hatten sie lediglich zwei Leichen vorgefunden. Ihre Eltern, deren Leiber bereits kalt gewesen waren. In jener Nacht waren auch die Wisperer zum ersten Mal aufgetaucht: sonderbare, pervertierte Geister, die alle umbrachten, die sich zu weit von ihren Dörfern fortwagten. Augenzeugen hatten geschworen, dass die Wisperer vom Herrn des Herrenhauses Befehle erhielten.
Selbst dann hatte Tacenda noch auf Rettung gehofft. Hatte gehofft, dass der Sumpf sie beschützen würde. Bis der Herr des Herrenhauses schließlich kam, um Rache an Willia zu nehmen und sie tötete. Und jetzt …
Und jetzt …
Tacenda sackte auf der Türschwelle der Familie Wiemer zusammen, den Kopf in den Händen, beschienen von kühlem Mondlicht. Die Priester und Willia hatten ihre Eltern nach den Regeln der Kirche bestatten wollen, doch Tacenda hatte darauf bestanden, dass ihre Leichen dem Sumpf zurückgegeben wurden. Priester konnten so viel über die Engel predigen, wie sie nur wollten, doch die meisten Anfurtener wussten, dass sie – ganz am Ende – dem Sumpf gehörten.
Aber … wer würde all diese Leichname zum Sumpf zurückbringen? Das gesamte Dorf?
Mit einem Mal schienen die Augen der Leichen sie zu beobachten. Mit schmerzender Hand tastete Tacenda nach dem Anhänger ihrer Schwester, den sie um ihr Handgelenk trug. An einer schlichten Lederschnur hing ein eisernes Symbol des Namenlosen Engels. Dieses Schmuckstück und ihre Gambe waren die einzigen Dinge von Bedeutung, die ihr in ihrem Leben noch geblieben waren. Es gab also keinerlei Grund, hierzubleiben und sich weiterhin dem Blick toter, wachsamer Augen auszusetzen.
Wie betäubt nahm Tacenda ihre Gambe und ging einfach los. Sie wanderte aus dem Dorf hinaus, an dem Staubweidenfeld vorbei, wo man Willias Leiche gefunden hatte.
An jenem Tag … Nun, ein Teil von Tacenda war damals erkaltet. Vielleicht lag es daran, dass sie nun, wo alles vorbei war, zu müde für Tränen war.
Sie ging in den finsteren Wald hinaus, an einen Ort, den keine geistig gesunde Person je betrat. Wer nachts durch den Wald reiste, verlangte förmlich nach einem Unheil, forderte das geradezu heraus, sich zu verirren oder sich für die Fänge irgendeiner im Dunkeln lauernden Bestie angreifbar zu machen. Warum sollte sie das jetzt noch scheren? Ihr Leben war sinnlos, und sie konnte sich nicht verirren, wenn sie doch ohnehin nicht vorhatte, jemals wieder zurückzukehren.
Und dennoch … Wenn sie die Augen schloss, konnte sie spüren, wo die Finsternis reiner war. Es fühlte sich fast so an wie jene zweite Finsternis, die sie fürchtete. Vor einigen Jahren war sie einem blinden Mädchen aus der nächsten Stadt begegnet, das zusammen mit einigen Händlern auf Besuch gekommen war. Willia war so aufgeregt gewesen, mit jemand anderem zu sprechen, der womöglich auch verstand, worum es sich bei der zweiten Finsternis handelte – doch dieses Mädchen hatte sich ob ihrer Beschreibungen nur verwirrt gezeigt. Sie fürchtete die Dunkelheit nicht und konnte auch nicht begreifen, weshalb sie dies tun sollte.
Damals hatte Tacenda begonnen, alles überhaupt erst richtig zu verstehen. Das Ding, das sie gesehen hatten, als sie vom Fluch ereilt worden waren, war etwas Tiefgreifenderes, Absonderlicheres. Etwas, das mehr war als nur Blindheit.
Sie ging auf die Finsternis zu. Ihr Rock verfing sich immer wieder im Unterholz, und sie kam an Bäumen vorbei, die derart uralt waren, dass Tacenda beim Zählen all ihrer Jahresringe mit Sicherheit durcheinandergekommen wäre. In vielen Nächten waren diese Bäume Tacendas einziges Publikum gewesen und der Wind in ihren Blättern ihr Applaus. Der Rest des Dorfes hatte so unruhig geschlafen wie die flackernde Flamme in einer Lampe, der es an Öl mangelte. Wenn man um Atem ringend aufwachte, war man zumindest noch am Leben.
Das endlose Blätterdach, hier und da durchstoßen von Lanzen aus stahlgrauem Mondlicht, schien das Firmament selbst zu sein. Getragen von den dunklen Säulen der Bäume, in die Unendlichkeit erstreckt, wie Spiegelungen von Spiegelungen. Sie ging eine gute halbe Stunde, doch nichts stellte ihr nach. Vielleicht waren die Monster des Waldes auch einfach nur zu verblüfft, ein Mädchen von fünfzehn Jahren allein umherwandern zu sehen.
Bald konnte sie den Sumpf riechen: Fäulnis, Moos und allerlei Abgestandenes. Er hatte keinen Namen, doch die Dorfbewohner wussten alle, dass er Anspruch auf sie erhob. Der Sumpf war ihr Schutz, da selbst jene Dinge, die in den finsteren Weiten des Waldes Angst und Schrecken verbreiteten – selbst fleischgewordene Albträume –, den Sumpf fürchteten.
Und doch hat er uns heute Nacht im Stich gelassen.
Tacenda trat auf eine kleine Lichtung hinaus. Sie kannte den Klang des Sumpfes ebenso gut wie den Klang ihres eigenen Herzens: ein tiefes Grollen wie von einem kochenden Topf, gelegentlich untermalt von einem Knacken, das an brechende Knochen erinnerte. Sie war viele Male mit ihren Eltern hierhergekommen, um Opfergaben darzubringen – aber dennoch hatte sie diesen Ort noch nie bei Nacht aufgesucht.
Er war … kleiner, als sie ihn sich vorgestellt hatte. Ein kreisrunder Teich aus dunklem Wasser. Obwohl überall in diesem Teil des Waldes Moore und trügerische Löcher mit Morast verstreut lagen, war dieser eine Teich unter ihren Leuten seit jeher als »der Sumpf« bekannt gewesen.
Tacenda trat ganz an den Rand und erinnerte sich an jenes leise Geräusch – nicht ganz ein Platschen, eher ein Seufzer –, das die Leichname ihrer Eltern erzeugt hatten, als man sie ins Wasser hatte gleiten lassen. Man musste Leichen nicht beschweren, wenn man sie an den Sumpf verfütterte. Die Körper versanken und tauchten nie wieder auf.
Sie stand zögernd am Rand des Teichs. Sie war geboren worden, um ihre Leute zu beschützen, und verfügte über eine Kraft, wie man sie seit Generationen nicht gesehen hatte. Doch heute Nacht war sie in der Ausübung dieser Pflicht gescheitert, und nicht einmal die Wisperer hatten sie gewollt. Alles, was noch blieb, war, sich ihren Eltern anzuschließen. In diese viel zu stillen Wasser einzutauchen und zu versinken. Es war ihre Bestimmung.
Nein, schien eine Stimme tief in ihr zu wispern.
Nein, das ist nicht der Grund, aus dem ich dich erschaffen habe …
Sie zögerte. War sie nun auch noch verrückt geworden?
»He!«, sagte eine Stimme hinter ihr. »He, was ist da los?«
Ein grelles, störendes Licht erwachte zum Leben und erhellte das Areal um den Sumpf herum. Tacenda wandte sich um und sah einen alten Mann in der Tür zur Hütte des Sumpfwarts stehen. Er hielt eine Laterne in der Hand und trug einen struppigen Bart, der größtenteils grau war – die Arme des Mannes wirkten jedoch nach wie vor kräftig, und er stand fest auf den Beinen. Rom war früher einmal Werwolfjäger gewesen, bevor er in die Anfurten gekommen war, um in der Priorei zu leben.
»Fräulein Tacenda?«, fragte er, um dann vor lauter Eile, zu ihr zu gelangen, fast über die eigenen Füße zu stolpern. »Kommt her! Geht da weg, Kind! Was ist denn los? Warum seid Ihr nicht in Verlasen und singt?«
»Ich …« Jemanden zu sehen, der noch am Leben war, machte sie ganz benommen. War etwa …
War etwa doch nicht alle Welt tot? »Sie kamen uns holen, Rom. Die Wisperer …«
Er zog sie vom Sumpf weg auf die Hütte zu. Sie war ein sicherer Ort – dank der Schutzzauber, die ein Priester auf sie gewirkt hatte. Natürlich hatten ebensolche Schutzzauber heute Nacht auch die Dorfbewohner nicht vor ihrem Schicksal bewahren können. Sie wusste nicht mehr, was noch sicher war und was nicht.
Priester aus der Priorei wechselten sich auf dem Beobachtungsposten in dieser Hütte ab. In jüngster Zeit hatten sie versucht, den Leuten zu verbieten, dem Sumpf Opfergaben darzubringen. Die Priester vertrauten dem Sumpf nicht und glaubten, die Bewohner der Anfurten müssten von ihrer uralten Religion abgebracht werden. Doch ein Außenseiter, selbst ein freundlich gesinnter wie Rom, konnte das niemals verstehen. Der Sumpf war nicht bloß ihre Religion. Er machte ihren Wesenskern aus.
»Was ist los, Kind?«, fragte Rom und drückte sie behutsam auf einen Hocker im Innern der kleinen Wachhütte. »Was ist geschehen?«
»Sie sind tot, Rom. Sie alle. Die Geister, die meine Eltern geholt hatten und meine Schwester … Sie kamen in Scharen. Sie haben alle geholt.«
»Alle?«, fragte er. »Was ist mit Schwester Gudenvala aus der Kirche?«
Tacenda schüttelte den Kopf. Sie fühlte sich leer. »Die Wisperer gelangten trotz der Schutzzauber hinein.« Sie schaute zu ihm auf. »Der Herr des Herrenhauses. Er war dort, Rom. Ich habe seine Schritte gehört, seine Atemzüge. Er hat die Wisperer angeführt und alle geholt. Er ließ nichts zurück außer toten Augen und kalter Haut …«
Rom schwieg. Dann griff er sich rasch ein Schwert, das neben der kleinen Pritsche an der Wand lehnte, und schnallte es an seinen Gürtel. »Ich muss zur Priorin. Falls der Herr des Herrenhauses wirklich … Nun, sie wird wissen, was zu tun ist. Gehen wir.«
Sie schüttelte den Kopf. Sie fühlte sich erschöpft. Nein. Rom zerrte an ihr, doch sie blieb sitzen.
»Beim Höllenfeuer, Kind«, sagte er. Er sah zur Tür hinaus, in Richtung des Sumpfes – dann verengten sich seine Augen zu Schlitzen. »Die Gebete auf dieser Hütte sollten Euch vor den schlimmsten Dingen des Waldes schützen können. Doch … wenn diese Geister in die Kirche hineinkommen konnten …«
»Die Wisperer wollen mich sowieso nicht.«
»Haltet Euch vom Sumpf fern«, sagte er. »Versprecht mir wenigstens das.«
Sie nickte, ohne etwas dabei zu empfinden.
Der alternde Krieger-Priester holte tief Luft, ehe er eine Kerze für sie anzündete, bevor er seine Laterne nahm und in die Nacht hinaus aufbrach. Er würde der Straße folgen, die ihn an Verlasen vorbeiführte. Dann würde er es selbst sehen.
Alle waren tot. Alle.
Tacenda saß da und schaute auf den Sumpf hinaus. Und langsam begann sie wieder etwas zu fühlen. Eine Wärme stieg in ihr auf. Ein Zorn.
All dies würde keinerlei Folgen für den Herrn des Herrenhauses haben. Rom konnte sich bei der Priorin beschweren, so viel er nur wollte, aber der hohe Herr – der neue Fürst dieser Region – war unangreifbar. Die Priester besaßen keine echte Macht, um ihm die Stirn zu bieten. Sie mochten vielleicht ein wenig laut werden, doch mehr würden sie nicht wagen, aus Angst davor, ausgelöscht zu werden. Die Bewohner der zwei Schwesterndörfer von Verlasen würden wegschauen und ihr Leben weiterleben, in der Hoffnung, dass der Hunger des hohen Herrn durch die, die er bereits umgebracht hatte, gestillt war.
Gefahren aus dem Wald waren eine Sache, doch die wahren Ungeheuer dieses Landes waren seit jeher seine Fürsten gewesen. Vor lauter Wut erglüht, begann Tacenda die kleine Hütte zu durchwühlen. Rom hatte die einzige echte Waffe mitgenommen, doch im alten Eisschränkchen fand sie einen Eispickel. Der würde reichen. Sie löschte die Kerze, ehe sie wieder hinaus ins Mondlicht trat.
Der Sumpf grollte zustimmend, als sie die Straße entlangzuschreiten begann, die zum Herrenhaus führte. Sie wusste, dass dies eine törichte Form von Trotz war. Der hohe Herr würde sie ohne jeden Zweifel umbringen. Er würde sie foltern, ihre Leiche für irgendein furchtbares Experiment schänden, ihre Seele an seine Dämonen verfüttern.
Sie ging trotzdem los. Sie würde sich nicht selbst in den Sumpf schleudern. Das war nicht ihre Bestimmung.
Sie würde wenigstens versuchen, den Herrn des Herrenhauses zu töten.
Kapitel Drei
Tacenda
Der Herr des Herrenhauses war vor zwei Jahren aufgetaucht, unmittelbar nachdem Tacenda das Schutzlied entdeckt hatte. Er hatte umgehend den bisherigen Herrscher der Anfurten beseitigt: eine Kreatur, die als Fürst Vaast bekannt gewesen war. Niemand hatte angesichts von Vaasts Tod eine Träne vergossen. Er hatte den jungen Frauen, die er nachts besuchte, oft etwas zu viel Blut gestohlen.
Doch immerhin hatte er nie sämtlichen Bewohnern eines Dorfes binnen eines einzigen Tages das Leben geraubt.
Tacenda kauerte am Rand jener Anlage, inmitten derer sich das Herrenhaus erhob, und betrachtete das stattliche Gebäude. Aus den Fenstern schien ein Licht, das einen allzu roten Schimmer hatte. Man wusste, dass der Herr des Herrenhauses Umgang mit Dämonen pflegte: Die vordere Zufahrt war sogar von geflügelten Statuen gesäumt, die gelegentlich zuckten, während Tacenda die schattenverhangenen Gestalten musterte.
Die Gambe auf den Rücken geschnallt, drückte sie den Eispickel fest an ihre Brust. Auf der Rückseite des Gebäudes würde es einen Dienstboteneingang geben: Ihr Vater hatte erzählt, dass er dort Hemden ablieferte.
Obwohl sie sich ungeschützt fühlte, ließ Tacenda den Wald hinter sich und überquerte den Rasen. Das Mondlicht erschien ihr grell und blendend. Konnte die Sonne wirklich noch heller sein?
Sie erreichte die Seite des Herrenhauses. Das Herz wummerte ihr in der Brust, während sie den Eispickel wie einen Dolch hielt. Sie lehnte sich gegen die Holzwand und arbeitete sich dann an ihr entlang Stück für Stück nach Süden vor. Ein Leuchten kam aus jener Richtung. Und waren das … Stimmen?
Sie erreichte die hintere Ecke des Gebäudes, spähte um sie herum und sah eine offene Tür. Der Dienstboteneingang, aus dem Licht in einem Rechteck auf den Rasen fiel. Ihr stockte der Atem: Eine Gruppe von kleinen, rothäutigen Kreaturen schnatterte dort, gleich vor der Tür. Die missgestalteten Teufel, die ihr bis an die Hüfte reichten, hatten lange Schwänze und trugen keinerlei Kleidung. Sie wühlten in einem Fass voller verfaulter Äpfel und bewarfen einander mit dem Obst.
Diese Äpfel … Sie mussten aus der Obstgartenernte vom letzten Monat stammen, die wie verlangt dem Herrn des Herrenhauses überstellt worden war. Die Dorfbewohner hatten ihm die schönsten Exemplare ausgesucht, aber da das Fass noch fast voll war, hatte man die Früchte offenbar einfach verfaulen lassen.
Tacenda duckte sich wieder hinter die Ecke. Ihr Atem ging schnell, ihre Hand zitterte. Sie schloss ganz fest die Augen und lauschte den Kreaturen, wie sie in ihrer gutturalen, in den Ohren kratzenden Sprache vor sich hin schnatterten. Sie hatte zwar schon oft schreckliche Laute aus dem Wald gehört, doch solche Kreaturen nun mit eigenen Augen zu sehen war eine ganz andere Sache.
Sie zwang sich zum Weitergehen und versuchte, ein paar Fenster entlang der Wand zu öffnen. Leider war jedes von ihnen fest verriegelt, und es hätte Aufmerksamkeit auf sich gezogen, wenn sie eines eingeschlagen hätte. Blieben also noch der Vordereingang oder die Tür hinten mit diesen Kreaturen davor.
Sie schlich sich zurück zur Ecke und wagte einen weiteren Blick auf diese Geschöpfe. Alle vier zankten sich um einen Apfel, der alles in allem noch recht genießbar wirkte. Tacenda holte tief Luft.
Und sang.
Das Schutzlied. Sie blieb leise und hielt die Melodie zart – doch ihre Gambe antwortete auf die Musik mit einem Vibrieren. Das tat sie oft, wenn Tacenda sie nicht zu spielen begann, sobald sie sang.
Das Lied ließ eine Wärme in ihr aufsteigen, Leidenschaft und Schmerz, die ineinander verschmolzen waren. Die Musik kam mehr durch sie als aus ihr. Jetzt schien sie besonders kraftvoll zu sein. Lebendig. Mehr, als sie es war.
Die Teufel erstarrten, und ihre schwarzen Augen weiteten sich, als wären sie benommen. Sie wichen zurück und bleckten viel zu scharfe Zähne. Dann huschten sie dankenswerterweise davon, leise krächzend auf den Wald zu.
Das Lied wollte anwachsen, wollte lauter aus ihr heraus. Tacenda unterbrach es stattdessen und atmete keuchend aus. Die Musik schenkte ihr Empfindungen. Sie zog sie aus kalten Wassern und hauchte ihr irgendwie Leben ein. Doch wie sollte sie irgendetwas anderes außer Zorn und Trauer empfinden?
Konzentriere dich auf die anstehende Aufgabe. Den Eispickel vor sich ausgestreckt, schlich sie durch die Hintertür des Herrenhauses und betrat einen Gang, der sich mit seinem dicken Teppich und seiner verzierten Holztäfelung etwas zu einladend anfühlte. Dies war das Zuhause eines Ungeheuers. Sie vertraute seiner freundlichen Fassade genauso wenig, wie sie einem kleinen Mädchen vertraut hätte, auf das sie im Wald stieß und das ihr lächelnd einen Schatz versprach.
In einem nahen Raum brachten Schritte den Holzboden zum Knarren.
Absolut sicher, dass irgendein Schrecken aus dem anderen Zimmer hervorbrechen und sie packen würde, nahm Tacenda die Treppe hinauf ins Obergeschoss.
Kaum hatte sie sich in einen Schatten gedrückt, trat tatsächlich etwas mit dunkelgrauer Haut unten in den Gang. Die Hörner der gewaltigen Kreatur strichen an der Decke entlang, und seine Schritte klangen schwer.
Ängstlich beobachtete Tacenda, wie das Wesen den Bereich vor der Hintertür inspizierte. Es hatte ihr Lied gehört – oder vielleicht auch nur gespürt. Sie musste sich irgendwo verstecken, wo sie nicht zu sehen war. Sie schlüpfte in den ersten Raum hinein, den sie im Obergeschoss fand: ein Schlafzimmer, wenn man von dem mondbeschienenen Himmelbett neben dem Fenster ausgehen konnte.
Sie durchquerte die Kammer hin zu einer Tür auf der gegenüberliegenden Seite und schlich sich in einen verschwenderisch eingerichteten Waschraum mit einem Zuber, in dem eine ganze Familie ein gemeinsames Bad hätte nehmen können. Sie schloss die Tür und damit sich selbst in einer herkömmlichen Form der Finsternis ein. Eine, die sie beinahe als tröstlich empfand. Zumindest aber als vertraut.
Nun überwältigte sie die Anspannung des Augenblicks letzten Endes doch. Sie setzte sich in der Dunkelheit auf einen Hocker, den Eispickel vor der Brust, die Finger bebend. Die Gambe auf ihrem Rücken schlug leise einen Akkord an – und Tacenda erkannte, dass sie in dem Versuch, sich selbst zu beruhigen, zu summen begonnen hatte. Sie verstummte jäh.
Stattdessen tastete sie nach dem Anhänger ihrer Schwester, den sie an sich genommen hatte, bevor Willias Leichnam an die Priester übergeben wurde.
Willia hatte auf die Engel vertraut. Sie war immer die Stärkere gewesen, die Kriegerin. Sie hätte leben sollen und Tacenda sterben. Für Willia hätte tatsächlich eine echte Chance bestanden, es zu schaffen, den Herrn zu töten.
Sie hatten sich stets aufeinander verlassen. Tagsüber hatte Willia Tacenda zu allerlei ermuntert und hatte sie hinaus auf die Felder geführt, um für die Arbeiter zu singen. Und nachts hatte Tacenda gesungen, während Willia gezittert hatte. Sie waren gemeinsam eine Seele gewesen. Musste Tacenda nun versuchen, allein weiterzuleben?
Stimmen!
Tacenda richtete sich in der Finsternis kerzengerade auf. Sie konnte hören, wie sich die Stimmen näherten – eine von ihnen schneidend, befehlsgewohnt. Sie kannte diese Stimme. Sie hatte sie vor zwei Monaten gehört, als der Herr des Herrenhauses gekommen war – in Umhang und Maske gewandet –, um sich über die Hemdenlieferung ihres Vaters zu beschweren.
Draußen auf den Dielen erklangen Schritte. Altes, müdes Holz knarzte. Tacenda erhob sich rasch und bezog Stellung unmittelbar neben der Tür. Ein Anflug von Panik überkam sie, als sie hörte, wie die Tür sich öffnete und Licht in den Waschraum fiel. Und dann …
Dann innerer Frieden. Es war Zeit. Rache!
Sie sprang aus den Schatten hervor und erhob ihre behelfsmäßige Waffe gegen den hohen Herrn – eine imposante Gestalt mit einem Bleistiftbärtchen, dunklem, zurückgekämmtem Haar und schwarzem Anzug. Der Eispickel erzeugte ein sattes Schmatzen, als sie ihn dem Mann direkt in die linke Brust trieb, gleich neben dem purpurnen Halstuch. Der Pickel schabte über Knochen, als er sich tief in ihn hineinbohrte.
Der hohe Herr erstarrte. Seiner erschütterten Miene nach schien sie ihn aufrichtig überrascht zu haben. Er öffnete leicht den Mund, doch er rührte sich nicht.
Konnte sie … Konnte sie sein Herz durchbohrt haben? Konnte sie es tatsächlich geschafft haben, den …
»Fräulein Hochwasser«, rief der hohe Herr über seine Schulter. »Da ist ein Bauernmädchen in meinem Waschraum!«
»Was will es denn?«, fragte eine weibliche Stimme aus dem anderen Zimmer.
»Es hat mit etwas auf mich eingestochen, was aussieht wie ein Eispickel!« Der Mann schubste Tacenda zurück in den Waschraum und zog dann mit einem Ruck den Eispickel heraus. Die gesamte Länge glänzte von seinem Blut. »Ein rostiger Eispickel!«
»Schön!«, rief die Stimme. »Fragt die Gute, wie viel ich ihr schulde!«
Tacenda nahm all ihren Mut – ihre Wut – zusammen und straffte die Schultern. »Ich bin gekommen, um Rache zu nehmen!«, rief sie. »Ihr müsst gewusst haben, dass ich es versuchen würde, nachdem Ihr …«
»Oh, still jetzt«, sagte er und klang dabei eher enttäuscht als verärgert. Kurz legte sich ein Schleier über seine Augen, als füllten sie sich mit blauem Rauch.
Tacenda wollte ihn anspringen, musste aber feststellen, dass sie auf magische Weise an Ort und Stelle eingefroren war. Sie mühte sich nach besten Kräften, doch sie konnte noch nicht einmal blinzeln. Und mit einem Mal war ihr ganzes Selbstvertrauen verflogen. Sie hatte die ganze Zeit gewusst, dass sie es nicht überleben würde, hierherzukommen. Sie hatte darauf gehofft, irgendeinen Akt der Vergeltung verüben zu können, doch die Wunde schien den hohen Herren nicht einmal zu schmerzen. Er warf seine Jacke über einen Stuhl im Schlafzimmer, um dann mit einem Finger an dem kleinen Teil seines weißen Rüschenhemds herumzutasten, der blutbesudelt war.
Die Frau, die schon zuvor gesprochen hatte, betrat nun das Zimmer … doch Frau war nicht ganz zutreffend. Die Kreatur trug menschliche Kleidung – eine taillierte graue Jacke über einem schlichten knielangen Rock –, und das schwarze Haar hatte sie zu einem Dutt gebunden. Doch sie hatte aschgraue Haut und dunkelrote Augen, und aus ihrem Haar lugten kleine Hörner hervor. Ein weiterer der dämonischen Schergen des hohen Herrn.
Die Dämonin hatte ein Hauptbuch unter den Arm geklemmt und ging hinüber zu Tacenda, um sie zu mustern. Erneut versuchte Tacenda irgendwie Gegenwehr zu leisten, doch sie konnte sich nicht aus der Haltung lösen, die sie eingenommen hatte, um sich mit gestrafften Schultern vor dem hohen Herrn aufzubauen.
»Merkwürdig«, sagte die Dämonin. »Sie kann nicht älter als sechzehn sein. Jünger als die meisten Eurer Möchtegernmeuchler.«
Der Mann stupste erneut mit einem spitzen Finger seine Wunde an. »Es kommt mir so vor, Fräulein Hochwasser, als würdet Ihr diese Lage nicht mit dem nötigen Ernst betrachten. Mein Hemd ist ruiniert.«
»Wir holen Euch ein anderes.«
»Das hier war mein Lieblingshemd.«
»Ihr habt siebenunddreißig andere, die haargenau so sind. Ihr könntet den Unterschied zwischen ihnen nicht einmal dann feststellen, wenn Euer Leben davon abhinge.«
»Das ist nicht der Punkt.« Er zögerte. »Siebenunddreißig? Das ist ein bisschen übertrieben. Sogar für mich.«
»Ihr hattet mich darum gebeten, einen ordentlichen Vorrat anzulegen, für den Fall, dass der Schneider gefressen wird.« Die Dämonin machte eine Geste in Tacendas Richtung. »Was soll ich mit dem Kind machen?«
Tacenda stockte der Atem. Sie konnte nach wie vor atmen, auch wenn ihre Augen mit offenen Lidern eingefroren waren und sie deshalb nur geradeaus vor sich hin starrte. Sie konnte den hohen Herrn durch die Tür des Waschraums gerade noch so dabei ausmachen, wie er sich im Schlafzimmer in einen Sessel sacken ließ.
»Lasst sie verbrennen oder so«, sagte er und griff nach einem Buch. »Vielleicht sollten wir sie an die Teufel verfüttern. Sie betteln immer um lebendiges Fleisch.«
Bei lebendigem Leib aufgefressen werden?
Stell es dir nicht vor. Denke gar nichts. Tacenda versuchte, ihre gesamte Aufmerksamkeit ihrer Atmung zu widmen.
Die Dämonin – Fräulein Hochwasser – lehnte sich gegen den Türrahmen des Waschraums, die Arme vor der Brust verschränkt. »Sie sieht aus, als wäre sie durch die Hölle gegangen. Und noch nicht einmal durch die netten Gegenden.«
»Es gibt nette Gegenden in der Hölle?«, fragte der hohe Herr.